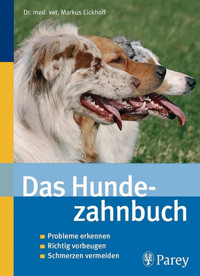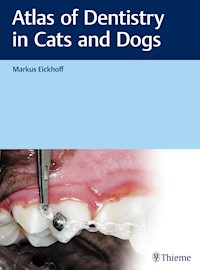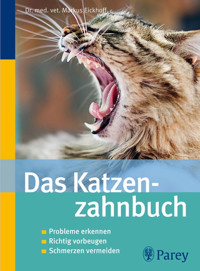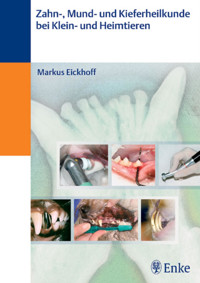219,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Als Tierarzt und Zahnarzt in einer Person betreibt Dr. Markus Eickhoff seit über 20 Jahren Zahnheilkunde bei Hund und Katze auf höchstem Niveau. Mit diesem Buch können Sie in über 1500 Bildern nun an seinem Erfahrungsreichtum teilhaben.
Welche Ausstattung brauche ich? Welche Behandlungsmöglichkeiten habe ich und wie führe ich diese durch? Auf diese Fragen gibt das Buch detailliert, systematisch und reich bebildert Antworten vom Experten.
In über 1500 Bildern sehen Sie jeden einzelnen Handgriff vieler faszinierender Fälle, und können dabei die Vorgehensweise detailliert nachvollziehen. Die vielen Praxistipps und Schritt-für-Schritt Erklärungen von gängigen Zahnbehandlungen geben Ihnen Sicherheit in der zahnärztlichen Behandlung von Kleintieren. Bild für Bild führt Dr. Eickhoff Sie an häufig indizierte Arbeitsweisen wie die korrekte Entfernung von Wurzelresten oder das Einbringen von Füllungen heran.
Durch die Fokussierung auf Hund und Katze sind nicht nur die gängigen, sondern auch die selteneren Behandlungsmöglichkeiten detailliert erfasst. Profitieren Sie von neuen Erkenntnissen bei der Therapie von außergewöhnlichen Fällen wie Gaumenspalten oder dentaler Ankylose.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Bild-Atlas der Zahnbehandlungen Hund und Katze
Markus Eickhoff
2., aktualisierte Auflage
1525 Abbildungen
Vorwort zur 2. Auflage
Fünf Jahre sind seit der Erstausgabe dieses Buches verstrichen und die Arbeit ist nicht weniger geworden. Auch die Coronapandemie hat ihren Teil dazu beigetragen, indem es mehr Hunde und mehr Katzen in den Haushalten geworden sind, weil die Anwesenheit dieser Tiere vielen Menschen in dieser schwierigen Situation geholfen hat. Umso wichtiger ist es, dass den vorherrschenden Erkrankungen bei all diesen Tieren durch qualifizierte tierärztliche Behandlungen adäquat begegnet werden kann. Und ich hoffe, dieses Buch kann hierzu einen kleinen Beitrag leisten.
Weissach im Sommer 2022
Markus Eickhoff
Vorwort zur 1. Auflage
Über zwanzig Jahre ausschließlich in der Tierzahnmedizin haben bei mir zu der Erkenntnis geführt, dass es erst mit Unterstützung des geschriebenen oder gesprochenen Wortes durch aussagekräftiges Bildmaterial überhaupt möglich ist, Wissen über die Diagnostik und Behandlung der Mundhöhle so zu transportieren, dass es sich in den Köpfen festsetzt. Nun ist der Tierbesitzer meist nicht der richtige Ansprechpartner, um Bilder über manchmal blutige Details anzuschauen. Dagegen sind gerade solche Bilder und Bildfolgen für den behandelnden Arzt notwendig, um das kunstgerechte Vorgehen bei den einzelnen Erkrankungen umsetzen zu können.
Die Zahnmedizin ist sehr apparate- und instrumentenlastig, und man muss recht breit aufgestellt sein, um allein die spezifischen Anforderungen bei sehr variablen Größen und Erkrankungen durch eine geeignete Ausstattung abdecken zu können. Hinzu kommt das notwendige Fachwissen um medizinische Vorgehensweisen, die bei Weitem das normale Spektrum eines Allgemeinmediziners überschreiten; daher hat sich in der Humanmedizin die Zahnmedizin als gesondert zu betrachtender Zweig herausgeschält. Für den Tiermediziner ist eine solche Entwicklung nur bedingt zu erwarten, sodass für eine adäquate zahnärztliche Behandlung von Hund und Katze die Erweiterung des Wissensschatzes unerlässlich wird. Dabei zielt dieses Buch nicht darauf ab, dass jeder Tierarzt jede Zahnerkrankung behandeln können muss; dagegen soll es dazu führen, um die Problematik und ggf. Notwendigkeit der Behandlung einer bestimmten Fragestellung zu wissen und somit über die geeignete Wahl der Therapie oder die Überweisung des Tieres an eine darauf ausgerichtete Stelle langjährige und häufig sehr schmerzhafte Leidensprozesse des betroffenen Tieres vermeiden zu können und einen Heilungsprozess einzuläuten.
Trotz der anstrengenden Thematik mit Frakturen, Blutungen und Schmerzen kann es zufriedenstellen, vielen Tieren die Tage wieder etwas heller zu machen.
Weissach im Frühjahr 2017
Markus Eickhoff
Und vor allem: Alles Liebe und nur das Beste meiner Frau Sandra und meinen beiden Kindern Dana und Jared, die auch dieses Buch wieder mit mir durchgestanden haben.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Teil I Grundlagen
1 Anamnese
2 Untersuchung Kopf und Mundhöhle
2.1 Anatomie und Morphologie der Mundhöhle
2.2 Mundhöhle Hund
2.3 Mundhöhle Katze
2.4 Röntgen Zähne und Kiefer
2.5 Sondierung Zähne
3 Befundinterpretation
3.1 Befundinterpretation pädiatrischer Erkrankungen
3.2 Befundinterpretation parodontaler Erkrankungen
3.3 Befundinterpretation traumatischer Erkrankungen
3.4 Befundinterpretation resorptiver Erkrankungen
3.5 Befundinterpretation entzündlicher Schleimhauterkrankungen
3.6 Befundinterpretation tumoröser Erkrankungen
4 Behandlungsaspekte
4.1 Apparative und instrumentelle Ausstattung
4.1.1 Apparative Ausstattung
4.1.2 Instrumentelle Ausstattung
4.2 Handhabung
4.3 Lokalanästhesie
Teil II Wiederkehrende Verfahren
5 Dentale Prophylaxe
5.1 Pflegezustand
5.2 Zahnreinigung
5.2.1 Vorbereitung
5.2.2 Reinigung mittels Ultraschall
5.2.3 Zahnreinigung mit Handinstrumenten
5.2.4 Politur und Desinfektion
5.3 Zahnbürsten
6 Zahnextraktionen
6.1 Geschlossene Extraktion – Schritt für Schritt
6.1.1 Schritt 1
6.1.2 Schritt 2
6.1.3 Schritt 3
6.1.4 Schritt 4
6.2 Offene Extraktion einwurzeliger Zahn – Schritt für Schritt
6.2.1 Schritt 1
6.2.2 Schritt 2
6.2.3 Schritt 3
6.2.4 Schritt 4
6.2.5 Schritt 5
6.2.6 Schritt 6
6.2.7 Schritt 7
6.3 Offene Extraktion mehrwurzeliger Zahn – Schritt für Schritt
6.3.1 Schritt 1
6.3.2 Schritt 2
6.3.3 Schritt 3
6.3.4 Schritt 4
6.3.5 Schritt 5
6.3.6 Schritt 6
6.3.7 Schritt 7
6.3.8 Schritt 8
6.3.9 Schritt 9
7 Entfernung von Wurzelresten
7.1 Entfernung von Wurzelresten – Schritt für Schritt
7.1.1 Schritt 1
7.1.2 Schritt 2
7.1.3 Schritt 3
7.1.4 Schritt 4
7.1.5 Schritt 5
7.1.6 Schritt 6
7.1.7 Schritt 7
7.1.8 Schritt 8
7.1.9 Schritt 9
8 Kompositfüllung
8.1 Kompositfüllung – Schritt für Schritt
8.1.1 Schritt 1
8.1.2 Schritt 2
8.1.3 Schritt 3
8.1.4 Schritt 4
8.1.5 Schritt 5
8.1.6 Schritt 6
9 Vitalamputation
9.1 Einkürzung von Zähnen – Schritt für Schritt
9.1.1 Schritt 1
9.1.2 Schritt 2
9.1.3 Schritt 3
9.1.4 Schritt 4
9.1.5 Schritt 5
9.1.6 Schritt 6
10 Kronenamputation
10.1 Kronenamputation – Schritt für Schritt
10.1.1 Schritt 1
10.1.2 Schritt 2
10.1.3 Schritt 3
10.1.4 Schritt 4
10.1.5 Schritt 5
11 Wurzelfüllungen
11.1 Einwurzeliger Zahn – Schritt für Schritt
11.1.1 Schritt 1
11.1.2 Schritt 2
11.1.3 Schritt 3
11.1.4 Schritt 4
11.1.5 Schritt 5
11.1.6 Schritt 6
11.1.7 Schritt 7
11.1.8 Schritt 8
11.1.9 Schritt 9
11.1.10 Schritt 10
11.2 Mehrwurzeliger Zahn 108 – Schritt für Schritt
11.2.1 Schritt 1
11.2.2 Schritt 2
11.2.3 Schritt 3
11.2.4 Schritt 4
11.2.5 Schritt 5
11.2.6 Schritt 6
11.2.7 Schritt 7
11.3 Mehrwurzeliger Zahn 208 – Schritt für Schritt
11.3.1 Schritt 1
11.3.2 Schritt 2
11.3.3 Schritt 3
11.3.4 Schritt 4
11.3.5 Schritt 5
11.3.6 Schritt 6
12 Wurzelspitzenresektion
12.1 Wurzelspitzenresektion – Schritt für Schritt
12.1.1 Schritt 1
12.1.2 Schritt 2
12.1.3 Schritt 3
12.1.4 Schritt 4
12.1.5 Schritt 5
12.1.6 Schritt 6
13 Einsetzen von Brackets
13.1 Einsetzen von Brackets – Schritt für Schritt
13.1.1 Schritt 1
13.1.2 Schritt 2
13.1.3 Schritt 3
13.1.4 Schritt 4
13.1.5 Schritt 5
13.1.6 Schritt 6
14 Platte/Aufbissschiene
14.1 Platte/Aufbissschiene – Schritt für Schritt
14.1.1 Schritt 1
14.1.2 Schritt 2
14.1.3 Schritt 3
14.1.4 Schritt 4
14.1.5 Schritt 5
14.1.6 Schritt 6
14.1.7 Schritt 7
14.1.8 Schritt 8
Teil III Fallbeispiele
15 Jungtier
15.1 Fehlende Zähne
15.1.1 Multiple Nichtanlagen und reduzierte Zahnbildung beim Hund
15.1.2 Multiple Nichtanlagen und Zahnfraktur bei der Katze
15.1.3 Nichtanlage der Canini beim Hund
15.1.4 Retinierter Unterkieferprämolar beim Hund und hochgradige Osteolyse
15.1.5 Retinierte Unterkieferprämolaren beim Hund beidseits
15.1.6 Retinierter Oberkiefercaninus beim Hund
15.1.7 Kieferorthopädie bei retiniertem Oberkiefercaninus beim Hund
15.2 Überzählige Zähne
15.2.1 Persistierende Milchfangzähne mit Fehlstellung beim Hund
15.2.2 Geschwister mit Doppelanlagen
15.2.3 Doppelanlage der Oberkieferfangzähne bei der Katze
15.2.4 Fehlstellung der Incisivi aufgrund eines Odontoms beim Hund
15.3 Zahnmissbildungen
15.3.1 Schmelzhypoplasie an Canini und Molaren beim Hund
15.3.2 Generalisierte Schmelzhypoplasie mit Wurzelmissbildung beim Hund
15.3.3 Glaszähne beim Hund
15.3.4 Doppelkrone am Unterkieferprämolaren bei der Katze
15.4 Fehlstellungen
15.4.1 Steilstand und Rückbiss
15.4.2 Frontaler und kaudaler Kreuzbiss
15.4.3 Lanzencaninus
15.5 Abrasionen beim Jungtier
15.6 Zahnfrakturen beim Jungtier
15.6.1 Zahnfrakturen 504 und 604
15.6.2 Zahnfraktur 504
15.7 Persistierende Milchzähne
15.7.1 Persistierende Milchzähne
15.7.2 Haifischgebiss beim kleinen Hund
15.8 Gaumenspalte
15.8.1 Gaumenspalte harter und weicher Gaumen beim Hund
15.8.2 Gaumenspalte harter und weicher Gaumen beim Hund, zweizeitiges Vorgehen
15.8.3 Traumatische Gaumenspalte bei der Katze
15.8.4 Lippenkieferspalte beim Hund
15.9 Craniomandibuläre Osteopathie (CMO)
16 Zahn
16.1 Abrasion und Attrition
16.1.1 Hochgradige Attrition der Incisivi
16.1.2 Hochgradige Abrasion der Frontzähne
16.1.3 Verfärbung des Oberkieferfangzahnes nach Abrasion
16.1.4 Periapikale Osteolyse des Oberkieferreißzahnes nach Abrasion
16.1.5 Abrasion Oberkiefercaninus mit Fistelbildung
16.2 Zahnfrakturen & Co
16.2.1 Zahnverfärbung
16.2.2 Zahnfraktur
16.2.3 Isolierter Wurzelspitzenprozess
16.2.4 Wurzelreste
16.2.5 Vitalamputation
16.2.6 Apexifikation
16.2.7 Bleaching
16.3 Karies
16.3.1 Karies an den Oberkiefermolaren mit Füllung und Extraktion
16.4 Füllungen
16.4.1 Missbildung der gesamten Krone eines Oberkieferfangzahnes
16.4.2 Absplitterung Kronenspitze und Bukkalfläche an einem Oberkieferreißzahn
16.5 Kronenersatz
16.5.1 Caninuskrone aus Metall
16.5.2 Caninuskrone aus Keramik
16.5.3 Reißzahnkrone
16.6 Feline odontoklastische resorptive Läsionen (FORL)
16.6.1 Schemata zu felinen odontoklastischen resorptiven Läsionen (FORL)
16.6.2 Multiple FORL
16.6.3 Entwicklung von FORL an Fangzahnwurzeln
16.6.4 Entwicklung von FORL nach Kronenamputation
16.7 Canine odontoklastische resorptive Läsionen (CORL)
16.7.1 CORL an Zahn 309
16.8 Zahnluxation
16.8.1 Luxation Oberkieferfangzahn links
16.8.2 Avulsion Oberkieferfangzahn rechts
16.9 Zahnextraktion
16.9.1 Offene Extraktion des Oberkiefercaninus beim Hund
16.9.2 Offene Extraktion des Oberkiefercaninus bei der Katze
16.9.3 Multiple Extraktion von Backenzähnen bei der Katze
16.9.4 Entfernung eines Wurzelrestes vom Oberkieferreißzahn bei der Katze
16.9.5 Entfernung von Zähnen mit Wurzelresorptionen beim Hund
16.10 Zahnimplantat Caninus
17 Parodont
17.1 Parodont: Physiologie und Pathologie
17.1.1 Beurteilung des Parodonts beim Hund
17.1.2 Beurteilung des Parodonts bei der Katze
17.2 Parodontitis
17.2.1 Gingivitis beim Hund
17.2.2 Wirkung einer Zahnreinigung auf die Gingiva beim Hund
17.2.3 Gingivektomie bei Gingivahyperplasie der Katze
17.2.4 Generalisierte Parodontitis beim Hund
17.2.5 Generalisierte Parodontitis bei der Katze
17.2.6 Fistelung bei Parodontitis
17.2.7 Symmetrische hochgradige Parodontitis an den Oberkieferbackenzähnen
17.2.8 Lokale approximale Parodontitis
17.2.9 Labiale Gingivaplastik bei lokaler Parodontitis
17.2.10 Lokale Parodontitis infolge Zahnfehlstellung
17.2.11 Lokale Parodontitis aufgrund eines frontalen Kreuzbisses
17.2.12 Lokale parodontale und paradentale Entzündung
17.2.13 Laser
17.2.14 Laseranwendung in der Parodontologie
17.2.15 Gingivektomie mittels Laser bei der Katze
17.2.16 Parodontale Schleimhautpräparation
17.2.17 Deckung einer Rezession am Oberkieferreißzahn bei der Katze
17.2.18 Geführte Gewebsregeneration und geführte Knochenregeneration
17.3 Gingivahyperplasie
17.3.1 Gingivahyperplasie und Gingivektomie
17.3.2 Gingivahyperplasie und Pseudotaschen
17.3.3 Gingivahyperplasie bei der Katze
17.3.4 Gingivahyperplasie und Extraktionen bei der Katze
17.4 Oronasale Fistel
17.4.1 Symmetrische oronasale Fisteln der Oberkieferfangzähne
17.4.2 Technik zum Verschluss einer oronasalen Fistel am linken Oberkieferfangzahn
17.5 Gingivostomatitis
17.5.1 Verlauf einer Gingivostomatitis bei Extraktion aller Backenzähne
17.5.2 Gingivostomatitis einer jungen Katze
17.5.3 Verzögerter Verlauf bei Behandlung einer Gingivostomatitis
17.5.4 Gingivostomatitis vor und nach Extraktion aller Zähne
17.6 Stomatitis des Hundes
17.6.1 Polypöse Stomatitis
17.6.2 Mukositis
18 Mundschleimhaut
18.1 Immunogene Entzündung
18.1.1 Abklatschentzündung
18.1.2 Eosinophiler Granulomkomplex
18.1.3 Lupus erythematodes
18.1.4 Myositis eosinophilica
18.1.5 Lefzenfaltendermatitis
18.2 Verletzung
18.2.1 Stöckchenverletzung am Gaumen
18.2.2 Fistelung nach Pfählungsverletzung am Gaumen
18.2.3 Ablatio der Haut am Unterkiefer nach einem Unfall
19 Umfangsvermehrungen
19.1 Zystische Umfangsvermehrungen
19.1.1 Follikuläre Zyste im Unterkiefer um einen teilretinierten Prämolaren
19.1.2 Symmetrische follikuläre Zysten im Unterkiefer
19.1.3 Symmetrische Ranulabildung
19.2 Gewebige Umfangsvermehrungen
19.2.1 Plattenepithelkarzinom an der Unterkieferfront beim Hund
19.2.2 Plattenepithelkarzinom am Oberkiefer bei der Katze
19.2.3 Plattenepithelkarzinom am Unterkiefer bei der Katze
19.2.4 Schema Kieferresektion
19.2.5 Akanthomatöses Ameloblastom am kaudalen Unterkieferkörper beim Hund
19.2.6 Akanthomatöses Ameloblastom Unterkieferfront beim Hund
19.2.7 Papillome beim jungen Hund
19.2.8 Odontom beim Hund
19.2.9 Odontom bei der Katze
19.2.10 Symmetrische Granulationsgebilde im Unterkiefer bei der Katze
19.2.11 Behandlung reaktiver Umfangsvermehrungen durch Einkürzung der Reißzähne bei der Katze
19.2.12 Röntgenschichtaufnahmen
20 Kieferknochen
20.1 Kieferfrakturen
20.1.1 Nicht invasive Versorgung einer Fraktur des Unterkieferkörpers beim Hund
20.1.2 Nasenfraktur
20.1.3 Nasenabriss
20.1.4 Symphysenfraktur bei der Katze
20.1.5 Fraktur des kaudalen Unterkieferkörpers bei der Katze
20.1.6 Kiefergelenksnahe Fraktur bei der Katze
20.1.7 Reißzahn im Frakturspalt
20.2 Kieferluxation
20.2.1 Kieferluxation Hund
20.2.2 Kieferluxation Katze
20.3 Missbildungen des Kiefers
20.3.1 Kiefermissbildung beim Hund
20.3.2 Kiefermissbildung bei der Katze
Teil IV Anhang
21 Ausgewählte Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I Grundlagen
1 Anamnese
2 Untersuchung Kopf und Mundhöhle
3 Befundinterpretation
4 Behandlungsaspekte
1 Anamnese
Zur Untersuchung der Mundhöhle eines widerspenstigen Tieres steht häufig nur ein kurzer Moment zur Verfügung. Bei genauem Zuhören während der Anamnese sollte es möglich sein, diesen sinnvoll zu nutzen, da man nun weiß, auf welche Region der Fokus gelegt werden muss. Die Grundlage für spätere Zahnprobleme kann schon beim Spielen im Welpenrudel gelegt werden ( ▶ Abb. 1.1), da es durch das Einkneifen sehr spitzer Milchfangzähne in den Kiefer des Geschwistertieres zu einer Störung der Zahnentwicklung kommen kann, die erst bei Durchbrechen der bleibenden Zähne offensichtlich wird.
Abb. 1.1Kebbeln im Welpenrudel. Das Kebbeln im Welpenrudel kann so heftig werden, dass es zu Verletzungen an den Milchzähnen oder den Keimen der bleibenden Nachfolger kommen kann.
Durch abrasives Spielzeug, wie z.B. einen Tennisball, kann es schnell zur Eröffnung der Milchzähne kommen, welche aufgrund der Weite des Kanals eine Autobahn für die opportunistische bakterielle Mundhöhlenflora darstellt, um in den tiefer gelegenen knöchernen Kiefer zu gelangen ( ▶ Abb. 1.2).
Abb. 1.2Glattes Gummispielzeug. Ein glattes Gummispielzeug ist zu favorisieren, wenn es um die Beschäftigung der Welpen geht, da raue Materialien, wie z.B. der Filz eines Tennisballs, zum Abrieb der Zähne führen; im schlimmsten Fall kommt es zur Beteiligung der Milchzahnpulpa.
Im Gegensatz zu stumpfem oder abrasivem Spielzeug steht bei Spielen mit einem Stöckchen ( ▶ Abb. 1.3) die akute Verletzungsgefahr im Vordergrund, da es zu Pfählungsverletzungen kommen kann, häufig sublingual oder retromolar versteckt. Nicht alles ist direkt erkennbar; so kann es beispielsweise erst mit Verzögerung zur Einschränkung der Kieferöffnung kommen, ersichtlich beim Gähnen, Spiel oder der Futteraufnahme ( ▶ Abb. 1.4).
Abb. 1.3Hund mit Stöckchen. Stöckchen empfehlen sich für Pfählungsverletzungen. Nicht immer verbleibt der Fremdkörper in der Wunde, jedoch reichen verbliebene Reste oder die sich etablierende entzündliche Reaktion aus, um eine Störung zu verursachen.
Abb. 1.4Entspanntes maximales Gähnen. Ein zufriedenes Gähnen ist meist ein Zeichen für eine unbehinderte Kieferöffnung. Ist diese aufgrund eines entzündlichen Geschehens, z.B. nach einer Stöckchenverletzung, eingeschränkt, sollte dem nachgegangen werden.
Je nach Haltungsweise des Tieres kann es durch abnorme Verhaltensweisen, wie z.B. durch Kauen am Metallgitter des Zwingers, zu Beschädigungen der Zähne kommen. Metallene Ablagerungen sind auf der Oberfläche der Zähne zu entdecken, es kann weiterhin zu Abrieb am Zahn oder auch zur Zahnfraktur kommen ( ▶ Abb. 1.5). Ebenso hat die Art der Fütterung Einfluss auf die Zahngesundheit, da entweder bei Weichfutter die Zähne keinerlei selbsttätige Reinigung erfahren bzw. es bei sehr hartem Futter zu Zahnfrakturen kommt.
Abb. 1.5Metallabrieb bei Zwingerhaltung. Dunkle, flache, fest anhaftende und metallene Ablagerungen weisen auf den Spieltrieb oder die Unterbeschäftigung des betroffenen Tieres hin, wodurch das Gitter des Zwingers oder die Metallstäbe der Autobox interessant werden und Schäden an den Zähnen begünstigen. Beim typischen Käfigbeißergebiss (cage biter) kommt es insbesondere zum Abrieb der Distalflächen der Canini.
Eine anamnestische Basis bietet in vielen Fällen auch alleinig die jeweilige Rasse mit ihren spezifischen Eigenheiten. So können je nach Rasse und Schädeltyp Erkrankungen potenziell im Raum stehen. Ein Boxer stellt den üblichen Verdächtigen bei retinierten ersten Prämolaren und „Epuliden“ ( ▶ Abb. 1.6) dar, ein Sheltie bei einem Lanzencaninus, eine junge Maine Coon bei einer hyperplastischen Gingivitis.
Abb. 1.6Schädelform. Der Boxer mit seiner prägnanten Schädelform weist häufiger typische Erkrankungsformen im Gebissbereich auf. In vielen Fällen finden sich nicht durchgebrochene, retinierte erste Prämolaren, gerne auch mit follikulärer Zyste, oder gingival vollkommen zugewucherte Zähne.
Bei einer Asymmetrie am Kiefer steht zwar zumeist eine dentale Ursache im Vordergrund, allerdings darf beim älteren Tier das Vorliegen einer neoplastischen Veränderung nicht außer Acht gelassen werden ( ▶ Abb. 1.7).
Abb. 1.7Auftreibung am Oberkiefer einer Katze. Finden sich massive Veränderungen am Gesichtsschädel wie bei dieser Katze, muss von einem bösartigen Geschehen ausgegangen werden. Die Absicherung erfolgt über die Untersuchung einer Gewebeprobe.
Plattenepithelkarzinome in der Mundhöhle bei Katzen treten häufig am Mundboden respektive am Zungengrund ( ▶ Abb. 1.8) auf. Wird dadurch der gesamte Unterkiefer aufgetrieben, ist der abzuklärende Bereich offensichtlich. Leider jedoch wachsen diese Tumoren häufig versteckt im Kehlgang. Eine Verhärtung des gesamten Mundbodens ist meist die Folge, was beim Fressen Probleme bereitet.
Abb. 1.8Umfangsvermehrung am Zungenuntergrund. Bereits bei der klinischen Untersuchung kann bei Verdacht auf ein Plattenepithelkarzinom am Zungengrund die Zunge durch Druck im Kehlgang angehoben werden, um auch den sublingualen Bereich intraoral inspizieren zu können. Eine deutliche Verhärtung ist meist Anlass genug, um eine Gewebeprobe zu nehmen.
Bei einem Autounfall oder beim High-rise-Syndrom der Katze ist der Kiefer häufig mitbeteiligt. Es liegen meist Zahn- und/oder Knochenfrakturen vor, die einen physiologischen Schluss des Kiefers verhindern und eine Futteraufnahme unmöglich machen. Neben offensichtlichen Ausbrüchen, z.B. in der Kieferfront ( ▶ Abb. 1.9), gilt es auch die ungestörte Kieferöffnung im Kiefergelenksbereich röntgenologisch zu kontrollieren.
Abb. 1.9Unfallkatze. Unfallkatze mit zerstörter Unterkieferfront unter Beteiligung von Zähnen und Kieferknochen.
2 Untersuchung Kopf und Mundhöhle
2.1 Anatomie und Morphologie der Mundhöhle
Ein Zahn hat seine Entwicklung mit Durchbruch der Krone noch lange nicht abgeschlossen. Die Entwicklung einer maturen Wurzel bedarf mehrerer Monate, sodass anfänglich eine große Pulpa und ein offenes Foramen apicale dominieren ( ▶ Abb. 2.1). In dieser Zeit sind Verletzungen des Zahnes mit nachfolgender Pulpitis meist nicht therapierbar, weshalb im ersten Lebensjahr eine erhöhte Belastung der Zähne vermieden werden sollte. Erst mit Bildung der Wurzelspitze und abgeschlossenem Höhenwachstum ist die Entwicklung des einzelnen Zahnes beendet ( ▶ Abb. 2.2), wobei die Zeiten aufgrund differierenden Durchbruchverhaltens voneinander abweichen.
Abb. 2.1Schema eines jungen Zahnes. Kronen- und Wurzelpulpa stellen einen sehr großen Raum dar, die Wandung des Zahnes ist noch sehr dünn. Die Wurzelscheide ist weich, über das Foramen apicale besteht ein weiter Zugang zur Zahnpulpa.
Abb. 2.2Schema eines maturen Zahnes. Der „erwachsene“ Zahn hat eine abgeschlossene Pulpa, die mit zunehmendem Alter und durch kontinuierliche physiologische Dentinbildung nach innen schmaler wird und sich verkleinert.
Mittels des Saumepithels ( ▶ Abb. 2.3, ▶ Abb. 2.4) wird das epitheliale Attachment geschaffen, die erste Barriere im Zahnsulkus. Dieser Verschluss verhindert durch Anheftung mittels Hemidesmosomen, dass Bakterien und deren Toxine in den Bereich des faserigen, desmodontalen Attachments gelangen. Allerdings ist das epitheliale Attachment anfällig für Schädigungen, sodass dessen Erhaltung mittels Zahnpflege der erste Schritt zur Sicherung der Zahngesundheit ist. Durch bakterielle Beladung der weichen Plaque mit Entwicklung eines Biofilmes wird zunächst das epitheliale Attachment überwunden, dann das desmodontale Attachment zerstört; es folgt der Abbau von parodontalen Fasern und vom Alveolarknochen ( ▶ Abb. 2.5).
Abb. 2.3Saumepithel. Der physiologische Sulkus ist beim mittelgroßen Hund ca. 2 mm, bei der Katze ca. 1 mm tief. Im Bereich des Sulkusbodens sorgen nicht keratinisierte Spezialzellen für die Anheftung des Zahnfleisches am Zahn im Bereich der Schmelz-Zement-Grenze.
Abb. 2.4Saumepithelzellen im Detail. Die Saumepithelzellen sorgen zahnseitig mittels Hemidesmosomen für die Anheftung an der Zahnoberfläche, untereinander sind die Zellen über Desmosomen verbunden. Aufgrund der fehlenden Keratinisierung sind diese Zelllagen permeabel und erlauben insbesondere einen sulkusgerichteten Durchgang wirtseigener Abwehrsubstanzen und -zellen.
Abb. 2.5Vergleich gesundes und krankes Parodont. Links ist das gesunde Parodont dargestellt: Die innere Auskleidung des Zahnsulkus dichtet mithilfe des Saumepithels das Parodont mundhöhlenseitig ab, bildet eine gingivale Manschette. Rechts ist das geschädigte Parodont dargestellt: Das Saumepithel (orange) ist apikal gewandert, es haben sich normale gingivale Schleimhautzellen in den Sulkus geschoben, können jedoch keinen Verschluss gewährleisten. Die Tasche ist vertieft durch eine Zunahme der Gingiva sowie durch einen Verlust der faserigen und knöchernen Abstützung des Alveolarknochens.
Der Oberkiefer ( ▶ Abb. 2.6) besteht aus dem paarigen Oberkieferknochen (Os maxillare), Zwischenkieferbein (Os incisivum) und Gaumenbein (Os palatinum), die über Knochennähte (Suturen) miteinander verbunden sind.
Abb. 2.6Oberkiefer. Die Schneidezähne befinden sich im Zwischenkieferbein, die Canini und Backenzähne im Oberkieferknochen, der Gaumenknochen ist zahnfrei. Die zwei großen rostralen Öffnungen zwischen Ober- und Zwischenkieferknochen stellen die Fissurae palatinae dar, über welche das Jacobsonsche Organ seine oronasale Verbindung erhält.
Der Unterkiefer ( ▶ Abb. 2.7) besteht aus den paarigen Unterkieferknochen (Os mandibulare), die rostral in der Medianen in der Symphyse bandhaft miteinander verbunden sind; anders als beim Menschen kommt es nicht zu einem knöchernen Durchbau.
Abb. 2.7Unterkiefer. Der Unterkiefer besteht aus dem horizontalen Unterkieferkörper und dem vertikalen Unterkieferast. Während der Oberkiefer appositionell und entlang der Suturen an Größe zunimmt, wächst der Unterkiefer insbesondere aus dem kaudalen Bereich heraus. Die Kiefergelenkköpfchen sind jeweils über die Gelenkgrube (Fossa mandibularis) am Schläfenbein (Os temporale) mit der Schädelbasis verbunden.
Die Zähne lassen sich entsprechend ihrer Funktion einzelnen Zahngruppen ( ▶ Abb. 2.8) zuordnen. Während sich im Unterkiefer alle Zähne im Os mandibulare befinden, stehen die Incisivi im Oberkiefer im Os praemaxillare (Zwischenkiefer), die Canini und Backenzähne im Os maxillare (Maxilla).
Abb. 2.8Zahngruppen. Die verschiedenen Zahngruppen sind eingefärbt: Incisivi blau, Canini grün, Prämolaren orange, Molaren gelb.
Die Speicheldrüsen befinden sich bei Hund und Katze als Drüsenpakete kaudal des Unterkieferwinkels. Lediglich die Jochbogendrüse findet sich separat hinter dem Jochbogen ( ▶ Abb. 2.9, ▶ Abb. 2.10).
Abb. 2.9Lage der Speicheldrüsen von lateral. Die Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis, grün) liegt direkt unterhalb der Ohrbasis mit einem rostralen und einem kaudalen Ausläufer. Direkt unterhalb davon im Bereich des Triborgschen Dreiecks findet sich die Glandula mandibularis (rot), die nach rostral in einer Kapsel beherbergt in die Glandula sublingualis (blau) übergeht. Die Jochbogendrüse (Glandula zygomatica, lila) findet sich separat hinter dem Jochbogen.
Abb. 2.10Lage der Speicheldrüsen von ventral. Im Bereich des Zungenbändchens endigen die Ausführungsgänge von Glandula mandibularis und sublingualis, der Ausführungsgang der Glandula parotis endet auf Höhe des Oberkieferreißzahnes bukkal auf der Wangenschleimhaut; kaudal hiervon endet auch der kurze Gang der Glandula zygomatica.
Zahnschemata ( ▶ Abb. 2.11, ▶ Abb. 2.12) dienen einer nachvollziehbaren Befundung und deren Verlaufskontrolle. Neben den Informationen zur Identifikation des Tieres wird das Gebiss in seinen Einzelheiten bewertet. Beläge, Zahnstein und Entzündungsgrad der Gingiva werden aufgenommen, über eine Legende können weitere Veränderungen wie z.B. Fraktur, Umfangsvermehrung etc. aufgezeichnet werden. Auch können in der Aufsicht Veränderungen am Kiefer oder geplante kieferorthopädische Apparaturen eingezeichnet werden. Im Detail ( ▶ Abb. 2.13) erkennt man, dass jedem einzelnen Zahn parodontale Taschentiefen zugeordnet werden können.
Abb. 2.11Zahnschema Hund, Gebiss. Das vollständige Gebiss des Hundes enthält 42 Zähne, erst im Bereich der Molaren zeigen sich mahlende (bunodonte) Abschnitte. Zu jedem einzelnen Zahn können die erhobenen Befunde in eine separate Box eingetragen werden.
Abb. 2.12Zahnschema Katze, Gebiss. Das vollständige Gebiss der Katze enthält 30 Zähne und ist rein schneidend (sekodont).
Abb. 2.13Zahnschema Hund, Detail. Neben der Dokumentation in Papierform bietet sich heute die Möglichkeit, alle Daten digital zu erfassen, sowohl schriftlich wie auch visuell aufbereitet. Beispiel hier ist die Software Prodenta der schwedischen Firma Accesia, welche auch in deutscher Sprache erhältlich ist.
Die Verzahnung der Zähne (Okklusion) ist bei Hund und Katze sehr eng. Bereits bei kleinen Abweichungen an einem einzelnen Zahn oder minimalen Stellungsveränderungen kommt es zu Störungen in der Schließbewegung des Kiefers. Im kaudalen Unterkiefer dominiert der kräftige Muskelfortsatz des Unterkieferastes. An ihm sind die kräftigen Mundschließer befestigt. Die enge anatomische Nähe der Zahnwurzeln zu benachbarten Strukturen des Kopfes veranschaulichen ▶ Abb. 2.14, ▶ Abb. 2.15 und ▶ Abb. 2.16.
Abb. 2.14Schädel des Hundes, Frontalansicht. In der Frontalansicht des Hundeschädels zeigt sich die enge anatomische Nähe der oberen Fangzahnwurzeln zur Nasenhöhle. Die Mesialfläche der Fangzahnwurzel ist lediglich durch eine papierdünne Knochenbedeckung von der Nasenhöhle entfernt.
Abb. 2.15Oberschädel Hund, Lateralansicht. In der Seitenansicht zeigt sich die Nähe der kaudalen Oberkieferbackenzähne bzw. des retromolaren Raumes generell zur Augenhöhle. Es liegt keine knöchern umschlossene Orbita vor, der Orbitaboden ist weichgeweblich. Entzündliche Veränderungen im kaudalen Kieferbereich oder im Retromolarraum äußern sich daher auch über eine abnehmende Resilienz des Augenhöhlenbodens.
Abb. 2.16Unterkiefer Hund, Lateralansicht. Der kräftigste Backenzahn des Unterkiefers ist der erste Molar, welcher den Reißzahn darstellt. Im Oberkiefer wird der antagonistische Reißzahn in Form des vierten Prämolaren gestellt.
Das modifizierte Zahnschema nach Triadan dient der eindeutigen Benennung der Zähne bei Hund und Katze. Infolge entwicklungsgeschichtlicher Verläufe erscheint das Gebiss der Katze lückig, weil nur noch die aktuell vorhandenen Zähne mit der entsprechenden dreiziffrigen Zahl benannt sind. Die erste Ziffer benennt den Quadranten; man beginnt dabei vom Standpunkt des Untersuchers aus im rechten Oberkiefer und fährt dann im Uhrzeigersinn fort. Die zweite Ziffer startet in der Medianen zwischen den inneren Incisivi und zählt nach kaudal fort; aufgrund einer zweistelligen Anzahl von Zähnen pro Quadrant wurde eine dritte Ziffer notwendig, sodass Ziffer zwei und drei als eine Zahl gelesen werden ( ▶ Abb. 2.17).
Abb. 2.17Zahnbenennung Hund. Im Uhrzeigersinn werden die Zähne, beginnend im rechten oberen Quadranten, jeweils von der Medianen nach kaudal durchnummeriert.
Auch bei der Katze ist die anatomisch enge Verflechtung von Maulhöhle, Nasenhöhle und Augenhöhle deutlich ( ▶ Abb. 2.18). Die enge Verzahnung des felinen Gebisses sowie die Gestaltung der sehr engen Kiefergelenke erlaubt lediglich eine reine Scharnierbewegung, es können keine Lateralbewegungen für das Zermahlen von Futter ausgeführt werden.
Abb. 2.18Schädel der Katze, Frontalansicht. Die Schädelform bei der Katze ist deutlich uniformer als beim Hund, was auf die geringere Variabilität der verschiedenen Rassen zurückzuführen ist.
Vergleichbar dem Hund nutzt die Zahnbenennung bei der Katze ebenfalls drei Ziffern ( ▶ Abb. 2.19), obwohl aufgrund der Gesamtzahl der Zähne und deren Ursprung pro Kieferquadrant eine zweistellige Zahl ausreichend gewesen wäre.
Abb. 2.19Zahnbenennung Katze. Die Zahnbenennung bei der Katze erfolgt analog zur Benennung beim Hund, berücksichtigt jedoch in der Abfolge nicht vorhandene Zähne in Form einer Lücke in der Zahlenfolge (z.B. 304, dann 307 folgend, 305 und 306 auslassend).
2.2 Mundhöhle Hund
Bereits im Milchgebiss können Veränderungen beobachtet werden, die zum einen behandlungsbedürftig sind und zum anderen Einfluss auf die Zahngesundheit der permanenten Zähne haben. Das vollständige Milchgebiss des Hundes besteht aus 28 Zähnen, es finden sich jeweils 7 Zähne pro Quadrant ( ▶ Abb. 2.20). Das Fehlen eines Zahnes oder eine fehlerhafte Stellung sollte dazu dienen, die Ursache oder die Auswirkung auf die bleibenden Zähne zu untersuchen.
Abb. 2.20Milchgebiss Oberkiefer. Im Milchgebiss des Hundes finden sich pro Quadrant jeweils 3 Schneidezähne, 1 Fangzahn und 3 Backenzähne. Die Zähne sind im Vergleich zur bleibenden Dentition deutlich kleiner, die interdentalen Lücken werden mit Wachstum des Kiefers größer.
Bei ausreichendem Platz im Kiefer stehen die Zähne in Reihe ( ▶ Abb. 2.21). Bei Hunden mit kurzem Kiefer kommt es dagegen häufig zu Rotationen im Backenzahnbereich sowie zum Crowding (Versatz der Zähne infolge Enge) in der Unterkieferfront, was sich manchmal bereits im Milchgebiss andeutet und mit Zunahme der Zahnzahl im bleibenden Gebiss offensichtlich wird.
Abb. 2.21Milchgebiss Unterkiefer. Infolge des Gebrauchs der Milchzähne kommt es zu Abnutzungserscheinungen, die – wie hier – z.B. zur Abrasion der Fangzahnspitzen führen. Solange es nicht zu einer krankhaften Beteiligung der Pulpa kommt, besteht keine Behandlungsbedürftigkeit.
Der Zahnwechsel läuft nicht immer nach dem Schema „Milchzahn ausgefallen – bleibender Zahn erscheint“. In der Wechselperiode dürfen Milchzähne oder Milchzahnreste parallel zum Durchbruch der bleibenden Zähne noch vorhanden sein ( ▶ Abb. 2.22). Besteht die Gefahr einer Zahnfehlstellung infolge des Verbleibs der Milchzähne, müssen diese sofort entfernt werden.
Abb. 2.22Milchzahnkappe Milchmolar. Im Wechselgebiss werden die Wurzeln der Milchzähne physiologischerweise resorbiert, dennoch kann es bis zum ausreichenden Durchbruch des bleibenden Nachfolgers zu einem Verbleiben der Kronen kommen. Diese lassen sich i.d.R. leicht entnehmen oder fallen von allein aus.
Das bleibende Gebissdes Hundes besteht aus 42 Zähnen. Jeder Oberkieferquadrant beherbergt 10 Zähne, jeder Unterkieferquadrant 12 Zähne. Man spricht von brachydonten Zähnen mit kurzer Krone und langer Wurzel. Als heterodont bezeichnet man sie, weil funktionsbedingt unterschiedliche Formen vorliegen. Die oberen Zähne liegen mit ihren Schneiden oder bukkalen Höckern ( ▶ Abb. 2.23) labial der unteren Zähne, der untere Bogen ist etwas schmaler.
Abb. 2.23Oberkiefermolaren. Die Oberkiefermolaren sind für die mahlende (bunodonte) Funktion im Fleischfressergebiss konzipiert. Durch Höcker und Gruben wird zusammen mit den Unterkiefermolaren eine zermahlende Oberfläche geschaffen.
Die Reißzähne stellen die wichtigsten Zähne im Verarbeiten des Futters dar ( ▶ Abb. 2.24). Aufgrund dieser Arbeitsbelastung sind sie leider auch häufig von einer Fraktur bedroht.
Abb. 2.24Oberkieferreißzahn. Der Oberkieferreißzahn liegt im Kaukraftbelastungszentrum des Hundes. In Zusammenarbeit mit dem Unterkieferreißzahn werden Futterbrocken aufgrund der zerteilenden (sekodonten) Funktion zerbissen.
Nicht von besonderer Bedeutung erscheinen zunächst die kleineren Prämolaren ( ▶ Abb. 2.25); sie ermöglichen im Zusammenspiel von Ober- und Unterkiefer jedoch das Fixieren von Gegenständen. Fällt ein Hund im Schutzdienst aus dem Ärmel, ist in vielen Fällen eine Schmerzhaftigkeit im Bereich der Prämolaren zu suchen.
Abb. 2.25Oberkieferprämolaren. Die kleinen Oberkieferprämolaren (der vierte, große Oberkieferprämolar fungiert als Reißzahn) stehen i.d.R. in keinem Kontakt zur unteren Zahnreihe. Hier kann nicht vollständig zerteilt werden.
Zuständig für das Greifen und Halten von Futter, Beute oder anderen Dingen sind die Fangzähne, Eckzähne bzw. Canini ( ▶ Abb. 2.26).
Abb. 2.26Oberkieferincisivi und -canini.Die Canini sind die exponiertesten Zähne des Oberkiefers und damit häufig prädisponiert für eine Fraktur aufgrund einer großen Krafteinwirkung. Die Verzahnung der Canini von Ober- und Unterkiefer ist sehr eng und gewährleistet damit deren Funktion als Fangzähne zum Halten der Beute.
Weniger häufig betroffen von Frakturen als ihre Pendants im Oberkiefer sind die Unterkieferreißzähne, was sich durch die bessere Stabilität infolge ihrer Größe und Masse erklärt ( ▶ Abb. 2.27).
Abb. 2.27Unterkieferreißzahn. Der Unterkieferreißzahn ist der erste Molar des Unterkiefers und der Antagonist des Oberkieferreißzahnes; er steht lingual des oberen Reißzahnes. Beim Zerbeißen kommt es aufgrund der starken Scherwirkung häufiger zum Abbrechen der Spitze und/oder der bukkalen Lamelle des oberen Reißzahnes, da sich der untere Reißzahn kompakter darstellt.
Neben den letzten Molaren ist v.a. der erste Prämolar im Unterkiefer des Hundes auf dem Rückzug ( ▶ Abb. 2.28). Dies ist als Fortsetzung der phylogenetischen Entwicklung zu interpretieren, nicht als Zahnfehler.
Abb. 2.28Unterkieferprämolaren.Bei physiologischer Kiefer- und Zahnstellung interdigitieren die unteren Prämolaren alternierend mit den oberen Prämolaren. Der erste Prämolar ist häufig im Rahmen der phylogenetischen Entwicklung entweder retiniert, in seiner Form reduziert oder gar nicht angelegt. Dieser Unterschied ist röntgenologisch zu objektivieren, um pathologische Prozesse im Kiefer zu vermeiden.
Für viele Züchter ist die saubere Scherenverzahnung ( ▶ Abb. 2.29) der Incisivi wichtig, um die notwendige Zuchtzulassung zu erhalten. Die phänotypisch korrekte Ausbildung der Verzahnung ist jedoch nicht immer Indiz für eine genetische Fehlerfreiheit, daher sollten nicht nur die Incisivi beurteilt werden.
Abb. 2.29Unterkieferincisivi und -canini. Die Unterkieferincisivi liegen auf einem etwas engeren Bogen als die oberen, dadurch ergibt sich die physiologische Scherenverzahnung. Die Unterkieferfangzähne okkludieren in gleichmäßigem Abstand approximal zwischen dem oberen seitlichen Schneidezahn und dem Oberkieferfangzahn.
Die Zunge stellt eine sehr spezialisierte Struktur dar, die – beim Hund verstärkt durch einen sog. Zungenknochen (Lyssa, Tollwurm) – als Muskelkörper bei der Aufnahme und beim Schmecken von Nahrung zum Einsatz kommt. Zum Schutz, zum Futtertransport, zur Geschmacksempfindung und zur Sensibilität nutzt die Zunge spezialisierte Fortsätze, die Papillen ( ▶ Abb. 2.30, ▶ Abb. 2.31).
Abb. 2.30Dorsalfläche der Zunge. Die Dorsalfläche der Zunge besitzt unterschiedliche Papillen. In der Menge dominieren die mechanisch tätigen Papillae filiformes, die verlängerte Hornzähnchen darstellen. Daneben finden sich gustatorische Papillen, die in engem Zusammenhang mit Geschmacksknospen stehen. Neben pilzartigen Papillae fungiformes (kleine rote Erhabenheiten) zeigen sich breite, kreisrunde, rote Flecken, welche die Papillae vallatae darstellen, die von einem Graben umsäumt sind. Im Bereich der Zungenspitze wird süß geschmeckt, am rostralen Seitenrand salzig, weiter kaudal sauer und im Bereich des kaudalen Zungenrückens bitter, auch als letzte Instanz vor der Aufnahme toxischer Stoffe, die häufig durch eine Bitternote gekennzeichnet sind.
Abb. 2.31Zungenpapillen. In der Detailaufnahme lässt sich sehr gut die hornartige Verlängerung der Papillae filiformes darstellen.
Die Computertomografie kann in den Fällen, bei welchen das zweidimensionale Röntgenbild seine Grenzen aufgezeigt bekommt, dazu dienen, sich die räumlichen Verhältnisse ( ▶ Abb. 2.32) bzw. bereits abgelaufene pathologische Prozesse zu vergegenwärtigen und den Grad der Erkrankung einschätzen zu können.
Abb. 2.32Darstellung der Oberkiefercaninuswurzel in der CT. In der computertomografischen Darstellung lässt sich die anatomische Nähe der oberen Caninuswurzeln zur Nasenhöhle sehr gut darstellen. Zwischen Caninuswurzel und Nasenhöhle besteht nur eine dünne Knochenwand, die bei entzündlichen Prozessen der Wurzel leicht arrodiert oder aufgelöst wird, was zu einseitigem Nasenausfluss führen kann.
Dass die Größe und Morphologie der Zähne mitentscheidend ist für die Kieferform, wird insbesondere in Schichtaufnahmen deutlich ( ▶ Abb. 2.33).
Abb. 2.33Darstellung der mesialen Unterkieferreißzahnwurzeln in der CT. Ebenso wie die Caninuswurzeln im Oberkiefer sind auch die mesialen Wurzeln der Unterkieferreißzähne raumfüllend. Auf der Aufnahme zeigt sich die große bukkolinguale Ausdehnung, apikal der Wurzel stellt sich der transluzente Mandibularkanal dar. Bei kleineren Hunderassen dehnt sich die Wurzel bis zum Ventralrand aus, überlagert dadurch den Mandibularkanal. Dies kann zu Blutungen bei der Extraktion führen durch Verletzung der A. oder V. alveolaris inferior, zum anderen kann bei Osteolyse und Hebelkräften während der Extraktion eine Fraktur provoziert werden. Eine präoperative röntgenologische Darstellung vor der Extraktion dient daher der Einschätzung der aktuellen Verhältnisse sowie der forensischen Absicherung.
Nicht jede Abweichung von der Norm ist pathologisch zu werten. Eine Verlängerung von Papillen kann komisch erscheinen, ist jedoch nicht behandlungsbedürftig ( ▶ Abb. 2.34).
Abb. 2.34Haarzunge. Bei exzessiver Verlängerung der mechanischen Papillae filiformes kann die sog. Haarzunge entstehen, gekennzeichnet durch eine meist dunkle, haarartige Verlängerung der Papillen. Dies zeigt sich gern in der medianen Furche und ist nicht behandlungsbedürftig.
Im Zahnwechsel gilt es, die physiologische Auflösung der Milchzahnwurzeln und den Verlust der Milchzähne ( ▶ Abb. 2.35) von pathologischen Auflösungsprozessen und Frakturen abzugrenzen.
Abb. 2.35Verfärbter Milchcaninus. Ein bräunlich oder lila verfärbter Milchcaninus ist ohne zusätzlich erkennbare Ursache im Rahmen des Zahnwechsels normal, da die Wurzel durch den nachrückenden und hier mit der Spitze durchbrechenden permanenten Caninus aufgelöst wird.
Nicht immer weist eine belagsbeladene Mundhöhle einen deutlichen weichen Biofilm auf den Zähnen auf. Aufgrund des basischen Charakters von Speichel kommt es relativ schnell zur Zahnsteinbildung durch Ausfällung der Mineralien im Speichel, die dann als Kristallisationsgrundlage fungieren ( ▶ Abb. 2.36).
Abb. 2.36Hochgradige Zahnsteinakkumulation. Die Kronenspitzen der Backenzähne ragen gerade noch über die massive Zahnsteinansammlung. Ob diese bereits zu einem manifesten parodontalen Geschehen mit knöcherner Schädigung geführt hat, lässt sich aus dem klinischen Befund nicht ableiten. Eine diagnostische Objektivierung mittels Röntgen ist zwingend.
Ein fast pathognomonisches Symptom für eine dentale Erkrankung ist die Ausbildung einer suborbitalen Schwellung ( ▶ Abb. 2.37).
Abb. 2.37Suborbitale Schwellung rechts. Das Zuschwellen des rechten Auges infolge einer suborbitalen Volumenzunahme ist am häufigsten die Folge eines knöchernen Prozesses im Bereich des Oberkieferreißzahnes oder der Molaren.
2.3 Mundhöhle Katze
Das permanente Gebiss der Katze besteht aus 30 Zähnen. Pro Oberkieferquadrant finden sich 8 Zähne ( ▶ Abb. 2.38), pro Unterkieferquadrant 7 Zähne. Die Schneidezähne sind sehr klein, gefolgt von dem wieder sehr prominenten Fangzahn. Der vierte Prämolar des Oberkiefers und der erste Molar des Unterkiefers bilden wiederum die Brechschere zur Zerteilung des Futters.
Abb. 2.38Oberkiefer Katze. Die hier variabel dunkel und hell pigmentierte Schleimhaut der Mundhöhle weist am Gaumen sehr deutliche Gaumenfalten auf. Es finden sich rein schneidende Zähne.
Zeigt sich die Gingiva beim Hund meist deutlich rosa bis rosa-rötlich, so weist die der Katze i.d.R. eine eher blassrosa Farbe auf ( ▶ Abb. 2.39).
Abb. 2.39Unterkiefer Katze. Im Gegensatz zur derben Gaumenschleimhaut zeigt sich sublingual eine sehr fragile, dünne Schleimhaut.
Im Backenzahnbereich des Unterkiefers findet sich eine beim Hund fehlende physiologische „Umfangsvermehrung“ ( ▶ Abb. 2.40).
Abb. 2.40Glandula molaris lingualis. Lingual des Unterkieferreißzahnes findet sich die Molarendrüse (Glandula molaris), die beim Hund nicht angelegt ist. Nach Entfernung des Unterkieferreißzahnes kann sie noch prominenter hervortreten, ist jedoch als physiologische Struktur nicht behandlungsbedürftig.
Werden die Incisivi der Katze extrahiert, erscheint für den Besitzer plötzlich eine tumorartige Veränderung am vorderen Gaumen, welche jedoch physiologischerweise genau dorthin gehört ( ▶ Abb. 2.41).
Abb. 2.41Papilla incisiva. Direkt kaudal der oberen inneren Incisivi findet sich bei der Katze wie beim Hund in der Medianen die Papilla incisiva. Hier enden die paarigen Ductus incisivus mit Anbindung an das intranasale Organum vomeronasale (Jacobsonsches Organ), welches v.a. beim Hund die zusätzliche Geruchswahrnehmung beim Wittern erklärt.
Ist beim Hund eine deutliche Scherenverzahnung der Incisivi gewünscht, zeigen sich bei der Katze andere Verhältnisse ( ▶ Abb. 2.42).
Abb. 2.42Okklusion der Frontzähne bei der Katze. Die Schneidezähne treffen weitestgehend in Form einer Zange aufeinander. Die Fangzähne verzahnen vertikal sehr tief miteinander, bei vollständigem Kieferschluss kann daher ein intensiver Kontakt insbesondere der Canini mit dem umgebenden Weichgewebe vorliegen.
Auch im Backenzahnbereich bleibt es bei einer sekodonten Ausbildung ( ▶ Abb. 2.43), es fehlen bunodonte Kieferabschnitte zum Mahlen von Futterbrocken. Das Gebiss ist futtertechnisch einzig und allein auf das Zerteilen von Nahrung ausgelegt.
Abb. 2.43Okklusion der Backenzähne bei der Katze. Die schneidende Wirkung der Backenzähne wird durch die tiefe vertikale Verzahnung unterstützt.
Der Zahnwechsel folgt einer vorgegebenen Abfolge ( ▶ Abb. 2.44, ▶ Abb. 2.45, ▶ Abb. 2.46, ▶ Abb. 2.47), Unregelmäßigkeiten dürfen als Anlass für eine weitere Diagnostik gewertet werden.
Abb. 2.44Oberkiefer, frühes Wechselgebiss. In diesem Wechselgebiss der Katze erkennt man, dass die Schneidezähne als Erstes wechseln.
Abb. 2.45Unterkiefer, frühes Wechselgebiss. Auch im Unterkiefer zeigen sich zunächst die Schneidezähne, die Milchzähne weisen bereits erhebliche resorptionsbedingte Verfärbungen auf.
Abb. 2.46Oberkiefer, spätes Wechselgebiss. Im späten Wechselgebiss des Oberkiefers haben bereits alle Zähne durchgewechselt, die Zähne haben jedoch noch nicht ihre komplette Durchbruchshöhe erreicht. Das Zahnfleisch ist gerötet, und es finden sich vermehrt Beläge. Der Zahnwechsel ist häufig begleitet von entzündlichen Veränderungen der umgebenden Gingiva. Auch verhindert die dadurch vorhandene Schmerzhaftigkeit eine natürliche Nutzung der Zähne. Meist verlieren sich Beläge und konsekutiv die Entzündung im weiteren Verlauf mit vermehrter Nutzung der hochgewachsenen Zähne.
Abb. 2.47Unterkiefer, spätes Wechselgebiss. Im Unterkiefer ist der Zahnwechsel später dran als im zugehörigen Bild des Oberkiefers ( ▶ Abb. 2.46). Reste der Milchbackenzähne stehen noch bukkal der bereits durchgebrochenen oder im Durchbruch befindlichen Zähne. Persistierende Milchzähne finden sich im Gebiss der Katze selten, sodass von einem weiteren physiologischen Wechsel ausgegangen werden kann.
Die raue Zunge der Katze ( ▶ Abb. 2.48) unterscheidet sich sehr deutlich von der seidigen Zunge des Hundes.
Abb. 2.48Zunge der Katze. Die Zunge der Katze stellt mit ihren ausgeprägten, rachenwärts gerichteten Papillae filiformes ein sehr geeignetes Instrument zur Fellpflege und zum Futtertransport dar. Wichtig bei der Untersuchung der Zunge ist die Kontrolle des Mundbodens. Durch eine Palpation des Kehlganges kann insbesondere bei Vorliegen eines Plattenepithelkarzinoms des Zungengrundes bereits relativ früh eine Verhärtung gefunden werden. Auf ein Vorliegen der sich meist versteckt entwickelnden Tumoren sollte aufgrund der Häufigkeit des Auftretens bei der älteren Katze immer kontrolliert werden, insbesondere wenn von veränderten Fressgewohnheiten die Rede ist.
2.4 Röntgen Zähne und Kiefer
Auswertbare Röntgenaufnahmen der Zähne erzielt man durch die Erstellung von Einzelzahnröntgenaufnahmen. Die entsprechenden Filme oder Sensoren werden intraoral platziert und gewährleisten eine weitestgehend überlagerungsfreie Darstellung der Zähne inklusive ihrer Wurzeln. Um die Ausrichtung der Röntgenstrahlen zu erleichtern, bietet es sich an, das Tier bei Aufnahmen im Oberkiefer in Bauchlage ( ▶ Abb. 2.49, ▶ Abb. 2.51), bei Aufnahmen im Unterkiefer in Rückenlage ( ▶ Abb. 2.50, ▶ Abb. 2.54) zu positionieren. Der Kopf sollte so ausgerichtet werden, dass sich die Zahnreihe in der Horizontalen bzw. parallel zur Tischplatte befindet.
Abb. 2.49Lagerung des Hundes bei Röntgenaufnahmen im Oberkiefer.
Abb. 2.50Lagerung des Hundes bei Röntgenaufnahmen im Unterkiefer.
Abb. 2.51Lagerung der Katze bei Aufnahmen im Oberkiefer. In diesem Fall wird der digitale Sensor durch Tupfer in korrekter Position gehalten.
In der orthopädischen Radiologie kommt i.d.R. die Rechtwinkeltechnik zum Einsatz. Aufgrund anatomischer Begebenheiten ist diese bei Hund und Katze jedoch lediglich im Unterkieferbackenzahnbereich möglich ( ▶ Abb. 2.55). Hierbei befinden sich aufzunehmender Zahn und Röntgenfilm parallel zueinander, der Zentralstrahl des Röntgengerätes trifft senkrecht auf beide Ebenen. Eine isometrische Darstellung ist damit gewährleistet. Alle anderen Mundhöhlenregionen erlauben diese Anordnung nicht. Daher muss auf die Halbwinkeltechnik ausgewichen werden ( ▶ Abb. 2.52, ▶ Abb. 2.53, ▶ Abb. 2.54). Hierbei wird der Zentralstrahl senkrecht auf die Winkelhalbierende zwischen Film- und Objektebene ausgerichtet, um eine isometrische Darstellung zu gewährleisten. Eine normierte Lagerung des Tieres hilft dabei, vorgegebene Werte zur Anwendung des Zentralstrahls anzuwenden.
Abb. 2.52Frontalansicht der Einstellung des Zentralstrahls bei Aufnahme der Oberkieferbackenzähne der Katze. Um eine Überlagerung der Backenzähne zu vermeiden, muss der Zentralstrahl bei der Aufnahme der Oberkieferbackenzähne flacher eingestellt werden. Beim Hund beträgt die Neigung 45°, bei der Katze 30°.
Abb. 2.53Einstellung des Zentralstrahls bei Aufnahme der Oberkieferschneidezähne. Für eine isometrische Darstellung der Zähne wird der Zentralstrahl senkrecht auf die Winkelhalbierende eingestellt.
Abb. 2.54Einstellung des Zentralstrahls bei Aufnahme der Unterkieferfrontzähne. Als Kompromiss erfolgt die graduelle Einstellung im Bereich der Unterkieferfrontzähne, um Incisivi und Canini gemeinsam darstellen zu können.
Abb. 2.55Einstellung des Zentralstrahls bei Aufnahme der Unterkieferbackenzähne. Die Erfassung der Wurzelspitzen im Unterkiefer gelingt mit einer Ventralneigung von bis zu 15°. Grundsätzlich ist die Aufnahme der Unterkieferbackenzähne am einfachsten, da die Anwendung der Rechtwinkeltechnik möglich ist.
Damit bei konventionellen Zahnröntgenaufnahmen auch nachträglich eine Zuordnung anhand des Filmes möglich ist, besitzen diese eine Prägung. Diese Prägung wird bei intraoraler Lagerung immer nach mesial gewandt, dadurch kann nach Unterscheidung von Ober- und Unterkiefer im Röntgenbild jeweils die korrekte Seite zugeordnet werden, da die konvexe Prägung jeweils nach mesial angeordnet werden kann ( ▶ Abb. 2.56).
Abb. 2.56Filmorientierung. Die Filmorientierung ist möglich durch immer gleichartige Anordnung des Filmes bei der Aufnahme. Die auf der zu belichtenden Seite konvexe Prägung sollte immer mesial orientiert werden, was dann auch nachträglich die quadrantenweise Zuordnung erleichtert.
"
Wie sich der Übergang vom Milchzahngebiss zur bleibenden Dentition des Hundes röntgenologisch darstellt, veranschaulichen die folgenden Abbildungen ( ▶ Abb. 2.57, ▶ Abb. 2.58, ▶ Abb. 2.59, ▶ Abb. 2.60, ▶ Abb. 2.61, ▶ Abb. 2.62, ▶ Abb. 2.63, ▶ Abb. 2.64, ▶ Abb. 2.65, ▶ Abb. 2.66, ▶ Abb. 2.67, ▶ Abb. 2.68, ▶ Abb. 2.69, ▶ Abb. 2.70, ▶ Abb. 2.71, ▶ Abb. 2.72).
Abb. 2.57Röntgenaufnahme des rechten Oberkieferreißzahnes beim Hund. Bei orthograder Projektion kommt es bei der Darstellung des Oberkieferreißzahnes häufig zur Überlagerung der mesialen Wurzeln. Um die Wurzeln im Röntgenbild freizustellen, nutzt man das Verfahren der Parallaxe: Durch Mesial- bzw. Distalprojektion werden die Wurzeln in der Bildebene auseinandergezogen. Die Weite der vitalen Pulpa ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich um einen jungen Hund handelt; die Entwicklung ist so weit fortgeschritten, dass ein physiologischer Parodontalspalt als schwarze Linie um die Wurzeln herum nachvollzogen werden kann.
Abb. 2.58Röntgenaufnahme des rechten Oberkiefercaninus beim Hund. In der Entwicklung der Caninuswurzel ist es noch nicht zum Wurzelspitzenschluss gekommen. In diesem Alter ist eine konventionelle Wurzelbehandlung bei Fraktur des Zahnes nicht möglich, da kein apikaler Stopp vorhanden ist und die Wurzelfüllung in den Kieferknochen überpresst würde.
Abb. 2.59Röntgenaufnahme der Oberkieferincisivi beim Hund. Die Wurzelspitze der Oberkieferincisivi befindet sich in der Bildung, der apikale Stopp ist noch fragil. Zwischen den inneren Incisivi präsentiert sich die Symphyse des Oberkiefers. Die Knochengrenze findet sich physiologischerweise knapp unterhalb der Schmelz-Zement-Grenze.
Abb. 2.60Röntgenaufnahme des linken Unterkieferreißzahnes. Direkt unterhalb der Wurzelspitzen des Zahnes zeigt sich der Mandibularkanal als transluzenter Bereich ohne deutliche alveoläre Struktur.
Abb. 2.61Röntgenaufnahme des linken Oberkieferreißzahnes beim erwachsenen Hund. Das gemeinsame Pulpenkavum hat sich mit zunehmendem „innerem“ Wachstum durch die Verbreiterung der Dentinschicht verkleinert.
Abb. 2.62Röntgenaufnahme des linken Oberkieferfangzahnes beim erwachsenen Hund. Die Pulpa ist noch bindfadenstark vorhanden, der Apex ist unauffällig, der Parodontalspalt gleichmäßig. Apikal zeigt sich eine leichte Transluzenz, die sich durch die Art der Projektion sowie das Vorhandensein eines apikalen Delta erklären lässt und physiologischerweise anzutreffen ist; statt über einen Zentralkanal treten die Gefäße und Nerven über ein weitverzweigtes Netz in die Pulpa ein und aus.
Abb. 2.63Röntgenaufnahme der Unterkieferfrontzähne beim jungen Hund. Die Wurzelspitzen sind noch nicht geschlossen, das Pulpenlumen der Canini ist sehr weit.
Abb. 2.64Röntgenaufnahme der Canini beim erwachsenen Hund. Beim erwachsenen Hund präsentieren sich dieselben Zähne (vgl. ▶ Abb. 2.63) mit einem deutlich verkleinerten Pulpalumen und einer geschlossenen Wurzelspitze. Der umlaufende Parodontalspalt ist unauffällig.
Abb. 2.65Röntgenaufnahme der rechten Oberkieferbackenzähne im Wechselgebiss beim Hund. Die Darstellung eines vollständigen Gebisses beim Hund erfolgt etwa um den 90. Lebenstag. Die kaudalen Backenzähne sind zu diesem Zeitpunkt in ihrer Entwicklung noch nicht weit, die Mineralisation der Krone lässt sich gerade erkennen (in diesem Bild als Ausschnitt vom Kontrast angehoben).
Abb. 2.66Röntgenaufnahme des rechten Oberkieferbackenzahnes im Wechselgebiss beim Hund. Die Milchzahnvorläufer sind am Alveolarkamm noch zu erkennen, die Krone des permanenten Reißzahnes ist in der Entwicklung.
Abb. 2.67Röntgenaufnahme der rechten Oberkieferprämolaren und des -caninus. Um die Keime der Prämolaren zeigt sich während der Entwicklung ein deutlicher, transluzenter Raum. Die Kronenspitze des Caninus liegt ebenso nah zur Vorläuferwurzel wie die Prämolarenspitzen zu ihrem Vorläufer. Der erste Prämolar weist physiologischerweise keinen Vorläufer auf.
Abb. 2.68Röntgenaufnahme der Oberkieferincisivi. Die Oberkieferincisivi liegen dichtgedrängt unterhalb der Milchincisivi. Erst mit Wachstum des Kiefers und weiterem Durchbruch kann sich der eigentliche Zahnbogen ausformen.
Abb. 2.69Röntgenaufnahme der Unterkieferfrontzähne. Aufgrund der anatomischen Enge muss auch im Zahnröntgenbild genau gezählt werden, um die korrekte Zahnzahl bestätigen zu können.
Abb. 2.70Röntgenaufnahme der rechten Unterkieferprämolaren. Die bleibenden Nachfolger liegen zwischen den weit gespreizten Wurzeln ihrer Vorläufer. Der erste Prämolar ist in der Entwicklung bereits weiter und besitzt keinen Milchzahnvorläufer.
Abb. 2.71Röntgenaufnahme vom rechten Unterkieferreißzahn. Es handelt sich um den ersten Zuwachszahn der Zahnreihe; dieser besitzt keinen Milchzahnvorläufer, da er aus einer distalen Verlängerung der Zahnleiste entsteht.
Abb. 2.72Röntgenaufnahme vom letzten rechten Unterkiefermolaren. Der als letztes entwickelte dritte Molar ist lediglich anhand seiner bereits existenten Kronenspitze zu diesem Zeitpunkt nachweisbar.
Wie sich die einzelnen Zähne der Katze röntgenologisch darstellen, zeigen die folgenden Abbildungen ( ▶ Abb. 2.73, ▶ Abb. 2.74, ▶ Abb. 2.75, ▶ Abb. 2.76).
Abb. 2.73Röntgenaufnahme der rechten Oberkieferbackenzähne bei der Katze. Aufgrund der engen Beziehung der Backenzähne zum Jochbogen wird eine flachere Einstellung des Zentralstrahls genutzt, um die Zähne weitestgehend überlagerungsfrei darstellen zu können.
Abb. 2.74Röntgenaufnahme vom rechten Oberkiefercaninus und der Incisivi bei der Katze. Durch eine leicht von lateral kommende Einstellung lassen sich auf einer Aufnahme der Caninus und die Incisivi darstellen. Wird die linke Seite analog aufgenommen, ist oft keine separate Aufnahme der Incisivi mehr vonnöten.
Abb. 2.75Röntgenaufnahme der linken Unterkieferbackenzähne bei der jungen Katze. Die Backenzähne sind mittels der Rechtwinkeltechnik sehr gut darstellbar, die weite Pulpa weist wieder auf das Alter der Katze hin. Findet sich eine weite Pulpa bei einem maturen Tier, ist davon auszugehen, dass der Zahn avital und behandlungsbedürftig ist.
Abb. 2.76Röntgenaufnahme der Unterkieferfrontzähne bei der Katze. Die Unterkiefersymphyse der Katze zeigt physiologischerweise einen deutlichen, irregulären transluzenten Bereich in der Verbindung der beiden Unterkieferkörper.
2.5 Sondierung Zähne
Die Sondierung stellt die Ergänzung zur Adspektion der Mundhöhle dar. Zum Aufspüren subtiler Strukturveränderungen an der Krone ist eine spitze zahnärztliche Sonde sehr hilfreich ( ▶ Abb. 2.77, ▶ Abb. 2.78, ▶ Abb. 2.79). Im Gegensatz zum supragingivalen Einsatz der zahnärztlichen Sonde wird die parodontale Sonde – nomen est omen – im subgingivalen Bereich eingesetzt. Sie dient dazu, den gingivalen Sulkus zwischen Zahn und Zahnfleisch auszumessen. Eine Parodontalsonde ist graduiert ( ▶ Abb. 2.80) und erlaubt das direkte Ablesen der Taschentiefe, die sich bei fortschreitendem parodontalem Geschehen vergrößert. Bei der Vielzahl der Sondenformen ist eine gute Ablesbarkeit der Taschentiefe ein wichtiges Kriterium ( ▶ Abb. 2.81). Die Einzelmessungen werden festgehalten und erlauben in der Gesamtsicht eine Beurteilung der parodontalen Gesundheit. Zusätzlich fallen durch die Sondierung einzelne, der Adspektion häufig entgangene vertikale Knochentaschen auf, die bei fehlendem Entzündungscharakter sonst übersehen werden könnten.
Abb. 2.77Zahnärztliche Sonde. Die zahnärztliche Sonde besitzt eine scharfe Spitze zur Detektion von Irregularitäten an der Zahnsubstanz.
Abb. 2.78Zahnärztliche Sonde IM3. IM3 bietet ein Kombiinstrument mit zahnärztlicher und parodontaler Sonde. Mit der spitzen zahnärztlichen Sonde können Defekte im Bereich der Krone erfasst werden, wie z.B. Fissurlinien, eine feine Eröffnung der Pulpa oder resorptive Defekte.
Abb. 2.79Zahnfrakturdiagnostik mit zahnärztlicher Sonde. Die bukkale Frakturlamelle des unteren Reißzahnes kann mittels der zahnärztlichen Sonde bewegt werden.
Abb. 2.80Parodontale Sonde. Die parodontale Sonde besitzt eine Graduierung, welche die Ausmessung des Zahnsulkus respektive der Zahnfleischtasche erlaubt. Pathologische Befunde können dem jeweiligen Zahn auf dem Zahnschema flächenspezifisch zugeordnet werden.
Abb. 2.81Parodontalsonde IM3. Am gegenüberliegenden Ende des IM3-Sondierungsinstruments findet sich eine parodontale Sonde. Die Millimetereinteilung mit farblicher Abgrenzung bei 5, 10 und 15 mm erlaubt ein leichtes Ablesen der Taschentiefe. Aufgrund der Millimeterabstände können auch die Taschentiefen bei der Katze sinnvoll erfasst werden.
Der Einsatz einer Parodontalsonde muss erlernt werden, um ein Gefühl für die richtige Handhabung zu entwickeln und tatsächliche Taschentiefen erheben zu können ( ▶ Abb. 2.82). Am wachen Tier kann das tiefe Eindringen der Parodontalsonde in das geschädigte Parodont helfen, um den Besitzer von der Behandlungsbedürftigkeit seines Tieres zu überzeugen ( ▶ Abb. 2.83). Interessant wird es immer dann, wenn durch die Schädigung des Parodonts andere Strukturen des Schädels miteinbezogen werden, wie z.B. die Nasenhöhle ( ▶ Abb. 2.84, ▶ Abb. 2.85).
Abb. 2.82Sonde am Sulkus. Die Zahnsonde wird mit der stumpfen Spitze zwischen Zahn und Zahnfleischrand angesetzt.
Abb. 2.83Sonde im Sulkus. Die Sonde ist drucklos in die pathogene parodontale Tasche des ersten Molaren am Hund eingeführt worden. Aufgrund der Schädigung des knöchernen Parodontalapparats kann die Sonde über die physiologische Tiefe von 2 mm in die Tiefe eingeführt werden.
Abb. 2.84Sonde an parodontaler Tasche. Die abgerundete Spitze befindet sich am freien Rand der marginalen palatinalen Gingiva des Oberkiefercaninus.
Abb. 2.85Sonde in parodontaler Tasche. Die parodontale Sonde ist palatinal bis zur Biegung eingeführt. Dies ist nur möglich, wenn ein massiver knöcherner Defekt vorliegt. In dieser parodontalen Tasche sind die Haltefasern zerstört, es ist zum Abbau des umgebenden Alveolarknochens gekommen. Häufig findet sich aufgrund der anatomischen Nähe eine Eröffnung der Nasenhöhle; bei Sondierung kann dann oftmals eine nasale Blutung der betroffenen Seite ausgelöst werden.
Neben dem originären vertikalen Einsatz einer Parodontalsonde im Sulkus kann diese auch dazu genutzt werden, die weit koronal gelegene Wurzelfurkation zu ertasten ( ▶ Abb. 2.86).
Abb. 2.86Sondierung der Wurzelfurkation mittels parodontaler Sonde. Horizontal eingeführte parodontale Sonde an einem Oberkieferprämolaren links beim Hund. Aufgrund des knöchernen Abbaus im Bereich der Furkation penetriert die Sonde vollständig und erscheint palatinal wieder.
Ist selbst die spitze zahnärztliche Sonde zu dick, um eine Eröffnung der Pulpa zu ertasten, bietet sich die Nutzung noch feinerer Instrumente an ( ▶ Abb. 2.87).
Abb. 2.87Endodontische Nadel als Sonde.Statt einer zahnärztlichen Sonde wird ein endodontisches Instrument zum Auffinden einer pulpalen Beteiligung genutzt. Mithilfe eines extrem feinen und rigiden sog. Pathfinders wird die Eröffnung der Pulpa verifiziert, da sie mit einer zahnärztlichen Sonde nicht auffindbar war.