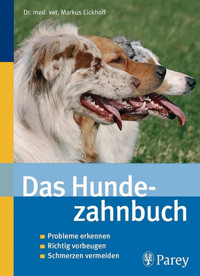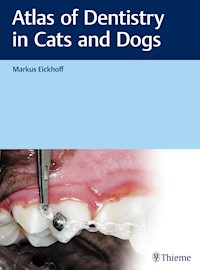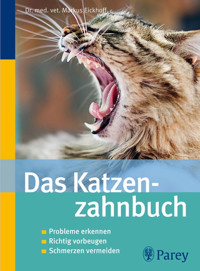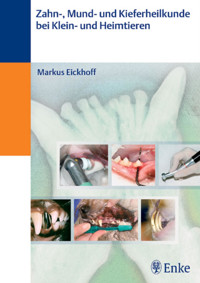
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Enke
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Endlich ein Praxisbuch zur Zahnheilkunde bei Klein- und Heimtieren. Für jede Problemstellung erhalten Sie Schritt für Schritt das Wissen für Ihre Diagnose, Therapie und dazu wichtige Entscheidungshilfen. Parallel dazu profitieren Sie von Hintergrundinformationen, die Sie dabei unterstützen, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen. Aufschlussreiche Bildreihen erklären Ihnen die Arbeitsabläufe. Aus dem Inhalt: - Zahnmedizinischer Untersuchungsgang - Dentales Röntgen - Zahnschmerz erkennen - Besitzer motivieren - Dentale Prophylaxe - Das erkrankte Parodont - Zahn- und Kieferfrakturen - Extrakapitel zu Heimtieren - Extrakapitel zu Jungtieren - Einsatz der Instrumente und Füllmaterialien - Tumoren und andere Erkrankungen des Mundraums
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde bei Klein- und Heimtieren
Markus Eickhoff
344 Abbildungen in 519 Einzeldarstellungen
Vorwort
Die tiermedizinische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist ein sich sehr schnell entwickelndes Feld. Die im Zeitraffer erlangten Fortschritte, auch durch Rückgriff auf humanzahnmedizinische Kenntnisse, brachten viele Vorteile. Ein Nachteil ist jedoch, dass der „Tierzahnarzt“ nun vor der nicht geringen Aufgabe steht, die Kenntnisse aller Zweige der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde für verschiedene Tierarten in sich vereinen und umsetzen zu müssen. So ist er gleichzeitig praktischer Zahnarzt, Parodontologe, Stomatologe, Kieferorthopäde, Kieferchirurg und Endodontologe.
Dieses Buch ermöglicht dem Leser, Erkrankungen der Zähne, Mundhöhle und Kiefer zu erkennen, zu bewerten und den Tierhalter bezüglich der Notwendigkeit und der Optionen einer Behandlung umfassend zu beraten. Die therapeutischen Maßnahmen werden praxisorientiert dargestellt; ob der Praktiker sie jedoch selbst durchführen kann und will, orientiert sich an der Bereitschaft, sich intensiv in der Thematik fortzubilden, der Ausstattung der jeweiligen Praxis, den Bedürfnissen des Tieres und den Ansprüchen des Tierhalters. Aufgrund der Weite des zahnmedizinischen Feldes ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Haustierärzten und Spezialisten anzustreben. Auch diese Kooperation wird durch dieses Buch gestärkt, da dem Haustierarzt damit eine gute Entscheidungsgrundlage gegeben ist, für die Abwägung zwischen Ausbau und Anwendung eigener Fähigkeiten und der Überweisung.
Ein Buch zu schreiben ist immer auch ein Gemeinschaftswerk. An erster Stelle danke ich daher meiner Frau Sandra, die nicht nur mitgefühlt, sondern als Tierärztin aktiv mitgearbeitet hat. Unterstützt wurden wir dabei von unserem Hund Sammy, der uns seit einem Jahrzehnt immer wieder zeigt, dass Zufriedenheit und regelmäßiges Fressen im Rudel das Wichtigste ist.
Auch danke ich meinen Eltern, dass sie trotz interpretationsbedürftiger beruflicher Entscheidungen mit doppeltem, zahnmedizinischem und tiermedizinischem Abschluss nicht an ihrer Erziehung oder an mir gezweifelt haben.
Zum Gelingen des Buches beigetragen hat auch meine gute Freundin Dr. Ulrike Marquart mit Bildmaterial, fachlichen Gesprächen und lustigen Abenden. Unterstützung habe ich ebenso erhalten durch Dr. Frank Seeliger, der als Berater in histopathologischen Fragen zur Seite stand sowie durch meinen lieben Kollegen Dr. Olivier Gauthier, der mir hervorragendes Bildmaterial zur Verfügung stellte.
Ganz besonderer Dank gilt meiner Redakteurin Frau Heike Listmann sowie meiner Projektmanagerin Frau Sigrid Unterberg für die intensive Zusammenarbeit bei der Erstellung unseres Buches. Weiterhin danke ich allen weiteren Mitarbeitern des Enke Verlages, die an der Umsetzung dieses Buches beteiligt waren.
Dank gilt natürlich nicht zuletzt meiner Förderin Frau Dr. Ulrike Arnold, die dieses Buch initiierte. Die gemeinsame Zusammenarbeit geht über dieses Buch hinaus, da die Vermittlung von Erkenntnissen in der Tierzahnheilkunde nicht bei einem Buch stehen bleibt, sondern in praktischen Seminaren und Fachbeiträgen in der Zeitschrift kleintier konkret fortgeführt wird.
Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit allen zuvor genannten dazu geführt hat, dem Leser ein interessantes und hilfreiches Buch zur Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde bei Klein- und Heimtieren zur Seite zu stellen.
Esslingen im Januar 2005
Markus Eickhoff
Inhalt
Vorwort
1 Der gesunde Zahn in der gesunden Mundhöhle
1.1 Entwicklung und Aufbau der Zahnhartsubstanz
Stadien der Zahnkeimentwicklung
Milch-, Ersatz- und Zuwachszähne
Entstehung der Zahnhartsubstanzen
Wurzelbildung und Zahndurchbruch
1.2 Pulpa
Form der Pulpa
Struktur der Pulpa
Apikales Delta
1.3 Parodont
Gingiva
Wurzelzement
Alveolarknochen
Parodontalspalt und Desmodont
1.4 Zahncharakteristika und -benennung
1.5 Kieferknochen
1.6 Mundhöhlenschleimhaut
1.7 Lymphatischer Rachenring
1.8 Kopflymphknoten
1.9 Speicheldrüsen
2 Tierzahnmedizinischer Untersuchungsgang
2.1 Anamnese
Haltungsbedingungen
Verhalten des Tieres
Vorausgegangene Erkrankungen
Derzeitige Erkrankung
2.2 Allgemeine Untersuchung
2.3 Extraorale Untersuchung
2.4 Intraorale Untersuchung
3 Dentales Röntgen
3.1 Dentales Röntgengerät
3.2 Konventionelle und digitale Aufnahmemedien
Dentale Röntgenfilme
Digitale Röntgensensoren
Fotostimulierbare Phosphorplatten
3.3 Bildqualität
3.4 Vor- und Nachteile des digitalen dentalen Röntgens
Faktor Zeit
Faktor Bildoptimierung
Faktor Strahlenbelastung
Faktor Datenübermittlung
Faktor Kosten
Faktor Bildfehler
Faktor sensitive Fläche
3.5 Film- bzw. Sensorlagerung in der Mundhöhle
3.6 Lagerung des Patienten
3.7 Projektionsgeometrie
3.8 Expositionsdosis
3.9 Filmentwicklung
3.10 Röntgenbildinterpretation
Dentales Röntgen: Der gesunde Zahn
Dentales Röntgen: Der erkrankte Zahn
3.11 Röntgenbildarchivierung
4 Anästhesie und Analgesie
4.1 Allgemeinanästhesie
4.2 Perioperatives Schmerzmanagement
4.3 Lokalanästhesie
Lokalanästhetika
Infiltrationsanästhesie
Leitungsanästhesie
Intraligamentäre Anästhesie
5 Das junge Tier
5.1 Fehlende und überzählige Zähne
Zu wenig Zähne
Zu viele Zähne
5.2 Missgestaltete Zähne
Wann ist die Versorgung von Zahndysplasien notwendig?
5.3 Zahnfrakturen beim Jungtier
Stellen abgebrochene Milchzähne ein Problem dar?
Wie behandele ich die Fraktur eines immaturen bleibenden Zahnes?
5.4 Parodontitis beim Jungtier
Lohnt sich zahnhygienische Prophylaxe schon beim Jungtier?
5.5 Fehlerhafte Zahnstellungen
Einbiss der Unterkiefercanini am Gaumen
Frontaler Kreuzbiss
5.6 Lippen-, Kiefer-, Gaumen-Spalten
5.7 Craniomandibuläre Osteopathie (CMO)
5.8 Papillomatose
6 Der frakturierte Zahn
6.1 Wie diagnostiziere ich eine Zahnfraktur?
6.2 Was ist von einer „wahren“ Zahnfraktur zu unterscheiden?
6.3 Die unkomplizierte Kronenfraktur
Versiegelung von Dentinwunden
6.4 Die Fraktur mit durchscheinender Pulpa
Indirekte Überkappung
6.5 Die iatrogene Eröffnung der Pulpa
Direkte Überkappung
6.6 Die komplizierte Kronenfraktur bei abgeschlossenem Wurzelwachstum
Wodurch entsteht eine Pulpitis?
Wie entsteht eine Pulpitis?
Wurzelbehandlung
6.7 Der nicht beherrschbare apikale Prozess
Wurzelspitzenresektion
6.8 Die komplizierte Kronenfraktur bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum
Frische Fraktur mit vitaler Pulpa
Alte Fraktur mit entzündeter oder avitaler Pulpa
6.9 Die Milchzahnfraktur
6.10 Füllungstherapie
Wie präpariere ich eine Kavität?
Unterfüllungsmaterialien
Verfahren zur adhäsiven Füllungsverankerung
Die Amalgamfüllung
Die Kompositfüllung
Die Glasionomerzementfüllung
Die Kompomerfüllung
Die Ormocerfüllung
6.11 Die Wurzelfraktur
6.12 Der luxierte Zahn
7 Das erkrankte Parodont
7.1 Unter welchen Vorraussetzungen entsteht eine Parodontitis?
7.2 Wie entsteht eine Parodontitis?
Aufbau des epithelialen Attachments
Zerstörung des epithelialen Attachments
Körpereigene Abwehrmechanismen im Parodont
Zerstörung des desmodontalen Attachments
7.3 Wie erkenne ich eine parodontale Erkrankung?
Diagnostika
Befunde im Rahmen parodontaler Erkrankungen
Parodontales Staging
7.4 Vielfalt parodontaler Erkrankungen
Chronische Parodontitis
Aggressive Parodontitiden
Nekrotisierende Parodontitis
Prognose einer Parodontitis
7.5 Behandlung einer Parodontitis
Wie gestaltet sich eine konservative Parodontalbehandlung?
Wie gestaltet sich eine chirurgische Parodontalbehandlung?
Parodontaler Splint
Pharmakologische Parodontaltherapie
Immunmodulation
7.6 Fazit Parodontalbehandlung
8 Dentale Prophylaxe
8.1 Zähneputzen
8.2 Zahnwachs
8.3 Futtermittel mit Zahnpflegeeffekt
8.4 Spezielle Zahnpflegeprodukte
8.5 Veterinary Oral Health Council
8.6 Fazit
9 Die Zahnextraktion und ihre Komplikationen
9.1 Wann muss ein Zahn extrahiert werden?
9.2 Präoperatives Röntgen
9.3 Extraktionsinstrumente und ihre Anwendung
Zahnelevatoren
Zahnluxatoren
Extraktionszangen
9.4 Wie gestaltet sich eine unkomplizierte „geschlossene“ Extraktion?
9.5 Wie gestaltet sich eine komplizierte „offene“ Exktraktion?
9.6 Komplikationen während einer Extraktion
Die Wurzelfraktur
Die Dislokation der Wurzelspitze
Blutung aus der Alveole
Eröffnung der Nasenhöhle
Die Kieferfraktur
10 Die Kieferfraktur und die Kiefergelenksluxation
10.1 Wie erkenne ich eine Kieferfraktur?
10.2 Besonderheiten der Kieferfrakturen
Frakturen der Unterkiefersymphyse
Frakturen des horizontalen Unterkieferastes
Frakturen des vertikalen Unterkieferastes
Frakturen des Gelenkfortsatzes
Frakturen des Oberkiefers
Ausbruchsfraktur
Pathologische Fraktur
10.3 Implantatentfernung
10.4 Zähne im Frakturspalt
10.5 Kiefergelenksluxation
11 Maligne orale Tumoren
11.1 Wie entsteht ein maligner Tumor?
11.2 Welche Tumoren sind in der Mundhöhle am häufigsten anzutreffen?
Malignes Melanom
Plattenepithelkarzinom
Fibrosarkom
11.3 Wie diagnostiziere ich maligne orale Tumoren?
Anamnese und Klinik
Röntgenaufnahmen
Gewebeuntersuchung
11.4 Prognostische Bewertung maligner Mundhöhlentumoren
11.5 Welche Therapieformen sind bei Mundhöhlentumoren sinnvoll?
Das vollständige chirurgische Entfernen des Tumors
Das chirurgische Reduzieren der Tumormasse
Die chemotherapeutische Bekämpfung des Tumors
Die strahlentherapeutische Bekämpfung des Tumors
Neue Ansätze in der Tumortherapie
11.6 Fazit
12 Erkrankungen der Speicheldrüsen
12.1 Speicheldrüsentumoren
12.2 Entzündungen der Speicheldrüsen
12.3 Speichelzysten
12.4 Speichelsteine
12.5 Speicheldrüseninfarkt
13 Hund Spezial
13.1 Karies
Wie entwickelt sich eine Karies?
Wie diagnostiziere ich eine Karies?
Wie versorge ich einen kariösen Zahn?
Prophylaxemaßnahmen
Fazit
13.2 Kronenersatz
Die Präparation einer Vollgusskrone
Die Abformung
Die Kieferrelationsbestimmung
Die Herstellung der Krone im Dentallabor
Die Einprobe und das Zementieren der Krone
13.3 Odontogene Umfangsvermehrungen und die Gingivahyperplasie
Die fibromatöse Epulis oder das periphere odontogene Fibrom
Die akanthomatöse Epulis oder das akanthomatöse Ameloblastom
Die Gingivahyperplasie
Das zusammengesetzte Odontom
13.4 Kaumuskelmyositis
Symptomatik
Diagnostik
Therapie
Prognose
14 Katze Spezial
14.1 Feline odontoklastische resorptive Läsionen (FORL)
Vorkommen
Pathogenese
Ätiologie
Klinisches Bild
Diagnostik
Behandlung
14.2 Eosinophiler Granulomkomplex
Ursachen
Befunde
Diagnose und Behandlung
14.3 Feline chronische Gingivo-Stomatitis
Ursachen
Befunde
Diagnose und Behandlung
15 Heimtiere
15.1 Was weist auf Zahnerkrankungen bei Heimtieren hin?
15.2 Wie gestaltet sich eine gründliche intraorale Untersuchung bei Heimtieren?
15.3 Hypsodonte Zähne
15.4 Anatomische Besonderheiten bei Heimtierspezies
Das Frettchen
Die Ratte
Das Kaninchen
Das Meerschweinchen
Das Chinchilla
15.5 Problematiken hypsodonter Zähne und ihre Behandlung
Missverhältnis von Zahnproduktion und -abnutzung
Zahntraumata
Zahnabszesse
Parodontales Geschehen
Karies
15.6 Fazit
16 Qualitätsmanagement
16.1 Rahmenbedingungen
16.2 Hygiene
16.3 Tierhalter-Compliance
Abbildungsnachweis
Sachregister
1 Der gesunde Zahn in der gesunden Mundhöhle
Vor der Beurteilung einer Erkrankung steht das Wissen um die Gesundheit. „Alles in Ordnung“ kann dem Tierhalter erst dann mitgeteilt werden, wenn sich in der Mundhöhle keine Anzeichen für schadhafte Prozesse ergeben. Die Beurteilung von Entzündungszeichen der Mundschleimhäute ist dabei häufig einfacher als die Beurteilung der Integrität der Zähne, da diese morphologisch wie funktionell Besonderheiten des Körpers darstellen. Anhand der Zahnentwicklung lässt sich der Aufbau der Zähne am besten nachvollziehen.
1.1 Entwicklung und Aufbau der Zahnhartsubstanz
Beginn der Zahnentwicklung
23. Tag: Anlage von Ober- und Unterkiefer25. Tag: Anlage der ZahnleisteDurch welchen induktiven Prozess beginnt das Epithel des Stomodeums zu proliferieren und sich als Zahnleiste in tiefere Gewebeschichten abzusenken? Mesenchymale Strukturen des Rumpfes gehen normalerweise aus den Somiten des Mesoderms hervor. Im Kopfbereich jedoch wird das mesenchymale Ursprungsmaterial aus einem Mix der vier kranialen Somiten (Mesoderm) und Zellen der Neuralleiste (Ektoderm) rekrutiert, man spricht daher auch von Kopfmesektoderm. Seine prospektive Bedeutung hinsichtlich der Zahnentwicklung scheint determiniert, denn mesektodermale Zellen machen sich baldigst auf ihren Weg in Richtung erster Kiemenbogen (▶Abb. 1.1).
Dort angelangt, geben sie Signale an das Epithel der primitiven Mundbucht ab, welches lokal mit einer Verdickung reagiert, die als odontogenes Epithel bezeichnet wird. Diese Transformation zeigt sich in einem Wechsel von kuboiden Zellen hin zu säulenförmigen Zellen. Das odontogene Epithel, welches der oben genannten Zahnleiste entspricht, senkt sich in Richtung der mesektodermalen Zellen ab, oder genauer betrachtet, es kommt lediglich zu einem relativen Absenken der Epithelverdickung aufgrund des Höhenwachstums der umgebenden, sich entwickelnden Kiefer (▶Abb. 1.2).
Auch unter den mesektodermalen Signalgebern selbst, die in der Tiefe des Bindegewebes liegen, kommt es unter Einfluss des odontogenen Epithels zu weiterer Zelldifferenzierung. Die aus ihnen entstehenden mesenchymalen Dentinbildner (Odontoblasten) und Zementbildner (Zementoblasten) werden dem Ursprung nach der kranialen Neuralleiste zugerechnet, daher spricht man von subepithelialem Ektomesenchym.
▶Abb. 1.1 Einwanderung mesektodermaler Zellen (orange-blauer Pfeil) in die Umgebung der Mundbucht (schwarze Pfeile). Die Mundbucht entsteht als Einstülpung des Ektoderms (blau), die Anschluss an den aus dem Endoderm (grün) entstehenden Magen-Darm-Trakt findet.
▶Abb. 1.2 Entstehung der Zahnleisten als Epithelverdickung des Mundhöhlenepithels.
▶Abb. 1.3 Entstehung der Zahnkeime über Knospen-, Kappen- und Glockenstadium (von links nach rechts). Die Ersatzzähne entstehen in der Ersatzzahnleiste, einem Ableger der generellen Zahnleiste (Abb. nach Boenig/Bertolini 1971).
Das Aufeinandertreffen von odontogenem Epithel und ektomesenchymalen Bindegewebszellen führt zu gegenseitigen Induktionsprozessen, welche eine weitere Ausdifferenzierung der Zellen und letztendlich die Produktion von verschiedenen Zahnhartsubstanzen in geordneter Schichtung erlauben.
Stadien der Zahnkeimentwicklung
Vor der Entstehung der Zahnhartsubstanzen entwickelt sich über drei aufeinander folgende Stadien der so genannte Zahnkeim (▶Abb. 1.3).
Es entstehen zunächst knospenartige Epithelverdickungen am freien Rand der abgesenkten Epithelleiste, man spricht vom Knospenstadium der Zahnentwicklung. Zunächst knospen Milchzähne (Dentes decidui), später in der Entwicklung in der gleichen Art und Weise die bleibenden Zähne (Dentes permanentes).
Über ein Kappenstadium mit konkaver Einstülpung der epithelialen Knospe werden mesektodermale Zellen als so genannte Zahnpapille integriert. Im Glockenstadium ist die Form der Zahnkrone bereits ersichtlich. Die Glocke beherbergt in einer Einstülpung die Zahnpapille mit den Odontoblasten. Sie ist gleichzeitig eingebettet in mesenchymales Bindegewebe, welches als so genanntes Zahnsäckchen fungiert. Aus ihm gehen die Zementoblasten hervor.
Zwischen den Epithelzellen, der um die Zahnpapille befindlichen Epithelstränge, bildet sich ein Spalt aus. Die äußere Lage wird zum äußeren Schmelzepithel, die innere Lage zum inneren Schmelzepithel. Das innere Schmelzepithel veranlasst die Differenzierung der äußersten ektomesenchymalen Zellschicht der Zahnpapille zu Odontoblasten, den Dentinbildnern. Diese wiederum induzieren die Entwicklung von hochzylindrischen Ameloblasten im inneren Schmelzepithel, den Schmelzbildnern.
Dem inneren Schmelzepithel liegt spaltseitig das so genannte Stratum intermedium auf, welches im Rahmen der gingivalen Anheftung an den Zahn von Bedeutung sein wird.
Der epitheliale Spalt vergrößert sich und bildet das so genannte Schmelzretikulum, aus welchem die Ameloblasten Substanzen für die Schmelzbildung gewinnen (▶Abb. 1.4).
Milch-, Ersatz- und Zuwachszähne
Die Verbindung des odontogenen Epithels zum Mundhöhlenepithel geht mit der Zeit verloren, es wird fortan als generelle Zahnleiste bezeichnet. Die Milchzähne (Dentes decidui) entstehen in der generellen Zahnleiste. Lingual bzw. palatinal kommt es zur Ausbildung eines Ablegers der generellen Zahnleiste, der Ersatzzahnleiste. In der Ersatzzahnleiste entwickeln sich die Ersatzzähne(Dentes permanentes), also bleibende Zähne, die einen Milchzahnvorläufer aufweisen. Die Entwicklung der bleibenden Ersatzzähne verläuft analog zur Entstehung der Milchzähne, nur zeitversetzt und ortsversetzt nach lingual bzw. palatinal. In einer kaudalen Verlängerung der generellen Zahnleiste entstehen die Zuwachszähne, also bleibende Zähne, die keinen Vorläufer im Milchgebiss haben.
▶Abb. 1.4 Zahnhartsubstanzbildung im histologischen Bild. Von links nach rechts: mesenchymales pulpales Gewebe (1), Odontoblasten (2), Prädentin (3), Dentin (4), Schmelz (5), Ameloblasten (6), Stratum intermedium (7) und Schmelzretikulum (8).
Bis zum vierten Prämolaren gibt es Ersatzzähne, kaudal hiervon Zuwachszähne.
Nach dieser Einteilung stellt sich die Frage, warum es im bleibenden Gebiss vier Ersatzzahn-Prämolaren gibt, obwohl nur drei Milchzahnvorläufer vorausgingen.
Die Antwort ist, dass für den ersten Prämolaren kein Milchzahn mehr ausgebildet wird, weil sich die Zahnzahl im Laufe der Phylogenese immer weiter reduziert hat.
Entstehung der Zahnhartsubstanzen
Beginnend im Glockenstadium laufen im Zahnkeim zwischen Ameloblasten und Odontoblasten gegenseitige Induktionsprozesse ab, die um den 55. Tag in der Produktion von Zahnhartsubstanz resultieren. Schmelz wird von Ameloblasten in Richtung der Odontoblasten produziert, Dentin von Odontoblasten in Richtung der Ameloblasten. Mit fortschreitender Zahnhartsubstanzproduktion entfernen sich die beiden Zelltypen immer weiter voneinander.
Schmelz
Schmelz ist die härteste Substanz des Körpers und viermal so hart wie Dentin.
Die Schmelzdicke bei Carnivoren ist im Vergleich zu der des Menschen sehr gering und beträgt durchschnittlich <0,1 mm bis 0,6 mm beim Hund bzw. bis 0,3 mm bei der Katze.
Schmelz besteht
zu 95 % aus mineralisierter Substanz (v. a. Hydroxylapatit),
zu 1 % aus organischer Matrix und
zu 4 % aus Wasser
Schmelz wird von Ameloblasten gebildet. Die initial gebildete Schmelzmatrix mineralisiert erst in einem Folgeschritt, in dem sich Apatitkristallite zu Schmelzprismen formieren. Die oberflächliche Schicht des Schmelzes besitzt allerdings keine Prismenstruktur, sondern lediglich ungeordnete Kristallite. Bei Ätzung unbehandelten Schmelzes im Rahmen zahnmedizinischer Behandlungen (▶S. 97) bildet sich daher im Gegensatz zu bearbeitetem Schmelz nur eine unregelmäßige Oberflächenstruktur.
Wachstumslinien des Schmelzes bezeichnet man als Retzius-Streifen, sie sind im histologischen Bild darstellbar und gleichen im Zahnquerschnitt den Wachstumsringen eines Baumes. Es handelt sich um hypomineralisierte Zonen aufgrund eines temporären Ruhezustandes der Ameloblasten. Bei einer Stoffwechselstörung der Ameloblasten ändert sich die Dicke oder auch die Struktur der Retzius-Streifen. Die „physiologische“ Störung zum Zeitpunkt der Geburt wird als Neonatallinie bezeichnet. Sie findet sich an allen Zähnen, die zum Zeitpunkt der Geburt in der Kronenbildung sind, also an den Milchzähnen und an den frühen bleibenden Zähnen. Störungen der Schmelzbildung mit veränderten Retzius-Streifen finden sich z. B. bei Schmelzhypoplasien (s. ▶Kap. 5.2).
Der Schmelz stellt aufgrund seiner Zusammensetzung und Struktur kein Gewebe dar, sondern ein kristallines Gefüge.
Nach Fertigstellung der Zahnkrone reduziert sich das Schmelzepithel, eine weitere Schmelzbildung ist somit ausgeschlossen.
Ende Kalzifikation der Milchzahnkronen ca. 20. Lebenstag
Ende Kalzifikation der Kronen bleibender Zähne ca. 120. Lebenstag
Dem inneren Schmelzepithel und dem Stratum intermedium kommt anfänglich noch weitere Bedeutung zu bei Erstellung primärer Anheftungsmechanismen zwischen Zahn und Zahnfleisch.
Über eine röntgenologische Abklärung ist eine definitive Aussage zur Anlage oder Nichtanlage von Zähnen ab der 12. Lebenswoche möglich, da hier bereits eine Kalzifikation der Kronen sichtbar sein sollte.
Dentin
Dentin ist weicher als Schmelz, jedoch härter als Knochen und stellt insbesondere bei Carnivoren den Hauptteil der Zahnmasse dar.
Dentin besteht
zu 70 % aus mineralisierter Substanz (vor allem Hydroxylapatit),
zu 20 % aus organischer Matrix (über 90 % Kollagen) und
zu 10 % aus Wasser.
Odontoblasten synthetisieren zunächst eine organische Vorstufe aus Kollagen, Glykoproteinen und Glykosaminoglykanen, das Prädentin, welches erst in einem weiteren Schritt mineralisiert.
Die Dentinbildung schreitet bei vitaler Pulpa lebenslang fort.
Deshalb findet sich den Odontoblasten aufgelagert immer eine Schicht aus Prädentin. Weitere Strukturunterschiede der Dentinareale führen zu einer Einteilung in
Manteldentin,
zirkumpulpales Dentin,
inter- und peritubuläres Dentin.
Auf ihrem Rückzug Richtung Pulpa hinterlassen die Odontoblasten ihre Fortsätze, die Tomes-Fasern, im Dentin. Diese befinden sich innerhalb von Dentinkanälchen respektive Dentintubuli. Auf sie wird in Kapitel 1.2 noch einmal eingegangen, da sie im Rahmen der Schmerzleitung von Bedeutung sind (▶S. 7).
Nach Zeitpunkt und Anlass der Dentinbildung unterscheidet man Primär-, Sekundär- und Tertiärdentin. Primärdentin wird bis zum Abschluss des Wurzelwachstums gebildet. Sekundärdentin wird als physiologische Dentinbildung im Rahmen des Alterungsprozesses nach Abschluss des Wurzelwachstums angesehen. Tertiärdentin erfolgt als Abwehrleistung auf einen Reiz hin und weist in der Regel Irregularitäten auf. Tertiärdentin kann sogar statt von Odontoblasten von pluripotenten Zellen der Pulpa produziert werden.
Wachstumslinien des Dentins werden als Ebnersche Linien bezeichnet und entstehen während eines Ruhezustandes der Odontoblasten. Sie stellen das Pendant zu den Retzius-Streifen des Schmelzes dar.
Wurzelbildung und Zahndurchbruch
Die Wurzelbildung beginnt, indem sich eine apikale Scheide aus aufeinander liegendem inneren und äußeren Schmelzepithel verlängert, es entsteht die so genannte Hertwigsche Wurzelscheide. Sie gibt die Form der Wurzeln vor und regt die Odontoblasten zur Bildung von Wurzeldentin an. Wird die Wurzelscheide im Entwicklungsprozess löchrig, bekommen Dentin und ektomesenchymale Zellen des Zahnsäckchens Kontakt. Letztere differenzieren sich daraufhin zu Zementoblasten (Zementbildnern), die dem Wurzeldentin Zement auflagern.
▶Abb. 1.5 Wechselgebiss der Unterkieferfront des Hundes. Die permanenten Ersatzzähne (rote Pfeile) liegen als Kronenkappen mit weiter Pulpa apikal der Milchzähne.
▶Abb. 1.6 Wechselgebiss im Unterkieferseitenzahnbereich des Hundes. Der permanente Unterkieferreißzahn (a) weist keinen dezidualen Vorläufer auf und bricht kaudal der Milchzähne durch. Der vierte Prämolar des permanenten Gebisses entwickelt sich zwischen den Wurzeln des letzten Milchzahnes (b).
Die Wurzelscheide wird nach der Wurzelbildung vollkommen überflüssig und daher auch aufgelöst. Reste verbleiben als Mallassezische Epithelreste im Bereich des Parodontalspaltes und können evtl. Grundlage sich entwickelnder Zysten sein.
Nach Kontakt von mesenchymalem Bindegewebe mit Dentin beginnt die Entwicklung des parodontalen Apparates mit Ausbildung von Wurzelzement, Parodontalfasern und der Ausformung des Alveolarknochens.
Der Begriff des Zahndurchbruchs beschreibt das Hochwachsen der Zähne bis zu ihrer endgültigen Höhe. Sein Ende wird durch den Schluss der Wurzelspitze gekennzeichnet
Aufgrund des Zahndurchbruchs in die Mundhöhle ist der Alveolarknochen von andauerndem Umbau betroffen. Auch die Entstehung des „okklusalen Pfades“, einer dem Zahndurchbruch voranschreitenden Knochenresorption, scheint determiniert. Der Durchbruch der Zähne wird insbesondere vom Zahnsäckchen gesteuert, der Zahn selber ist hierbei von untergeordneter Bedeutung.
Die Milchzähne brechen bei Hund und Katze in der 3.-6. Lebenswoche durch.
Der bevorstehende Wechsel zu bleibenden Zähnen kündigt sich durch größer werdende Interdentalräume an, die durch das Größenwachstum der Kiefer entstehen. Die permanenten Zähne folgen wie schon die Milchzähne einem vorgegebenen okklusalen Pfad, der Richtung und Ort des Durchbruchs vorgibt.
Inzisivi sowie die ersten Zuwachszähne sind die ersten Vertreter der bleibenden Dentition. Die Canini benötigen aufgrund der langen Krone am längsten zur Einstellung in der physiologischen Höhe, die Wurzelspitze schließt dementsprechend spät.
Beim Zahnwechsel werden die Wurzeln der Milchzähne resorbiert, um einen reibungslosen Ausfall der Milchzähne und einen ungehinderten Durchbruch der bleibenden Zähne zu ermöglichen.
Die bleibenden Zähne brechen zwischen dem 3. und 7. Lebensmonat durch; bei größeren Rassen zeitlich nach vorne, bei kleineren Rassen etwas nach hinten verschoben (▶Abb. 1.5–1.8).
Durchbruchsreihenfolge der Zähne beim Hund 01 → 02 → 03 → 05 → 09 → 04 → 08 → 07 → 06 → 10 → 11
Durchbruchsreihenfolge der Zähne bei der Katze 01 → 02 → 03 → 09 → 04 → 06 → 08 → 07
Die oberen Incisivi brechen vor den unteren Incisivi durch.
Die unteren Canini brechen vor den oberen Canini durch.
▶Abb. 1.7 Wechselgebiss der Unterkieferfront der Katze.
▶Abb. 1.8 Wechselgebiss im Unterkieferseitenzahnbereich der Katze.
1.2 Pulpa
Form der Pulpa
Die Pulpa befindet sich in der Pulpakammer, welche schematisch ein verkleinertes Abbild der Zahnform darstellt. Man unterscheidet die Kronenpulpa mit in die Höcker laufenden Pulpenhörnern von der Wurzelpulpa, welche bis zum Austritt der Pulpa am Wurzelapex reicht (▶Abb. 1.9).
Die Form der Pulpa ist sehr variabel, ebenso wie die Anzahl der Wurzelkanäle pro Wurzel variieren kann.
Grundsätzlich sollte von einem Kanal bei einem einwurzeligen Zahn, von zwei Kanälen bei einem zweiwurzeligen Zahn und von drei Kanälen bei einem dreiwurzeligen Zahn ausgegangen werden. Da jedoch auch Variationen mit mehreren Kanälen innerhalb einer Wurzel vorkommen können, sollte im Röntgenbild sowie bei präparatorischer Darstellung der Wurzelkanaleingänge peinlichst genau auf akzessorische Kanäle geachtet werden.
Mit Abschluss des Wurzelwachstums hat auch die Zahnpulpa ihre Form gefunden, die sich jedoch infolge beständiger, lebenslanger Dentinbildung immer weiter verkleinert (▶Abb. 1.10 a + b).
▶Abb. 1.9 Pulpenanatomie eines Unterkieferreißzahnes. Pulpenhorn (1), Kronenpulpa (2) und Wurzelpulpa (3).
▶Abb. 1.10 a+b Weite des Pulpalumen am Unterkieferreißzahn eines zehn Monate alten (a) und eines zehn Jahre alten (b) Hundes.
Bis zum Alter von zwei Jahren lässt sich anhand der Größe der Pulpa eine recht sichere Altersbestimmung vornehmen.
Struktur der Pulpa
Die Konsistenz der Pulpa ist anfänglich der Whartonschen Sulze der Nabelschnur vergleichbar, nimmt jedoch mit zunehmendem Alter mehr und mehr fibrösen Charakter an. Eingebettet in eine Grundsubstanz aus Glykosaminoglykanen, Proteoglykanen und Glykoproteinen finden sich kollagene, retikuläre und oxytalanartige Fasern sowie Gefäße und Nerven. Neben Fibroblasten, pluripotenten undifferenzierten Mesenchymzellen (Ersatzzellen) und Zellen des Immunsystems gehören auch die Odontoblasten zur Pulpa (▶Abb. 1.11):
Die Odontoblasten bilden die äußerste Schicht der Pulpa und liegen dem Prädentin innen an (▶Abb. 1.4, [2]). Die in den Dentintubuli liegenden Odontoblastenfortsätze (Tomes-Fasern) reichen bis zur Schmelzdentingrenze. Einzelne Fortsätze reichen zwischen die Ameloblasten und verursachen dort Schmelzfehler, so genannte Schmelzspindeln.
Im subodontoblastischen Raum liegt die zellkernarme oder so genannte Weilsche Zone. Darauf folgt die zellkernreiche oder so genannte bipolare Zone, in deren Anschluss findet man die Kernpulpa.
Die zellkernarme Zone ist gekennzeichnet durch Zytoplasmafortsätze der Fibroblasten und Ersatzzellen, dünnwandige Gefäße und Nervenfasern.
In der zellkernreichen Zone findet sich eine hohe Zahl von Fibroblasten sowie undifferenzierten Mesenchymzellen. Die undifferenzierten Mesenchymzellen haben die Funktion von Ersatzzellen, können z. B. geschädigte Odontoblasten ersetzen, wie sie auch die Funktion anderer Abwehr- oder Bindegewebszellen übernehmen können.
▶Abb. 1.11 Schematische Darstellung der Pulpazonen.
▶Abb. 1.12 Schematische Darstellung des apikalen Deltas.
Die Kernpulpa ist vorwiegend durch Fibroblasten sowie kollagene und retikuläre Fasern gekennzeichnet. Zentral verlaufend findet sich eine Vielzahl von Gefäßen, die über den Wurzelapex sowie über akzessorische Kanäle im gesamten Wurzelverlauf in die Pulpa ein- bzw. austreten. Neben ortsständigen Zellen finden sich weiterhin freie Zellen, welche die lokale Abwehr der Pulpa repräsentieren (Makrophagen, Lymphozyten etc.).
Auch die Pulpaperipherie weist eine ausgeprägte vaskuläre Versorgung auf, vor allem gekennzeichnet durch einen Plexus arteriovenöser Anastomosen in der zellkernreichen Zone. Dessen Ausläufer sind im gesamten subodontoblastischen Raum bis zwischen die Odontoblasten zu verfolgen.
Ähnlich verhält es sich mit der nervalen Versorgung, die in der Peripherie zwei Plexus ausbildet. Zum einen den so genannten Raschkowschen Plexus der zellkernreichen Schicht, zum anderen den zwischen den Odontoblasten gelegenen Intraplexus. Neben der vegetativen Gefäßversorgung sind sensible Fasern des Nervus trigeminus vorhanden, die insbesondere im subodontoblastischen Raschkowschen Nervenplexus konzentriert werden.
Apikales Delta
Bei Hund und Katze ist das so genannte apikale Delta deutlich ausgeprägt. Statt eines Hauptkanals findet sich in der Wurzelspitze ein Netz aus vielen ein- und austretenden kleinen Gefäßen (▶Abb. 1.12). Entgegen früherer Annahmen finden sich neben arteriellen und venösen Gefäßen auch blind endende Lymphgefäße in der Pulpa.
Der Übergang der Pulpa in das periapikale Desmodont wird als „Mischgewebe“ bezeichnet. Die Reaktion dieses Bereiches ist der entscheidende Faktor für den Erfolg oder Misserfolg von Wurzelbehandlungen (s. ▶Kap. 6.6).
Zahnschmerz
Neueren Untersuchungen der nervalen Pulpaversorgung zu Folge enden die sensiblen Fasern nicht im Randbereich der Pulpa, sondern erst an der Schmelz-Dentin-Grenze. Sie laufen somit zwischen den Odontoblasten hindurch mit den Tomes-Fasern innerhalb der Dentintubuli.
Bei Vorliegen einer Dentinwunde geht man neben der direkten Ansprechbarkeit sensibler Nervenendigungen zusätzlich von einer Reizleitung über einen hydrodynamischen Mechanismus aus. Eine Dentinliquorbewegung innerhalb der Dentintubuli bei Änderung des Druckes an der Dentinoberfläche (z. B. thermisch bedingte Dimensionsänderungen von Füllungsmaterial oder Luftbewegung) kann zum Ansprechen sensibler pulpaler Rezeptoren führen. Der „Zahnschmerz“ wird afferent zum Ganglion gasseri weitergeleitet, von wo aus über Zwischenstationen letztendlich der sensorische Anteil der Großhirnrinde über erfahrenes Leid informiert wird. Die sensible Versorgung des Zahnes unterscheidet sich bei Mensch, Hund und Katze in ihren strukturellen Komponenten nicht voneinander. Daher sollte von einer gleichartigen Schmerzempfindung ausgegangen werden.
1.3 Parodont
Gingiva
Man unterteilt die Gingiva in freie und befestigte Gingiva.
Die freie Gingiva ist über einen epithelialen Ansatz adhäsiv an den Zähnen verhaftet, man spricht von einem epithelialen Attachment. Der kronenseitige freie Rand wird als Gingivalsaum bezeichnet.
Der Ansatz der befestigten Gingiva am Alveolarknochen erfolgt über kollagene Faserbündel ohne Ausbildung einer Submukosa, wodurch bei manchen Tieren der Eindruck einer getüpfelten Oberfläche hervorgerufen wird.
Die Höhe der Gingiva hat keinen Einfluss auf die Gesundheit des Parodontalapparates.
Eine Gingiva geringer Dicke äußert Entzündungszeichen deutlicher und ist als bevorzugter Entstehungsort von Rezessionen anzusehen.
Das bindegewebige Pendant zum epithelialen Attachment ist das desmodontale Attachment, welches im Abschnitt Parodontalspalt und Desmodont besprochen wird (▶S. 9).
Im Gegensatz zum desmodontalen Attachment muss das epitheliale Attachment schon während des beginnenden Zahndurchbruchs seine Funktion wahrnehmen. Erst durch den schützenden Abschluss des Epithels kann eine ungestörte Bildung des desmodontalen Attachments gewährleistet werden.
Das reduzierte innere Schmelzepithel, bestehend aus Ameloblasten und Stratum intermedium, stellt während des Zahndurchbruchs vorübergehend einen dichten Verschluss von Zahn und Gingiva sicher. Aus dem Stratum intermedium bildet sich in der Folgezeit das Stratum basale des sich entwickelnden Saumepithels, welches fortan für die epitheliale Sicherung des Zahnsulkus verantwortlich ist. Die Zellen des Saumepithels sind relativ uniform, man unterscheidet dennoch Stratum basale und Stratum suprabasale. Im Gegensatz zum gingivalen Epithel zeigen Zellen des Saumepithels keine Keratinisierung.
Das epitheliale Attachment stellt den Locus minoris resistentiae des Verbundes von Zahn zu umgebenden Strukturen dar, dem bei der Entstehung von Erkrankungen des Parodontalapparates besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Wurzelzement
Im Wurzelzement sind die Parodontalfasern zahnseitig verankert, es ist die Basis der Aufhängung des Zahnes in seiner Alveole. Das Wurzelzement bildet sich, wenn Wurzeldentin nach Verlust der epithelialen Wurzelscheide Kontakt zu Zellen des Zahnsäckchens bekommt.
Man unterscheidet azelluläres von zellulärem Zement. Im dünnen azellulären Zement, welches koronalen Anteilen der Wurzel aufgelagert ist, finden sich fast ausschließlich von außen einstrahlende kollagene Faserbündel. Insbesondere ihm kommt eine Haltefunktion zu.
Das zelluläre Wurzelzement weist eine knochenähnliche Struktur auf, es findet sich vor allem auf apikalen und mittleren Anteilen der Wurzel. Neben kollagenen Fasern finden sich hier Zementoblasten und -zyten.
Zement besteht
zu 61 % aus mineralischer Substanz (v. a. Calcium und Phosphor),
zu 27 % aus Kollagen und
zu 12 % aus Wasser.
Zement ist damit von allen Zahnhartsubstanzen dem Knochen am ähnlichsten.
Eine Vaskularisierung des Zementes ist im Gegensatz zum Knochen nicht vorhanden. Das desmodontale Attachment beginnt im gesunden Zahnhalteapparat im Anschluss an die zervikale epitheliale Manschette auf Höhe der Schmelz-Zement-Grenze.
Alveolarknochen
Der Alveolarknochen dient der Verankerung der Zähne und verteilt entstehende Drücke.
▶Abb. 1.13 Schematische Darstellung des Parodonts, welches sich aus Gingiva inkl. Saumepithel (1), Desmodont (2), Wurzelzement (3) und Alveolarknochen (4) zusammensetzt.
Da der Alveolarknochen funktionsabhängig ist, fällt er nach Zahnverlust, also nach Verlust seiner Aufgabe, weitestgehend einer funktionellen Atrophie anheim.
Der Kiefer weist eine geschlossene Kortikalis auf. Eine Ausnahme ist die Oberfläche der Zahnfächer, der Alveolen, die voneinander durch Septa interalveolaria und innerhalb einer Alveole bei Mehrwurzeligkeit durch Septa interradicularia weiter unterteilt sind. Die kortikale Auskleidung der Alveolen ist nicht durchgängig, sondern ähnelt einem Sieb und wird als Lamina cribriformis bezeichnet. Über die Aussparungen der Lamina cribriformis kommunizieren Desmodontalfasern und Gefäße des Parodontalspaltes mit dem Knochenmarksraum, der noch Anteile blutbildenden roten Knochenmarks aufweisen kann. Auf Einzelzahnröntgenaufnahmen zeigt sich die Lamina cribriformis durch Überlagerungseffekte als röntgendichte Linie, welche durchgehend um den Parodontalspalt herum verläuft und im Röntgenbild als Lamina dura angesprochen wird.
In der Parodontaldiagnostik stellt ein beginnender Verlust der Lamina dura ein frühes Symptom eines Parodontalschadens dar.
Die funktionelle Belastung des Alveolarknochens schlägt sich nieder in einer trajektoriellen Ausrichtung der spongiösen Knochenbälkchen.
Parodontalspalt und Desmodont
Der zwischen Wurzelzement und Alveolarknochen befindliche Raum wird als Desmodontalspalt bzw. Parodontalspalt bezeichnet. Die Weite des Parodontalspaltes ist Abbild seiner funktionellen Belastungen. Aufgrund zervikaler und apikaler Weite sowie mittlerer Enge ähnelt er einer Sanduhr. Beim Menschen finden sich Werte von 0,20 mm koronal und apikal sowie 0,15 mm im mittleren Abschnitt. Apikal und koronal führen nichtaxiale Belastungen zu einer größeren Auslenkung als im mittleren Teil, der daher mehr oder weniger als Ruhepol fungiert.
Im Alter kommt es infolge lebenslanger Zementproduktion zu einer weiteren Verengung des Parodontalspaltes.
Das Desmodont, also der parodontale Faserapparat, verbindet das Wurzelzement mit dem Alveolarknochen und ist das bindegewebige Pendant zum epithelialen Attachment. Es wird daher als desmodontales Attachment bezeichnet. Das Desmodont gewährleistet die Aufhängung des Zahnes in seiner Alveole, die so genannte Thekodontie.
Im desmodontalen Raum finden sich bis zu 75 % Fasern und faserbildende Zellen, daneben Gefäße, Nerven, interstitielles Gewebe sowie freie Zellen (Leukozyten, Makrophagen). Sensorische Fasern des Nervus trigeminus vermitteln Schmerz und Druckänderungen.
Die Aufgabe der Kollagenfasern besteht in der Verbindung von Zahn und Alveole, die im Zement inserierenden Anteile der Fasern werden als Sharpeysche Fasern bezeichnet.
Vom Zement wie vom Alveolarknochen wachsen Fasern in der Mitte des Parodontalspaltes aufeinander zu und verbinden sich miteinander. Es entsteht ein Netzwerk, welches den Zahn gegen Zug, Druck und Rotation in der Alveole sichert (▶Abb. 1.14).
Ein vollständig ausgebildetes Parodont liegt erst nach abgeschlossener Einstellung des Zahnes in die Zahnreihe, mit physiologischer Höhe und abgeschlossenem Wurzelwachstum, vor. Zu diesem Zeitpunkt muss die Ausrichtung der Kollagenfasern den lebenslang auftretenden funktionellen Beanspruchungen entsprechen, wohingegen in verschiedenen Phasen des Zahndurchbruchs die Orientierung der Fasern variiert.
Die Parodontalfasern sind nicht verantwortlich für den Zahndurchbruch, denn die vollständige Überbrückung des Parodontalspaltes durch desmodontale Fasern erfolgt erst nach Abschluss des Durchbruchs.
Der Kollagenfaserapparat des Desmodonts zeigt einen sehr hohen Umsatz, so erfolgt die Kollagenbildung im Desmodont zweimal schneller als in der Gingiva und viermal schneller als in der Dermis.
Wird der Kollagenaufbau beeinträchtigt, zeigen sich die Auswirkungen im Parodont entsprechend schneller. Beispiel hierfür ist ein schneller Zahnverlust bei Skorbut.
Oxytalanfasern haben ihren Ursprung zwar im Zement, erreichen jedoch nicht den Alveolarknochen, sondern verlaufen lediglich zementnah parallel zur Zahnachse. Ihre Aufgabe besteht wahrscheinlich in der Kontrolle der Zahnstellung und in der Regulation des Blutflusses.
Die Elastizität des Parodonts ist nicht durch elastische Fasern oder die Dehnbarkeit des kollagenen Anteils bedingt, sondern durch die Nachgiebigkeit aller parodontalen Strukturen mit Verschiebung von Flüssigkeit in Knochenmarksräume, deren Grundlage durch eine hohe Vaskularisierung des Parodontalspaltes gegeben ist.
Der mature Zahn weist eine lückenlose Schmelzkappe auf, einen ausgeprägten Dentinkörper, eine geschlossene Wurzelspitze und einen funktionstüchtigen Parodontalapparat samt umgebendem Kieferknochen (▶Abb. 1.15).
▶Abb. 1.15 Aufbau des Zahns im Kiefer.
Zahnentwicklung im Überblick
23.Entwicklungstag:Anlage von Ober- und Unterkiefer25.Entwicklungstag:Anlage der Zahnleiste55.Entwicklungstag:Beginn Produktion Zahnhartsubstanz20.Lebenstag:Ende Kalzifikation der Milchzahnkronen3.–6.Lebenswoche:Durchbruch der Milchzähne120.Lebenstag:Ende Kalzifikation der Kronen bleibender Zähne3.–7.Lebensmonat:Durchbruch der bleibenden Zähne1.4 Zahncharakteristika und -benennung
Zahnformel Hund
Milchzahngebiss (Dd)
3 1 33 1 33 1 33 1 3permanentes Gebiss (Dp)
2 4 1 33 1 4 23 4 1 33 1 4 3Das vollständige Milchzahngebiss der Katze besteht aus 26 Zähnen, das vollständige permanente Gebiss aus 30 Zähnen.
Zahnformel Katze
Milchzahngebiss (Dd)
3 1 33 1 32 1 33 1 2permanentes Gebiss (Dp)
1 3 1 33 1 3 11 2 1 33 1 2 1Die Angaben zu den Zähnen der Heimtiere finden Sie in ▶Kapitel 15.
Modifiziertes Zahnschema nach Triadan
Die Benennung der einzelnen Zähne erfolgt mittels eines Zahnschemas, welches drei Ziffern nutzt und das nach Triadan modifizierte humanmedizinische Zahnschema der FDI (Fédération Dentaire Internationale) darstellt.
▶Abb. 1.16 a+b Zahnbenennung bei Hund (a) und Katze (b), basierend auf dem nach Triadan modifizierten Zahnschema der FDI. Die erste Ziffer für den Quadranten beginnt im Oberkiefer rechts und wird im Uhrzeigersinn weitergezählt. Beginnend am inneren Incisivus werden die Zähne mit Ziffer 2 und 3 nach distal gezählt.
Die erste Ziffer steht für die Zuordnung zu rechtem oder linkem Ober- bzw. Unterkiefer.
Die zweite und dritte Ziffer sind eine fortlaufende Nummerierung nach distal, beginnend am inneren Inzisivus.
Da im Tierreich häufig mehr als eine einstellige Anzahl von Zähnen pro Quadrant zu finden ist, sind anders als beim Menschen zwei Ziffern notwendig, so z. B. zur Benennung des zweiten oder dritten Molaren beim Hund (▶Abb. 1.16 a+b).
Die scheinbar lückenhafte Benennung im Bereich der Prämolaren der Katze resultiert aus der Festlegung, dass ein vollständiges Gebiss vier Prämolaren beinhaltet.
Die Reduktion der Zahnzahl im Laufe der Evolution hat zu einem Verschwinden der rostralen Prämolaren der Katze geführt. Dieses wird in der fortlaufenden Benennung der Zähne in Form einer Auslassung berücksichtigt, um auch die Zuordnung zu den Vorläufern im dezidualen Gebiss zu gewährleisten. Die detaillierte Spezifizierung des einzelnen Zahnes bietet die Möglichkeit, die erhobenen Befunde oder Behandlungsoptionen selektiv zuzuordnen. Um sich unnötige Schreiberei zu ersparen, bieten sich Befundschemata an, auf welchen die gewünschten Daten kurz und übersichtlich vermerkt werden (▶Abb. 1.17 a+b).
Grundsätzlich lässt sich eine reduzierte Zahnzahl als phylogenetische und damit fortschrittliche Anpassung des Hunde- und Katzengebisses an die Erfordernisse der Ernährung und Haltung interpretieren.
▶Abb. 1.17 a+b Befundbögen für Hund (a) und Katze (b).
Hiervon betroffen sein dürfen jedoch lediglich Zähne, die in das Schema der evolutionären Zahnzahlreduzierung hineinpassen, wie z. B. vordere Prämolaren oder letzte Molaren.
Als schwerer meist genetischer Defekt ist dagegen das Fehlen von Canini, kaudalen Prämolaren, Reißzähnen oder vorderen Molaren anzusehen.
Zahncharakteristika
Die in der Zahnmedizin verwendeten Richtungsbezeichnungen beschreibt ▶Abb. 1.18.
1.5 Kieferknochen
Die zahntragenden Anteile des Oberkiefers setzen sich zusammen aus der paarigen Maxilla (Oberkieferbein) und dem unpaaren Os incisivum (Zwischenkieferbein). Das Dach der Mundhöhle wird vervollständigt durch das keine Zähne tragende paarige Os palatinum (Gaumenbein). Nach komplizierten Umlagerungsprozessen während der Entwicklung werden die Oberkieferknochen über Suturen miteinander verbunden. Werden die Umbauprozesse der Knochen und konsekutiv der bedeckenden Weichteile in ihrer Entwicklung gestört, kann es zur Entstehung von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten (▶S. 59) kommen.
Prominente Gefäße und Nerven treten jeweils über das Foramen infraorbitale auf die Bukkalflächen des Oberkiefers, über das Foramen palatinum major und minor auf die Ventralflächen des Mundhöhlendaches.
▶Abb. 1.18 Bezeichnungen zur Orientierung an Zahn und Kiefer.
Der Unterkiefer besteht allein aus der paarigen Mandibula, deren Äste in der rostralen Unterkiefersymphyse syndesmotisch miteinander verbunden sind. Eine Symphysenfraktur ist somit im eigentlichen Sinne keine Fraktur, sondern eine Symphysensprengung.
Man unterscheidet das horizontale Corpus mandibulae vom vertikalen Ramus mandibulae. Das Corpus mandibulae beherbergt in der Pars alveolaris die Unterkieferzähne und im Canalis mandibularis die versorgenden Gefäß- und Nervenstrukturen, die am Foramen mandibulare ein- und an den Foramina mentalia zum Teil wieder austreten. Der Ramus mandibulae stellt zum einen den Gelenkfortsatz des Unterkiefers, zum anderen Ansatzflächen für die Kaumuskulatur. Der Kieferwinkel der Fleischfresser weist einen ausgeprägten Processus angularis auf.
Der Unterkiefer ist über das Kiefergelenk mit dem Os temporale (Schläfenbein) verbunden. Das Kiefergelenk ist ein inkongruentes Walzengelenk, welches durch einen Discus in eine obere und untere Etage untergliedert wird. Sind beim Hund neben reinen Drehbewegungen auch Gleitbewegungen möglich, so entspricht das Kiefergelenk der Katze eher einem reinen Scharniergelenk. Eine Kaudalbewegung des Unterkiefers wird hier durch einen ausgeprägten Processus retroarticularis verhindert.
1.6 Mundhöhlenschleimhaut
Die Mundhöhlenschleimhaut ist nicht einheitlich gestaltet, sondern weist deutliche funktionelle Anpassungen auf.
Gingiva und Schleimhaut des harten Gaumens sind sehr derb und fest auf dem Periost ihrer knöchernen Unterlage verhaftet, wohingegen die Schleimhaut des Vestibulums oder des Unterzungenraumes locker über eine Submukosa mit dem darunter befindlichen Bindegewebe verbunden ist.
Die Schleimhaut des Zungenrückens weist Besonderheiten in der Oberflächengestaltung auf. Neben verhornten mechanischen Papillae filiformes, welche verlängerte Hornzähnchen darstellen und die Aufnahme von Flüssigkeit oder die Fellreinigung erleichtern, finden sich schwach oder unverhornte gustatorische Papillen, in welchen Geschmacksknospen eingelagert sind. Unter den gustatorischen Papillen unterscheidet man pilzartige Papillae fungiformes, von einem Graben umgebene Papillae vallatae und am kaudalen Zungenseitenrand befindliche blattartige Papillae foliatae.
Perinatal finden sich beim Hund Papillae marginales im vorderen Zungendrittel, die als Saugpapillen das Umschließen der Zitze erleichtern.
Als funktionellen Antagonisten der mechanischen Zungenpapillen weist der harte Gaumen quer verlaufende Rugae palatinae (Gaumenfalten) auf, beim Hund zwischen sechs und zehn, bei der Katze in der Regel sieben bis neun an der Zahl.
Kaudal der inneren Oberkieferincisivi befindet sich die unpaare Papilla incisiva, auf welcher die paarigen Ductus incisivi endigen. Der Ductus invisivus ist die rostrale Fortleitung des Ductus vomeronasalis, ausgehend vom Organum vomeronasale (Jakobsonsches Organ) am Boden der Nasenhöhle. Im Organum vomeronasale befindet sich ein zusätzliches Mundgeruchs- und Witterungsorgan, histologisch gekennzeichnet durch olfaktorisches Epithel.
1.7 Lymphatischer Rachenring
Im Bereich des Fauciums hat die Mundhöhle lokale Abwehrzentren lymphoretikulären Gewebes entwickelt. Stellen Aggregate dieses lymphoretikulären Gewebes selbstständige Gebilde dar, spricht man von Tonsillen oder Mandeln.
Zunge und Gaumensegel von Hund und Katze weisen lediglich diffus verteiltes lymphoretikuläres Gewebe und Ansammlungen von Lymphozyten auf. Dagegen ist die Tonsilla palatina (Gaumenmandel) deutlich ausgeprägt, findet sich allerdings versteckt in einer Schleimhautfalte, der Fossa tonsillaris. Ihre konkave Form macht sie zu einer Grubenmandel, die glatte Epitheloberfläche ohne Krypten definiert sie als balgfreie Mandel.
Die Tonsilla pharyngea (Rachenmandel) befindet sich im nasalen Anteil des Pharynx im Bereich der Choanen. Die Rachenmandel ist aufgrund ihrer erhabenen Form eine Beetmandel, es handelt sich wiederum um eine balgfreie Mandel.
1.8 Kopflymphknoten
Drei wichtige Lymphzentren sind im Kopfbereich zu unterscheiden.
Das Lymphocentrum parotideum nutzt als tributäres Gebiet oberflächliche Partien des Kopfes und filtert die Lymphe in den Nll. parotidei (Ohrspeicheldrüsenlymphknoten), die sich unter dem präaurikulären Zipfel der Glandula parotis befinden. Im physiologischen Zustand sind sie nur bedingt tastbar, da sie durch das Drüsengewebe bedeckt oder sogar darin eingebettet sind. Im vergrößerten Zustand sind sie beim Hund gut tastbar.
Das Lymphocentrum mandibulare bekommt Zufluss aus allen tiefen Bereichen des Kopfes sowie zusätzlich von oberflächlichen Partien des rostralen Nasenbereichs. Pathologische Prozesse an Zähnen, Kieferknochen oder Kaumuskeln führen daher zu einer Vergrößerung der Nll. mandibulares (Mandibularlymphknoten), die sich im Bereich des Kieferwinkels gut tasten lassen.
Das Lymphocentrum retropharyngeum erhält ebenfalls Zufluss aus tieferen Schädelregionen, insbesondere von Gaumen, Rachenring, kaudalen Kopfbereichen und Hals. Weiterhin werden die Nll. retropharyngeales als Durchgangsstation der Nll. parotidei und mandibulares genutzt und dementsprechend mitbetroffen. Die Nll. retropharyngeales laterales (seitliche Schlundkopflymphknoten) liegen im Bereich der Atlasflügel und sind dort vor allem bei Vergrößerung gut tastbar, die Nll. retropharyngeales mediales (mittlerer Schlundkopflymphknoten) liegen direkt dem Schlundkopf aufgelagert.
Im physiologischen Zustand haben die Kopflymphknoten der Katze etwa Erbsengröße, beim Hund etwa Kirschgröße, jedoch finden sich rassebedingte Unterschiede.
1.9 Speicheldrüsen
Speicheldrüsen sind bei Hund und Katze relativ selten von Erkrankungen betroffen, ist dieses jedoch der Fall, können Schwellungen das Operationsgebiet sehr unübersichtlich werden lassen, sodass anatomische Kenntnisse gefragt sind (▶Abb. 1.19 a+b). Die großen Speicheldrüsen sind als kompaktes Paket unterhalb des Kiefergelenkes zu finden.
Unterhalb des Ohres mit einem prä- und postaurikulären Zipfel liegt die dreieckige Glandula parotis (Ohrspeicheldrüse). Ihr Ausführungsgang verläuft quer über den Musculus masseter und tritt auf Höhe des Oberkieferreißzahnes als Papilla parotidea durch die Wange in die Mundhöhle.
Die rundliche Glandula mandibularis liegt am ventralen Rand der Ohrspeicheldrüse, im Bereich des Kieferwinkels. Auf dem Weg ihres Ausführungsganges, des Ductus mandibularis, zwischen Musculus mylohyoideus und hyoglossus teilt sie sich die fibröse Drüsenkapsel mit der rostral gelegenen Glandula sublingualis. Der Ausführungsgang endet am Zungenbändchen mit der Caruncula sublingualis. Die Glandula sublingualis unterscheidet man in zwei Drüsenanteile. Sie befindet sich rostral der Glandula mandibularis im Kehlgang und tritt in der Mundhöhle beidseitig als Sublingualwulst in den Recessus sublinguales laterales hervor. Der kaudale Anteil, die Glandula sublingualis monostomatica weist einen Ausführungsgang auf, den Ductus sublingualis major, der mit dem Ausführungsgang der Glandula mandibularis auf der Caruncula sublingualis endet. Der rostrale Anteil, die Glandula sublingualis polystomatica weist keinen separaten Ausführungsgang auf, sondern endet über viele kleine Ductus sublinguales minores auf dem Sublingualwulst. Im Gegensatz zu anderen Spezies ist die Glandula polystomatica bei Hund und Katze immer noch als recht kompaktes Drüsengewebe identifizierbar.
▶Abb. 1.19 a+b Schematische Darstellung der Lage der großen Speicheldrüsen und ihrer Ausführungsgänge beim Hund: Gl. parotis (grün), Gl. mandibularis (rot), Gl. sublingualis (blau), Gl. zygomatica (violett).
Die Glandula zygomatica befindet sich ventral des Processus zygomaticus der Maxilla. Ihr Hauptausführungsgang endet kaudal der Papilla parotidea auf Höhe des ersten Oberkiefermolaren als Papilla zygomatica im Vestibulum.
Neben den großen Speicheldrüsen finden sich viele kleine Speicheldrüsen:
Die Glandulae labiales, zu denen auch die separat besprochene Glandula zygomatica gerechnet wird, enden im Vestibulum. Als ventrale Formation labialer Drüsen und somit Pendant zur Glandula zygomatica findet sich bei der Katze die Glandula molaris buccalis, die sich über viele kleine Gänge ins Vestibulum ergießt.
Als Besonderheit weist die Katze eine Glandula molaris lingualis auf, die sich direkt medial des Unterkieferreißzahnes befindet und nicht selten mit einer pathologischen Umfangsvermehrung verwechselt wird.
Die Sekretion erfolgt direkt über Öffnungen an ihrer Oberfläche.
Glandulae palatinae finden sich im weichen Gaumen und enden direkt auf dessen ventraler Fläche. Auch die Zunge hat im Bereich der Papillae vallatae und foliatae Drüsen aufzuweisen, die als von Ebnersche Spüldrüsen bezeichnet werden.
2 Tierzahnmedizinischer Untersuchungsgang
Die umfassende Betrachtung des Tieres steht auch bei rein tierzahnärztlichen Fragestellungen an erster Stelle. Die Anamnese erstreckt sich daher auf alle Bereiche tierischen Lebens. Eine in die Wohnung urinierende Katze kann ebenso mit einer oralen Problematik in Zusammenhang stehen wie die rezidivierende Hauterkrankung eines Hundes.
Die folgenden Erläuterungen dienen einer zusätzlichen tierzahnärztlichen Perspektive, die Beachtung allgemeinmedizinischer Prinzipien vorausgesetzt.
2.1 Anamnese
Wichtige Aspekte einer tierzahnärztlichen Anamnese sind Haltungsbedingungen, Verhalten und vorausgegangene Erkrankungen auf der einen Seite, auffällige aktuelle Symptome, die zur Vorstellung des Tieres geführt haben, auf der anderen Seite. Nachfolgend sind die wichtigsten Fragen zu diesen Aspekten der Anamnese bei Hund und Katze aufgeführt.
Haltungsbedingungen
Handelt es sich um ein Einzeltier oder wird es in der Gruppe gehalten?
erhöhter Infektionsdruck
Stress mit Supprimierung des Immunsystems, damit erhöhte Anfälligkeit für z. B. aggressive Parodontitis (
▶
S. 122
)
Befindet sich der Hund in Zwingerhaltung oder lebt er in der Familie?
Verhaltensauffälligkeiten, wie z. B. Käfigbeißen mit erhöhter Gefahr einer Zahnfraktur oder -abrasion (s.
▶
Kap. 6
)
Ist es ein reiner Familienhund oder Gebrauchs- bzw. Arbeitshund?
erhöhte Zahnbelastung mit Gefahr einer Zahnfraktur
Was und wie oft wird gefüttert?
evtl. verminderter selbsttätiger Zahnreinigungseffekt mit erhöhter Gefahr einer Parodontitis (s.
▶
Kap. 7
)
diätetische Fehler mit erhöhter Gefahr einer Zahnentwicklungsstörung (Hypoplasie,
▶
S. 46
) oder -resorption (odontoklastische resorptive Läsion, s.
▶
Kap. 14.1
)
Hat das Tier Spielzeuge?
Spielgewohnheiten, z. B. führen Tennisbälle durch ihre abrasiven Eigenschaften zur verstärkten Abnutzung der Zähne
Werden Zähne geputzt?
schlechte Parodontalhygiene birgt erhöhte Gefahr einer Parodontalerkrankung (s.
▶
Kap. 7
)
Verhalten des Tieres
Hat sich das Verhalten des Tieres verändert?
Spieltrieb gedämpft aufgrund Schmerzhaftigkeit
Kopfscheuheit aufgrund Schmerzhaftigkeit
reduzierter Allgemeinzustand durch Ausweitung eines oralen Geschehens
Wird einseitig gekaut oder aufgenommen? Trägt das Tier die Spielzeuge einseitig?
Symptome hochgradiger Schmerzhaftigkeit
Spielt das Tier mit Steinen oder Stöcken?
Kaugewohnheiten mit erhöhter Gefahr von Abrasion oder Zahnfraktur (s.
▶
Kap. 6
)
spitze Fremdkörper können z. B. zu einer Pfählungsverletzung führen
Reibt sich das Tier mit dem Kopf an Gegenständen?
jeglicher Reiz in der Maulhöhle kann Reaktionen zur Reizeliminierung hervorrufen
Gähnt das Tier entspannt?
Probleme beim Öffnen des Fangs durch pathologische Prozesse im Bereich des Kiefergelenks oder des Rachens (z. B. Pfählungsverletzung, Faucitis oder Craniomandibuläre Osteopathie, s.
▶
Kap. 5.7
,
14.3
)
Vorausgegangene Erkrankungen
Gab es Verschlechterungen des Allgemeinzustandes ohne offensichtliche Erkrankung?
übersehene orale Problematik wie z. B. Parodontitis oder apikales Geschehen mit Auswirkungen auf weitere Organsysteme (s.
▶
Kap. 6
+
7
)
Gab es Erkrankungen der Geschwistertiere?
hereditäre Problematik, wie z. B. Missverhältnis von Ober- zu Unterkiefer (
▶
S. 51
)
Sind Futteraufnahme und Gewichtszunahme des Welpen normal?
funktionelle Behinderung z. B. durch Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte (s.
▶
Kap. 5.6
)
Traten Allergien oder Hauterkrankungen auf?
Mundhöhle als weiterer Manifestationsort entzündlicher Veränderungen
aufgrund von Juckreiz und Lecken parodontal eingespießte Haare führen zur Etablierung eines parodontalen Geschehens (s.
▶
Kap. 7
)
Liegt ein Diabetes mellitus vor?
vermehrte Entzündungsneigung
Liegt eine FeLV- oder FIV-Infektion vor?
supprimierte Immunabwehr
Gab es im Welpenalter Infektionserkrankungen?
Zahnentwicklungsstörungen, wie z. B. Schmelzhypoplasie (s.
▶
Kap. 5.2
)
Gab es im Welpenalter Verletzungen am Kopf?
Zahnentwicklungsstörungen z. B. mit Versprengung von Zahnfragmenten in benachbarte Kieferanteile (s.
▶
Kap. 5.2
)
Kieferdeformitäten, die z. B. zu einem behinderten Kieferschluss oder zu parodontalen Entzündungen prädisponieren
Sind die Impfungen komplett?
Grunderkrankungen mit oraler Komponente, wie z. B. Schmelzhypoplasien bei einer Staupeinfektion (
▶
S. 47
) oder erhöhte Entzündungsanfälligkeit bei einer FIV- oder FeLV-Infektion
Wurden bei vorausgehenden Erkrankungen Medikamente eingesetzt und welche?
pharmakologisch bedingte Zahnmissbildungen oder -erkrankungen, z. B. Zahnverfärbungen durch Tetrazyklingabe (
▶
S. 47
) oder Parodontitis bei Kortisongabe
Derzeitige Erkrankung
Hat das Tier Gewicht verloren?
schlechte Futteraufnahme aufgrund von Schmerzen oder funktioneller Behinderung
Traten Schwellungen im Kopfbereich auf?
Abszess, Granulom, Missbildung oder Tumor
Wurden Fistelungen beobachtet?
apikaler Prozess mit Durchbruch über die Schleimhaut oder Haut (
▶
S. 64
,
65
)
Zeigt sich Nasenausfluss oder Schnupfen?
Entzündungen an Oberkieferzähnen
Oronasale Fistel (
▶
S. 156
)
Oberkiefertumor (s.
▶
Kap. 11
)
Hat das Tier vermehrt gespeichelt?
jeglichen Reiz in der Mundhöhle
erschwertes Schlucken
Erbricht oder regurgiert das Tier?
Entzündung des Rachens
hastiges Abschlucken
Schreit das Tier beim Fressen auf oder lässt es Futter fallen?
Schmerzhaftigkeit Mundhöhle
Riecht das Tier aus der Mundhöhle?
parodontale Problematik (s.
▶
Kap. 7
)
frakturierter, nekrotischer Zahn (
▶
S. 64
)
Tumor mit ulzerierten oder nekrotischen Arealen (s.
▶
Kap. 11
)
Blutet das Tier aus dem Maul?
Entzündung, z. B. eine erhöhte Blutungsneigung bei Parodontitiden
Verletzung, z. B. bei Vorliegen eines oralen Fremdkörpers
Tumor, z. B. durch ulzerierte Oberfläche, durch erhöhte Blutungsneigung wie beim Mastozytom oder Einbeißen des antagonistischen Zahnes bei ungehemmtem Wachstum
2.2 Allgemeine Untersuchung
Die allgemeine Untersuchung des Tieres sollte in der Tierzahnheilkunde direkt dazu genutzt werden, die Anästhesietauglichkeit des Tieres zu erheben, da die detaillierte intraorale Inspektion immer einer Narkose bedarf. Das Herz-Kreislauf-System, Atmungsapparat sowie Leber- und Nierenfunktion verdienen daher besondere Beachtung.
2.3 Extraorale Untersuchung
Häufig lassen sich bereits bei der extraoralen Untersuchung Hinweise auf ein krankhaftes Geschehen des Zahn-, Mund- und Kieferbereiches finden.
Symmetrieabweichungen werden häufig durch eine entzündliche Schwellung hervorgerufen und haben im Gesichtsschädelbereich zumeist eine dentogene Ursache (▶Abb. 2.1). Eine neoplastische oder teratogene Ursache einer Asymmetrie sollte je nach Alter des Patienten nicht außer Acht gelassen werden (▶Abb. 2.2).
▶Abb. 2.1 Asymmetrie am Gesichtsschädel eines Hundes infolge einer Wurzelspitzenentzündung.
▶Abb. 2.2 Asymmetrie am Gesichtsschädel einer Katze infolge einer Neoplasie des rechten Oberkiefers.
▶Abb. 2.3 Offensichtlicher Fremdkörper (Röhrenknochen) am Unterkiefer eines Hundes.
▶Abb. 2.4 Einseitiger Nasenausfluss aufgrund eines entzündlichen Wurzelspitzengeschehens des frakturierten Oberkiefercaninus bei der Katze.
▶Abb. 2.5 Exzessives Speicheln mit gleichzeitigem Vorstrecken der Zunge aufgrund einer ausgeprägten Parodontitis.
Exophthalmus kann sich bei raumfordernden Prozessen im retromaxillären Bereich zeigen oder bei Entzündungen der letzten Oberkiefermolaren. Ebenso kann jedoch auch ein Enophthalmus mit Nickhautvorfall als Zeichen einer schmerzhaften Zahnerkrankung mit aktiver Retraktion des Bulbus, oder aufgrund atrophierter Kaumuskulatur, auftreten. Konsistenz und Größenabweichungen der Speicheldrüsen oder Lymphknoten können Zeichen eines entzündlichen oder neoplastischen Geschehens sein und eine Asymmetrie des Kopfes hervorrufen. Die Integrität der Haut ist ebenso zu kontrollieren wie die Kontinuität der knöchernen Basis. Zu unterscheiden ist, ob die Haut von kieferseits z. B. als dentale Fistel, in einen pathologischen Prozess einbezogen wird, oder ob es über äußere Einwirkung wie z. B. einen spitzen Fremdkörper zu deren Verletzung gekommen ist.
Fremdkörper in der Maulhöhle müssen jedoch nicht immer in Zusammenhang mit Pfählungsverletzungen auftreten (▶Abb. 2.3).
Bei der Unfähigkeit zu einem vollständigen Kieferschluss müssen alle knöchernen Strukturen auf ihre Intaktheit palpiert werden, Krepitation oder unphysiologische Mobilität weisen auf eine Fraktur hin. Die Position der Kiefergelenkköpfchen muss direkt vor dem Processus retroarticularis tastbar sein, andernfalls kann eine Kieferluxation vorliegen. Ist die Maulöffnung nur unter Abwehrbewegungen oder Schmerzäußerungen möglich, kann dieses Hinweis sein auf entzündliche Prozesse im retromaxillären Bereich, z. B. durch eingespießte Fremdkörper oder Entzündungen im Oropharynx. Einseitiger Nasenausfluss bzw. verkrustetes Sekret am Naseneingang ist zumeist als sicherer Hinweis auf ein dentales Geschehen, häufig im Caninusund Prämolarenbereich des Oberkiefers, zu werten (▶Abb. 2.4).
Speicheln an sich, aber auch speichelverklebtes Fell sind zumeist die unspezifische Folge eines Reizes in der Mundhöhle (▶Abb. 2.5). Nur in seltenen Fällen ist Speicheln ursächlich in den Speicheldrüsen begründet. Bei der Katze findet sich dieses Symptom vor allem bei Entzündungen des Oropharynx kombiniert mit einem Vorstrecken der Zunge.
▶Abb. 2.6 Beurteilung der Zähne und Kiefer durch Beiseitenehmen der Lefze bei geschlossenem Fang.
▶Abb. 2.7 Beurteilung der Zähne, Kiefer, Zunge und des Rachenraumes bei geöffnetem Fang. Die Oberkieferlefze sollte durch Daumen und Finger beidseitig angehoben und dabei ein schmerzhaftes Einklemmen über den Höckerspitzen der Oberkieferzähne vermieden werden.
▶Abb. 2.8 Die Asymmetrie des Zahnsteinbefalls im Seitenzahn des Hundes hatte ihre Ursache in einer Missbildung des linken Unterkieferreißzahnes.
▶Abb. 2.9 Schmelzrisse und Verfärbungen können Hinweise auf eine unfunktionell hohe Belastung der Zähne sein.
▶Abb. 2.10 Die Blutung aus der Pulpa nach Zahnfraktur ist offensichtliches Zeichen für eien absolute Behandlungsindikation.
Veränderungen des Kehlgangs lassen sich, außer bei ausgeprägten Mukozelen der Speicheldrüsen (▶S. 185) meist nur durch gezielte Palpation darstellen. Verhärtungen oder Umfangsvermehrungen können ihre Ursache z. B. in entzündlichen Reaktionen auf Fremdkörper, Speicheldrüsenerkrankungen oder in Neoplasien haben. Zumeist lassen sich bereits Hinweise auf Mitbeteiligungen des Mundbodens und der Zunge durch tiefe extraorale Palpation des Kehlganges gewinnen.
Vergrößerungen der mandibularen, parotidealen oder retropharyngealen Lymphknoten (▶S. 14) sind häufig einziger äußerer Indikator für ein entzündliches Geschehen der Mundhöhle und sollten daher zu erhöhter Aufmerksamkeit bei der intraoralen Inspektion führen.
2.4 Intraorale Untersuchung
Bei der Erstvorstellung eines Tieres wird die intraorale Untersuchung sicherlich ohne Anästhesie erfolgen, außer es läge ein Notfall vor.
Dennoch sollte jedes Symptom einer oralen respektive dentalen Erkrankung zum Anlass genommen werden, eine detaillierte Untersuchung unter Anästhesie vorzunehmen.
Nur sie erlaubt eine objektive Befundung aller notwendigen Parameter, da viele Tiere im Wachzustand nicht gewillt sind, z. B. Sondierungen oder Röntgenaufnahmen vornehmen zu lassen.
Beim „schnellen Blick“ am wachen Tier sollte daher versucht werden, einen Überblick zu gewinnen und prägnante Symptome zu erkennen (▶Abb. 2.6–2.13). Bei der Untersuchung sollte geachtet werden auf:
Symmetrieabweichungen der Kiefer und Zähne
Okklusion
Missbildungen
Zahnstein und Plaque (
▶
Abb. 2.8
)
Zahnverfärbungen (
▶
Abb. 2.9
)
Zahnfrakturen (
▶
Abb. 2.10
)
parodontale Entzündungserscheinungen (
▶
Abb. 2.11
)
Speichelmenge
Fremdkörper (
▶
Abb. 2.12
)
Entzündungen und Verletzungen der Mundschleimhäute (
▶
Abb. 2.13
)
Umfangsvermehrungen
Wenn möglich sollten Konsistenzänderungen der Gewebe mittels Palpation kontrolliert werden, hierzu zählen insbesondere auch Zunge und Mundboden. Bei der Untersuchung der Zunge kann gleichzeitig auch eine Inspektion des Rachenraumes vorgenommen werden.
Die detaillierte Untersuchung in Narkose umfasst zusätzlich eine Befunderhebung mittels verschiedener Hilfsmittel, auf die bei den entsprechenden Indikationen eingegangen werden soll:
zahnärztlicher Sonde (
▶
S. 63
)
parodontaler Sonde (
▶
S. 115
)
Röntgendiagnostik (
▶
S. 22
)
ggf. Biopsieentnahme und (
▶
S. 174
)
ggf. mikrobiologischer oder virologischer Diagnostik (
▶
S. 114
)
▶Abb. 2.11 Freiliegende Wurzelflächen und durchgängige Wurzelfurkationen weisen auf ein fortgeschrittenes parodontales Geschehen hin.
▶Abb. 2.12 In den Parodontalspalt eingespießte Haare können als Fremdkörper den parodontalen Abbau beschleunigen. Sie können jedoch auch sekundär in einer parodontalen Tasche eingespießt sein.
▶Abb. 2.13 Verletzungen des Gaumens entstehen zumeist durch Pfählungsverletzungen. Ein Fremdkörper kann, muss aber nicht mehr vorhanden sein.
3 Dentales Röntgen
Die häufig unspezifische Symptomatik dentaler Erkrankungen benötigt Hilfsmittel zur Objektivierung. Besonders aussagekräftig ist dabei das intraorale Röntgen.
Bedeutung des intraoralen dentalen Röntgens
An klinisch erkrankten Zähnen konnten beim Hund in einem Viertel, bei der Katze in einem Drittel der Fälle wichtige zusätzliche, behandlungsbedürftige Befunde nachgewiesen werden.An klinisch gesunden Zähnen konnten beim Hund in ca. 30 %, bei der Katze in ca. 40 % der Fälle überhaupt erst behandlungsbedürftige Befunde erhoben werden.Bei Verdacht auf Erkrankungen mit dentaler Ursache, zur Beurteilung des Ist-Zustandes im Rahmen eines parodontalen Geschehens oder als Verifizierung eines Behandlungserfolges ist das dentale Röntgen unverzichtbar. Der Nutzen einer guten Röntgendiagnostik liegt weit über dem Risiko einer gut geführten Narkose, die zur Erstellung intraoraler Röntgenbilder zumeist notwendig wird. Zahnerkrankungen können durch intraorales Röntgen rechtzeitig erkannt und langwierige, chronische Herderkrankungen vermieden werden.
Vorzüge des intraoralen Röntgens
Ober- und Unterkiefer erlauben bei extraoraler Filmlagerung in den wenigsten Regionen eine überlagerungsfreie Projektion der Zähne. Diese Superposition ist bei intraoraler Positionierung des Röntgenfilmes weitestgehend vermeidbar. Eine intraorale Positionierung normaler Filmkassetten ist lediglich in der Ober- und Unterkieferfront möglich. Dennoch sollten sogar in diesen Lokalisationen dentale Röntgenfilme verwendet werden, da deren hohe Detailgenauigkeit die Beurteilung graziler Strukturen ermöglicht, die sogar bei Verwendung fein zeichnender Film-Folien-Kombinationen der Standardfilme verloren gehen würde.
3.1 Dentales Röntgengerät
Intraorale Röntgenaufnahmen können zwar auch mittels einer veterinärmedizinischen Röntgenanlage belichtet werden, die sehr umständliche Patientenlagerung sowie der notwendige Transport vom Behandlungsplatz zum Röntgenplatz sprechen jedoch gegen diese Variante. Statt den Berg zum Propheten zu bringen, kann über ein dentales Röntgengerät mit schwenkbarem Röntgenarm eine einfachere Lösung am Behandlungsplatz gewählt werden (▶Abb. 3.1).
Dentale Röntgengeräte sind als stationäre oder mobile Version erhältlich. Ihre Röhrenspannung liegt zwischen 60 und 75 kV, die Röhrenstromstärke bewegt sich bei 7 mA. In der Regel sind diese Werte fest vorgegeben, sodass die Belichtung der Filme lediglich über den Faktor Zeit verändert wird. Während der Exposition entspricht der Kontrollbereich (Strahlenbelastung von mehr als 6 mSv effektiver Jahresdosis) einem Radius von 1,5 m um die Strahlenquelle. In der Regel wird deshalb der gesamte Betriebsraum als Kontrollbereich angesehen.
Abb. 3.1 Dentales Röntgengerät (Heliodent, Fa. Sirona) mit beweglichem Wandarm.
Abb. 3.2 Röntgentubus. Die Gradeinteilung zur Einstellung des zylindrischen Röntgentubus erleichtert eine verzeichnungsfreie Projektion.
Besondere bauliche Röntgenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig.
Die Betätigung des Auslösers kann dank eines ausreichend langen oder flexiblen Kabels in angemessener Entfernung erfolgen.
Das Strahlennutzfeld wird durch die Größe des Röntgentubus vorgegeben und weist auf der Hautoberfläche einen Durchmesser von 6 cm auf. Durch Projektionshilfen kann mithilfe eines weiteren Filters auf das zu belichtende Areal eingeblendet werden. Über den beweglichen Gerätearm ist die Ausrichtung des Röntgenstrahlers zum Tier möglich. Die exakte Einstellung des Projektionswinkels wird mittels einer Skala am Röntgentubus erleichtert. Die Form des zylindrischen Röntgentubus macht eine visuelle Kontrolle des Einstellwinkels möglich, die Länge des Röntgentubus gibt gleichzeitig den notwendigen Fokus-Haut-Abstand vor (▶Abb. 3.2). Wird der belichtete Röntgenfilm vor Ort in einer Tischdunkelkammer entwickelt, ist eine fortwährende Kontrolle der Anästhesie möglich.
3.2 Konventionelle und digitale Aufnahmemedien
Der Vorteil intraoraler Aufnahmemedien liegt in ihrer Größe und Detailgenauigkeit. Durch die intraorale Positionierung von Dentalfilmen, digitalen Sensoren oder fotostimulierbaren Phosphorplatten, kann eine weitestgehend überlagerungsfreie Darstellung dentaler Strukturen erreicht werden.
Dentale Röntgenfilme
Dentale Röntgenfilme arbeiten ohne Verstärkerfolien. Hierdurch erhöht sich zwar die benötigte Strahlendosis, man erzielt jedoch die bestmögliche Feinzeichnung, da eine Streuung der Röntgenstrahlen durch Kristalle der Verstärkerfolien ausbleibt. Die lichtsensitiven Elemente des konventionellen dentalen Röntgenfilms sind Silberbromidkristalle in einer Größe von 0,3-6,4 µm. Die zufällig verteilten Silberbromidkristalle befinden sich geschützt durch eine Deckschicht in einer Emulsionsschicht, die beidseitig auf einer Trägerschicht aus Acetylzellulose aufgebracht ist. Derzeit gebräuchliche Dentalfilme entsprechen der Empfindlichkeitsklasse E, die trotz relativ großer Korngröße zur Erhöhung der Lichtausbeute eine ausreichende Auflösung bietet. Die Zahnfilme befinden sich eingeschweißt in einer flexiblen, wasserdichten Verpackung, sodass ein Kontakt mit Feuchtigkeit respektive Speichel ausgeschlossen ist. Dentale Röntgenfilme sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Abb. 3.3 Dentalfilm. Die aufnahmeseitig konvexe Prägung ist sowohl auf der Schutzhülle als auch auf dem Röntgenfilm erkennbar (rote Pfeile).
Für die Veterinärmedizin geeignete Röntgenfilmgrößen
Größe 0 (sensitive Fläche ca. 2 × 3 cm) für Einzelzahnröntgenaufnahmen bei der Katze bzw. kleinen HunderassenGröße 2 (sensitive Fläche ca. 3 × 4 cm) für Einzelzahnröntgenaufnahmen bei mittleren und großen Hunden sowie Übersichtsaufnahmen von Zähnen der Ober- und Unterkieferfront bei Katzen und kleinen HunderassenGröße 4 (sensitive Fläche ca. 5 × 7 cm) für Übersichtsaufnahmen von Zähnen der Oberund UnterkieferfrontEine aufnahmeseitig konvexe Eckenprägung erlaubt die sichere Zuordnung der Filme zur jeweiligen anatomischen Region ohne zusätzliche Kenntlichmachung (▶Abb. 3.3). Um diesen Vorteil zu nutzen, ist die korrekte Ausrichtung des Filmes notwendig (▶Abb. 3.4). Grundsätzlich sind verschiedene Schemata möglich.
Abb. 3.4 Die Eckenprägung (schwarze Punkte) erlaubt bei der hier gezeigten Filmausrichtung immer eine verwechslungsfreie Zuordnung des Röntgenfilms zum jeweiligen Quadranten.
Abb. 3.5 Digitaler CCD-Röntgensensor des Sidexis Intraoral Röntgensystems.
Ein einfaches und unverwechselbares Schema ist die Ausrichtung der Eckenprägung nach mesial.
Nach Unterscheidung von Oberkiefer und Unterkiefer im Röntgenbild anhand anatomischer Merkmale