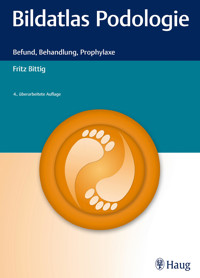
89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl F. Haug
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vom Krankheitsbild zur podologischen Behandlung
- Schritt-für-Schritt-Bildfolgen zeigen die häufigsten Veränderungen und Erkrankungen der Füße
- Vorher-Nachher-Aufnahmen helfen die fußpflegerischen Maßnahmen richtig umzusetzen
- Sicherheit in der Beurteilung und Behandlung durch zahlreiche farbige Referenzbilder
- einzigartiges Anschauungsmaterial und viele praktische Tipps
Neu in der 4. Auflage
- Kapitel Neurodermitis
- Wundmanagement beim Diabetischen Fußsyndrom
- Deformitäten der Kinderfüße
- podologische Arbeitstechniken: Fremdkörperentfernungen
- Behandlungsfehler: weitere Beispiele aus der podologischen und ärztlichen Praxis
- zahlreiche neue Abbildungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bildatlas Podologie
Befund, Behandlung, Prophylaxe
Fritz Bittig
4., überarbeitete Auflage
711 Abbildungen
Geleitwort
15 Jahre nach der Erstauflage dieses Buches halten Sie nun die 4. Auflage in der Hand. Schon beim einfachen Durchblättern, dem Überfliegen der zahlreichen, exzellent bebilderten Fallbeispiele zeigt sich die umfangreiche Erfahrung, die Akribie und Begeisterung, die es dem Autor erlaubt hat, ein derartiges Buch zu veröffentlichen. So stellt es mit seinen eindrucksvollen Vorher-Nachher-Aufnahmen, der genauen Beschreibung verschiedenster Arbeitstechniken und lnstrumentarien oder der detaillierten Bilder einzelner pathologischer Kasuistiken nicht nur ein „Lesebuch“ im wahrsten Sinne des Wortes für jeden in diesem Berufsfeld Tätigen, sondern auch ein fast lexikalisches Lehr-Standardwerk für die podologische Praxis dar.
Da man als Arzt zwar täglich mit zahlreichen Problemen des Fußes zu tun hat, jedoch in Aus- und Weiterbildung nur ungenügendes Werkzeug an die Hand bekommt, um im täglichen „Geschäft“ den Patienten ausreichend helfen zu können, gibt einem dieser Atlas aufgrund aktuellsten Wissens Hilfestellung und Sicherheit in der Beurteilung und Behandlung der wichtigsten podologischen Problemstellungen. So bringt dieses Lehrbuch den „podologischen“ Leser auf den neuesten Stand und lässt den ärztlichen Rezipienten beim Blick über den Tellerrand der eigenen Zunft viel Bereicherndes für die tägliche ärztliche Praxis finden.
Dr. med. univ. Christian Stezer
Berchtesgaden, im Sommer 2016
Vorwort zur 4. Auflage
Liebe Leser,
heute halten Sie die 4. Auflage meines „Bildatlas Podologie“ in den Händen.
Bereits 1999 hat mich der Hippokrates Verlag gefragt, ob ich Interesse hätte, ein konzeptionell völlig neues Fachbuch zu schreiben. Damit ging ein lang gehegter Wunsch von mir in Erfüllung. Dass nach all den Jahren die Nachfrage noch immer so groß ist, macht mich glücklich. Deshalb kam ich dem Wunsch von Frau Monika Grübener vom Haug Verlag gerne nach, eine 4. Auflage zu planen.
Das Berufsbild der Podologen und medizinischen Fußpfleger hat sich bis heute sehr gewandelt. Aus diesem Grund wurde der komplette Bildatlas völlig aktualisiert und mit viel neuem Bildmaterial ergänzt. Ein völlig neues Thema ist die Fremdkörperentfernung. Der Bildatlas bietet die Grundlage für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen medizinischen Berufsgruppen wie Ärzten, Physiotherapeuten, Orthopädie-Schuhmachern und fördert somit die berufliche Akzeptanz, die immer mehr in den Vordergrund tritt.
Ich möchte mich bei all meinen treuen Lesern bedanken, die zum großen Teil bei mir in Berchtesgaden in Hospitationstagen die Arbeitstechniken aus meinen Büchern erlernt haben und mir stets ein positives Feedback gaben, nochmals ein etabliertes Standardwerk neu zu konzipieren. Ebenso danke ich meiner Frau für die kontinuierliche Motivation, nach einem arbeitsreichen Tag in der Praxis zusätzlich am PC mein Manuskript zu schreiben. Mit Stolz darf ich Ihnen verraten, dass unsere Tochter Eva (Diplomgrafikerin in München) bei der Gestaltung des Covers maßgeblich beteiligt war. Das ehrt mich besonders.
Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß und Neugierde beim „Studieren“ meines neuen Bildatlas Podologie. Er soll Ihnen mit wertvollen Tipps und interessanten Bildern bei Ihrer täglichen Arbeit stets eine Hilfe sein.
Ihr
Fritz Bittig
Berchtesgaden, im Juni 2016
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort zur 4. Auflage
1 Dermatologie
1.1 Erkrankungen der Haut
1.1.1 Callositas/Schwielen
1.1.2 Clavus
1.1.3 Dermatomykosen/Dermatosen
1.1.4 Hyperhidrosis und Bromhidrosis
1.1.5 Hyperkeratose
1.1.6 Neurodermitis
1.1.7 Psoriasis
1.1.8 Rhagaden/Fissuren
1.1.9 Schrunden
1.1.10 Tumoren
1.1.11 Verruca
1.2 Erkrankungen der Nägel
1.2.1 Beau-Reil-Querfurchen
1.2.2 Exostose
1.2.3 Koilonychie
1.2.4 Leukonychia
1.2.5 Mees-Querstreifen
1.2.6 Onychoatrophie
1.2.7 Onychoauxis
1.2.8 Onychogryposis
1.2.9 Onycholyse
1.2.10 Onychomykosen
1.2.11 Onychophosis
1.2.12 Onychorrhexis/Unguis bifidus
1.2.13 Onychoschisis
1.2.14 Pachyonychie
1.2.15 Paronychie oder Panaritium
1.2.16 Psoriasis
1.2.17 Pterygium
1.2.18 Sklerodermie
1.2.19 Subunguale Exostose
1.2.20 Subunguales Granulationsgewebe
1.2.21 Subunguales Hämatom
1.2.22 Subunguale Hyperkeratose
1.2.23 Subungualer Clavus
1.2.24 Trachyonychie
1.2.25 Unguis convolutus
1.2.26 Unguis hippocraticus
1.2.27 Unguis incarnatus
1.2.28 Unguis inflexus
1.2.29 Unguis in turriculo
1.2.30 Unguis retroflexus
2 Innere Medizin
2.1 Diabetisches Fußsyndrom (DFS)
2.1.1 Polyneuropathie (PNP)
2.1.2 Periphere, arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
2.1.3 Mischform: Polyneuropathie bei gleichzeitiger peripherer arterieller Verschlusskrankheit
2.1.4 Hinweise zur Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
2.1.5 Behandlungsbeispiele
2.1.6 Klassifikation diabetischer Fußläsionen
2.2 Hämophilie (Bluterkrankheit)
2.2.1 Allgemein
2.2.2 Praxisbeispiele
2.3 Hyperurikämie/Gicht
2.3.1 Allgemein
2.3.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
2.4 Lymphödeme
2.4.1 Allgemein
2.4.2 Behandlungsbeispiele
2.5 Phlebologie/Varicosis
2.5.1 Allgemein
2.5.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
3 Orthopädie
3.1 Deformitäten
3.1.1 Kleinkinder und Jugendliche
3.1.2 Erwachsene
3.2 Charcot-Fuß
3.2.1 Erwachsene
3.3 Enchondromatose
3.3.1 Allgemein
3.3.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
3.4 Rheuma/Rheumatismus
3.4.1 Allgemein
3.4.2 Behandlungsbeispiele
3.5 Syndaktylie
3.5.1 Allgemein
3.5.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
4 Chirurgie
4.1 Emmert-Plastiken (Keilexzisionen)
4.1.1 Allgemein
4.1.2 Behandlungsbeispiele
4.2 Fremdkörperverletzungen
4.2.1 Allgemein
4.2.2 Behandlungsbeispiele
4.3 Traumen (Blasen)
4.3.1 Allgemein
4.3.2 Behandlungsbeispiele
5 Podologische Arbeitstechniken
5.1 Inkarnatortechnik nach Bittig
5.1.1 Allgemein
5.1.2 Behandlungsbeispiele
5.2 Kombination manueller und rotierender Instrumente
5.2.1 Allgemein
5.2.2 Behandlungsbeispiel
5.3 Medihaltertechnik nach Lehrmethode Bittig
5.3.1 Allgemein
5.3.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
5.4 Nagelprothetik
5.4.1 Aufgussverfahren
5.4.2 Behandlungsbeispiele
5.5 Orthonyxie/Spangentherapie
5.5.1 Allgemein
5.5.2 Behandlungsbeispiele
5.6 Orthosenanfertigung
5.6.1 Allgemein
5.6.2 Behandlungsbeispiele
5.7 Schleiftechnik nach Lehrmethode Bittig
5.7.1 Allgemein
5.7.2 Behandlungsbeispiele
5.8 Tamponadetechnik
5.8.1 Allgemein
5.8.2 Behandlungsbeispiel
5.9 Verbandstechnik nach Lehrmethode Bittig
5.9.1 Allgemein
5.9.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
5.10 Zangentechnik nach Lehrmethode Bittig
5.10.1 Allgemein
5.10.2 Behandlungsbeispiele
6 Behandlungsfehler
6.1 Durch den Patienten selbst (iatrogen) verursachte Behandlungsfehler
6.1.1 Allgemein
6.1.2 Praxisbeispiele für iatrogen verursachte Behandlungsfehler
6.2 Durch Podologen/medizinische Fußpflege verursachte Behandlungsfehler
6.2.1 Allgemein
6.2.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
6.3 Behandlungsfehler aus der ärztlichen Praxis
6.3.1 Allgemein
6.3.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
7 Instrumenten- und Materialkunde
7.1 Allpresan-Produkte
7.2 Druck- und Reibungsschutz
7.3 Hartmann-Verbandstoffe
7.4 Jentschura basische Körperpflege
7.5 Prontoman-Medizinprodukte
7.6 Remmele‘s Propolis Produkte
7.7 Snögg Wundschnellverband
7.8 Spenco 2nd Skin Druckschutz
7.9 Spezialinstrumente
7.9.1 Manuelle Instrumente
7.9.2 Rotierende Instrumente speziell nach Lehrmethode Bittig
7.10 Podo pure+ Absaugtechnik
Teil II Anhang
8 Praktische podologische Fortbildung
9 Hersteller
10 Literatur
11 Abbildungsnachweis
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
1 Dermatologie
1.1 Erkrankungen der Haut
1.1.1 Callositas/Schwielen
1.1.1.1 Allgemein
Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Ihre Hornschicht ist unterschiedlich dick. Sie ist sehr dünn an den Augenlidern, an den Händen und den Füßen hingegen wesentlich dicker. Wird die Haut mechanisch, thermisch oder chemisch belastet, reagiert sie mit einer Schutzfunktion und bildet eine vermehrte Hornschicht, die Schwiele (Callositas). Bei der Schwiele handelt sich um eine umschriebene Hornzellenvermehrung. Es ist meist eine glatte Oberflächenverhornung, die nicht schmerzt und daher vom Patienten meistens akzeptiert wird, bis der Druck zu stark wird.
Periunguale Verhornungen der Finger mit schmerzhaften Einrissen im Nagelmondbereich (Lunulum) sind nicht selten. Diese harten Hornhautspalten sind nicht nur schmerzhaft, sondern beeinträchtigen die Lebensqualität des Betroffenen enorm! Als Komplikation können sich extrem schmerzhafte Schwielenentzündungen und Hämatome mit Flüssigkeitsansammlung unter der Hornhautplatte bilden.
Lokalisation Callositas/Schwielen treten häufig an der Ferse, am mediolateralen und lateroplantaren Großzehenballen und an Zehengelenken auf. Die Hautelastizität fehlt völlig und bei mechanischer Belastung kann die Hautoberfläche einreißen. Sie ist typischerweise bei bestimmten Berufsgruppen wie Maurern, Fliesenlegern und Bauarbeitern an den Händen zu finden.
Faktoren, die eine Hornhautbildung fördern In erster Linie sind hier zu nennen:
mechanische Belastung im Sinne von Reibung durch
berufsbedingtes Schuhwerk (Stahlkappen)
Sportschuhe (z.B. für Klettern, Wandern, Bergsteigen, Golf, Eishockey, Eiskunstlauf, Ballett)
Schuhe mit hohen Absätzen
Tragen von geschlossenen Schuhen ohne Strümpfe erzeugt eine „Haftreibung“ (Haut klebt am Leder fest, schwitzt, fördert Blasen-/Hornhautbildung und Ekzeme, Mykosen und Allergien durch Farb- und Gerbstoffe)
Fußdeformationen wie Hallux valgus, Senk-, Spreiz- und Knickfuß begünstigen Fehlbelastungen
Lähmungen (Paresen)
Frakturen
einseitiges Hinken
Wirbelsäulenbeschwerden
thermische Belastung wie Hitze und Kälte, ebenso Reibungswärme, die durch mechanische Reizung auf der Haut entsteht
chemische Belastung durch Laugen, Säuren und Schweißbildung
genetische Veranlagung, z. B. Fischschuppenkrankheit (Ichthyosis) oder Schuppenflechte (Psoriasis)
natürliche Hautalterung (Austrocknung, Faltenbildung, Elastizitätsverlust)
falsches Schuhwerk
Mykosebefall der Haut (Schutzmechanismus wird ausgelöst)
1.1.1.2 Behandlungs- und Praxisbeispiele
Siehe ▶ Abb. 1.1, ▶ Abb. 1.2 und ▶ Abb. 1.3
Abb. 1.1 Multiple Schwielen mehrerer dorsaler Zehenglieder einer 60-jährigen, ca. 185 cm großen Patientin, die seit vielen Jahren an Rheuma leidet. Durch ständig angeschwollene Füße ergeben sich stets Probleme beim Kauf „bequemer“ Schuhe. Frauenschuhe sind in dieser Größe zudem sehr schwer zu bekommen. Kurze Behandlungsintervalle zur Abtragung der Schwielen sind anzuraten.Praxistipp: Unbedingt orthopädischen Schuhmacher empfehlen zur individuellen Beratung und Anfertigung adäquaten Schuhwerks.
Abb. 1.2 Druckschmerzhafte, harte Schwiele auf der V. Zehe.
Abb. 1.2a Zustand vor der podologischen Behandlung.
Abb. 1.2b Es handelt sich um die Vorstufe eines Clavus. Zustand nach Entfernung des Hornhautdeckels mit einem Hartmetallfräser (424GQSR 040) und anschließender schonender Entfernung der elastischen Hornschicht mit dem Medihalter Klingenform 3V. Das Hühnerauge ist deutlich erkennbar. Praxistipp: Unbedingt einen 2nd Skin Spenco Verband anlegen.
Abb. 1.3 Plantare schmerzhafte Schwiele unter der II. Zehe bei einer ca. 50-jährigen ca. 50 kg leichten Patientin. Mit dem Hartmetallfräser 296X 031 wird die harte Hornhaut abgetragen und mit dem Medihalter Klingenform 3V nachgeglättet.
1.1.2 Clavus
1.1.2.1 Allgemein
Lokal begrenzte Verdickungen der Hornschicht mit zentralem, in die Tiefe gerichtetem „Dorn“ bezeichnet man im Volksmund als Hühnerauge oder Leichdorn (lat.: Clavus, griech.: Heloma). Hühneraugen entstehen durch chronischen Druck, oft auf knochennaher Haut. Sie sind sehr schmerzhaft, besonders wenn sie auf Gelenken oder auf der Fußsohle liegen. Bei immer wieder auftretendem Druck presst sich der Keratinkern langsam in die Lederhaut und deformiert oder vergrößert die Papillen. Ein Hühnerauge, das sich in der Hornschicht zu einer Schwiele entwickelt und schmerzt, wird als Dornschwielebezeichnet. Diese darf nicht mit der Dornwarze verwechselt werden.
Entwicklung von Hühneraugen Im Gegensatz zu oberflächlichen Hyperkeratosen befinden sich Hühneraugen (Clavi) in tieferen Hautschichten und sind meist schmerzhaft. Werden Schwielen nicht konsequent behandelt, können sich zusätzlich Schwielenentzündungen und Hühneraugen entwickeln.
Enges Schuhwerk und Deformationen der Füße bzw. Zehen fördern ebenso die Entstehung von Clavi wie lang andauernder Druck auf erhabene Körperstellen (Gelenke, Knochenvorsprünge). Hühneraugen können sich auf der gesamten Fußsohle, auf, unter und zwischen den Zehen sowie an den Gelenken und Zehenspitzen bilden. Man findet sie auch im Nagelfalz und sogar unter der Nagelplatte, an der Ferse sowie am inneren und äußeren Fußrand. Bei Hühneraugen zwischen den Zehen (Clavus interdigitalis) kommt es leicht zu einer Mazeration der Haut. Man spricht von einem weichen Hühnerauge (Clavus mollis).
Wesentliche Merkmale des Hühnerauges sind
Meist runde, in der Form einer Linse abgegrenzte, erhabene, gelbliche Verhornung. Die Gelbfärbung kommt durch die dicke Hornschicht zustande.
Das zentrale „Auge“ ist bei der „Bittig-Schältechnik“ mit dem Medihalter (Klingenform 3V) als Hornhautkegel gut sichtbar.
Oft Schmerzen im Ruhezustand oder beim Gehen.
Im zentralen Kern sind keine Blutgefäße oder Nerven enthalten (außer beim Clavus neurofibrosus, vascularis und neurovascularis). Die Schmerzen werden durch den Druck des Hornkegels hervorgerufen.
Eine Wetterfühligkeit ist nicht selten zu beobachten.
Formen In der dermatologischen Literatur sind verschiedene Formen des Hühnerauges beschrieben, die sich in der Praxis allerdings nicht immer leicht voneinander abgrenzen lassen:
Clavus durus (Cd)
Heloma durum (hartes Hühnerauge)
Lokalisierte schmerzhafte Verhornung mit zentralem, keratotischen Hornpfropf.
Lokalisation: Tritt häufig über prominenten Zehengelenken sowie unter Mittelfußköpfchen oder sonstigen druckexponierten Hautstellen auf. Als Sonderform sei hier das Heloma spina (Dornschwiele) genannt, das selbst im Nagelfalz vorkommen kann.
Clavus miliaris (Cmil)
Heloma miliare
Nach heutiger Klassifikation nicht mehr zu den „echten“ Hühneraugen zu zählen. Hiernach handelt es sich um disseminierte, milienähnliche Hornperlen an der Fußsohle.
Clavus mollis (Cm)
Heloma molle (weiches Hühnerauge)
Lokalisation: Meist zwischen den Zehen zu finden, wo es begünstigt durch Schweißsekretion durch Reibung oder Druck zu Hauterweichungen (Mazerationen) kommt. Es kommt teilweise zu ulzerierenden Hautveränderungen.
Sonder- und Übergangsformen
Clavus apex (Cap)
Apex bezeichnet lediglich die Lokalisation einer speziellen Hühneraugenform an der jeweiligen Zehenkuppe bzw. Zehenspitze.
Clavus neurofibrosus (Cnf)
Heloma neurofibrosum
Man findet es an Grenzstellen, wo die Haut neben vermehrter Hornzellenbildung eine Kompensation der Überbelastung mit Bindegewebe (fibröse Fasern) versucht. Mit dem Mikroskop kann man freie Nervenendigungen finden. Wenn sich die Blutgefäße vermehren, entsteht ein Clavus vascularis.
Clavus neurovascularis (Cnv)
Heloma neurovasculare
Ist ein sehr schmerzhaftes, leicht blutendes Hühnerauge, das von vielen, feinen Kapillaren (Blutgefäßen) und Nervenenden durchsetzt ist.
Es gilt als eine Mischform, die der Körper wegen der geänderten mechanischen Ansprüche und Erfordernisse produziert.
Clavus papillaris (Cp)
Heloma papillare
Erheblich verdickte Papillarschicht. Findet sich auf dorsalen Zehengelenken oder der Fußsohle.
Clavus subungualis (Csu)
Heloma subunguale
Es gilt als Sonderform und bildet sich durch zu starken Druck und Scherkräfte unter der Nagelplatte, wobei starke Schmerzen erzeugt werden können.
Clavus vascularis (Cv)
Heloma vasculare
Als charakteristisches Zeichen kann man punktförmige Blutaustritte bezeichnen.
Clavusentzündung (Citis)
Bedeutet jegliche Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung, Schmerz des Clavus und seiner Umgebung. Häufige Ursachen sind barfuß laufen im geschlossenen Schuh ohne Strümpfe oder die unsachgemäße Anwendung von Hühneraugenpflastern.
Weiterführende Literatur
Die theoretische Darstellung der verschiedenen Formen ist hier nicht ausführlich möglich, weshalb auf das gängige Lehrmaterial verwiesen sei.
Begleiterscheinungen und Komplikationen Eine unangenehme Begleiterscheinung sind Deformierungen in der Papillarschicht und entzündliche Veränderungen in der Umgebung des in die Tiefe der Lederhaut eingedrungenen Dornes. Auch Veränderungen beim Auftreten und Gehen sind zu beobachten. Drückt der Hornkegel entsprechend seiner Lokalisation auf ein Gelenk, kann es zur Knochenhautreizung (Periostitis) und zu entzündlicher Verschmelzung mit der Umgebung der Gelenkkapsel kommen. Zum Teil entstehen sogar Abszesse (Eiterungsprozesse in geschlossenen Kavernen), wenn Keime durch Hornhautrisse einen Weg ins Innere des Hühnerauges finden. Flächig ausgebreitete Entzündungen (Phlegmonen) und Erysipele (Keimausbreitung in der Haut) können ebenso wie die Blutvergiftung (Sepsis) schlimme Komplikationen darstellen.
Beachte
Bei Hühneraugen unbedingt enges Schuhwerk vermeiden!
Behandlung Was das Abtragen des Hühnerauges mit dem Skalpell, Credo-Hobel, der Hornhautzange oder dem Hohlmeisel anbelangt, sei darauf hingewiesen, dass jede Schule anders lehrt, sich demnach auf eine bestimmte Methode der jeweiligen Lehrkraft beruft. Wir lehren europäischen Standard und sind der Meinung, dass ein Spezialist mit jedem Instrument sicher umgehen und es individuell in der Praxis einsetzen muss. Virtuoses Arbeiten beschert Erfolg, Freude und Patientenbindung und zeigt fachliche Kompetenz.
Praxistipp
An dieser Stelle sei ausdrücklich vor dem Umgang mit Ätzmitteln und Keratolytika wie Salizylsäure u. Ä. gewarnt! Grundsätzlich sollte kein Patient mit sog. Hühneraugenpflastern aus der Apotheke oder Drogerie zu Hause allein hantieren. Die Gefahr, dass diese Pflaster verrutschen, ist zu groß. Die Säure unterscheidet „nicht“ zwischen gesunder Haut und Verhornung. Es kommt allzu leicht zu einer Schädigung der dünnen Haut um das eigentliche Hühnerauge, weißlich aufgequollenes undifferenziertes Gewebe inmitten von rot entzündeter Umgebung ist die Folge. Es ist dann kaum möglich, das eigentliche Hühnerauge zu erkennen und schmerzlos zu entfernen. Nur der Podologe sollte im entsprechenden Fall einen ordnungsgemäßen Okklusivverband anlegen, ihn kontrollieren und ihn auch abnehmen.
1.1.2.2 Podologische Arbeitstechniken
Vor- und Nachteile manueller Techniken
Skalpell
Vorteile:
eignet sich für oberflächliche, weiche und elastische Verhornungen
ideal für einen geraden Hautschnitt (in der Chirurgie!)
abgetragene Hornhaut entfernt sich selbst bzw. fällt herunter (Selbstreinigung)
Nachteile:
keine Bleistifthaltung mit Drehung möglich, da der Griff „umklappt“
im interdigitalen Zehenbereich nur flächige Abtragung lateral oder medial möglich
bei interdigitaler Hühneraugenlage nicht zu empfehlen
durch den manuellen Druck des Instruments auf die entzündliche, schmerzhafte Hautoberfläche kann der Schmerz verstärkt werden
Credo-Hobel
Vorteile:
eignet sich für oberflächliche, weiche und elastische Verhornungen
transversale und vertikale Ausführung erhältlich
Nachteile:
nicht selbstreinigend (Hornhaut muss durch Öffnen des Hobels entfernt werden)
beim Zug durch die „oberflächliche“, unelastischere Hornhaut wird die „elastische, junge“ Haut mit nach oben in den Hobel gezogen, was zu enormen Schnittverletzungen führen kann
durch den manuellen Druck des Instruments auf die entzündliche, schmerzhafte Hautoberfläche kann der Schmerz verstärkt werden
Medihalter
Vorteile:
ideal und sicher durch zirkuläre Drehmöglichkeit in der Bleistifthaltung zum Entfernen von harten Hühneraugenkernen im Zwischenzehenraum, an der Fußsohle, am Fußrand, auf Gelenken usw.
ebenfalls virtuos in der Skalpellhaltung einzusetzen (Lehrmethode Bittig)
ideal zum präparativen „Schnitzen“ bei periungualen Verhornungen der Zehen
mit Klingengröße 3V und 8 kann das podologische Einsatzgebiet perfekt abgedeckt werden
Nachteile:
durch den manuellen Druck des Instruments auf die entzündliche, schmerzhafte Hautoberfläche kann der Schmerz verstärkt werden
leider gibt es unterschiedlich scharf geschliffene Klingenqualitäten auf dem Markt
zu viele verschiedene Klingenformen verunsichern den Käufer
ungenügende Beratung, z.B. auf Fachmessen bei den jeweiligen Firmen im Bezug auf Unterschiede bei der Anwendung
Zange
Vorteile:
Gegenüber dem Skalpell, Credo-Hobel und Medihalter ist nur das Handling unterschiedlich.
Nachteile:
Gerade die Form der Griffe und Zangengröße wirken sich entsprechend negativ auf das Handling aus, bis hin zur „Umständlichkeit“ (schräg geschliffener, besonders spitzer Zangenkopf verunsichert den ungeübten Behandler und ist gefährlich).
Die Bezeichnung „Diabetikerzange“ ist irreführend, einem podologischen Berufsanfänger wird somit suggeriert, dass er mit dieser „ungefährlichen“ Zange dem Diabetiker keine Verletzungen zuführen kann. Diese Aussage ist falsch!
Vor- und Nachteile maschineller Techniken
Hohlfräser
Vorteile:
Nur in geübter, erfahrener Hand geringerer Druck als manuelle Instrumente.
Nachteile:
hohe Verletzungsgefahr, besonders bei Zacken am Fräserkopfende
Einsatz nicht mehr zeitgemäß
durch hohe Umdrehung pro Minute (U/min) zieht sich der Hohlfräser leicht in die Haut, wenn zu viel Druck und zu deutliche Schräglage (Winkel) gewählt werden
Hohlraum schlecht von Hornhautrückständen zu säubern (unhygienisch!)
erhöhter Zeitfaktor durch übermäßig ängstliches, unsicheres und vorsichtiges Arbeiten (unrationell!)
unbefriedigendes Endergebnis
Diamantschleifer
Vorteile:
harte Hühneraugenoberfläche und Hornhautreste am Hautkrater können sehr leicht mit geringer Verletzungsgefahr geglättet werden
im Universal-Schleifset nach Bittig sind alle Formen zur Hühneraugenvorbehandlung enthalten
Nachteile:
hauptsächlich als „Vorarbeit“ geeignet, um die Arbeit in tieferen Schichten zu ermöglichen
gute Absauganlage erforderlich
Hartmetallfräser
Vorteile:
hervorragende Abrasivität
schnelles, rationelles Arbeiten möglich
viele Fräserformen ermöglichen durch unterschiedliche Verzahnung vielfältige Einsatzmöglichkeiten, entsprechend des ECO-Sets von Bittig zusammengestellt
verdrängt den Hohlfräser völlig
Nachteile:
Fußpflegemotor sollte mindestens 30000–40000 U/min vorweisen
gute Absauganlage erforderlich (ideal: Podo pure+, siehe Kap. ▶ 7.10)
Praxistipp
Podologische Grundsätze:
Jedes Hühnerauge ist ein eigenständiges Krankheitsbild.
Je nach Art des Hühnerauges wird der Patient individuell wieder einbestellt.
Nach jeder Hühneraugenbehandlung muss ein Druck- bzw. Reibungsschutz nach Verbandstechnik Bittig angebracht werden, dieser verzögert die Hornhautneubildung.
Hühneraugenpflaster sind gefährlich und unprofessionell; sie können verrutschen und die Säure daut die „gesunde Haut“ an, sodass es in der Folge zur schmerzhaften Entzündung um den Hühneraugenkern kommt.
Individuelle Orthosenanfertigung wird in der gängigen Fachliteratur und in der Ausbildung behandelt.
Einen 2nd Skin Spenco als Druckschutzverband anlegen.
Eine Silikon-Zehenkuppe wird empfohlen und angepasst; sie ist jedoch nicht den ganzen Tag zu tragen, da sich Feuchtigkeit ansammeln und die Haut aufweichen kann.
1.1.2.3 Behandlungs- und Praxisbeispiele
Clavus durus
Siehe ▶ Abb. 1.4, ▶ Abb. 1.5 und ▶ Abb. 1.6.
Abb. 1.4 Hornschwiele mit 3 eingelagerten Clavus durus dorsale an der V. Zehe. Nach der Entfernung des Hornhautdeckels mit der Medihalter-Hebeltechnik nach Lehrmethode Bittig (Klingenform 3V) sind die 3 Druckpunkte deutlich sichtbar. Propolis Lösung auf die Haut auftragen, antrocknen lassen und mit einem 2nd Skin Spenco Druckschutz (Verbandslehre nach Bittig) für 3–5 Tage auf der betroffenen Stelle fixieren.
Abb. 1.5 Schmerzhafter Clavus im medialen Nagelfalz der Großzehe.
Abb. 1.5a Zustand vor der podologischen Behandlung.
Abb. 1.5b Mit einer kleinen Eckenzange wurde ein Nagelkeil abgezwickt und vorsichtig die Inkarnatortechnik nach Lehrmethode Bittig angewandt. Schmerzhafte Kompressionsstelle sichtbar nach erfolgreicher Hornhautentfernung mit dem Medihalter Klingenform 3V. Medikation oder Propolis Lösung auftragen und 2nd Skin Spenco mit Omnifix fixieren.
Abb. 1.6 Entzündeter Clavus durus im Bereich des proximalen Interphalangealgelenks dorsal auf der II. Zehe einer weiblichen Patientin. Die Hühneraugen sind durch Reiter- bzw. Hammerzehen entstanden.
Abb. 1.6a Zustand vor der podologischen Behandlung.
Abb. 1.6b Mit einem Hartmetallfräser (424GQSR 040) wird der Horndeckel vorsichtig abgeschliffen und mit dem Medihalter Klingenform 3V der Wundrand begradigt. Ein Wundverband mit Prontoman Gel wird angelegt und eine proximale Druckentlastung des Gelenks für Tag und Nacht angebracht. Tägliche Kontrolle.
Abb. 1.6c Nach ca. 1 Woche ist die Wunde keimfrei, abgeheilt und die Patientin beschwerdefrei.Praxistipp: Zehenkissen empfehlen oder Korrekturorthose anfertigen.
Clavus mollis
Siehe ▶ Abb. 1.7, ▶ Abb. 1.8, ▶ Abb. 1.9 und ▶ Abb. 1.10.
Abb. 1.7 Clavus mollis interdigitalis. Deutlich zu erkennen ist der tiefe, schmerzhaft entzündete Hautdefekt. Die Patientin liebt es, ohne Strümpfe in ihren Pumps im Sommer zu laufen. Schnell wirksame Sprühdesinfektion mit Cutasept F oder Octenisept. Druckschutzmaßnahmen in Form von individuell zugeschnittenem Foam-O-Felt 5 mm, damit es zu einer Abheilung der Wunde kommen kann.Praxistipp: Prontoman Gel tägl. mit Wattestäbchen auftragen. Wiedervorstellung in 1–3 Tagen.
Abb. 1.8 Chronischer, nicht schmerzhafter Clavus mollis im IV. Interdigitalraum mit starkem Druckgefühl. Sprühdesinfektion vor der Behandlung mit Cutasept F oder Octenisept. Die oberflächliche Hornhaut wird mit dem Diamantschleifer 5894 065 abgeschliffen. Medikation oder Remmele’s Propolis Lösung auftragen.Praxistipp: Foam-O-Felt 5 mm distal der IV. und V. Zehe als Abstandhalter fixieren, um den Druck auf den Clavus zu verhindern und die Abheilung zu beschleunigen. Wiedervorstellung in ca. 1–3 Tagen.
Abb. 1.9 Akuter Clavus mollis mit starker Entzündung nach unsachgemäßem Gebrauch eines Hühneraugenpflasters. Vorsichtiges Abtragen mit Hartmetallfräser T431Speed Titan-Nitrit-Beschichtung. Verletzung vermeiden durch „Rückwärts-Schleiftechnik“ nach Lehrmethode Bittig! Medikation auf steriles Wundpflaster auftragen und festkleben. Unbedingt Druckschutz Foam-O-Felt 5 mm am proximalen Gelenk aufbringen, um die IV. und V. Zehen zu trennen! Anfangs tägliche Kontrolle und Verbandswechsel.
Abb. 1.10 Die weiche, elastische Verhornung zwischen den Zehen wurde mit dem Diamantschleifer 5894 065 geglättet. Die restliche Hornhaut wurde mit dem Medihalter Klingenform 3V entfernt.
Abb. 1.10a Zustand vor der podologischen Behandlung.
Abb. 1.10b Nach der podologischen Behandlung.
Clavus miliaris
Siehe ▶ Abb. 1.11 und ▶ Abb. 1.12.
Abb. 1.11 Multiple Hühneraugenkerne (Clavus miliaris) im plantaren Vorfußbereich.
Abb. 1.11a Zustand vor der podologischen Behandlung.
Abb. 1.11b Mit dem Medihalter Klingenform 3V werden nach der Lehrmethode Bittig die harten Hühneraugenkerne zirkulär ausgeschält.Praxistipp: Eine Druckentlastung durch weiche Metapolster ist zu empfehlen. Die Patientin sollte sich spezielle Einlagen beim Orthopädieschuhmacher anfertigen lassen.
Abb. 1.12 Rechter und linker Fuß im Vergleich. Achtung, kein Fall für Berufsanfänger oder „Kurzausgebildete“!
Abb. 1.12aa, b Multipler Befall von „Hornkugeln“ unterschiedlichster Größe bis hin zum Clavus durus et neurofibrosus.
Abb. 1.12b
c, d
c, d Plantaransicht beider Füße in Großaufnahme vor der Behandlung.
e, f Hautzustand nach der podologischen Behandlung. Mit groben Hybrid Twistern wurden die kugelförmigen Verhärtungen auf der Oberfläche abgeflacht und elastifiziert. Danach wurde mit Hartmetallfräsern 424GQSR 060, 424GQSR 040 und T431Speed 031 die tiefer gelegene Verhornung verdünnt. Nun kommt der Allpresan Podoexpert Hornhautweicher zum Einsatz. Großflächig wurden die Fußsohlen eingesprüht. Nach entsprechender Einwirkdauer konnte Skalpell- und Hohlmeiseltechnik angewendet werden. Skalpell Klingenform 10 und Hohlmeiselklingenform 8 und 3V kamen zum Einsatz. Medikation und zur täglichen Anwendung Podoexpert Repair Creme oder Repair Schaum-Creme zur therapiebegleitenden Pflege zur Vorbeugung gegen Hautpilz.
Clavus papillaris
Siehe ▶ Abb. 1.13.
Abb. 1.13 Clavus papillaris: Scharf umrissener Rand mit mazerierter Kernumgebung. Praxistipp: Sehr therapieresistent und sehr empfindlich auf seitlichen Druck. Eine Kaustika-Anwendung führt zu einer Entzündungsreaktion (Pus), die an eine traubenförmige Papille erinnert. Prontoman Gel oder Propolis Lösung wird als dekontaminierende Anwendung empfohlen. Unbedingt Druckentlastung mit kreisförmig ausgeschnittenem Foam-O-Felt 5 mm (Verbandstechnik nach Bittig) und Fixation mit Omnifix.
Clavus neurofibrosus
Siehe ▶ Abb. 1.14 und ▶ Abb. 1.15.
Abb. 1.14 Clavus neurofibrosus medioplantare linke Großzehe mit faserreicher, verhornter Umgebung. Praxistipp: Vorsichtige Abtragung der zwischen den Papillen liegenden Verhornungen mit hochtourig rotierenden Instrumenten, „ohne zusätzlichen Druck“ zu verursachen. Keine Kaustika (hochprozentig) verwenden! Therapieresistent, wenn die Prädisposition nicht behoben wird! Überweisung zum Orthopädieschuhmacher.
Abb. 1.15 Harte Schwielenoberfläche an der dorsalen V. Zehe links, die nach Entfernung einen Clavus neurofibrosus zutage bringt.Praxistipp: Nach Hornhautentfernung wird ein 2nd Skin Spenco Druckschutzverband nach Lehrmethode Bittig angelegt.
Clavus neurovascularis
Siehe ▶ Abb. 1.16 und ▶ Abb. 1.17.
Abb. 1.16 Apex III. Zehe stark verhornt und mit einem Blutgefäß lokalisiert.
Abb. 1.17 Die starken Schmerzen gehen von einem Nervenimpuls von der Apex der II. Zehe aus, die verhornt ist. Darin befindet sich ein Blutgefäß. Die Verhärtung vorsichtig mit dem Hartmetallfräser 424 GQSR 040 abtragen und die weitere Feinarbeit mit der Hohlmeiselklinge 3V durchführen. Dann wird ein 2nd Skin Spenco Druckschutzverband nach Lehrmethode Bittig angelegt.
Clavus vascularis
Siehe ▶ Abb. 1.18.
Abb. 1.18 Clavus vascularis mit starker Verhornung der lateralen V. Zehe links. Mit Hartmetallfräser M426X 023 wurde die harte Hornhaut abgenommen. Propolis Lösung auftragen und antrocknen lassen. Praxistipp: Nach der Hornhautentfernung ist ein 2nd Skin Spenco Verband nach Lehrmethode Bittig als Druckschutz anzulegen.
Sonderformen Clavi apex (Cap)
Siehe ▶ Abb. 1.19, ▶ Abb. 1.20 und ▶ Abb. 1.21.
Abb. 1.19 Multiple Clavi bilden an der Apex starke, deckelartige Hyperkeratosen.
Abb. 1.19a Besonders stark ist die II. Zehe betroffen.
Abb. 1.19b Mit Hartmetallfräser 424GQSR 060 wurde die „knöcherne“, holzartige Masse grob abgetragen und mit den Hartmetallfräsern 424GQSR 040 und M426X 023 die verbliebene Hornhaut elastifiziert. Danach traten Clavus neurovascularis et Clavus neurofibrosus in trauter Zweisamkeit in Erscheinung. Multiple Clavus-vascularis-Ansammlung an fast jeder Zehenkuppe.Praxistipp: Eine plantare Orthose zur Unterstützung und Zehenkuppenentlastung ist angezeigt. Schmerzhafte Zehenkuppen müssen mit einem 2nd Skin Spenco Verband nach Lehrmethode Bittig versorgt werden. Weiterempfehlung zum Orthopädieschuhmacher.
Abb. 1.20 Eine schmerzhafte, überdimensionierte Keratose/Verknöcherung der Apex II. Zehe.
Abb. 1.20a Dieser Befund überfordert den podologischen Berufsanfänger, da ihm die Erfahrung und die noch fehlenden podologischen Praktiken der Fußprofis fehlen. Fußpfleger mit sog. Kurzausbildung an 4 Wochenenden oder 1-wöchigen Lehrgängen sollten sich zurückhalten, denn jegliche Selbstüberschätzung kann zu einer „Körperverletzung“ führen.
Abb. 1.20b Die Hyperkeratose wurde mit dem Hartmetallfräser 424GQSR 060 und 424GQSR 040 vorsichtig abgetragen.Praxistipp: Nach Medikation wurde zur Druckentlastung ein 2nd Skin Spenco Verband an der Zehenkuppe befestigt (Verbandstechnik nach Bittig) und die Patientin nach ca. 3–5 Tagen zur Nachbearbeitung einbestellt.
Praxistipp
Nach einer massiven Hornhautentfernung an der Zehenkuppe muss grundsätzlich ein Druckschutzverband angelegt werden. 2nd Skin Spenco ist die ideale Druckschutzlösung für den Profi. Diese Spezialverbände können beim Autor in seiner podologischen Lehrpraxis erlernt werden.
Abb. 1.21 In die Nagelplatte übergehendes Hornkonglomerat, das die Patientin über Monate tolerierte. Sie betrat humpelnd unsere Fußambulanz.
Abb. 1.21a Zustand vor der podologischen Behandlung.
Abb. 1.21b Subunguale Hyperkeratose drückt die Nagelplatte in dorsale Richtung und ein Clavus neurofibrosus zeigt sich nach der schwierigen Abtragung des Mischgewebes mit Hartmetallfräser 424GQSR 040. Mit dem Medihalter Klingenform 3V wurde die elastische Haut präpariert.
Abb. 1.21c Nach Sprühdesinfektion mit Cutasept F und Medikation wurde ein luftdurchlässiger Snögg Wundverband angelegt.
Abb. 1.21d Das positive Behandlungsergebnis nach 3 Wochen.
Clavus subungualis
Siehe ▶ Abb. 1.22.
Abb. 1.22 Schmerzhafter Clavus subungualis beider Großzehen nach podologischer Behandlung der Nagelplatte.
Clavusentzündung (Citis)
Siehe ▶ Abb. 1.23, ▶ Abb. 1.24, ▶ Abb. 1.25, ▶ Abb. 1.26 und ▶ Abb. 1.27.
Abb. 1.23 Weibliche Patientin, die sich nach einem Stadtbummel, ohne Strümpfe im Schuh (Pumps) zu tragen, mit akut entzündetem Hühnerauge in meiner Praxis vorstellte.
Abb. 1.23a Zustand vor der podologischen Behandlung.
Abb. 1.23b Zustand nach kompletter Ablösung der entzündeten Haut. Prontoman Gel wird aufgetragen und ein steriler Wundverband angelegt. Anfangs täglicher Verbandswechsel.
Abb. 1.23c 8 Tage nach Behandlungsbeginn ist die Wunde verheilt.
Abb. 1.24 Clavi-Entzündung.
Abb. 1.24a Patientin klagt über starke, stechende Druckschmerzen an der lateralen Seite der rechten Kleinzehe bei leichter, oberflächlicher Verhornung. Die Patientin geht fast immer „ohne Strümpfe“ in geschlossenen Schuhen. Eine Eiterblase entleert sich spontan nach Abschleifen der Verhornung mit dem Hartmetallfräser T431 Speed 031.
Abb. 1.24b Der Blick in die Tiefe lässt ein Clavus mollis papillaris vermuten, obwohl ein „harter“ Hornhautdeckel vorlag.Praxistipp:




























