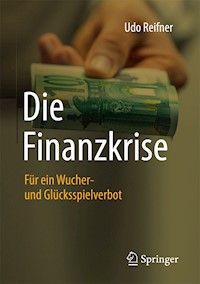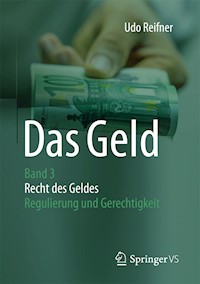Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sparen für die Bildung der Kinder ist nicht nur gesamtgesellschaftlich gesehen eine sinnvolle Altersvorsorge. Bisher wurden Bildung des Nachwuchses und private Vorsorge jedoch voneinander getrennt betrachtet. Das gilt darüber hinaus auch für die vom Einkommen der Eltern abhängige Studienförderung durch das BAföG. Dass alles zusammengehört, verdeutlicht dieses Buch, das die Ergebnisse von zwei vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegebenen Projekten zusammenfasst und so ein virtuelles „Zukunftskonto“ entwickelt, das alle Geldströme miteinander verknüpft. Das Buch zeigt, dass es nicht ausreicht, nach Art der Vermögensbildung für Arbeitnehmer das Sparen zu subventionieren. Sollen gerade die bildungsfernen Schichten erreicht werden, muss die Doppelbelastung durch Altersvorsorge und Bildungssparen abgebaut werden, indem die Sparbeiträge bei Nicht-Gebrauch auch für die Rente im Alter nutzbar sind. Außerdem muss sichergestellt werden, dass das Vermögen der Sparer genauso vor dem Zugriff eventueller Gläubiger geschützt wird wie es bei der Altersvorsorge der Fall ist. Da bildungsferne Schichten auch als Verbraucher häufig in der schwächeren Position sind, muss der Staat dafür sorgen, dass seine Subventionen nicht durch unseriöse Finanzakteure abgeschöpft werden. Im rechtlichen Teil werden daher Verbraucherschutz, Subventions- und Steuerrecht sowie die rechtlichen Bestimmungen der Altersvorsorge so aufeinander abgestimmt, dass diese Ziele erreicht werden können. Ein weiterer Schritt besteht darin, die Nutzung des Angesparten mit einem Multiplikatoreffekt zu versehen, indem Anbieter den Übergang in einen Ausbildungskredit ebenfalls mit abdecken. Der angesparte Betrag hilft, Probleme bei der Rückzahlung zu absorbieren und damit eines der größten Probleme privater Studienfinanzierung angeht: die Überschuldung der ehemaligen Studierenden. Im zweiten Teil wird analysiert, welche Bedarfe es hierfür gibt und wer das Zukunftskonto mit welchen Anreizen zu Bildung, Sparen oder Altersvorsorge wahrscheinlich nutzen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriftenreihe des
Instituts für Finanzdienstleistungen e. V.
Band 18
Prof. Dr. Udo Reifner (Projektleitung), Prof. Dr. Arndt Schmehl, Dr. Niklas Korff, RA Michael Knobloch, Dipl. Volkswirt Michael Feigl
mit Beiträgen von
Prof. Dr. Saul Schwartz (Ottawa), Dr. Silvana Stahl (Rostock),
stud. rer.pol. Frank Osterloh, stud. rer.pol. Kerstin Jürgenhake, stud. rer. pol. Jan Schulze (Hamburg) und einem Untersuchungsdesign für eine Marktstudie der infas GmbH,
Dr. Helmut Schröder, Dr. Johannes Leinert
Vorwort
Die Studie beruht auf einem Vorhaben des Bundesministeriums für Forschung und Technologie, das die Möglichkeiten eines geförderten Sparens für die Bildung der Kinder in zwei Schritten untersuchen ließ. Mit beiden Gutachten wurde das institut für finanzdienst-leistungen e.V. beauftragt. Das erste Gutachten zum Thema „Rechtsfragen des Zukunfts-kontos“ BMBF AZ 01WS1110 wurde durch Prof. Dr. jur. Dipl. Soz. Udo Reifner, Prof. Dr. jur. Arndt Schmehl und Dr. Niklas Korff erstellt.
Das hier vorgelegte Gutachten wurde ebenfalls unter Leitung von Prof. Dr. Udo Reifner (Dipl. Soz.) zusammen mit dem Autor des jährlichen Überschuldungsreports Herrn Rechtsanwalt Michael Knobloch sowie Dipl. Volkswirt Michael Feigl am iff erstellt. Von stud. rer. pol. Jan Schulze wurden das Konzept der Bildungsferne und zur Situation beim Berufsbildungsangebot im dualen System erstellt. Neben der Auswertung allgemein zugänglicher Daten hat das iff mit Unterstützung des Soziologen Prof. em. Dr. Wilfried Laatz (Universität Hamburg) eigene statistische Auswertungen von Panelumfragen wie SOEP und EVS vorgenommen. Hierzu gehören die Identifikation bildungsferner Haushalte und ihre Nutzung von Anlageprodukten sowie die finanziellen Möglichkeiten der Bildungsvorsorge bei Eltern und Großeltern.
Aus Sicht des Bankenmarketing hat ferner Frau Dr. Silvana Stahl, Universität Rostock, mit einem betriebswirtschaftlichen Entscheidungsansatz einen Vergleich der Nutzungsprobleme bei der Riesterrente mit den zu erwartenden Nutzungsproblemen beim Zukunftskonto eingebracht.
Überdies hat der Ökonom Prof. Saul Schwartz (Universität Ottawa) ein Kapitel zur Frage beigesteuert, welche Gründe und Lösungsmöglichkeiten für Fehlnutzungen in Kanada, dem Land mit den wohl profiliertesten Erfahrungen beim Bildungssparen, gezogen wurden. Es wurde von der Wirtschaftsstudentin Cathrin Ulikowski übersetzt.
Schließlich haben unter Anleitung des Projektleiters die Soziologiestudierenden Kerstin Jürgenhake und Frank Osterloh eine empirische Befragung bei türkischen Migranten in Bezug auf wesentliche, im Projekt ermittelte Nutzungsparameter durchgeführt.
Hamburg, den 10. November.2014
Zusammenfassung
1. (Definition) Das Zukunftskonto stellt eine virtuelle Zusammenfassung von in verschiedener Form angesparten Geldbeträgen (Sparvermögen) einschließlich der darauf bezogenen Forderungen auf Zahlung staatlicher Förderung (Prämienanwartschaften) dar, die während einer nachschulischen Bildungszeit vom Begünstigten verbraucht werden können.
Der Sparvorgang wird anfänglich mit einer Prämienanwartschaft von 150€ bei einer Einlage von 20€ bezuschusst und dann jährlich bis zum 18. Lebensjahr mit einer Prämienanwartschaft in Höhe von 33% des gesparten Betrages (max. 100€) bedacht, so dass 7.350€ zuzüglich der auf die eingezahlten Beträge entfallenden Zinsen als gefördertes Startkapital erreicht werden können, die einen Zuschuss während eines üblichen Studienverlaufs von monatlich 132€ erlauben könnten.
Durch eine Nutzung des Zukunftskontos, seiner Zahlungsgeschichte als Sicherheit und Prognoseinstrument in der Kreditvergabe, könnte es Zugang zu einem privaten Studiendarlehen vermitteln, das bis nahe an eine Vollfinanzierung heranreichen würde.
2. (Zwecksparen) Das Zukunftskonto gehört zur Vermögensbildung bei einkommensschwächeren Schichten (Arbeitnehmersparzulage, Bausparen, Riesterrente, betriebliche Altersvorsorge). Es handelt sich jedoch um Zwecksparen, ähnlich der Altersvorsorge. Statt Vermögensbildung geht es somit um Bildungsvermögen, das grundsätzlich immaterieller Natur ist und damit weniger Gemeinsamkeiten mit den anderen Systemen der Vermögensbildung hat. In das System der Bildungsfinanzierung insbesondere über das BAföG lässt sich das Zukunftskonto insoweit gut einfügen, als der Unterschied zwischen Kredit- und Sparfinanzierung für das System weniger bedeutsam ist, weil nur der Zeitpunkt des Sparens (Nachsparen beim Kredit) verschoben ist und daher bereits im Wohn-Riester-Vertrag die Kredittilgung als Sparen anerkannt wurde. Insofern bietet es sich an, beim Zukunftskonto das eigenverantwortliche Finanzieren von Bildung in den Mittelpunkt zu stellen und damit sowohl Sparen wie auch Kredit zu ermöglichen.
3. (Soziales) Die soziale Komponente des Zukunftskontos liegt nicht in der Fokussierung der Förderungsinhalte, sondern darin, dass die Zielgruppe Kinder mit ungewissem zukünftigen Bildungsvermögen sind, sozialkompensatorische Möglichkeiten im Ansparvorgang durch Stiftungen, Arbeitgeber und Staat möglich bleiben und schließlich die Schonung des Vermögens gegenüber Gläubigern schichtenspezifisch wirkt.
4. (Produkte) Modelle für die Produkte, die im Zukunftskonto geführt werden können und dabei eine optimale Zweckerreichung erlauben, ergeben sich im Sparvorgang aus den zertifizierten Riester-Verträgen, wobei die notwendige Flexibilität bei Ein- und Auszahlung im Bildungssparen noch durch neue Produktvarianten bei privater Rentenversicherung und Bausparverträgen entwickelt werden muss. Für die Kombination von Sparen und Darlehen bietet das Bausparsystem Vorbilder. Aus Gesichtspunkten des Verbraucherschutzes sollten einige wenige Anforderungen an die Produkte gesetzlich normiert werden wie insbesondere die Festlegung des Begriffs „Zukunftskonto“ im Gesetz, um die unlautere Nutzung in der Werbung auszuschließen, die Angabe eines zusätzlichen Zinssatzes, der bei Sparkreditkombinationen die Gesamtkosten aus beiden Produkten ausweist sowie ein Tilgungsplan bei Darlehensverträgen vor deren Abschluss.
5. (Förderung) Modelle für die Förderung können an das BAföG-System (sowie die Bildungsurlaubsgesetze der Länder) angelehnt werden. Sie weisen die gegenüber Wohneigentum, Alter und Vermögensbildung spezifischen Bedingungen der Bildungsfinanzierung auf, die eine hohe Flexibilität, altruistische Möglichkeiten, eine Integration von (Vor-)Sparen und Nachsparen (Kredit) erlauben. Damit empfiehlt es sich, das Zukunftskonto in drei Phasen zu unterteilen: die Sparphase mit reduzierten Entnahmemöglichkeiten, die (berufliche) Ausbildungsphase mit der dem BAföG angepassten Entnahmemöglichkeit und Zweckbindung sowie die Fort- und Weiterbildungsphase, die zusätzlich auch an die Zwecksetzungen des Bildungsurlaubs anschließen kann, wobei politische Entscheidungen über die genauen Einzelheiten noch zu treffen sind. Anders als bei Subventionsmodellen geht es beim Zukunftskonto darum, die staatliche Förderung im Wesentlichen als effektives Anreizsystem zum eigenen Sparen zu nutzen und damit Multiplikator-Effekte zu erzielen.
6. (Verwaltung) Die Verwaltung des Zukunftskontos selbst sollte einer zentralen Behörde übertragen werden, zu deren Aufgaben bisher schon ähnliche Aufgaben gehören. Im Bereich der Prüfung der zweckgerechten Verwendung sollten dagegen die sach- und ortsnahen Ämter für Ausbildungsförderung zuständig sein. Bezüglich der Zulassung der Produkte käme eine Zuständigkeit der für die Zertifizierung der Riester-Produkte zuständigen Behörde in Frage. Eine Zertifizierung erscheint jedoch unverhältnismäßig; stattdessen wird es genügen, wenn die Stelle, bei der das Zukunftskonto als virtuelles Konto zu führen ist, Listen der Produkte veröffentlichen, für die sie die Zulassung erteilt hat.
7. (Verwendung) Die Verwendung sollte so flexibel wie möglich, jedoch zur Erhaltung der sozialen Sicherung als Schonvermögen, so zweckgebunden wie nötig strukturiert sein. Von daher empfiehlt sich, eine am Angehörigenbegriff des Steuerrechts orientierte begrenzte Übertragung zuzulassen. Schädliche Entnahme bleibt möglich und führt zum Verlust der entsprechenden An-wartschaften auf Förderung. In der Sparphase sollte darüber hinaus wegen der Gläubigerbenachteiligung die Entnahmefrist mindestens zwei Jahre betragen.
8. (Zwecksicherung) Bei der Zweckfestlegung wird zwischen rein funktionalen bzw. inhaltlichen Gesetzesdefinitionen (materielle Feststellung von Bildung) und institutionell unterfütterten Definitionen (v.a. Angebote qualifizierter Institutionen) aus Gründen der Rechtssicherheit, Verwaltungsvereinfachung und Sachnähe vor allem für Letzteres optiert. Eine Umwandlung in andere geförderte Sparformen wäre nur möglich, wenn deren Zugangsbedingungen zeitgleich während des Sparvorgangs auch erfüllt sein können. Dies ist allerdings nicht der Fall, da der Sparvorgang während der Kindheit des Begünstigten erfolgt und damit die anderen Fördersysteme systemwidrig allein für diese Übernahme erweitert werden müssten.
9. (Regelung) Eine Regelung kommt rechtssystematisch als Einzelgesetz oder als zusätzlicher Abschnitt des BAföG infrage, an das die Normen möglichst eng anzulehnen sind. In Bezug auf die verbraucherschützenden Materien des Absatzes von Finanzdienstleistungsprodukten ebenso wie der Informationspflichten gibt es keine Besonderheiten dieser grundsätzlich privatrechtlich organisierten Anlage- und Kreditprodukte. Hier gelten die produktspezifischen Regeln von BGB, Investmentgesetz und VVG. Besondere Beachtung verdient die Rechtsprechung zu Kombinationskrediten, wo Sparen und Kredit parallel laufen und die Umleitung von Tilgungsleistungen in ein Ansparprodukt (Kapitallebensversicherungskredite, Bausparsofortfinanzierung) kritisch bewertet werden. Die vorliegende Konstruktion eines Vorsparens zur Kreditsicherung ist dagegen in der Praxis bisher nicht üblich und weist auch nicht die für Kombinationsprodukte typischen Gefahrenelemente auf.
10. (Gesetzesvorschlag: Rohentwurf) Zusammenfassend ergeben sich die zu regelnden Merkmale aus dem nachfolgend ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne eingehende Berücksichtigung anderer Gesetze, die u.a. aus Gründen des Schonvermögens (dazu Parallelgutachten) zu ändern wären, erstellten Rohentwurf, der als Leitfaden dient und gegebenenfalls in einer zweiten Projektentwicklungsphase, nach den weiteren notwendigen politischen Zwischenentscheidungen, zur Vorlagereife im Gesetzgebungsverfahren zu führen wäre:
Rohentwurf
Konzept eines Gesetzes zur Einführung der Förderung der privaten Bildungsvorsorge durch das Zukunftskonto (Zukunftskonto-Gesetz)
Art. 1
Gesetz zur Förderung der privaten Bildungsvorsorge durch das Zukunftskonto (Zukunftskonto-Gesetz)
§ 1 Zukunftskonto
(1) Für Personen, die dem in § 8 BAföG genannten Personenkreis angehören, werden Guthaben aus Sparbeiträgen und Vermögensanlagen auf Antrag in einem geförderten Zukunftskonto verbucht, wenn
1. diese Anlagen vor Eintritt der Volljährigkeit für eine ausschließliche Verwendung i.S.v. § 3 dieses Gesetzes angespart werden,
2. während der Sparphase auf mindestens 2 Jahre festgelegt wurden und
3. durch geeignete Vorkehrungen gewährleistet ist, dass mindestens der eingezahlte Nominalbetrag zum jeweiligen Ausgabenzeitpunkt zur Verfügung stehen wird.
(2) Die zuständige Behörde ermittelt entsprechend den Meldungen über die zum Jahresende erreichten Sparbeiträge das Ansparvermögen sowie die erreichten Prämienanwartschaften und eröffnet der berechtigten Person die Möglichkeit, einmal jährlich den Kontostand einzusehen. Die zuständige Behörde zahlt bei der Verwendung die Förderung so aus, dass das zweckgebundene Sparguthaben um die Prämie erhöht wird.
§ 2 Förderung
Die Förderung wird bis zu ihrer Verwendung in der Form von Prämienanwartschaften auf dem Zukunftskonto geführt. Sie beträgt für das jeweils erste Jahr des Sparens 150€ bei Einzahlung von mindestens 20€ sowie 33% des in den Folgejahren jeweils angesparten Betrages, soweit dieser 333€ nicht übersteigt. Die Prämienanwartschaften werden mit Wirkung zum Beginn einer zweckgerechten Verwendung in einen Anspruch auf Auszahlung in entsprechender Höhe auf ein gefördertes Guthabenkonto umgewandelt.
§ 3 Verwendung
(1) Das auf dem Zukunftskonto geführte prämienbegünstigte Guthaben kann nur zum Zwecke
1. der Ausbildung im Sinne des Abschnitts I des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
[weitere, zusätzliche Optionen zur Erweiterung – hier als Baukasten gedacht:]
2. der Berufsausbildung im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG
3. der Berufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes
4. der Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
5. der Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme, die nach Landesrecht von der hierfür zuständigen Behörde als für die Wahrnehmung eines landesrechtlichen Anspruchs auf Bildungsurlaub bzw. beruflicher Freistellung zu Bildungs- oder Qualifikationszwecken anerkannt ist, verwendet werden.
(2) Die Verwendung kann durch Entnahme und Verbrauch des Guthabens oder durch Einsatz des Guthabens als Sicherheit für die Rückzahlung eines zu dem Verwendungszweck aufgenommenen Darlehens erfolgen.
(3) Der späteste Zeitpunkt der prämienbegünstigten Verwendung entspricht [ggf.: im Falle von § 3 Nr. 1 bzw. außer in den Fällen von § 3 Nr. 5 oder ggf. weiteren Nummern] dem sich aus § 10 Abs. 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ergebenden Zeitpunkt.
§ 4 Finanzprodukte
(1) In das Zukunftskonto aufgenommen werden nur Beträge aus liquiden Finanzprodukten, die den Anforderungen dieses Gesetzes genügen.
(2) Soweit die Nutzung der verbuchten Beträge zur Kreditaufnahme erfolgt, muss der Darlehensvertrag zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben einen Gesamtzinssatz ausweisen, der die Zahlungsströme aus Sparanlage und Darlehen berücksichtigt. Ferner ist dem Darlehensnehmer vor Darlehensabschluss ein anfänglicher Zahlungsplan auszuhändigen.
§ 5 Übertragbarkeit und Pfändungsschutz
Die auf dem Zukunftskonto verbuchten Beträge können nur an Angehörige i.S. des § 15 AO und nur insoweit übertragen werden, wie die darin eingestellten Forderungen einer Person zustehen, die die Bedingungen der Förderung in gleicher Weise erfüllt. Im Übrigen sind Übertragung und Pfändung ausgeschlossen. Soweit das auf dem Zukunftskonto verbuchte Vermögen gefördert wurde, ist es Schonvermögen und gilt nicht als Vermögen oder Einkommen des Begünstigten in Bezug auf Ansprüche auf öffentliche Leistungen, Unterhalt oder in der Insolvenz.
§ 6 Beendigung
Das Zukunftskonto einschließlich der darin versprochenen Anwartschaften erlischt, wenn mit Förderung bedachte Beträge außerhalb der nach § 3 zugelassenen Möglichkeiten verwendet werden.
§ 7 Zuständigkeiten
(1) Das Zukunftskonto nach §§ 1 und 2 wird von der Zentralen Stelle für das Zukunftskonto verwaltet. Sie wird bei [Behörde der unmittelbaren oder mittelbaren Bundesverwaltung eintra-gen] eingerichtet.
(2) Für Entscheidungen über die zulässige Verwendung nach § 3 sind die Ämter für Ausbildungsförderung zuständig.
Art. 2 Änderung des BAföG
[In § 27 Abs. 2 Ziff. 1 BAföG werden am Ende die Worte „und Leistungen aus Vermögen i. S. des Bildungsvorsorgegesetzes“ ergänzt.]
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zusammenfassung
Rohentwurf
Erster Teil: Das Zukunftskonto als Förderprodukt
1 Grundfragen
1.1 Wozu dient das Zukunftskonto?
1.1.1 Definition
1.1.2 Welche bildungspolitische Bedeutung soll es haben?
1.1.2.1 Finanzieller Nutzen für den/die Studierende(n)
1.1.2.2 Bildungspolitischer Nutzen für den Zugang bildungsärmerer Schichten
1.1.2.3 Konsequenzen für die Produktgestaltung
1.2 Wie passt das Zukunftskonto in die Vermögensbildung?
1.2.1 Allgemeine und spezielle Zwecke
1.2.2 Vermögensbildung und Bildungsvermögen
1.2.3 Umlage- und Kapitalstockverfahren im Bildungssystem
1.2.4 Konsequenzen
1.3 Wie soll gespart und gefördert werden?
2 Welche Produktmodelle kommen infrage?
2.1 Produktprofil
2.2 Sparen (Riester Modell)
2.3 Kredit
2.4 Sparen zum Kredit (Modell „Bauspardarlehen“)
2.5 Kreditsparen (Modell „Kapitallebensversicherungs-kredit“)
3 Welche Fördermodelle kommen infrage?
3.1 „BAföG-Modell“
3.1.1 Gemeinsame Zugangsbedingungen
3.1.2 Vermögen
3.1.3 Anrechenbar als Einkommen? (§ 21 BAföG)
3.1.4 Insolvenzfestigkeit
3.2 „Riester-Modell“
3.3 „Bausparförderungsmodell“
3.4 Fördersystem des Zukunftskontos
3.5 Zwecksicherung
4 Zwischenergebnis: Das Modell Zukunftskonto
4.1 Festlegungen
4.2 Produktmerkmale
4.3 Sparförderung, Verwendungskontrolle und Reporting
4.4 Erweiterungen
Zweiter Teil: Rechtliche Ausgestaltung
5 Rechssystematische Einordnung
5.1 Gesetzessystematische Einordnung
5.1.1 Zuordnung zum BAföG
5.1.2 Zuordnung zum EStG
5.1.3 Eigenständiges Gesetz über das Bildungssparen
5.1.4 Bewertung
5.2 Rechtliche Einordnung des Zukunftskontos selbst
6 Privatrechtliche Konstruktion der Sparprodukte
6.1 Geeignete Bildungssparprodukte im System der Riester Verträge
6.1.1 Klassische Private Rentenversicherung
6.1.2 Banksparplan
6.1.3 Fondssparplan
6.1.4 Genossenschaftsanteile und Immobilienkredite
6.1.5 Bausparverträge
6.2 Anlagekriterien nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG)
6.2.1 Festanlage bis zum Eintritt der Bedingung und Kündigung
6.2.2 Nominalwertgarantie
6.2.3 Möglichkeit des Anbieterwechsels
6.2.4 Umwandlung in andere geförderte Anlageformen
6.2.4.1 Umdeutung beim Begünstigten
6.2.4.2 Umdeutung beim Sparer
6.2.4.3 Zweckerweiterung
6.2.5 Übertragbarkeit
6.3 Zahlungsströme
6.3.1 Einzahlungen
6.3.2 Auszahlung
6.4 Unlautere Werbung (UWG)
6.4.1 Schutz des Bildungszwecks
6.4.2 Klagerecht und Vertragsauflösung
6.4.3 Koppelungsangebot
6.5 Vertrieb (WpHG)
6.5.1 Vermittler
6.5.1.1 Sachkundeprüfung
6.5.1.2 Berufshaftpflichtversicherung
6.5.1.3 Registrierung
6.5.2 Dokumentation
6.5.3 Aufsicht
6.6 Produktinformation (AltZertG, VVG, InvG)
6.6.1 Altersvorsorgeprodukte (AltZertG)
6.6.2 (Renten)Versicherungsprodukte (VVG)
6.6.3 Fonds (InvG)
7 Privatrechtliche Konstruktion des Kreditsparens
7.1 Der „Kapitalbildungskredit“
7.2 Modelle im geltenden Recht
7.2.1 Privates BAföG
7.2.2 KfW-Bildungskredite
7.2.3 Umgekehrter Generationenvertrag (z.B. Universität Witten/Herdecke)
7.3 Elemente des Kreditsparplans
7.3.1 Rahmenvertrag eines Kreditsparmodells
7.3.2 Höhe des Darlehens
7.3.3 Laufzeit
7.3.4 Zinssatz
7.3.5 Rückzahlungsmodalitäten
7.3.6 Zahlungsschwierigkeiten: Stundungsmodelle und Kündigung
7.3.7 Recht auf Darlehenserhalt
7.4 Verbraucherschutz bei verbundenen Geschäften
7.4.1 Verbundene Geschäfte
7.4.2 Widerrufsrecht
7.4.3 Effektivzins- und Gesamtbetragsangabe bei Kombiprodukten
7.4.4 Übertragbarkeit
8 Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz
8.1 Gesetzgebungskompetenz
8.2 Gesetzgebungsverfahren
8.3 Verwaltungskompetenzen
8.4 Einflussnahme auf die Produktgestaltung
8.5 Differenzierung nach Anbietern
8.6 Die Kontenverknüpfung
9 Steuerrechtliche Bewertung
10 Umsetzung im Subventionsrecht
10.1 Gerichtsfeste Bildungszweck-Definition
10.1.1 Ziel der gesetzlich zu treffenden Definition
10.1.2 Vielfalt und Systematisierung der Bildungsbegriffe (funktionale und institutionelle Begriffsbildungen)
10.1.3 Bildung und Weiterbildung im umfassenden Sinne
10.1.4 Steuerrechtliche Begriffe und die Frage ihrer Nutzbarkeit für das Zukunftskonto
10.1.4.1 Berufsausbildung im Sinne des Sonderausgabenabzugs
10.1.4.2 Fortbildung und Weiterbildung
10.1.4.3 Berufsausbildung im Sinne des steuerlichen Familienleistungsausgleichs (Kinderfreibetrags)
10.1.4.4 Berufsausbildung im Sinne des steuerlichen Werbungskostenbegriffs
10.1.5 Berufsbildung und berufliche Ausbildung im arbeits- und berufsbildungsrechtlichen Sinne
10.1.6 Bildungsbegriffe der Landesgesetze über den Bildungsurlaub bzw. die Bildungsfreistellung
10.1.7 Ausbildungsbegriff des BAföG
10.2 Kappungsgrenzen sonstiger Förderung
10.3 Förderung
10.3.1 Nutzer
10.3.2 Art der Förderung und Fälligkeit
10.3.3 Verwaltung der Daten
10.4 Umwandlung in Altersvorsorgevermögen
10.5 Förderungsversagung
11 Elemente eines Gesetzesentwurfs
Dritter Teil: Allgemeine Nutzungsanalyse
12 Bildungsbedarf
12.1 Berufsbildungsangebote in Deutschland
12.2 Bildungsteilnehmer
12.3 Bildungsbenachteiligung
12.3.1 „Bildungsferne“ als Konzept
12.3.2 Empirischer Überblick
12.3.3 Beruflichen Bildung und Weiterbildung
12.3.4 Studium
12.4 Ergebnis
13 Bildungsbarrieren
13.1 Finanzieller Aufwand
13.1.1 Lehre, Meister und individuelle Weiterbildung
13.1.2 Studium
13.1.3 Ergebnis
13.2 Überschuldung
13.3 Berufsbildungswunsch und Einkommen
13.4 Fehlendes Finanzwissen
14 Spar- und Vorsorgepotenziale
14.1 Sparfähigkeit
14.2 Spartätigkeit und Sparneigung
14.3 Sparmotive – Sparziele
14.4 Ergebnis
15 Produktzugang
15.1 Sparprodukte
15.1.1 Anforderungsprofil für das Zukunftskonto
15.1.2 Ähnliche Sparprodukte
15.1.3 Beliebte Produkte
15.1.4 Bevorzugte Vertriebswege
15.1.5 Produktqualität
15.2 Kreditprodukte
15.2.1 Konsumratenkredite
15.2.2 Dispositions- und Überziehungskredite
15.2.3 Studienkredite
15.2.4 Ergebnis
Vierter Teil: Einzelstudien
16 Nutzung des Zukunftskontos in Kanada
16.1 Einführung
16.2 Geschichte, Struktur und Durchführung
16.3 Programm Statistiken
16.4 Barrieren beim Zugang zum Bildungssparen (RESP)
16.5 Komplexität, Marketing und Anbieterinteresse
16.6 Lösungsvorschläge: Public Private Parntenrship und Gruppenpläne
17 Nutzungspotenziale des Zukunftskontos bei türkischen Migranten (Studie)
17.1 Design der Umfrage
17.2 Soziales Umfeld
17.2.1 Familie
17.2.2 Freundeskreis
17.3 Persönliche Eigenschaften
17.4 Einstellung zu Finanzdienstleistungen
17.5 Zugang
17.6 Finanzielle Allgemeinbildung
17.7 Staatliche Förderung
17.8 Zugang zum Bildungssystem
17.9 Zusammenfassung
18 Nutzungsprobleme des Vorsorgesparens am Beispiel Riesterrente – eine betriebswirtschaftliche Untersuchung
18.1 Einfluss der Produktförderung und -darstellung auf das Entscheidungsverhalten
18.1.1 Verbreitungsquote von Riester-Verträgen als Indiz beschränkt rationalen Verhaltens
18.1.2 Framing-Effekte im Kontext von Vorsorgeprodukten und Ableitung der theoretisch Hypothesen
18.1.3 Ergebnis: Framing bei Vorsorge-Sparen?
18.2 Ursachen mangelnder Nutzung am Beispiel der Riester-Rente
18.2.1 Informationsasymmetrie
18.2.2 Mangelnde Vorausschau
18.3 Gesamtergebnis
19 Marktstudie zur Nutzung des Zukunftskontos – Untersuchungsdesign für eine empirische Untersuchung (infas)
19.1 Vorbemerkung
19.2 Anforderungen an eine empirische Potenzialanalyse
19.3 Überblick über das Untersuchungsdesign
19.4 Teilstudie: Explorative Fokusgruppen
19.5 Teilstudie: Repräsentative Befragung von „Eltern“
19.6 Teilstudie: Repräsentative Befragung der „Großelterngeneration“
19.7 Teilstudie: Explorative Leitfadeninterviews mit Stiftungen und Unternehmen
19.8 Kostenschätzung
Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhang
1 Migrantenbefragung:
1.1 Hypothesen und Dimensionen:
1.2 Soziale und finanzielle Verhältnisse
1.2.1 Bildung
1.2.2 Investitionen / Ansparvorgänge
1.2.3 Langfristige Sparmodelle
1.2.4 Kreditwürdigkeit / Sprachkenntnisse / finanzielle Allgemeinbildung
1.2.5 Private finanzielle Netzwerke
1.3 Freunde und Bekannte
1.3.1 Wertestruktur
1.3.2 Soziale und finanzielle Verhältnisse
1.3.3 Bildung
1.3.4 Finanzielle Situation
1.4 Persönliche Eigenschaften
1.4.1 Wertestruktur
1.4.2 Finanzielle Situation
1.4.3 Bildung
1.4.4 Zugang zu Finanzdienstleistungen
1.4.5 Zugang zu Bildungseinrichtungen
2 Beispiel Riesterrente: Exkurs Prospect Theory
Tabellen
Tabelle 1:
Erträge des Zukunftskontos
Tabelle 2:
Subventionen nach Zweck und Objekt
Tabelle 3:
Vermögensbildung und Bildungsvermögen
Tabelle 4:
Spar- und Fördermodell
Tabelle 5:
Quellen der individuellen Bildungsfinanzierung
Tabelle 6:
Riester-Modell
Tabelle 7:
Berufsbildungssystem und Berufsbeispiele
Tabelle 8:
Zuordnung deutscher Bildungsabschlüsse zu den ISCED-Stufen 3 bis 6 der UNESCO
Tabelle 9:
Neuzugänge in das Ausbildungs- und Hochschulsystem 1995 und 2010
Tabelle 10:
Schülerinnen und Schüler nach besuchter Schulart und höchstem Schulabschluss der Eltern 2009
Tabelle 11:
Schülerinnen und Schüler nach besuchter Schulart und höchstem beruflichen Bildungsabschluss der Eltern 2009
Tabelle 12:
Bildungsbeteiligung nach Bildungsherkunft* 2009
Tabelle 13:
Soziale Herkunftsgruppen nach beruflicher Stellung und Bildungsherkunft
Tabelle 14:
Inanspruchnahme der Finanzierungsquellen bei Studierenden nach sozialer Herkunft der Studierenden
Tabelle 15:
Wahrgenommene Finanzierungslücke bei Studierenden nach ausgewählten Merkmalen
Tabelle 16:
Einfluss der erwarteten Studienkosten auf die Entscheidung für oder gegen ein Studium / alle Studienberechtigten ½ Jahr nach Schulabgang
Tabelle 17:
Studienberechtigte 2008 ein halbes Jahr nach Schulabgang: Finanzielle Aspekte, die aus Sicht von Studienberechtigten ohne Studienabsicht (sehr) stark gegen die Aufnahme eines Studiums an einer Fachhochschule oder Universität sprechen nach Bildungsherkunft
Tabelle 18:
Bildungsabschlüsse in der Bevölkerung und bei Klienten von Schuldnerberatungsstellen im Vergleich
Tabelle 19:
Arbeitslosigkeitsindikatoren bei Klienten in Schuldnerberatungsstellen
Tabelle 20:
Überschuldungsauslöser nach Einschätzung von Schuldnerberatern 2005 bis 2012 Q1
Tabelle 21:
Einkommensarmut und Armutsgefährdung bei Klienten von Schuldnerberatungsstellen 2007 bis 2011
Tabelle 22:
Studienberechtigte 2008 ein halbes Jahr nach Schulabgang: Aspekte, die aus Sicht von Studienberechtigten ohne Studienabsicht (sehr) stark gegen die Aufnahme eines Studiums an einer Fachhochschule oder Universität sprechen nach Geschlecht und Bildungsherkunft
Tabelle 23:
„Ich befürchte, dass ich nach dem Studienabschluss die Kreditrückzahlung nicht vollständig leisten kann“
Tabelle 24:
Studienberechtigte 2008 ein halbes Jahr nach Schulabgang: Aspekte, die aus Sicht von Studienberechtigten ohne Studienabsicht (sehr) stark gegen die Aufnahme eines Studiums an einer Fachhochschule oder Universität sprechen nach Geschlecht und Bildungsherkunft
Tabelle 25:
Quartalsmäßige Gesamtausgaben und Ersparnis nach Einkommen, Schul- und Berufsbildung, gewichtete Mediane
Tabelle 26:
Verfügbares Einkommen, private Konsumausgaben und Sparbeträge 2005 – 2011
Tabelle 27:
Geldvermögensbestände 2008 nach Einkommen, Schul- und Berufsbildung, gruppierte Mediane
Tabelle 28:
Sparziele in Deutschland, Italien und Frankreich
Tabelle 29:
Anlageverträge und Kapital bei einkommensarmen Personen
Tabelle 30:
Neuabschlüsse von Bausparverträgen nach den Berufsgruppen der Bausparer
Tabelle 31:
Bekanntheit von Anlageprodukten
Tabelle 32:
Vertriebswege ausgewählter Bausparkassen
Tabelle 33:
Verbreitungsquote der Riester-Verträge
Tabelle 34:
Explorative Gruppendiskussionen mit Fokusgruppen
Tabelle 35:
Repräsentative, standardisierte Befragung von Eltern und „Großelterngeneration“
Tabelle 36:
Explorative Leitfadeninterviews mit Stiftungen und Unternehmen
Tabelle 37:
Kostenübersicht telefonische Erhebungen (in Euro)
Abbildungen
Abbildung 1:
Verfahrensablauf nach BMBF Modell Bildungssparen
Abbildung 2:
Unterrepräsentation von Arbeiterkindern im Studium
Abbildung 3:
Finanzierungsquellen der nachschulischen Bildung
Abbildung 4:
Umlage- oder Kapitalstockverfahren?
Abbildung 5:
Studienfinanzierungsanteile in Prozent
Abbildung 6:
Studienfinanzierungsbetrag in Euro
Abbildung 7:
Geld als Zweck und Mittel der Förderung
Abbildung 8:
Anforderungsprofil für Finanzdienstleistungen
Abbildung 9:
Sparen nach dem Riester Modell
Abbildung 10:
Sparen und Kredit für Bildung
Abbildung 11:
Sparen und Kreditsparen
Abbildung 12:
Zweckerreichung
Abbildung 13:
Nutzung des Zukunftskontos
Abbildung 14:
Berufsbildungssystem in Deutschland
Abbildung 15:
Studienwahrscheinlichkeit der Studienberechtigtenjahrgänge 1996 – 2010 nach beruflichem Abschluss der Eltern (in%)
Abbildung 16:
Höhe der monatlichen Einnahmen nach der sozialen Herkunftsgruppe der Studierenden (Mediane)
Abbildung 17:
Zusammensetzung der monatlichen Einnahmen nach sozialer Herkunft
Abbildung 18:
Gesamtbevölkerung und Klienten von Schuldnerberatungsstellen nach Alter und Bildung im Vergleich
Abbildung 19:
Einkommensverteilung und Bildung /relative Erwerbseinkommensposition
Abbildung 20:
Vertrauen von Studenten gegenüber Kreditinstituten und dem BaFöG-Amt
Abbildung 21:
Ausgaben der privaten Haushalte für Grundbedürfnisse als Anteil des Haushaltsnettoeinkommens 2008
Abbildung 22:
Berufsunfähigkeits- und Haftpflichtversicherungen nach Einkommen, Schul- und Berufsbildung, Anteile an der jeweiligen Gruppe
Abbildung 23:
Verbreitung und Umfang des Geldvermögenbesitzes nach Altersgruppen
Abbildung 24:
Verbreitung und Empfänger von Geldgeschenken der Generation ab 40
Abbildung 25:
Nettosparquoten der privaten Haushalte im internationalen Vergleich
Abbildung 26:
Spartätigkeit deutscher Haushalte
Abbildung 27
Monatliche Sparbeträge je Haushalt (2011)
Abbildung 28:
Anteil der Haushalte, die über kein Vermögen* verfügen
Abbildung 29:
Sparziele der Bundesbürger
Abbildung 30:
Verteilung des Geldvermögens der privaten Haushalte nach ausgewählten Produktgruppen in Mrd. Euro (Differenzierung der Einlagen)
Abbildung 31:
Anforderungsprofil für das Zukunftskonto
Abbildung 32:
Aktueller Besitz von Geldanlageprodukten
Abbildung 33:
Nutzung von Anlageprodukten nach Schulbildung
Abbildung 34:
Nutzung von Anlageprodukten nach Berufsbildung
Abbildung 35:
Nutzung von Anlageprodukten nach Einkommen
Abbildung 36:
Vertriebsweganteile Leben 2010 (gesamt)
Abbildung 37:
Vertriebswege von Investmentfonds 2009
Abbildung 38:
Hat eine vom Produktverkauf unabhängige Beratungsgebühr Vorteile?
Abbildung 39:
Interesse an Kostenpflichtiger Beratung - Bereitschaft zur Zahlung von Beratungshonoraren
Abbildung 40:
Hindernisse für das Verständnis und Vergleichbarkeit von Produkten
Abbildung 41:
Kreditanlässe und Kreditbedarf
Abbildung 42:
Private Haushalte mit Restschulden in verschiedenen Kreditarten nach Alter (2008)
Abbildung 43:
Zwingende Ausschlusskriterien bei der Vergabe von Ratenkrediten
.
Abbildung 44:
Zwingende Mindestkriterien der Krediteinräumung bei Ratenkrediten
Abbildung 45:
Gekündigte Kredite bei Überschuldeten nach Anzahl 2011
Abbildung 46:
Verfügbarkeit Dispositionsrahmen, nach Schulabschluss
Abbildung 47:
Nutzungshäufigkeit von Dispositionskrediten nach Schulbildung
Abbildung 48:
Nutzung Ratenkrediten nach Haushaltseinkommen
Abbildung 49:
Studienkredite 2011 nach Anbietergruppen
Abbildung 50:
Vergabe von Studienkrediten nach Anbietern
Abbildung 51:
Bekanntheit von Kreditangeboten zur Studienfinanzierung nach sozialer Herkunft
Abbildung 52:
RESP Programm - Beitrags- und Förderungsentwicklung in Millionen Can$
Erster Teil: Das Zukunftskonto als Förderprodukt
1 Grundfragen
1.1 Wozu dient das Zukunftskonto?
1.1.1 Definition
Das Zukunftskonto ist zunächst die notwendige zugkräftige Bezeichnung des politischen Anreizprogramms für die Adressaten und die Öffentlichkeit.
In dem hier interessierenden, finanztechnischen Sinne bezeichnet der Begriff Zukunftskonto dagegen eine virtuelle Zusammenfassung von in verschiedener Form angesparten Geldbeträgen (Sparvermögen) einschließlich der darauf bezogenen Forderungen auf Zahlung staatlicher Förderung (Prämienanwartschaften), die während einer nachschulischen Bildungszeit vom Begünstigten verbraucht werden können.
Damit soll zusätzlich zu den bisherigen finanziellen Säulen wie Elternförderung, BAföG, Studienstiftungen, betriebliche Unterstützung, Eigenverdienst der Studierenden sowie einer Kreditfinanzierung über den Markt eine Vorsorgemöglichkeit bestehen, bei der ein entsprechend gefördertes Finanz-Bildungsvermögen aufgebaut wird.
Der Sparvorgang wird anfänglich mit einer Prämienanwartschaft von 150€ bei einer Einlage von 20€ bezuschusst und dann jährlich bis zum 18. Lebensjahr mit einer Prämienanwartschaft in Höhe von 33% des gesparten Betrages (max. 100€) bedacht, so dass 7.350€ zuzüglich der auf die eingezahlten Beträge entfallenden Zinsen als gefördertes Startkapital erreicht werden können.
Abbildung 1: Verfahrensablauf nach BMBF Modell Bildungssparen
1.1.2 Welche bildungspolitische Bedeutung soll es haben?
Das Zukunftskonto soll einen Anreiz schaffen, für nachschulische Bildung finanziell so vorzusorgen, dass damit die Wahrscheinlichkeit gerade bei eher bildungsfernen Schichten zur nachschulischen Bildung deutlich steigt. Es wird somit Elternförderung, BAföG, Förderungen von Stiftungen und Stiftern ergänzen und den Kreis der Begünstigten erweitern helfen. Um die zutreffende Form der Förderung sowie der geförderten Spar- und Finanzprodukte festlegen zu können, muss ein grober Überblick über die voraussichtlichen Wirkungen verschafft werden.
1.1.2.1 Finanzieller Nutzen für den/die Studierende(n)
Nach den Sozialerhebungen des Hochschulinformationssystems HIS, die zuletzt für das Jahr 2006 vorliegen, verfügen Studierende monatlich im Durchschnitt über eine Betrag zwischen 742€ (niedrige soziale Herkunftsgruppe) und 790€ (hohe soziale Herkunftsgruppe), wobei zwischen 2003 und 2006 die Differenz beider Gruppen von 35 auf 48€ angestiegen ist. Gleichwohl liegen anders als die übrigen Einkommen in der Gesellschaft die Ausgaben der Studierenden aller Schichten in den Durchschnittswerten recht eng beieinander, so dass insgesamt von einem Bedarf um 750€ monatlich ausgegangen werden muss, der sich allerdings je nach Studienrichtung und Region (Stadt/Land) stärker differenzieren kann.
Geht man von einem Masterabschluss aus, so dürften einschließlich zweier Examenssemester mindestens 11 Semester zu finanzieren sein, woraus sich ein Gesamtbetrag von rund 50.000€ an Studienkosten errechnet.
Ein Ansparbetrag von 7.750€, bei dem der Sparprozess im Alter von ½ Jahr1 des zukünftig Studierenden mit einer Rate von 300€ pro Jahr2 beginnen würde3, ergäbe bei dem zuletzt festgestellten Durchschnittseintrittsalter von 18 Jahren4 eine Spardauer von 17 ½ Jahren und bei Ausnutzung der maximal möglichen Förderung von 100€ pro Jahr sowie einer Anfangsprämie von 150€ und einer angenommenen durchschnittlichen Verzinsung von 2%5 (allein auf den Sparbetrag, da die Prämienanwartschaften unverzinslich sein werden), einen zu Studienbeginn verfügbaren Gesamtbetrag von 8.122€. Dies wären immerhin 16,2% des Finanzierungsbedarfs im Studium. Wir errechnen daher überschlägig die folgenden Werte in der nachfolgenden Tabelle, wobei eine kleine Förderdifferenz von 50€ (1.850€ zu 1.900€) hier verbleibt.6
Tabelle 1: Erträge des Zukunftskontos
1.1.2.2 Bildungspolitischer Nutzen für den Zugang bildungsärmerer Schichten
Machen einkommensschwache Schichten vom Zukunftskonto Gebrauch, so könnte dadurch eine finanzielle Studienbarriere deutlich gesenkt werden, zumal aus der Überschuldungsforschung bekannt ist, dass die Überschuldung häufig durch einen relativ unbedeutenden Liquiditätsabfall erfolgt, bei dem ein Teil der Kreditrate nicht bezahlt und damit das gesamte System zum Einsturz gebracht werden kann.7 Leider sind die Daten hier nicht sehr hilfreich. Die HIS-Erhebungen beziehen sich nur auf Studierende, d.h. solche, die ihren Studienwunsch realisiert haben, während es hier darum gehen würde, bei denjenigen, die eine Hochschulberechtigung haben und gleichwohl davon keinen Gebrauch machen, schichtenspezifisch die Gründe zu erfahren. Wir haben gleichwohl die Daten über die Studierenden zugrunde gelegt und dabei in Kauf genommen, dass die schichtenspezifische Verteilung der Hochschulzugangsberechtigung dadurch unberücksichtigt bleibt. Wir erhalten dadurch ein grobes Bild von dem Nutzungsgrad der nachschulischen Bildung an Hochschulen nach Schichtenzugehörigkeit. Leider sind auch die neueren Daten zur Schichtung bei Studierenden nach der HIS-Untersuchung mit den Daten des Statistischen Bundesamtes zur Sozialstruktur grob nicht kompatibel. Wir haben sie für unsere Zwecke vergleichbar gemacht und können damit auf jeden Fall ein deutliches Defizit in der nachschulischen Bildung bei der Arbeiterschicht feststellen, das sich auch bei genaueren Zahlen (entsprechend abgeschwächt) erhalten dürfte.8 Danach wären Angestellte und Beamte ähnlich ihrer Proportion bei den Studierenden vertreten, die Selbständigen deutlich überrepräsentiert und die Arbeiter um ca. die Hälfte (40% (West) bzw. 55% (Ost)) unterrepräsentiert.
Abbildung 2: Unterrepräsentation von Arbeiterkindern im Studium
Ob dies nur finanzielle Gründe hat und welche Rolle etwa die Nähe der Eltern zu einer höheren Ausbildung hat, mit der der hohe Anteil derjenigen erklärt wird, deren Eltern bereits Akademiker sind, kann hier nicht entschieden werden. Wir referieren zur Bedeutung der Finanzierungsquellen den Studienanfänger-Report der HIS9:
„Studienanfänger/innen, die Studienbeiträge zahlen, finanzieren diese mehrheitlich mit finanzieller Unterstützung von Eltern, Verwandten oder eines Partners / einer Partnerin (75%). 17 Prozent finanzieren die Beiträge ausschließlich über diese Quelle. Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist das Jobben neben dem Studium. Eine Mehrheit der Studienanfänger/innen (51%), die Studienbeiträge zahlen, bringt die finanziellen Mittel (teilweise) selbst auf. Diesbezüglich bestehen erhebliche herkunftsspezifische Unterschiede: Erstimmatrikulierte mit akademischem Bildungshintergrund erhalten überdurchschnittlich häufig Unterstützung von den Eltern (85% vs. 66% derjenigen ohne akademischen Bildungshintergrund). 24%von ihnen finanzieren die Studiengebühren ausschließlich mit elterlicher Hilfe; unter jenen aus nicht-akademischen Familien sind dies gerade einmal elf Prozent. Erstimmatrikulierte, deren Eltern über keinen Hochschulabschluss verfügen, bringen die finanziellen Mittel indes häufiger selbst auf (57% vs. 44%; als ausschließliche Quelle: 5% vs. 4%), finanzieren den Betrag über einen Kredit (13% vs. 6%) oder nutzen andere, nicht näher spezifizierte Finanzierungsquellen (23% vs. 13%).
Abbildung 3: Finanzierungsquellen der nachschulischen Bildung
Da nachschulische Bildung für wirtschaftlich relativ schwache Bevölkerungsgruppen oftmals die Überlegung der Kreditaufnahme erforderlich macht, ist bezüglich der Wirkungen auch auf Erkenntnisse zur Abhängigkeit der Verschuldungsbereitschaft vom sozialen Status zurückzugreifen. Ausgangspunkt sind empirische Befunde, wonach die Bereitschaft, für die Bildung Schulden aufzunehmen, unter anderem in einer Abhängigkeit von der Selbsteinschätzung steht, ob die Schulden mit Sicherheit zurückgezahlt werden können und ob sich die Bildungsinvestition „lohnt“. Die Verschuldungsbereitschaft für Bildung ist demzufolge in sozial schwächeren und eher bildungsfernen Schichten und Milieus vergleichsweise gering10 und im Übrigen nach bestimmten Befunden in Bezug auf Frauen zudem geringer als in Bezug auf Männer, was entsprechenden negativen Einfluss auf die soziale Mobilität durch Bildung hat. Durch die vermögensbildende Wirkung des Zukunftskontos wird die relative Bedeutung der Frage einer Kreditaufnahme durch Bildung geringer. Es ist daher die Annahme plausibel, dass dieses Instrument die soziale Mobilität am Zugang zum kostenträchtigen nachschulischen Bildungsbereich erhöht.
Nach einer anlässlich der Studiengebührendebatte getroffenen Einschätzung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen stellen weniger die nachschulischen Bereiche als vielmehr die frühkindliche und die vorschulische Bildung derzeit diejenigen Bereiche dar, in denen öffentliche Mittel besonders effizient zur Erzielung von Verbesserungen der Chancengerechtigkeit im Bildungswesen eingesetzt würden, da hier die größten Verbesserungen mit dem kleinsten Mitteleinsatz zu erwarten seien.11 Dies betrifft zwar zunächst eine andere Frage. Würde aus ihr indes, wie es vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen angedeutet wird, die Folgerung gezogen, die Beitragspflichtigkeit tertiärer Bildungsgänge zu dem Zweck zu erhöhen, entsprechend mehr öffentliche Mittel in den Vorschulbereich fließen zu lassen12, so würde das Zukunftskonto dies möglicherweise faktisch teilweise mitfinanzieren, indem es die Zahlungsfähigkeit für die nachschulische Bildung erhöht. Dies wäre ein wohl unerwünschter Nebeneffekt, nicht aber ein Ziel des Zukunftskontos, da die Verbesserung der vorschulischen Chancengerechtigkeitsmaßnahmen insoweit indirekt von der Zielgruppe des Zukunftskontos, also zu großen Teilen von der Gruppe der Adressaten der Chancengerechtigkeitsmaßnahmen selbst finanziert würde. Dies würde die Stoßrichtung des Zukunftskontos sicherlich teilweise konterkarieren und zugleich Mitnahmeeffekte beispielsweise von Ländern bedeuten, wenn diese sich zur Begründung der Tragbarkeit von Entgeltpflichten an Hochschulen und anderen Landeseinrichtungen auf die Verfügbarkeit des Zukunftskontos stützen wollten. Rechtlich verhindern lassen sich solche Entwicklungen, die eine politische Frage sind, nicht. Insbesondere sprechen sie letztlich nicht gegen die Sinnhaftigkeit des Zukunftskontos sondern dagegen, die Ausbildung deshalb zu verteuern, weil die Eigeneinnahmen gesteigert wurden. Der vor allem psychologische Effekt, dass sich Eltern und Umfeld gerade bildungsferner Schichten frühzeitig für Bildung interessieren und dies in einem Sparvorgang manifestieren, der augenfällig lohnend und sinnvoll erscheint, darf nicht dadurch verwässert werden, dass diese Mittel an anderer Stelle wieder abgeschöpft werden. Das Zukunftskonto fügt den Verteilungseffekten im Bildungsbereich insoweit eine zusätzliche Facette hinzu, derer sich die bildungspolitische Diskussion bei und nach Einführung dieses neuen Instruments nunmehr bewusst sein muss.
Das Zukunftskonto würde quer zu den bisher getrennt verlaufenden Systemen stehen und über die Spartätigkeit Elternunterhalt, Eigenverdienst und Staat evtl. auch Dritte in den Prozess der Studienfinanzierung einbinden. Dabei ist in dem aktuellen Modell zudem der Eigenverdienst, der Gelderwerb neben dem Studium, besonders problematisch, weil er der Effektivierung des bestehenden Studiums (Verkürzung, Bachelor und Master) und der effektiveren Ausnutzung der Ressourcen entgegensteht und zudem den Studienerfolg behindern kann. Dieser Eigenanteil am Studium wird nun vorverlagert. Das eigentlich Neue an diesem System ist daher auch die veränderte Philosophie. Aus einem Umlageverfahren (Alt für Jung, Steuerzahler für in Ausbildung stehende, Gemeinschaft für Einzelne) würde ein Kapitalstockverfahren (individueller Aufbau von Vermögen). Damit reiht sich das Zukunftskonto in die Prozesse der Neugestaltung der Altersvorsorge ein und dürfte Erfahrungen und Einsichten vermitteln, die auch für ein stärkeres Engagement in der Altersvorsorge genutzt werden könnte. Man könnte sogar das Zukunftskonto als Programm der finanziellen Allgemeinbildung für die Altersvorsorge begreifen.13
Abbildung 4: Umlage- oder Kapitalstockverfahren?
Bezieht man dies auf die aktuelle Studienfinanzierung, wie sie in den nachfolgenden Grafiken nach den HIS Untersuchungen abgebildet ist, so ergibt sich, dass der Bereich der Finanzierung über private Kanäle dadurch erheblich gestärkt werden dürfte. Dies kann auch Effekte im Bewusstsein der Zielgruppe auslösen, wenn aktiveres Verhalten in der Bildung eher Normalität ist als in einer rein staatlich organisierten Bildungsfinanzierung.
Abbildung 5: Studienfinanzierungsanteile in Prozent
Abbildung 6: Studienfinanzierungsbetrag in Euro
Danach spielen auch jetzt schon Ersparnisse eine Rolle und zwar im Durchschnitt und gleichbleibend in den Jahren seit 2003 126€ Beitrag zur Studienfinanzierung allerdings nur bei den 17% der Studierenden, die überhaupt hier mit Sparen vorgesorgt haben. Die anzunehmenden Unterschiede zwischen Unter- und Oberschicht im Sparverhalten, lassen sich allerdings aus den HIS Statistiken nicht ablesen.14 Angesichts einer durch die hohe Verschuldung der Unterschichten dort insgesamt bestehender negativen Sparquote besteht ausreichender Grund zur Annahme, dass sich ein bei der Zielgruppe sozial schwächerer Herkunftshaushalte initiierter Sparprozess über das Zukunftskonto als Senkung der Bildungsbarriere auswirken kann.
1.1.2.3 Konsequenzen für die Produktgestaltung
Das Zukunftskonto würde die Möglichkeit verschaffen bei sukzessiver Entnahme während des Studiums und fortdauernder Verzinsung zu 2% 132€ monatlich zu entnehmen.
Die Eltern sind nach Häufigkeit und Beträgen die dominierende Finanzierungsquelle während des Studiums. Es liegt nahe, sie auch im Ansparvorgang an erster Stelle anzusprechen.
Die Konzentration der Mittelaufbringung auf die Studienzeit selber ähnelt dem Umlageverfahren in der Altersvorsorge und wird über das Zukunftskonto um ein Kapitalstockverfahren mit mehr Eigeninitiative ergänzt.
Da die Eltern bei der laufenden Studienfinanzierung engagiert sind, jedoch offensichtlich Vorsorge nur in geringem Maße betrieben wird, müssen die Anreize zum Sparen deutlich sein und vor allem auch weitere Personen in den Sparprozess eingebunden werden können.
Die gewählten Modelle müssen allerdings zielgenau sein.
1.2 Wie passt das Zukunftskonto in die Vermögensbildung?
Das Zunftskonto soll die Kosten nachschulischer Bildung für bildungsferne Schichten leichter tragbar machen und sie auf diese Weise zu mehr Bildung animieren. Dadurch wird das Zukunftskonto Teil eines Systems, mit dem der Staat von jeher versucht hat, die Vermögensbildung gerade bei Schichten, die nicht zu den „vermögenden Schichten“ gehören, zu fördern, um ihre Chancen in einer Gesellschaft zu erhöhen, die mehr Kapital auch bei privaten Haushalten verlangt, um Teil zu haben.
Die bestehenden Systeme fördern Geldvermögen, den Erwerb von Wohneigentum, aber auch Wohnvermögen durch Mietzuschüsse sowie höhere Rentenzahlungen im Alter.
Vermögensbildung
erfolgt im Fünften Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG). Dort wird die Sparvermögensbildung mit dem Bausparen verknüpft, das sich von einer speziellen Bauförderung zu einer allgemeinen Vermögensbildungsförderung entwickelt hatte. Im Jahre 2009 wurde dies teilweise revidiert und das Bausparen wieder deutlich an den Erwerb von Wohneigentum geknüpft.
15
Rentenzahlungen
als Beitrag zum Monatseinkommen werden im Wohngeldgesetz, im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie in den verschiedenen Fördersystemen zur privaten Altersvorsorge unterstützt.
Weiter werden
Rentenzahlungen im Studium
durch das BAföG anhand von Einkommens- und Vermögenskriterien sowie durch das Stipendienprogramm-Gesetz (Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms [Stipendienprogramm-Gesetz – StipG] vom 21. Juli 2010) – dort anhand von Begabungs- und Leistungskriterien und in Abhängigkeit von der fachlichen Zweckbestimmung durch private Zuschussgeber – generiert.
1.2.1 Allgemeine und spezielle Zwecke
Das bestehende Fördersystem unterscheidet zwischen Zahlungen, die besondere Kosten einer das Einkommen erhöhenden Zahlung ganz oder teilweise decken sollen, und Zahlungen, die das Sparvermögen erhöhen sollen.
Tabelle 2: Subventionen nach Zweck und Objekt
Ordnet man das Zukunftskonto in dieses System ein, so geht es um die
Förderung für
spezielle
Zwecke mit nur nachgelagert sozialem Ausgleichszweck,
einkommensbezogene
Förderung, die Rentenzahlungen während der Bildungszeit generieren soll,
Vorsorge,
da es um den Aufbau eines einkommensfähigen Vermögens geht.
Bereits bei der Einführung von Bildungsgutscheinen (§ 28 SGB II) ist deutlich geworden, dass die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den Staat und die damit verfolgte Erreichung eines bestimmten sozialpolitischen Zwecks getrennt voneinander betrachtet werden müssen.
Geldvermögen ist dabei einmal selber Ziel der Vermögensbildung, insoweit es einen Schlüssel zu Reichtum und vielen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entfaltung bietet (Geldvermögensbildung).
Geldzuwendungen können jedoch auch als Mittel zur Erreichung eines unmittelbar definierten Vermögens angesehen werden.
Abbildung 7: Geld als Zweck und Mittel der Förderung
Es ergeben sich zwei unterschiedliche Vermögensbegriffe:
Geld als Reichtum mit universell einsetzbaren Möglichkeiten („Vermögensbildung“).
Geld als Mittel zum Aufbau spezieller Fähigkeiten und Möglichkeiten („Bildungs-, Gesundheits-, Kommunikations-, Wohn-, Altersvermögen“).
1.2.2 Vermögensbildung und Bildungsvermögen
Für das Zukunftskonto ist daher zu entscheiden, ob es ausreicht, die Berechtigung für die Förderung so zu gestalten, dass damit Bildungsdefizite gedeckt werden können (Vermögensbildung) oder ob zusätzlich das Produkt in der Weise gestaltet werden muss, dass eine effektive Investition der bereitgestellten Geldmittel für den Erwerb der Bildung nach Art der Auszahlung und Zweck seiner Verwendung sichergestellt werden muss.
Tabelle 3: Vermögensbildung und Bildungsvermögen
1.2.3 Umlage- und Kapitalstockverfahren im Bildungssystem
Weltweit sind die Jahre ab 1980 durch eine Trendwende vom traditionellen Umlageverfahren bei sozial- und zweckorientierten Subventionen über Staat und Sozialversicherungen zu einem auf Eigeninitiative aufbauenden Kapitalstockverfahren gekennzeichnet. Am deutlichsten ausgeprägt ist dieser Systemwechsel in der Altersvorsorge, wo neben die Rentenversicherung die private Altersvorsorge tritt. Die wirtschaftstheoretische Einordnung als „Benefit Defined“ und „Contribution Defined“ Systems (BDS und CDS) macht zudem klar, dass die Bezeichnung als Umlage- und Kapitalstockverfahren eher die Sicht privater Anbieter als das System wiedergibt. Entscheidend ist im Systemwechsel, ob der einzelne die unmittelbare Verantwortung für die im Gesellschaftssystem insgesamt notwendigen Bedingungen der Versorgung im Alter, aber auch für ein stetiges Arbeitseinkommen ebenso wie für die Kinder oder die Bildung und Weiterbildung übernimmt. Wo der eigene Beitrag über die Höhe der verfügbaren Mittel entscheidet, wird dem Eigeninteresse an Bildung, Versorgung ein größere Bedeutung eingeräumt, was durchaus auch als demokratische Teilhabemöglichkeit angesehen werden kann, auch wenn sie häufig als Abbau sozialer staatlicher Verantwortung empfunden wird, bei der Rentenkürzung, BAföG Einsparungen oder Einschränkung der Versicherungsleistungen in der Krankenversicherung eher kurzfristiger staatlicher Fiskalpolitik zu entspringen scheinen.
Der in der Alters- und Krankenvorsorge bekannte Prozess ist auch dem Bildungssystems nicht fremd. Dabei muss man nicht auf die Ansätze bei Einführung eines Studiengeldes für Studierende verweisen, die bis heute kontrovers diskutiert werden. Die Studienförderung nach dem Umlageverfahren eines reinen Subventionsmodells, wie es das sog. Honnefer Modell vorschrieb und in das neue BAföG System 1971 noch ohne strukturelle Änderung übernommen wurde, erhielt mit der Pflicht zu einem anfangs noch bescheidenen Grunddarlehen als Ergänzung zur Subvention im Jahre 1974, dessen Anteil in den Folgejahren aufgestockt wurde, bereits ein eigenverantwortliches Element. Im Jahre 1981 wurde dies bis zur Rückkehr zu einem dualen System nach der Wende im Jahre 1990 sogar zu einem System umgewandelt, das nur noch Darlehen vergab.
Zwar bildeten die Studierenden auch hier keinen „Kapitalstock“. Gleichwohl erfolgte die Studienfinanzierung durch ihre Beiträge (CDS), nur dass sie erst nach Inanspruchnahme der Gelder aufgebracht werden müssen. Insoweit führt die Charakterisierung von Kapitalstockverfahren für den Systemwechsel in die Irre. Finanztechnisch stellen Kredit und Sparen nur zwei zeitlich verschobene Elemente eines Sparvorgangs dar, weshalb in der Kreditbranche auch vom „Nachsparen“ gesprochen wird und der Gesetzgeber etwa im Wohnriester dem Ansparen in ein Vorsorgekonto die Tilgung eines Hypothekenkredites für selbstgenutzten Wohnraum gleichgestellt hat.
Kreditfinanzierung wie Sparfinanzierung folgen somit denselben Systemprinzipien. Beides sind Contribution Defined Systems.
Das Zukunftskonto ergänzt folglich letztlich nur das bestehende kreditfinanzierte Contribution Defined System des BAföG um die finanztechnische Komponente des Vorsparens bzw. der „Kreditaufnahme bei sich selbst“. Der Unterschied, wann gespart wird, ist systematisch unbedeutend und hängt von den Kapitalbildungsmöglichkeiten vor und nach der Nutzung ab, die eher zufällig sind. Die Elternphase bis zum 18. Lebensjahr rekurriert auf die Kapitalmöglichkeiten der Eltern und ist damit notwendig kapitalstockorientiert. Die Ausbildungsphase danach rekurriert auf ein durch Ausbildung zu erreichende zukünftiges Erwerbsvermögen und wird damit stärker Kreditelemente enthalten.
Das Zukunftskonto passt sich somit logisch in einen weltweiten Trend16 zu mehr Eigenverantwortung bei der Erreichung öffentlicher Ziele ein und stellt keineswegs einen Systembruch oder ein isoliertes Vorgehen dar.
Allerdings sollten auch die Defizite beachtet werden, die dieser Systemwechsel gerade im sozialen Bereich bringen kann. Das Contribution Defined System baut auf sozial unterschiedlicher Verteilung von Vermögen auf und lässt sie auf die Finanzierung dieser öffentlichen Güter wirken. Wo früher eine vermögensunabhängige Versorgung bestand, tritt nach einem Systemwechsel eine Versorgung, die ihrer Höhe und Intensität nach eine soziale Schiefverteilung in den öffentlichen Bereich hinein verlängert. Dies hat sich bei der privaten Altersvorsorge etwa dort gezeigt, wo ein radikaler Systemwechsel wie in Chile, Argentinien oder in Tschechien vorgenommen wurde. Die sozialen Auswirkungen waren so entscheidend, dass ebenso wie bei der Wiedereinführung der Subventionsleistungen im BAföG nach der Wende eine teilweise Rückkehr zum Umlageverfahren erzwungen wurde.
Seitdem geht es weltweit nicht mehr um ein entweder/oder zwischen BDS und CDS sondern um ein sowohl/als auch. Dieser Systemmix kann wie im BAföG durch Parallelität beider Systeme von BAföG Darlehen und BAföG Zuschuss verwirklicht werden oder wie in der Riesterrente durch sozial kompensatorische staatliche Förderung gerade sozial schwacher Sparer in der privaten Altersvorsorge.
Das Zukunftskonto wählt keinen dieser beiden Wege, indem es anders als das kanadische System in der Subvention selber keine sozialkompensatorischen Elemente einbaut. Das bedeutet, dass Familien mit höherem Einkommen damit bessere Möglichkeiten des Sparens haben werden als Familien mit niedrigeren Einkommen. Angesichts der geringen Subventionen ist dieses häufig zu Unrecht als Gießkannenprinzip bezeichnete Subventionssystem jedoch rational, weil die Verwaltung sozial kompensatorischer Leistungen so aufwändig und für Missbrauch anfällig ist, dass die Kosten der Verwaltung die Subvention weit übersteigen und damit das Gesamtsystem unrentabel machen würde.
Die notwendig sozial kompensatorischen Elemente fehlen jedoch deshalb keineswegs.
Zunächst werden ja nicht die Eltern, sondern die Kinder gefördert, denen heute bei der Langlebigkeit und Tendenzen zur Desintegration von Familien nicht mehr ohne weiteres unterstellt werden kann, dass sie bei Ausbildungsbeginn oder später den Vermögensstatus ihrer Herkunftsfamilie fortsetzen können. Sie weisen somit kaum vorhersagbare Vermögenssituationen bei Inanspruchnahme der Subvention auf. Wenn man wie hier vorgeschlagen zugleich die Ausbildungsphase durch Verknüpfung von privaten Studiendarlehen mit dem Zukunftskonto stärkt, wird ebenfalls soziale Kompensation ermöglicht.
Das System des Zukunftskontos ist ferner so konzipiert, dass auch sozial kompensatorische Einrichtungen des öffentlichen Interesses sich hier engagieren können. Da auch zukünftige Arbeitgeber, Stiftungen, Vereine oder gar der Sozialstaat selber sich am Aufbau des Bildungsvermögens beteiligen können, werden hierdurch für gesellschaftliche Potenziale sozialer Kompensationen Handlungsmöglichkeiten geschaffen, die öffentlich unterstützt wirksam werden können.
Das entscheidende sozial kompensatorische Element des Zukunftskontos wird jedoch der Aufbau eines Schonvermögens für Bildungszwecke sein. Indem das Zukunftskonto dabei hilft, vom Gläubigerzugriff geschütztes Vermögen für die Bildung aufzubauen, schafft es ein schichtenspezifisch wirkendes Mittel zum Vermögensaufbau, das das Sparen in der Unterschicht interessant macht, während es die vermögenden Haushalte nicht betrifft. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass dieses Schonvermögen auch faktisch durchgesetzt wird, um den Bildungszweck auf der Grundlage der Erfahrungen bei Einführung der Kapitalstockverfahren in der Altersvorsorge sowie bei der zeitweisen Umstellung auf ein Volldarlehen im BAföG 1981 effektiv und sozial gerecht zu schützen. Diese Zweckzuordnung zum Sozialstaatsprinzip dürfte auch ein entscheidendes verfassungsrechtliches Argument dafür sein, warum die Gläubigerrechte aus Art. 14 GG hier zurückstehen müssen. Dabei hilft zur Überwindung dieser verfassungsrechtlichen Hürde, wie sie im Parallelgutachten ausführlich dargestellt wurde, auch das Argument, dass das für Bildungszwecke gebildete Vermögen von Dritten stammt und ohne Zukunftskonto gar nicht gebildet worden wäre. Den Gläubigern wird damit durch den Pfändungsschutz auch nichts genommen.
1.2.4 Konsequenzen
Das Zukunftskonto soll Bildungsvermögen in Form eines Kapitalstocks mit individuellen Sparanreizen schaffen. Das aufgebaute Geldvermögen sollte daher die Kosten der Bildungsausgaben teilweise kompensieren. Dies bedeutet, dass eine steuerrechtliche Absetzbarkeit der Sparbeiträge weniger geeignet wäre, nicht nur wegen der geringeren Steuersätze der Unterschichten, sondern vor allem weil die Gewährung der Prämien im Nachhinein der Subvention den Charakter einer Belohnung für Vorsorge verleiht und damit den Bildungszweck betont. Aber auch bei einer reinen Subventionslösung ist trotz der dadurch verdeutlichten Zweckrichtung durch zusätzliche Regelungen darauf zu achten, dass die Auszahlung entsprechend dem Anfall der Bildungskosten erfolgt. Entnahmerechte würden hier zu Fehlallokationen einladen und zudem auch Probleme bei der Gewährleistung der Zweckbestimmung (etwa durch Pfändungsschutz und Vorteilssicherung gegenüber anderen sozialen Leistungen) aufwerfen.
Die Einordnung in die Systemergänzung der BFS Vorsorge durch CDS Systeme spricht für eine duale Nutzung des Guthabens auf dem Zukunftskonto: einerseits für Auszahlungen während Ausbildung und Weiterbildung, andererseits für die Nutzung des Guthabens für den Zugang zu Studiendarlehen privater Anbieter.
Die wichtigste soziale Komponente dürfte aber der Schutz des Zukunftskontos als Schonvermögen darstellen. Ohne diese Regelung ließe die Subvention – da ihre soziale Zielrichtung nicht schon über die Einzahlungsseite rechtlich genau gezielt abgegrenzt werden kann – einen zu hohen Anteil von Fällen erwarten, in denen sie vorwiegend Mitnahmeeffekte produzieren würde.
1.3 Wie soll gespart und gefördert werden?
Tabelle 4: Spar- und Fördermodell
1 So die Annahmen im Modell des BMFT s.o.
2 Unsere Berechnung kommt für die errechnete Höchstförderungssparsumme von 7.750€ allerdings leicht abweichend auf einen max. jährlichen Sparbetrag von 297,30€.
3 Das Konzept geht vom Beginn des Sparprozesses bei 0,5 Jahren und einem Eintrittsalter von 19 aus. Dies könnte für die Zukunft mit der Verkürzung der Zeit zur Hochschulreife und dem Wegfall des Militärdienstes wohl auch realistisch sein. Zurzeit wäre dies aber noch zu früh angesetzt. Eine Verschiebung insgesamt um ein Jahr nach der Geburt und beim Studienanfang kommt für die Modellrechnung zu denselben Ergebnissen.
4