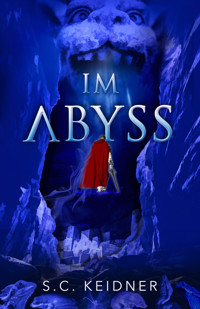5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die spannende Fantasy-Reihe um Reisen durch magische Bilderwelten im E-Book-Sammelband! Band 1: Eigentlich plant Caro ein Schauspielstudium. Doch dann landet sie von einem Augenblick zum nächsten in der rätselhaften Welt des Marmorpalasts. Nicht nur wird sie da von Drachen gejagt, nein, sie erfährt auch, dass sie eine Bildvagabundin ist – sie kann in Bilder reisen, in Welten, die anders sind als alles, was sie kennt. Nach dem ersten Schock steht fest: Sie muss den Weg zurück nach Hause finden. Nur: Wo ist das Bild, das sie zurückbringt? Dann heftet sich auch noch der Drachen-Gestaltwandler Ryu an Caros Fersen, mit dem es sie auf die verlorenen Inseln verschlägt – wo sich die unfreiwilligen Reisegefährten zusammenraufen müssen, um zu überleben … Band 2: Nach der Flucht von Abanyama setzen Caro und Ryu ihre Suche nach dem Bild fort, mit dem sie Talamhceo endlich verlassen können. Ausgerechnet im großen Tempel von Drymaron soll es zu finden sein, inmitten von Priestern, die auf der Jagd nach Zauberwesen sind, seien es nun Drachen, Hexen oder Dämonen. Aber von den Priestern erkannt und getötet zu werden, ist nicht die einzige Gefahr, der sie ins Auge sehen müssen. Roul, Herr von Abanyama, will nicht von Caro ablassen und verfolgt sie erbarmungslos … Band 3: Auf ihrer abenteuerlichen Weltenwanderung sind Caro und Ryu in das vom Krieg zerrissene Dämmerreich geraten. Hier lebt die Kaste der Nasiya, die in ihren Träumen durch ferne Welten reisen. Ist eine ihrer auf Pergament gebannten Traumvisionen das ersehnte Bild, mit dem die beiden Bildvagabunden heimfinden? Doch es ist leichter gesagt als getan, in den Hort, die Heimat der Nasiya, und damit an ein Bild für die Weiterreise zu gelangen. Der windumtoste Berggipfel wird von Zentaurenkriegern belagert, die ebenso wie Caro und Ryu den Traumbildern nachjagen – und sich sehr für Reisende aus anderen Welten interessieren … Band 4: Caro und Ryu sind in Abkhinda angelangt, wo die Gilde der Bildvagabunden residiert, großzügig unterstützt vom Tanios, dem Herrscher des Landes. Mit dem Wissen der Gilde über die Welten, angesammelt über Jahrhunderte in einer riesigen Bibliothek, wollen sie nun endlich den Weg nach Hause finden. Doch der Tanios, der Abkhinda mit harter Hand regiert, hat andere Vorstellungen: Ryus Drachenfeuer soll ihm helfen, eine erstarkende Rebellion niederzuschlagen. Und dann ist da noch Banor, der Zentaur, der ihnen nach Abkhinda gefolgt ist, um sich zu rächen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marmor und Nebel
Prolog
Einem glitzernden Stern gleich streute der Kristall das Sonnenlicht in die Ecken des düsteren Raums. Er malte helle Flecken auf die Kerben und Dellen der Werkbank, schien von den gläsernen Kolben auf den Regalbrettern wider und spiegelte sich in den Schneiden der sorgsam aufgereihten Messer.
Es ist vollbracht.
Aus dem Destilliergefäß tropfte es und im Athanor knisterte das Feuer. Kutschen rumpelten auf dem Kopfsteinpflaster jenseits der Ziegelsteinmauern. Wohlbekannte Laute, die ihn begleitet hatten auf seinem Weg. Dessen Ende erreicht war.
Er stand da und starrte ungläubig auf sein Werk. Lange Jahre hatte er von diesem Augenblick des Triumphs geträumt, ihn sich mit aller Kraft seines Herzens ersehnt. Sich ausgemalt, wie sich seine Thesen bewahrheiteten. Wie sich Spott und Gelächter in Anerkennung und Glückwünsche wandelten. Noch am Morgen hatte er wirklich und wahrhaftig gedacht, dieser Moment sei endlich gekommen, der Moment, in dem er als Erster die vierte Dimension betreten sollte.
Er hatte sich geirrt. Die vierte Dimension gab es schlichtweg nicht.
Aber seine Anstrengungen waren nicht umsonst gewesen. Ganz im Gegenteil. Er hatte etwas anderes entdeckt. Etwas Größeres. Unvorstellbares.
Ein ungewisses Hochgefühl stieg in ihm auf. Er lächelte, vorsichtig nur, damit er einem bösartig gesinnten Schicksal keinen Anlass gab, seine Entdeckung in den nächsten Sekunden zum Hirngespinst werden zu lassen. Doch sie blieb bestehen. In den Strahlen der aufgehenden Sonne schimmerten Kristall und Messer verheißungsvoll.
Sein Lächeln wurde breiter.
Als er den Arm hob und den Hammer mit aller Kraft auf den kanonenkugelgroßen Kristall sausen ließ, lachte er lauthals auf.
1
Die Jugendstil-Haustür knallte zu.
Caro schoss mit einem hastigen »Hallo!« an einer irritiert guckenden Mittdreißigerin in Jeans, kamelfarbenem Wollmantel und Designerstiefeln vorbei, polterte die Holztreppe in den ersten Stock hinauf und raste durch die angelehnte Wohnungstür in den mit Stäbchenparkett ausgelegten Flur. Ihre eilig heruntergerissene Jacke flog an der Garderobe vorbei zu Boden. »Paps, Leo, Christine!«
Im Schlafzimmer, gleich neben der Tür, stapelten sich Kleidersäcke auf dem Bett. Der Schrank stand offen, noch halb gefüllt mit Tante Gudruns Pullovern, Kleidern, Jeans und Jacken. Niemand zu sehen. Auch das Bad gegenüber war leer.
»Wo steckt ihr?«
»Hier hinten!« Leo streckte den Kopf aus der Wohnzimmertür am Ende des Flurs. »Was brüllst du so?«
Caro fuchtelte mit dem Smartphone. »Juilliard!«
»Was?« Paps’ Kopf erschien neben dem von Leo.
»Und wo ist der Kaffee?«, setzte Leo vorwurfsvoll hinzu.
»Vergiss den Kaffee!« Sie hatte kurz vor dem Coffeeshop kehrtgemacht. »Nachricht von der Juilliard School!«
»Und?«, fragte Paps vorsichtig.
»Ich … ich habe sie noch nicht geöffnet.«
»Mann, Caro, dann öffne sie!« Leo griff nach dem Smartphone, das sie rechtzeitig aus seiner Reichweite brachte.
»Lass das, Leo!«
»Caro, jetzt lies sie schon!«, sagte Paps streng.
Christine kam mit Packpapier in der Hand aus der Küche. Sie runzelte die Stirn. »Was ist los?«
»Nachricht von Juilliard«, erklärte Leo.
»Von wem?«
»Von der Juilliard School in New York! Caro, jetzt mach!«
Caro starrte auf das Display des Smartphones. Sie hatte sich auf dem Weg zum Coffeeshop auf ihrer Bewerbungsseite eingeloggt, wie so häufig in den letzten Wochen, seit sie ihre Unterlagen hochgeladen hatte. Immer wieder war sie enttäuscht worden. Bis gerade eben. Neben dem Nachrichten-Button prangte eine rote Eins. Eine neue Nachricht. Was würden sie ihr sagen? Würde sich ihr Traum, ein Studium an einer der führenden Schauspielschulen der Welt, endlich erfüllen?
»Caro!« Paps wurde sichtlich sauer. »Sieh nach!«
Christine rollte die Augen.
Caro atmete durch. Dann drückte sie den Button. Ihr Finger zitterte.
Sie las. Und las noch einmal. Meinte, ihr Herz würde jeden Moment zerspringen. Las es ein drittes Mal, um sich ja nicht zu irren. »Das … ich meine …« Sie verstummte.
»Was?« Christine, ungeduldig.
»Ich bin weiter.« Fassungslos sah sie die anderen an, Paps, ihre Schwester und Leo, auf dessen Gesicht sich ein Grinsen breitmachte. »Ich bin weiter. Auditions. Vorsprechen. Im Januar oder Februar. Ich soll mich für ein Datum registrieren.«
»Yes, we can!«, brüllte Leo und riss sie so fest an sich, dass es schmerzte. »Wow, Glückwunsch! Ein Schritt näher an Hollywood!«
»Herzlichen Glückwunsch!« Paps strahlte und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, wobei er Leo unsanft aus dem Weg schob. »Das Vorsprechen schaffst Du, hundertprozentig!«
»Herzlichen Glückwunsch, Caro.« Das Lächeln ihrer Schwester hatte etwas Gezwungenes. Christine knabberte noch daran, dass sie bei dem Erbe leer ausgegangen war und Tante Gudrun Caro die Wohnung im Frankfurter Westend vermacht hatte. Leo, Caros bester Freund, hatte Christines Angebot, beim Ausräumen der Wohnung zu helfen, daher als Versuch gewertet, sich heimlich etwas Wertvolles unter den Nagel zu reißen. Was aber damit zusammenhängen konnte, dass er Christine nicht leiden mochte.
Diese Verwicklungen waren Caro jetzt herzlich egal. Da stand es. Schwarz auf weiß. »Ich glaube es nicht. Juilliard. New York. Ich meine, ja, es ist nur das Vorsprechen, aber …« Sie starrte auf die Mail, die sie unverändert zum Vorsprechen einlud. Darunter der Link zu den Terminen, über den man sich eintragen sollte. Mit dem Gefühl, neben sich zu stehen, loggte sie sich schließlich aus und steckte das Smartphone in die Hosentasche.
»Nun komm schon!« Paps zog sie ins Wohnzimmer und drückte sie auf das rote Samtsofa. »Du bist gut und das haben die sofort gemerkt, als sie dein Video gesehen haben. Das Vorsprechen wird ein Klacks für dich! Christine, hast du in der Küche Sekt oder so etwas gesehen? Das müssen wir feiern!«
Christine gab einen Ton von sich, der nach »Hmpf« klang.
Leo rannte an ihrer Stelle in die Küche, die er, den Geräuschen nach zu urteilen, auf seiner Suche nach etwas Trinkbarem auf den Kopf stellte. »Ha! Eine Flasche Prosecco im Kühlschrank! Wo sind …? Ach, was soll’s!«
Sie stießen mit Wassergläsern an. Die Champagnerkelche hatte Gudrun einer ihrer Freundinnen vermacht, die sie vor ein paar Tagen abgeholt hatte.
»Also!« Paps hob das Glas. »Auf Caros Schauspielkarriere!«
»Auf Caro!«, brüllte Leo und murmelte Christine.
Das kühle Prickeln des Proseccos erschien Caro genauso unwirklich wie die Einladung zum Vorsprechen. Falls das Vorsprechen und der Callback klappten, würde sie im kommenden Herbst nach New York ziehen! Um Schauspiel zu studieren! Weg aus Frankfurt, weg vom Studium der Theaterwissenschaften!
Stopp! Du hast gerade mal die erste Hürde geschafft, zwei liegen noch vor dir! Werde nicht übermütig!
Sie nahm hastig einen weiteren Schluck. Es war real. So real wie das alte Sofa, der Couchtisch aus den Sechzigern und der zerschlissene Sessel am Erkerfenster, in dem Gudrun gelesen und ihre Rollen gelernt hatte. Sie war Fernsehschauspielerin gewesen und hatte die Liebe zur Schauspielerei in Caro erweckt. Ohne Gudrun, die ihr gut zugeredet hatte, sich in Theatergruppen zu engagieren und sie beim Lernen für die kleineren Rollen unterstützte, die sie in Independent-Filmen ergatterte, hätte sie es nicht geschafft, diese eine Runde weiter an der Juilliard zu kommen. Und ohne das Erbe hätte sie sich nie an der Juilliard beworben. Nur mit dem Verkauf der Wohnung würde sie die horrenden Studiengebühren zahlen können.
Sie fühlte sich seltsam an, diese Mischung aus Trauer um ihre Tante, ungläubiger Freude und Schuld. Endlich konnte sie sich ihren großen Traum erfüllen! Aber möglich gemacht worden war ihr das durch Gudruns Tod. Das nagte an ihr. Wenn Gudrun doch noch da wäre und auf dem Sofa bei ihnen säße!
Mit einer abrupten Bewegung stellte sie das Glas auf dem Couchtisch ab. Sollte sie wirklich feiern?
»Es ist genau das, was Gudrun gewollt hätte.« Paps hatte sich neben sie gesetzt und legte den Arm um ihre Schultern. »Sie würde sich wünschen, dass du dein Erbe so nutzt. Hat sie das nicht im Testament gesagt? Dass du deine Träume leben sollst?«
»Ja, doch. Aber es fühlt sich … falsch an. Von ihrem Tod zu profitieren, meine ich.«
»Sie hat es so gewollt!« Leo hatte sich in den Sessel am Erkerfenster geworfen, Christine stand missmutig mit Packpapier und Glas in den Händen im Türrahmen. »Wenn du es nicht machst, würdest du ihrem letzten Wunsch zuwiderhandeln!«
Caro hob die Hände. »Ihr habt ja recht! Trotzdem hoffe ich jedes Mal, dass Gudrun mich begrüßt, wenn ich durch die Wohnungstür komme. Und mir lachend erklärt, dass ihr Tod nichts weiter als eine Filmszene gewesen sei.«
»Ein unerlässlicher Schlusspunkt der Inszenierung des Lebens«, murmelte Leo.
Christine verdrehte die Augen.
»Ich weiß, dass es schwer ist. Du und Gudrun habt euch sehr nahegestanden«, sagte Paps. »Es dauert, bis man sich daran gewöhnt hat, dass sie nicht mehr da ist. Aber so ist es nun einmal.«
Caro lächelte wehmütig. »Ja, das ist es. Ich stelle mir gerade vor, welchen Freudentanz sie aufgeführt hätte, wenn sie von der Einladung zum Vorsprechen wüsste!«
Paps lachte und Leo meinte grinsend: »Vielleicht führt sie den gerade auf ihrer Wolke auf.«
»So, wie ich meine Schwester kenne, klaut sie dabei den Engeln den Heiligenschein.« Paps erhob sich. »Aber auf, wir sind noch lang nicht fertig! Der Container kommt morgen und bis dahin müssen wir alles durchgesehen und ausgeräumt haben!«
»Das gilt auch für Hollywooddiven«, sagte Leo. Dafür handelte er sich einen Boxhieb auf dem Arm ein. »Aua!«
»Geschieht dir recht. Ich mache im Schlafzimmer weiter. Los, hilf mir dabei.« Aber sie konnte nicht verhindern, dass auf ihrem Gesicht ein Grinsen erschien, das sicher noch breiter war als das von Leo vorhin. Juilliard war zum Greifen nah! Und tief drinnen war sie sicher, dass Gudrun damit zu tun hatte. Vielleicht war sie irgendwo da draußen und passte auf sie auf, lenkte ihre Geschicke. Ein kindischer, aber tröstlicher Gedanke.
»Ma’am, yes, Ma’am.« Leo salutierte zackig.
Christine verschwand wortlos in der Küche, wo sie das Geschirr einpackte, dass Paps und Mam nehmen wollten. Paps wandte sich den Regalen im Wohnzimmer zu, um Aktenordner nach Unterlagen zu durchsuchen.
Im Schlafzimmer besah Leo sich seufzend die Kleidersackberge und den noch halb vollen Schrank. »Ich kann nicht glauben, dass eine allein lebende Frau so viel Kleidung hat. Doch, ich kann es glauben. Ist ja eine Frau. Aua!« Das war ein weiterer Boxhieb gewesen.
»Werd nicht frech. Übrigens stehst du kurz davor, deine Wette zu verlieren. Nur so zur Info.«
»Nix da!« Er steckte den Kopf in den Schrank. »Ich bin erst dran, wenn die Juilliard School dich aufnimmt!«
Sie kicherte. Mit einem Mal wurde ihr leicht ums Herz, aber das konnte auch an dem Prosecco auf nüchternem Magen liegen. »Ich freue mich schon auf meinen Tag im Spa! Sponsored by Leo Brückner.«
»Ph«, machte Leo, der in besagtem Spa als Physiotherapeut arbeitete. »Sag mal, das sind ja alles Männersachen hier!« Er kam zum Vorschein, in der Hand eine Anzugjacke mit Einstecktuch.
»Die gehörten meinem Onkel Doran.«
»Dein Onkel? Ich wusste gar nicht, dass Gudrun verheiratet war!«
»War sie. Mein Onkel ist vor zwanzig Jahren verschwunden. Ich habe keine Erinnerungen an ihn, ich war damals erst ein Jahr alt. Er ist eines Abends joggen gegangen und nicht zurückgekommen. Gudrun hat ihn als vermisst gemeldet und irgendwann für tot erklären lassen. Der Raum gegenüber der Küche ist sein Arbeitszimmer. Sie hat ihn so belassen, wie er bei seinem Verschwinden war.«
»Echt?« Leo warf einen neugierigen Blick schräg über den Flur, durch die offen stehende Tür des Arbeitszimmers. Dort stand ein Schreibtisch aus dunklem Holz vor zwei hohen Fenstern mit weißen Netzgardinen. An der Wand zwischen den Fenstern hing ein Bild in einem Goldrahmen. Ansonsten gab es bis an die Decke reichende Regale, die nur unterbrochen wurden von den Türen eines Einbauschranks. Den sie auch noch ausräumen mussten. »Na ja, man liest ja immer wieder von diesen Fällen. Frei nach dem Motto: Schatz, ich hole mal gerade Zigaretten. Vielleicht wurde er ja ermordet!«, setzte er wenig gefühlvoll hinzu.
»Ein Unfall ist wahrscheinlicher. Er ist nach der Arbeit häufig eine Runde gelaufen. Jedenfalls ist Gudrun eines Abends nach Hause gekommen und er war weg. Nur der Zettel, auf dem er geschrieben hatte, er sei joggen, lag auf dem Küchentisch. Die Polizei ist seine Joggingstrecke abgefahren und hat sogar mit einem Boot auf dem Main nach ihm gesucht. Vor vier Jahren haben sie sich wieder gemeldet. Sie hatten eine Leiche gefunden, einen Obdachlosen, der erfroren war, und haben Gudrun Fotos gezeigt. Doch der Mann war nicht Onkel Doran.«
»Das muss hart für sie gewesen sein. Sie hat wirklich gar nichts von ihm weggetan?«
»Nein, sie brachte es nicht übers Herz.«
Er deutete auf das Foto auf dem Nachttisch. »Dann ist er das?«
»Ja, das ist das Hochzeitsfoto von Tante Gudrun und Onkel Doran.«
»Sie hat in Schwarz geheiratet!«
»Und nur standesamtlich. Meine Großeltern waren nicht amüsiert, aber wenigstens war Onkel Doran Beamter, das hat es rausgerissen.« Sie betrachtete den grinsenden Mann neben ihrer lächelnden jungen Tante. Er war groß und hager und erinnerte mit seiner gebogenen Nase an einen Habicht.
»Deine Tante scheint ein schwarzes Schaf gewesen zu sein.«
»Eher ein exotisches Schaf. Und auch nur so lange, bis sie eben einen Beamten heiratete und mit der Schauspielerei durchaus Erfolg hatte. Da waren meine Großeltern glücklich. Aber jetzt lass uns weitermachen, sonst werden wir nie fertig!«
Es war erstaunlich, welche Massen an Kleidung sie aus dem Schrank zogen. Gudrun hatte sich nicht nur geweigert, die Sachen ihres Mannes wegzugeben, sondern auch Kostüme aus Theateraufführungen und Verfilmungen behalten. Sie fanden ein bodenlanges Kleid in Weiß und Rosa mit einem atemabschnürenden Korsett, ein Marlene-Dietrich-Outfit, Petticoats aus den Fünfzigerjahren, weite bunte Hippieröcke und Bauernblusen. Caro wollte all dies am nächsten Tag der Uni-Theatergruppe mitbringen. Dann leerten sie Onkel Dorans Schrankseite. Anzüge, von denen einer aussah wie der nächste, wurden in Säcke gestopft, gefolgt von Hemden, Krawatten, T-Shirts, Unterwäsche, einer Jeans, einem Morgenmantel und einer Hausweste.
Es ging auf den Spätnachmittag zu, als Leo einen Knäuel Sportsocken in einen prall gefüllten Sack stopfte und gähnte. »Pause! Gibt’s außer Prosecco noch was zu trinken?«
»Da stehen Mineralwasserflaschen im Kühlschrank. Und es gibt Filterkaffee. In der Dose neben der Kaffeemaschine. Die Filter sind in der Pappschachtel dahinter.«
»Cappuccino ist mir lieber. Weil du dich gerne ablenken lässt beim Kaffeeholen, stiefele ich mal los. Olaf, Christine, ich ziehe los, zum Coffeeshop. Soll ich euch etwas mitbringen?«
»Doppelter Espresso!«, kam es aus dem Wohnzimmer und »Latte!« aus der Küche.
»Cappuccino«, sagte Caro. »Mit viel Koffein und noch viel mehr Zucker.«
»Okay.« Leo verschwand in den Flur. Es raschelte, als er in seinen Mantel schlüpfte.
»Nimm den Schlüssel mit, er steckt.«
»Jawoll, Frau Kaleun!« Die Wohnungstür fiel ins Schloss.
Um Platz zu schaffen, trug Caro die Säcke in den Flur. Dann öffnete sie Gudruns Nachtschrank, in dem Schmuck lag. Zumeist handelte es sich um dicke Ringe aus Silber und schwere lange Ketten mit Strassanhängern.
»Paps, Christine! Wollt ihr etwas von Gudruns Schmuck? Als Andenken?«
Über das Tempo, mit dem Christine ins Schlafzimmer eilte, hätte Leo gegrinst. Paps gesellte sich zu ihnen, aber bevor ihre Schwester nach etwas greifen konnte, fragte er: »Willst du das nicht für dich behalten?«
Caro schüttelte den Kopf und legte die Hand auf ihr Sweatshirt, unter dem sie Gudruns Geschenk zum achtzehnten Geburtstag trug, eine goldene Kette mit einem Anhänger aus einem roten Stein. Sie hatte Gudruns Urgroßmutter gehört und war das einzige Schmuckstück, das Caro etwas bedeutete. »Nein. Aber vielleicht will Mam etwas haben?«
Schließlich hatten sie den Schmuck aufgeteilt und Paps und ihre Schwester verschwanden in Küche und Wohnzimmer. Caro hingegen beschloss, auf den von Leo versprochenen Kaffee zu warten, bevor sie weitermachte. Ein Gähnen unterdrückend wanderte sie in Onkel Dorans Arbeitszimmer. Sie war selten dort gewesen, denn Tante Gudrun hatte es nicht gerne gesehen, wenn sich jemand darinnen aufhielt. Es war ihre Erinnerungsstätte an Doran gewesen.
Sie musterte den Raum. Die Regale und der Wandschrank waren eingebaut. Wie die Küche auch, würde sie sie nicht entfernen lassen. Das sollte der Käufer der Wohnung entscheiden. Alle anderen Möbel würden sie in den Container entsorgen. Es gab nichts Wertvolles darunter und die Sachen waren alt und verwohnt.
Sie strich mit der Hand an den Buchreihen entlang. Die Bücher waren ein Sammelsurium aus antiken in Frakturschrift gehaltenen Bänden, gebundenen Ausgaben und Taschenbüchern. Die meisten von ihnen waren zerlesen. Onkel Doran schien alles verschlungen zu haben, was ihm unter die Finger gekommen war. Von Goethe und Schiller über die Bestseller der Achtziger- und Neunzigerjahre bis hin zu obskuren Berichten über Ufosichtungen, Hexen und im Bermudadreieck verschwundenen Schiffen schien er nichts ausgelassen zu haben.
Sie zog ein paar Bücher heraus und öffnete sie. In jedes hatte Doran seinen Namen in altmodischer Schrift geschrieben, inklusive des Initials ›W‹ für seinen Zweitnamen, den sie nicht kannte.
Sie vertiefte sich in ein Buch über Felszeichnungen in der Atacamawüste, in dem behauptet wurde, die Zeichnungen seien von Außerirdischen gemacht worden. Jemand – es war wohl Doran gewesen – hatte Anmerkungen an die Seitenränder geschrieben. Laut denen war so ziemlich alles, was in dem Buch behauptet wurde, ›Unfug‹ oder ›Blödsinn‹. Dann öffnete sie eines über die Kraft der Magie an der Stelle, die mit einer vergilbten Postkarte aus Bad Pyrmont – mit lieben Grüßen von Hilde – markiert war. »›Die transzendente Kraft der Magie durchdringt den Kosmos‹«, las sie den ersten Satz halblaut. »›Alles ist mit allem verbunden. Erfahrbar ist die Magie über höhere Bewusstseinsebenen, die ausschließlich zu erreichen sind, indem das rationale Denken aufgehoben wird …‹«. An diesen Satz hatte Doran ein ›Aha!‹ gekritzelt. Sie stellte das Buch zurück. Onkel Doran, der Beamte, war facettenreicher gewesen, als sie es sich vorgestellt hatte. Nun, er hatte auch eine unkonventionelle Frau geheiratet.
Sie öffnete den Wandschrank. In seinen mit geblümtem Papier ausgelegten Fächern lagerten Büromaterialien: Stifte, Notizblöcke, Tesafilm, Uhu, ein Bleistiftspitzer. Es gab Schuhkartons mit vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos. Sie zeigten lachende Männer und Frauen in der Kleidung der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Keine Ahnung, wer diese Leute gewesen waren. Sie mussten die Fotos durchsehen, vielleicht erkannte Paps jemanden darauf.
In dem großen Fach hinter der rechten Tür bedeckte ein Laken Gegenstände. Sie zog es weg. Darunter kamen opulente Ölgemälde zum Vorschein. Das vorderste zeigte eine Hochgebirgskulisse im Sonnenuntergang, mit Schneefeldern, Bergwiesen, Tannen und einem Flöte spielenden Hirten nebst den dazugehörigen Ziegen. Dahinter mehrere mit ähnlichen Szenen, Kinder auf einer Alm, ein Dorfbrunnen in einem Alpendorf, über dem sich schneebedeckte Gipfel erhoben, und ein einsames Tal unter bedrohlich aussehenden Bergriesen. Keine Chance, dass sie die behielt. Vielleicht hatte ein Antiquitätenhändler Interesse.
Sie schlenderte zu dem Gemälde, das zwischen den Fenstern hing. Der goldene Rahmen war ungewöhnlich. Er war bis auf die muschelförmigen Verzierungen in drei seiner Ecken glatt. In die Ecke unten rechts hingegen war ein altertümlich bekleideter Mann geschnitzt, der mit einem Rucksack auf dem Rücken und einem Wanderstock in der Hand eifrig ausschritt. Das Bild selbst zeigte einen breiten Korridor mit grauweißem Marmorfußboden, der auf drei Spitzbogenfenster zulief. Durch die Spitzbögen erkannte man den Ausschnitt eines Gartens mit Büschen und Blumen sowie einer Wand, an der Efeu emporrankte. Im Vordergrund stand ein zierlicher Tisch mit geschwungenen Beinen, darauf eine aufwendig verzierte Vase. Im Vergleich zu den überladenen Gebirgsdarstellungen im Schrank wirkte dieses Gemälde modern steril.
Das Geräusch des sich drehenden Schlüssels in der Wohnungstür unterbrach ihre Gedankengänge. »Ich bin’s!« Die Tür schlug zu. »Mit genug Koffein und Zucker, um eine Kompanie LKW-Fahrer vierundzwanzig Stunden wach zu halten!«
»Klingt super! Ich bin im Arbeitszimmer!« Sie fuhr mit den Fingern über den Rahmen, die rechte Leiste hinunter zu der Figur des Wanderers, strich über sie. Die Schnitzerei ist so ….
Ein Dröhnen wie von den Turbinen eines Jumbojets erschütterte den Raum. Erschrocken fuhr sie herum. Leo stand in der Tür, den Becherhalter mit den Kaffees in der einen Hand und eine braune Gebäcktüte in der anderen. Sein entsetztes Gesicht und das Arbeitszimmer verschwammen, als würde jemand die Umgebung verpixeln. Die Pixel bildeten Farbflächen, die sich zu drehen begannen und zu Farbstreifen wurden, die in Rot, Gelb, Grün, Blau und sämtlichen Schattierungen dazwischen um sie wirbelten. Ihr Aufschrei ging in dem Dröhnen unter. Sie konnte sich nicht bewegen, nicht einen einzigen Schritt machen, um dem Mahlstrom der Farben zu entrinnen. Dann zerbarst der Mahlstrom und löste sich in Finsternis und Stille auf.
2
Ihre Wange presste sich an einen harten, kühlen Untergrund. Warme Luft, durchsetzt mit der Note eines Dufts, der sie an einen längst vergangenen Provenceurlaub erinnerte, umfächelte sie. Vögel zwitscherten. Etwas raschelte.
Aufstöhnend stemmte sie sich hoch. »Leo, was war das?« Sie rieb sich die Augen, versuchte, die Farbpunkte zu vertreiben, die in der Luft vor ihr tanzten.
Bis auf fröhliches Vogelgezwitscher kam keine Antwort.
»Leo?« Sie zwinkerte.
Die Punkte verschwanden und die Umgebung kam in Fokus. Ein geschwungenes Tischbein, weiter oben eine Vase mit einem Muster aus goldenen und roten Blüten und Blättern. Sie saß auf dem Boden eines breiten Flurs. Fußboden und Wände bestanden aus weißgrauem Marmor. Vor ihr lagen drei unverglaste, mit rötlichem Stein umfasste Spitzbogenfenster. Durch sie war ein Garten mit einer efeubewachsenen Wand zu sehen, der vom gelborangen Sonnenlicht eines späten Sommernachmittags beschienen wurde. Vor den Fenstern bog der Gang nach links ab. Das Rascheln entpuppte sich als das von vertrockneten Blättern und Grashalmen, die der Wind in der Ecke unter den Fenstern zu einem Haufen zusammenwehte.
Sie sprang auf. Wirbelte herum und erwartete Leo zu sehen, der rief: »Reingelegt!«
Da war niemand. Hinter ihr verlief der Marmorflur bis zu einer Mauer, an der ein Wandteppich hing, und knickte dort nach links ab.
»Leo?«, flüsterte sie mit trockener Kehle.
Vogelgezwitscher und das Rascheln von Blättern und Gräsern.
Sie schluckte und tappte vorsichtig zu dem Wandteppich, auf dem golddurchwirkte Fäden in Braun, Weiß, Blau und Grün das Abbild einer geometrisch angelegten Parkanlage zeigten, mit Wasserbecken, einem Heckenlabyrinth und einer Freitreppe, die zu einem palastartigen Gebäude führte. Das Gewebe war an den Rändern ausgefranst und hatte Dutzende Mottenlöcher.
Der Flur lief zu ihrer Linken ein paar Meter weiter und endete an einer geschlossenen weißen Flügeltür mit goldenen Einlegearbeiten und einem verschnörkelten Griff.
Kein Paps, kein Leo, keine Christine. Und keine Wohnung.
»Oh, Mann.«
Sie schlich zurück, am Tisch vorbei zu der Flurecke an den Spitzbögen. In dem dort beginnenden Korridor gingen linksseitig Türen ab, die ähnlich prächtig gestaltet waren wie die am Wandteppich. In der Wand gegenüber jeder Tür befanden sich Spitzbogenfenster. Neben den Türen waren Eisenklammern angebracht. In einer steckten die Reste einer Fackel.
Sie nahm die Ausstattung des Flurs nur vage zur Kenntnis. Es war seine Länge, die sie nach Luft schnappen ließ. Er lief ins Unendliche. Wände, Boden, Decke, Türen und Spitzbögen verschmolzen in der Ferne zu einem grauen Punkt.
»Was … wo bin ich? Leo? Paps?« Ihre Stimme klang dünn. »Hallo? Ist da wer?«
Keine Antwort.
Mit klopfendem Herzen trat sie an das Fenster und spähte in einen verwilderten Garten. Sträucher mit roten und gelben Blüten wuchsen hier. Klatschmohn und Margeriten durchsetzten das hohe Gras. Die efeubewachsene Wand, die den Garten begrenzte, lag knapp zehn Meter entfernt. Vor ihr wucherten Rosmarinsträucher und Thymian. Über den Pflanzen, auf Höhe des nächsten Stockwerks, gab es eine Reihe von vor Schmutz blinden Fenstern, darüber ein löchriges Dach aus terrakottafarbenen Ziegeln.
Sie beugte sich nach draußen. Der vernachlässigte Garten war ein schlauchförmiger Innenhof, der parallel zu dem endlosen Flur verlief und sich in der Ferne verlor. Rechts neben dem Fenster, aus dem sie lehnte, endete er an einer hohen fensterlosen Mauer.
Sie zog den Kopf zurück, drehte sich um und starrte den Boden, die Wände und das Tischchen mit der Vase an.
Es sieht aus wie in dem Bild.
»Scheiße, wo bin ich?« Panik kroch in ihr hoch, beschleunigte den ohnehin hektischen Schlag ihres Herzens. »Leo? Bist du da irgendwo? Paps? Christine?«
Niemand antwortete. Ein warmer Luftzug strich durch Sträucher, Gräser und Blumen und trug den Duft nach Provence in den Flur.
Ein Traum! Beinahe hätte sie aufgelacht. Natürlich, das musste es sein! Sie war eingeschlafen! Sie träumte von dem Bild, das sie im Arbeitszimmer betrachtet hatte!
»Wach auf!«, befahl sie sich und zwickte sich in den Arm. »Los!«
Bis auf einen kurzen Schmerz im Arm geschah nichts.
Falls das ein Traum ist … dann passierte vielleicht gleich etwas. Eine der Türen würde aufgehen. Jemand herauskommen. Oder die Mauern würden sich auflösen. Oder sich in Gudruns Wohnung verwandeln.
Ein Schmetterling flog taumelnd aus dem Hof herein und setzte sich an die Wand, wo er zitternd mit den zarten Flügeln schlug. Sie waren schwarz und betupft mit blau schillernden Punkten.
Caro schluckte in einem vergeblichen Versuch, ihre Kehle zu benetzen. Das war kein Traum? Wo war sie? Wie war sie hierher gekommen? Wo waren Paps, Leo und Christine?
»Scheiße«, wisperte sie. Es gelang ihr nur mit Gewalt, die Tränen zurückzudrängen, die ihr in die Augen stiegen.
Da kam ihr die erlösende Eingebung. »Handy!«
Mit einem erleichterten Seufzer zog sie das Smartphone aus der Hosentasche und schaltete es ein. Der Akku war voll, sie hatte ihn heute Morgen aufgeladen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, ihren Bewerbungsstatus an der Juilliard nicht checken zu können.
Suchen ...
Kein Netz.
Klar, wenn man die blöden Dinger mal wirklich brauchte! Sie ging ein paar Meter den Flur hinunter und wieder zurück, schwenkte das Gerät über ihrem Kopf hin und her und hielt es durch ein Spitzbogenfenster in den Hof. Das Handy beharrte stumpfsinnig darauf, dass es kein Netz fand.
»Scheiße!« Sie schaltete es aus und stopfte es in die Tasche. Sie musste sich einen Ort mit Empfang suchen. Vielleicht wenn sie dem Flur folgte …? Nein: Sie war hier gelandet, also befand sich der Rückweg auch hier, oder? Vielleicht gab es eine versteckte Tür?
Sie fuhr mit den Händen an der Wand entlang. Der Marmor war kühl, die Fugen zwischen den Steinen kaum zu erkennen. Auf der schwarzen Tischplatte lag eine Staubschicht, in die ihre Finger Schlangenlinien malten. Sie hob die verstaubte Vase an und drehte sie um. Ein vertrocknetes Blatt segelte zu Boden. Auch hinter dem Wandteppich gab es nur eine glatte Marmorwand.
Blödsinn, ich bin nicht durch eine Tür hergekommen!
Sie befahl sich, nicht in Panik zu verfallen. Denk nach, was geht hier vor?
Sie war an den Ort gelangt, den das Gemälde im Arbeitszimmer darstellte, ein abstruser, aber beunruhigend logischer Gedanke. Falls sie einmal für fünf verrückte Sekunden annahm, dass dem so war, gab es hier ein Bild vom Arbeitszimmer in Gudruns Wohnung? Mit dem sie nach Frankfurt zurückkehren konnte? An den Wänden hier hingen nur diese Eisenklammern, aber keine Bilder. Und in den Räumen?
Sie schlich auf Zehenspitzen zur ersten Tür in dem endlosen Flur, legte ein Ohr an das Türblatt. Stille. Zögernd drückte sie die Klinke und zog die Tür auf. Das Quietschen ungeölter Angeln hallte von den steinernen Wänden wider und ließ sie zusammenfahren.
Keine der Türen klappte auf, niemand rief »Wer ist da?« oder kam, um dem Geräusch auf den Grund zu gehen.
Sie zog die Tür so weit auf, dass sie den Kopf durch den Spalt stecken konnte. Ein leerer Raum mit schmutzigen Fenstern, durch die sie einen Hof ähnlich dem am Flur erkannte. Die Marmorwände waren nackt. Rechts gab es einen Durchgang, der einen Blick in den nächsten – ebenfalls leeren – Raum erlaubte. Die dicke Staubschicht auf dem Boden war unberührt.
Sie schloss die Tür, die wieder das gellende Quietschen von sich gab. Ob nicht doch jemand …? Doch sie blieb allein und wusste nicht, ob das beruhigend oder beängstigend war. Falls sie jemanden fand, konnte der ihr erklären, wo sie war. Andererseits war es schwer vorstellbar, dass die Bewohner glücklich über eine Fremde sein würden, die unvermittelt in ihr Haus oder Schloss oder Was-auch-immer-das-hier-war schneite.
Trotzdem: Sie war hier. Für einen Traum war es zu real. Sie war allein. Was sie hergebracht hatte, hatte weder Leo, Paps noch Christine erfasst – und es war nicht mehr da, brachte sie nicht zurück nach Hause.
Sie zwang sich, überlegt vorzugehen, auch wenn ihre Sinne darauf aus waren, sie in ein heulendes Nervenbündel zu verwandeln. Sie atmete durch, wie sie es zu tun pflegte, bevor sie die Bühne betrat.
Stell dir vor, das ist ein Abenteuerfilm. Was macht die Heldin? Optionen durchdenken!
Sie konnte bleiben und warten, ob jemand auftauchte, der ihr half. Vielleicht Paps und Leo, die den Weg herfanden. Schließlich hatte Leo miterlebt, was passiert war. Sie würden alle Hebel in Bewegung setzen, um sie zurückzuholen!
Oder sie ging auf die Suche nach einem Ausgang, fand heraus, wo sie war, und kehrte nach Hause zurück. Das erschien ihr die bessere Alternative. Der Staub in dem Zimmer und auf dem Tischchen zeigte, dass sich lange niemand um dieses Gebäude gekümmert hatte. In absehbarer Zeit würde keiner vorbeikommen. Und hätten Paps und Leo ihr folgen können, wären sie längst aufgetaucht.
Also einen Ausgang suchen. Nur, in welcher Richtung lag der? Es gab leider keine grünen Schilder mit dem Wort »Ausgang« oder mit einem rennenden Männchen und einem Pfeil darauf. Vielleicht den langen Flur hinunter? Bevor sie das tat, war es besser, sicherzustellen, dass es in dem Raum am Wandteppich nicht etwas gab, was ihr weiterhalf. Sie lief um die Ecken und drückte die Klinke der Flügeltür runter. Das Holz schabte leicht über den Boden, als sie die Tür aufzog.
»Wow!«, entfuhr es ihr.
Der Raum war ein Saal, der eine im wahrsten Sinne des Wortes verstaubte Grandezza ausstrahlte. Wände und Decken waren in Gold gehalten. Das Sonnenlicht, das durch die hohen Fenster fiel, brach sich in staubigen Spiegeln, die in allen Variationen an den Wänden hingen. Buntes Spiegelglas formte Mosaike – Bögen, Quadrate, Landschaften, Blumenranken, eine Reihe kleiner Säulen in einer Nische, Sterne, der Mond, die Sonne. Aufgelockert wurde das glimmende Wirrwarr durch Spiegelflächen mit dicken goldenen Rahmen, viele von ihnen bedeckt mit den weißen Streifen von Vogelkot. Auf Hüfthöhe lief eine mit Blüten und Blättern bemalte Holzverkleidung um den Saal. Vor den zerbrochenen Fenstern, die von Bögen bunten Spiegelglases umgeben waren, stand ein Tisch aus dunklem Holz, davor drei Stühle.
Caro trat einen Schritt vor, um gleich darauf erschreckt zurückzufahren. Dutzende, wenn nicht gar Hunderte ihrer Spiegelbilder bewegten sich an den Wänden. Bei einem fröhlichen Fest musste der Effekt überwältigend sein. Wenn man auf sich allein gestellt gestrandet war, wirkten die Spiegelungen verstörend, als zeigten sie in den Mauern gefangene Geisterwesen.
Die mit Spiegelmosaiken verzierte Tür am anderen Ende des Saals erkannte Caro erst auf den zweiten Blick. Was es dahinter wohl gab? Vorsichtig schob sie sich an der Wand entlang. Da hier augenscheinlich lange niemand gewesen war, erschien die Vorsicht zwar unsinnig, aber sie wollte trotzdem so wenige Spuren wie möglich hinterlassen. Nahe der Wand fielen die Abdrücke ihrer Sneaker hoffentlich nicht auf.
Als sie die Tür öffnete, wehten ihr warme Luft und das Geräusch plätschernden Wassers entgegen. Ein Wandelgang. Er zog sich um einen gekiesten Hof und wurde von ihm durch gedrungene Pfeiler getrennt. Steinerne Sitzgelegenheiten standen an den Wänden. In der Mitte des Hofs gab es einen Brunnen. Ein Fisch aus rotem Marmor spie Wasser, das sich in einem Becken aus grauem Stein sammelte. Zwischen den Kieseln wuchsen Gras und Unkraut.
Das Plätschern erinnerte sie an ihre trockene Kehle. Mit einem vorsichtigen Rundblick, um sicherzustellen, dass sie allein war, kniete sie am Brunnen nieder. Kieselsteine drückten gegen ihre Knie. Sie schöpfte eine Handvoll des klaren kalten Wassers und trank.
Sie würde hier weitergehen. Der Hof erschien ihr freundlicher als der endlose Flur. Probehalber schaltete sie das Smartphone an, das weiterhin kein Netz fand. Sie machte ein Foto des Hofs und besah es sich in der Vorschau. Es bewies, dass das hier real war, und würde helfen, die anderen von dem zu überzeugen, was sie erlebt hatte. Falls sie sie wiedersah.
Sofort verbat sie sich solch morbide Gedankenspiele. Natürlich würde sie nach Hause finden! Sie war hergekommen, also gab es einen Weg zurück! Das war ja wohl logisch.
An dem Wandelgang nahm ein Flur seinen Anfang. Er knickte regelmäßig nach links oder rechts ab und erlaubte ihr so, um Ecken zu spähen, bevor sie weiterhastete. Die Räume an ihm waren leer und die Innenhöfe, in die man durch mit Bögen gekrönte Austritte gelangte, überwuchert von Gräsern und Sträuchern, zwischen denen sich häufig Kräuter, Obst und Gemüsepflanzen fanden. In einem gab es in einer windgeschützten Ecke kleine saftige Tomaten. Sie stopfte sie sich in den Mund, während sie weiterlief, zu nervös, um zu rasten, obwohl sie müde wurde.
Wo zum Teufel war sie nur? In Frankfurt war es Dezember gewesen, aber hier herrschte Sommer. Es gab niemanden in diesem riesigen Gebäude. Der Anzeige des Handys nach zu urteilen wanderte sie seit zwei Stunden durch die Flure, ohne jemanden zu treffen, oder ein Festnetztelefon oder einen Ausgang zu finden. Was sonderbar war: Es gab keine Graffiti an den Wänden. Obdachlose waren anscheinend auch keine eingezogen. Das Gebäude war vollkommen verlassen.
Sie hatte sich dermaßen an die Gleichförmigkeit des Flurs gewöhnt, dass sie überrascht stehen blieb, als der sich zu einer Halle mit einer hohen Kuppel erweiterte, die von marmornen Säulen getragen wurde. Die Verzierungen an den Säulen stellten Efeuranken, Blumenblüten und Blätter dar. In den Boden war ein Ranken und Vögel darstellendes Mosaik eingelassen. Verblichene Malereien bedeckten die Innenseite der Kuppel. In ihnen kämpften Lindwürmer, flogen über Wolken oder bäumten sich feuerspeiend auf. Durchbrochen wurden die Bilder von Fenstern, hinter denen der Sonnenuntergang den Himmel rot färbte. Auf einer Seite der Halle führte ein torartiger Durchgang auf eine Terrasse aus weißem Marmor, auf der anderen standen riesige Flügeltüren sperrangelweit auf.
Ein Ausgang! Sie rannte zum Durchgang hinaus, so froh war sie, endlich nach draußen gefunden zu haben. Auf der etwa zwanzig Meter langen Terrasse standen mannshohe Blumenkübel. Sie waren nicht bepflanzt und einer zerbrochen. Stufen führten in einen mit Kieseln bestreuten Hof, der von Mauern umgeben war. An ihnen liefen Wandelgänge entlang, darüber erhoben sich Fensterreihen. Die Gebäude, die den Hof umschlossen, waren dreistöckig. Der erhoffte Ausgang war das nicht.
Sie ging zurück in die Halle, zu den Flügeltüren, und blieb wie vom Donner gerührt stehen. Ein überdachtes Amphitheater tat sich vor ihr auf. Es gab Sitzreihen aus Marmorsteinen, die sich im Halbrund gegenüber der Bühne erhoben, und an deren oberster sie stand. Die Bühne hatte ein Loch in der Mitte, in dem sich der Souffleurkasten befunden haben musste. Sogar von hier oben erkannte sie die dicke Staubschicht, die auf den Holzbohlen lag und sich auf den Sitzgelegenheiten fortsetzte. Hinter der Bühne würde es zum Fundus mit seinen Kostümen und Requisiten gehen, zu den Werkstätten für den Kulissenbau und den Proberäumen.
Die Bühne. Ihr Lebenstraum. Es war, als verhöhnten sie die hallende Leere und der zentimeterdicke Staub, als sagten sie ihr, dass ihr Traum ausgeträumt war.
Wenn sie aus diesem absonderlichen Gebäude, das kein Ende hatte, nicht entkam.
Wenn sie den Weg nach Hause, zu ihrer Familie und zu Leo, nicht fand.
Sie sah sie vor sich, ihren Vater, wie er aufgeregt ihre Freunde abtelefonierte, ihre Mutter, die händeringend daneben stand. Und Leo, der sich Vorwürfe machte, sich einredete, er hätte ihr helfen müssen. Diese Bilder taten ihr in der Seele weh.
»Ich bin okay«, flüsterte sie, auch wenn sie sie nicht hörten. »Ich bin okay!«
Was, wenn sie auf ewig durch diese endlosen Flure, einsamen Räume und Säle irrte?
»Scheiße. So eine verdammte Scheiße!« Sie brach in Tränen aus.
3
Als ihre Tränen versiegten, war die Sonne untergegangen.
Sie trocknete sich das Gesicht mit den Ärmeln des Sweatshirts und war dankbar um das gebrauchte Taschentuch, das sie in der Hosentasche fand und mit dem sie sich die Nase putzte.
Schluss jetzt! Die Heulerei nützt dir nichts! Denk nach! Was nun?
Nachts durch dunkle, einsame Korridore zu irren, war eine furchterregende Vorstellung. Nein, sie würde sich ausruhen und morgen bei Tageslicht weitermachen.
So zog sie sich nach einigem Nachdenken hinter die Bühne zurück, wo sie sich geschützter fühlte als in der hohen Leere des Zuschauerraums. In einer ehemaligen Werkstatt fand sie mithilfe des Lichts des Smartphones einen Diwan und von Motten zerfressene Stoffe, in die sie sich wickelte.
Doch der Schlaf ließ auf sich warten. Ihre Gedanken kreisten unaufhörlich, klammerten sich an wilde Hoffnungen. Dass dies doch nur ein Traum war. Dass sie sich den Kopf gestoßen hatte und im Koma lag, ja, selbst das erschien ihr besser, als in einem endlosen Gebäude verloren zu gehen! Aber ihre innere Stimme machte diese Hoffnungen zunichte, flüsterte ihr zu, dass all das zu echt war. Holz knackte. Irgendwo heulte der Wind. Weiter entfernt knarrte es. Träume und Wahnvorstellungen waren nicht derart real und nüchtern.
Irgendwann musste sie trotzdem eingeschlummert sein, denn mit einem Mal fuhr sie hoch, sah sich orientierungslos um, erinnerte sich dann entsetzt daran, wo sie sich befand, hinter der Bühne des leeren Amphitheaters, mitten in einem riesigen Gebäude. Es war stockfinster.
Und dann hörte sie, was sie geweckt hatte: Schritte! Da war jemand! Jemand, der ihr helfen konnte!
Sie warf ihre Behelfsdecke von sich und wollte losstürmen, stolperte über etwas, hielt sich aber auf den Beinen. Das Etwas schepperte auf dem steinernen Boden.
Sie erstarrte. Lauschte. Das Schrittgeräusch war verklungen. Hatten diese Leute den Lärm gehört? Würden sie hinter die Bühne kommen? Waren es gar Paps oder Leo?
Zitternd vor Aufregung fummelte sie das Handy raus und tappte in seinem Licht bis zur Bühne, wo sie es zögernd wieder ausschaltete. Es war vielleicht nicht besonders schlau, mit dem Lichtschein auf sich aufmerksam zu machen. Sie konnte nicht sicher sein, dass es Paps oder Leo gewesen waren, deren Schritte sie gehört hatte. Wer oder was würde sich hier nachts herumtreiben? Vielleicht die Security oder ein Nachtwächter? Sollte sie sich doch bemerkbar machen?
Ihre Finger klammerten sich um das Handy. Nein, besser lauschen, dann entscheiden.
Sie horchte. War das … nein, das war ein Klappern, vielleicht ein durch einen Luftzug bewegtes Fenster.
Sie fasste sich ein Herz und schlich gebückt zwischen den Zuschauerreihen nach oben, presste sich neben den Flügeltüren an die Wand, in der Hoffnung etwas zu sehen oder zu hören. Sie wagte kaum zu atmen und horchte eine gefühlte Ewigkeit, aber es blieb still.
Den Rest der Nacht verbrachte sie hier. Versteckt hinter dem dicken Holz der Flügeltür konnte sie durch den Spalt zwischen Türblatt und Wand spähen und jeden sehen, der die Kuppelhalle durchquerte. Aber sie glaubte nicht, dass jemand vorbeikommen würde. Je länger sie lauschte, desto mehr war sie davon überzeugt, sich geirrt zu haben. Es hatte keine Schritte gegeben.
Schließlich, als die Sonne aufging und den Himmel rosa färbte, überquerte sie eilig den Innenhof, der jenseits der Hallenterrasse mit den leeren Blumenkübeln lag. Die Fensterreihen über ihm waren dunkel, das Knirschen der Kiesel unter den Sohlen ihrer Sneaker wie Gewehrfeuer. Durch eine Tür kam sie auf einen Flur, der in beide Richtungen endlos gerade weiterlief. Sie wandte sich nach links. Der Flur erschien ihr in dieser Richtung ein klein wenig heller und freundlicher als in der anderen.
Es war, als hätte man sie nach gestern zurückversetzt. Ein einsamer Flur, leere Räume und Austritte in überwucherte Innenhöfe mit Brunnen, Obst und Gemüse. Sie aß zwei Birnen und stopfte Tomaten als Vorrat in die Bauchtasche ihres Sweatshirts. Einmal rief sie mutig »Hallo, ist da jemand?«, aber ihr Ruf verhallte unbeantwortet.
Am späten Nachmittag kam sie wieder an einen der unzähligen Austritte und blieb unvermittelt stehen. Das war kein von hohen Mauern umgebener Hof! Vor ihr erstreckte sich ein Feld aus Lavendelbüschen. Die Sträucher waren übermannshoch und wucherten wild. Betäubender Duft stieg ihr in die Nase. Tausende von Schmetterlingen und Bienen schwirrten um die violetten und blauen Blüten. Zikaden zirpten. Vögel sausten vor dem rot verfärbten Himmel hin und her. Und – das war es, was sie veranlasste, in das Feld zu treten – die Lavendelreihen zogen sich bis zum Horizont. Zwischen ihnen wuchsen von Sonne und Hitze verdorrtes Gras und Unkraut.
Das Gebäude hatte ein Ende! Die Erleichterung trieb ihr beinahe die Tränen in die Augen.
Sie straffte die Schultern und lief los, drehte sich nach einiger Zeit um. Das Gebäude, das sie verlassen hatte, war dreistöckig, mit blinden Fensterreihen und einem roten Ziegeldach. Es erstreckte sich zu einer Seite bis zum Horizont. In der anderen Richtung, aus der sie gekommen war, begrenzte eine doppelt mannshohe Wand das Feld, hinter der sich Fensterreihen und eine Vielzahl von Dächern erhoben.
Sie schüttelte den Kopf. Egal. Sie hatte den Ausgang gefunden! Wenn sie quer über das Feld lief, dann entfernte sie sich weitestmöglich von den Mauern, etwas, das nach den zwei Tagen in dieser verrückten Anlage äußerst verlockend erschien.
Der Weg war allerdings mühsam. Sie stolperte über Grasbüschel. Hummeln und Bienen flogen auf und taumelten in ihrer Verwirrung über dieses riesige Wesen, das Sträucher und Zweige zur Seite bog, gegen sie. Aber die Mühe lohnte sich. Bald sah sie statt Mauern und Dächern nur noch Lavendelreihen hinter sich. Dann, ganz unvermittelt, trat sie aus dem Schutz der Sträucher und stand vor einer marmornen Mauer. Sie blickte hoch. Verschmutzte Fenster und ein Dach, in dem Ziegel fehlten, ragten in den Himmel. Und liefen zu beiden Seiten endlos weiter.
»Das gibt es doch nicht!« Sie wurde wieder von einem Gebäude aufgehalten? Sie hätte ein Steinmäuerchen erwartet, das das Feld von einer Straße trennte, nicht aber eine Marmormauer, durch die Bögen in einen im Licht des späten Nachmittags halbdunkel daliegenden Flur führten. Das täuschte nicht darüber hinweg, dass er genauso aussah wie der auf der anderen Seite des Felds. Mit Türen, hinter denen, wie sie sich überzeugte, leere Räume lagen.
Die mühsam in Zaum gehaltene Angst schlug in frustrierte Wut um. Sie knallte die Tür des Raums, den sie betrachtet hatte, zu und brüllte los: »Hallo!«
Der Knall und ihr Ruf hallten von den kahlen Flurwänden wider.
»Ist da jemand?«
Der Widerhall verebbte.
»Hallo? Irgendwer?«
Der Wind rauschte durch Lavendelbüsche und eine Biene flog summend vorbei. Die Nacht brach an. Die untergehende Sonne tünchte den Horizont flammenrot. Über dem Feld standen bereits die Sterne. Sie leuchteten intensiv, Diamanten gleich, die jemand achtlos auf einem Tuch aus blauschwarzem Samt verstreut hatte. Die bleiche Sichel des Mondes kletterte bedächtig am Nachthimmel empor.
Sie trat nach draußen. Dunkle Fensterreihen über ihr. Keine Lichter jenseits des Lavendelfelds. Sie rieb sich die Schläfen, versuchte, ihren stoßweise gehenden Atem zu beruhigen, und rutschte mit dem Rücken an der Wand zur Erde hinunter. Die Sonne hatte die Steine erwärmt. Fast schien es, als sei das Gebäude ein lebendes Wesen, durch dessen Adern warmes Blut floss, und das sich einen Spaß daraus machte, sie in die Irre zu führen.
»Scheiße«, flüsterte sie, dieses Mal erschöpft, geschlagen. Die Anlage wollte sie nicht aus ihren marmornen Klauen lassen. Was sollte sie nur machen? Blieb ihr nichts anderes übrig, als den endlosen Fluren zu folgen? Zu hoffen, dass sie irgendwann einmal den Ausgang fand? Oder eine Erklärung dafür, was mit ihr geschehen war?
Wie auch immer, für heute war mit dem Umherirren Schluss. Im Dunkeln herumzustolpern war sinnlos. Mit dem Smartphone hatte sie zwar Licht, aber sie musste sparsam mit dem Akku umgehen. Also keine Nachtwanderung und Licht nur, wenn sie es absolut benötigte. Keine Fotos mehr. Noch einmal versuchte sie erfolglos, ein Netz zu finden. Sie schaltete das Gerät aus, nachdem sie den Flugmodus aktiviert hatte, um den Akku zu entlasten.
Wenigstens konnte sie draußen übernachten und dem Gebäude für die Nacht entrinnen! Unter zwei Lavendelbüschen, deren blütenbedeckte Zweige sich ineinander verflochten hatten, fand sie Unterschlupf. Der Boden war mit vertrocknetem Gras bedeckt. Einer der in den Flur führenden Bögen lag wenige Meter entfernt. Sollte es regnen oder kalt werden, konnte sie sich in das Gebäude zurückziehen.
Sie legte sich auf den Rücken, faltete die Hände hinter dem Kopf und starrte blicklos auf das Zweiggeflecht über sich. Hatten Paps und Leo Hilfe geholt? Sicher hatten sie das! Oder waren doch sie es gewesen, die sie in der Nacht gehört hatte? Ihr Vorhaben, so weit weg wie möglich von dem Gebäude am anderen Ende des Felds zu gelangen, bekam Risse. Was, wenn Paps und Leo dort nach ihr suchten? Vielleicht sollte sie morgen dorthin zurückkehren, in den Korridor, in dem sie angekommen war. Ja, das war eine gute Idee, auch wenn ihr davor graute, die endlosen Flure zurückzulaufen. Aber weiter durch das Gebäude zu irren, half ihr nicht. Besser war es, in dem Flur mit dem Tischchen auf Hilfe zu warten. Wenn sie Glück hatte, traf sie auf dem Weg dorthin auf diese Hilfe!
Erschöpfung überwältigte sie. Wenigstens war sie halbwegs satt, hatte Tomaten auf ihrem Weg durch das Lavendelfeld gegessen. Leos Gebäcktüte kam ihr in den Sinn. Was würde sie für einen Kaffee und ein Teilchen geben …
»Ich stelle die Kuchen und den Kaffee in der Küche auf den Tisch.« Leo verschwand aus der Tür. Seine festen Schritte hallten im Flur.
Erleichtert rappelte sie sich auf. Endlich etwas zu essen! Und Kaffee! Sie warf einen letzten Blick auf das Gemälde mit dem Flur und die anderen mit den Gebirgsszenen. Was die Bilder wohl wert waren?
Das Geräusch der Schritte im Flur wurde lauter.
»Leo, trampel nicht so rum!«, rief sie. »Du störst Tante Gudrun!«
Das Stampfen von Stiefeln auf dem Marmorboden vibrierte in ihren Ohren.
»Leo«, murmelte sie, »nicht so …«
Sie schreckte hoch. Ein Zweig ratschte über ihre Wange. »Autsch!«
Mondlichtpunkte tanzten um sie, geworfen von Zweigen, die sich im Wind bewegten.
Wo zum Teufel befand sie sich?
Der Duft erinnerte sie. Das Lavendelfeld.
Da waren Schritte. Viele Schritte, als ob ein ganzer Trupp Soldaten exerzierte.
Da kommt jemand! Vielleicht Hilfe, vielleicht Paps und Leo!
Schon wollte sie aufspringen, auf die Leute zustürzen, die da im Flur liefen, doch ein barsches »Halt!« ließ sie innehalten. Die tiefe Männerstimme war ihr fremd und der befehlende Ton erschreckte sie.
Erst schauen, wer das ist.
Sie verrenkte sich den Kopf, konnte aber nicht weit genug durch den Bogen in den Flur spähen, um etwas zu erkennen.
Ein Schatten trat in das Feld, ein Mann. Er drehte sich langsam, während er das Feld in Augenschein nahm. Er war hochgewachsen und kräftig, mit einem muskulösen Nacken, breiten Schultern und kurz geschorenem dunklem Haar. Sein Profil, mit einer geraden Nase und kantiger Kinnpartie, wirkte im kalten Mondlicht hart und unnahbar. Er trug eine Uniformjacke, die mit zwei Lederschlaufen auf der linken Schulter geschlossen war und mit einem nietenverstärkten Gürtel zusammengehalten wurde. Den Umhang hatte er nach hinten, auf den Rücken, geworfen. Seine kräftigen Beine steckten in schwarzen Hosen und schweren Stiefeln. Eine Hand lag am Knauf eines in seinem Gürtel steckenden Schwerts.
Ein … Schwert?
Sie zog den Kopf zwischen die Schultern, versuchte, sich kleinzumachen. Was waren das für Leute? Mittelalter-Fans beim Rollenspiel?
Der Mann sah in ihre Richtung.
Caro erstarrte. Seine Augen leuchteten bernsteinfarben, brannten hell wie die eines Feuerdämons. Sie bohrten sich durch die Lavendelzweige, Röntgenstrahlen, die sie erfassten, erfassen mussten! Das entsetzte Aufkeuchen blieb ihr in der Kehle stecken. Gleich würde er sich auf sie stürzen! All ihre Sinne schrien, sie solle wegrennen, in das Feld flüchten. Doch ihr Körper gehorchte nicht, als wüsste er, dass Flucht sinnlos war. Der Kerl ist groß und kräftig. Er hat dich schnell eingeholt! Sie blieb wie versteinert sitzen, ähnlich einem Reh, das im grellen Scheinwerferlicht eines nahenden Autos auf der Straße verharrte.
Der Mann wandte sich mit einem Kopfschütteln ab und ging zurück in den Flur.
Caro schluckte, eine Bewegung, die ihre trockene Kehle reizte. Nein, nicht husten! Keinen Laut! Den Hustenreiz zu unterdrücken, trieb ihr die Tränen in die Augen.
»Hast du etwas gesehen?«, fragte jemand.
»Da war ein Geräusch. Der Wind.« Die barsche Stimme klang verhalten, als überlegte der Mann, ob er tatsächlich nur den Wind gehört hatte.
Caros Herz hämmerte. Sie wagte kaum, zu atmen.
Schritte näherten sich, eilig und bestimmt. »Die Räume und Höfe sind verlassen.« Eine Frauenstimme.
»Eingänge zu den Katakomben?« Der barsch klingende Mann.
»Keine. Auch nicht in der Küche und den Vorratsgewölben.«
»Dieser Flügel liegt nicht allzu weit entfernt vom Thronsaal.« Eine nachdenklich klingende, etwas heisere Stimme. »Es ist fraglich, ob wir hier die flüchtigen Sklaven finden.«
»Die Spuren waren eindeutig. Fünf Dasa, die in diese Richtung unterwegs waren.«
»Es kann sein, dass sie kein Lager aufgeschlagen haben und weitergezogen sind.«
»Das ist möglich. Bedenke: Einer ist am Bein verletzt. Er wird nicht weit laufen können.«
»In Ordnung.« Der barsch klingende Mann. »Wir kehren zu den Gärten zurück, wo wir die Spuren gefunden haben. Dann nehmen wir uns den nächsten Flügel vor. Aber Obacht! Lasst die Hände an den Schwertern. Hier gibt es Dasa-Verstecke, aus denen sie uns auflauern könnten. Abmarsch!«
Schritte hallten von den steinernen Decken und Wänden wider, wurden leiser und verklangen. In der Ferne schlug eine Tür.
Caro atmete langsam aus, so leise, dass sie es nicht hörte. Das waren keine Menschen! Die Augen dieser … Wesen leuchteten! Sie trugen Schwerter! Sie jagten flüchtige … Sklaven!
»Oh, verflucht«, flüsterte sie.
Sie kroch auf allen vieren aus dem Busch, versteifte sich, als von weither ein Ruf erklang. Der Ruf wiederholte sich. Ein Nachtvogel. Langsam und mit zitternden Beinen erhob sie sich. Der Bogen, in dem der Mann gestanden hatte, gähnte ihr entgegen.
Sie stolperte zurück, die Augen auf die Düsternis des Flurs gerichtet, hielt inne und lauschte auf die Stille. Trat zwei Schritte zurück und lauschte. Stolperte. Drehte sich um und rannte wie von Furien gejagt hinaus auf das Feld, durch die Strauchreihen, deren Zweige die Haut ihrer Hände und ihres Gesichts zerkratzten, rannte, bis sie nur noch Lavendel um sich sah, und ließ sich unter einem Strauch zu Boden fallen. Ihr Atem ging keuchend, abgehackt. Trotz der Anstrengung und der lauen Nachtluft fror sie. Sie zog die Beine an und legte die Arme um die Knie in einem vergeblichen Versuch, sich zu wärmen. Starrte blicklos in das Dickicht.
Wo zum Teufel bin ich gelandet?
4
An Schlaf war nach der unheimlichen Begegnung mit den Schwertträgern nicht mehr zu denken. Was hatte es mit den Sklavenjägern auf sich? Waren es Wesen aus einer anderen Welt? Dämonen, Feuergeister?
Sie kicherte hysterisch. Ja, klar, Dämonen! Carolyn Rebmann, reiß dich zusammen!
Eher mittelalterliche Rollenspiele, organisiert in einer leer stehenden Palastanlage. Aber Laienspieler, deren Augen leuchteten? Gab es Kontaktlinsen, die einen derartigen Effekt hatten? Wenn ja, warum lief man damit mitten in der Nacht durch die Gegend?
Nun, wenigstens gab es hier jemanden. Aber keine Chance, dass sie sich diesen Leuten anvertraute! Gott sei Dank hatten die Schwertträger ihre Rufe nicht gehört! Der Mann mit der barschen Stimme hatte gefährlich geklungen. Sie jagten ›Dasa‹, wer oder was das auch immer war. Er hatte seine Kumpane gewarnt, gesagt, dass die Dasa ihnen auflauerten. Würden sie ihr, Caro, ebenfalls auflauern?
Sie musste beiden, Schwertträgern und Dasa, aus dem Weg gehen. Ihren Plan, zurück zu dem Flur mit dem schwarzen Tischchen zu wandern, konnte sie vergessen. Die Schwertträger waren in die Richtung abmarschiert. Bestimmt hingen das Gebäude hier und das am anderen Ende des Felds, da, wo sie hergekommen war, zusammen! Bestimmt waren es die Schritte der Sklavenjäger gewesen, die sie in der letzten Nacht gehört hatte! Nein, sie musste einen anderen Ausweg suchen und dabei extrem vorsichtig vorgehen. Keine Rufe mehr. Türen noch unauffälliger öffnen. Jeden Raum, Saal und Flur vor dem Betreten sondieren. Während der Pausen und des Schlafs verstecken.
Als die ersten Sonnenstrahlen das Lavendelfeld beschienen, kroch sie aus dem Strauch. Sie fühlte sich wie gerädert, aber ihre Nervosität erlaubte keine Müdigkeit. Auf ihrem Weg zurück zu dem Flur, in dem die Schwertträger aufgetaucht waren, sah sie niemanden. Ihre Überlegung war einfach: Wenn sie sich in die Richtung wandte, aus der die Schwertträger gekommen waren, würde sie ihnen nicht begegnen. Außerdem hatte jemand verlassene Küchen erwähnt, die dort liegen sollten. Vielleicht fand sie etwas zu essen und zu trinken. Trotz der Schrecken der Nacht war sie hungrig und durstig.
Sie folgte dem Flur mit behutsamen Schritten. Ihre Sneaker machten kaum einen Laut auf dem Steinfußboden. Sie stellte sicher, dass niemand hinter ihr auftauchte und schaute um die Ecken, bevor sie weiterlief. Irgendwo würde es einen Zugang zu den Küchen geben. Wahrscheinlich eine Treppe. Die Frau hatte von ›Gewölben‹ gesprochen. Damit musste der Keller gemeint sein. Also öffnete sie kurz alle Türen, um festzustellen, was dahinter lag.
Fündig wurde sie keine fünf Minuten später. Eine schmale Tür verbarg den Eingang zu einem schmucklosen engen Gang. Er endete an einem Treppenhaus mit spinnenwebverhangenen Fenstern, die, wenig überraschend, auf einen Innenhof blickten. Steinerne Stufen führten sowohl nach oben als auch in den Keller.
Von einem der oberen Stockwerke bekäme sie einen besseren Überblick über die Anlage und konnte vielleicht den Ausgang leichter finden! Sie stieg die Treppe hinauf, die an einem engen Gang endete, und strich die dicken Spinnenweben von einem der Fenster dort.
»Oh, Mann.«
Gebäude, so weit das Auge reichte. Marmorbauten mit prunkvollen Fassaden und gekrönt von Kuppelkonstruktionen. Arkadenhöfe. Tempel mit mächtigen Säulenvorbauten. Kathedralen. Dachgärten, bewachsen mit Blumen, Sträuchern und Bäumen. Kupfer- und Ziegeldächer. Gepflasterte Gehsteige. Dazwischen Baumkronen, an einigen Stellen so viele, dass es sich um ausgedehnte Wälder oder Parkanlagen handeln musste. Links von ihr krochen die Gebäude einen Hügel hinauf. Eine überdachte Treppe führte dort zu einem von weißen Säulen getragenen Kupferdach, von dem sich ein Vogelschwarm in den blauen Himmel erhob. Hinter den Säulen die Schatten von Statuen. Am Horizont zu ihrer Rechten ragten monumentale Kuppeldächer empor. In der Morgensonne glänzten sie wie Gold.
Sie rannte den engen Gang hinunter, riss die Tür auf und stand in einem Flur, dessen Fenster ebenfalls Aussicht auf ein Gebäudemeer boten. Nichts als Gebäude, kilometerweit, bis zum Horizont, durchbrochen von Höfen und Freiflächen in allen Größen mit Wäldern, Parks, Gärten oder Feldern. Es schien, als habe sich ein größenwahnsinniger Architekt an einer wilden Mischung aus französischen Prunkbauten des 17. Jahrhunderts, morgenländischen Städten und griechischer Antike ausgetobt.
Aber keine Menschen. Keine Fahrzeuge. Keine Straßen. Sie befand sich in einer riesigen menschenleeren Palastanlage, die sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnte.
Wieder riss sie das Smartphone aus ihrer Tasche, aber es fand sich kein Netz. Genauso wenig wie es Lampen, Lichtschalter oder Elektrokabel gab, existierten weder Stromleitungen noch Satellitenschüsseln oder Funkmasten über den Dächern.
Wie betäubt stieg sie die Treppe hinunter. So irre es auch klang, sie befand sich in einer anderen Welt. In der es keine Technologie gab, dafür aber Sklavenjäger mit glühenden Augen, die diese Dasa suchten, die wiederum den Schwertträgern auflauerten. In der sie auf sich allein gestellt war. Was zum Teufel war das für eine Welt? Wieso war sie in ihr gelandet? Wie entkam sie ihr?
Sie blieb an einem der verdreckten Fenster des Treppenhauses stehen. Der Innenhof sah friedlich aus mit seinen Blumen und den grauen Tauben, die im hohen Gras nach Futter suchten. Es war ein Bild so gegensätzlich zu der wilden Verzweiflung, die ihr die Kehle verengte. Würde sie nach Hause zurückgelangen?
Bestimmt nicht, wenn ich hier rumstehe und mir leidtue!
Entschlossen räusperte sie sich. Die Heulerei hatte sie in dem Theater hinter sich gebracht. Sie zwang sich, an die nächsten Schritte zu denken. Runter in die Gewölbe. Etwas essen. Proviant sammeln. Einen Plan machen, wie sie nach Hause kam.
Also los.
Je weiter sie die steinernen Stufen in den Keller stieg, desto dunkler wurde es. Keine Fenster, kein Licht. Die Dunkelheit hatte etwas Tröstliches, sie bot die Möglichkeit zum Rückzug vor den einsamen Hallen. Sie folgte den Stufen im Licht des Smartphones bis zu ihrem Ende, von dem sie ein Gang in einen großen Kellerraum mit Feuerstellen, steinernen Trögen, einer Pumpe, Kessel, Töpfen, Pfannen und Geschirr führte. An einer Wand gab es Sitzgelegenheiten aus Stein, daneben stand ein mächtiger schwarzer Schrank. Durch einen Schacht fiel Tageslicht. Sie schaltete das Smartphone aus.
Unter der Pumpe war eine Pfütze, verursacht, so nahm sie an, von den Sklavenjägern. Sie spülte einen verstaubten Becher gründlich aus, füllte ihn mit dem kalten Wasser, das aus der Pumpe kam, wenn sie den Pumpenschwengel bediente, und trank mit langen Schlucken. Dann wusch sie sich Gesicht und Arme. Das Wasser weckte nicht nur ihre Lebensgeister, sondern auch ihren Kampfwillen.
»Sklavenjäger, ihr könnt mich mal! Weiter geht’s«, befahl sie sich halblaut.
Für ihre Suche nach dem Heimweg brauchte sie einen Rucksack oder eine Tasche, Decken, Vorräte, Wasser. Und nicht zu vergessen: Ein Frühstück und das schnell.
Hinten in der Wand war eine Tür eingelassen. In der Hoffnung, eine Speisekammer zu finden, öffnete sie sie und musste den Raum dahinter im Licht des Smartphones untersuchen, weil es keinen Fensterschacht gab. Hölzerne Regale an den Wänden, in der Mitte des Raums ein Tisch. Die Regale waren leer. Unter dem Tisch fand sie eine Kiste mit löchrigen Tischdecken. An der Stirnwand des Raums gab es einen Schacht nach oben, in dem morsch aussehende Seile baumelten. Früher hatte es da wahrscheinlich einen Aufzug gegeben, mit dem man Vorräte herunter oder das Essen zu den Herrschaften nach oben geschafft hatte.
Seufzend kehrte sie in die Küche zurück. Wasser gab es, aber mit Vorräten sah es mau aus – sie würde sich auf das verlassen müssen, was in den Höfen wild wuchs. Außerdem brauchte sie einen Wasserbehälter, der sich verschließen ließ. Aber es gab keine Glas- oder Feldflaschen, nur Eimer, Krüge und Becher. Um an eine Decke oder eine Tasche zu kommen, würde sie die Zimmer in den oberen Etagen durchsuchen. Es musste Schlafzimmer gegeben haben. Mit etwas Glück hatten die Bewohner Nützliches hinterlassen.
Bevor sie sich erneut auf den Weg nach oben machte, zog sie noch den Schrank auf und leuchtete hinein. Stapel von Tellern und Schüsseln.
»Was ist das für eine sonderbare Fackel?«, fragte jemand hinter ihr.
Sie schrie auf und fuhr herum. Das Smartphone fiel scheppernd zu Boden.
In der Tür zur Speisekammer stand ein Mann. Mit seinem einfach geschnittenen Lederhemd, einer Lederhose und Stiefeln erinnerte er an einen Fallensteller aus dem Wilden Westen. Ein struppiger Vollbart bedeckte sein wettergegerbtes Gesicht, konnte aber sein freundliches Lächeln nicht verbergen.
»Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken.« Seine Höflichkeit war entwaffnend und das Einzige, was ihre wilde Flucht aus der Küche verhinderte.
»Was?«, brachte sie hervor.
»Ich habe Geräusche gehört und bin ihnen nachgegangen. Entschuldige, falls ich dich erschreckt habe«, wiederholte der Mann. »Gestern haben sich die Garden hier herumgetrieben. Ich wollte feststellen, ob sie zurückgekommen sind. Da habe ich deine Fackel gesehen. Das hat mich neugierig gemacht.«
»Fackel?«, echote Caro fassungslos. »Ach so, ja, das Handy. Ich meine, das ist keine Fackel …« Ihre Stimme erstarb.
Der Mann sah auf das zu ihren Füßen liegende Gerät und runzelte die Stirn. »Stimmt, es hat keine Flamme. Was ist es dann?«
»Ein … Handy«, sagte sie schwach. »Man, also, man … leuchtet damit.« Die Funktionen eines Handys zu erklären, erschien ihr reichlich sinnlos. Es wäre ihr auch gar nicht gelungen, so durcheinander wie sie war.
»Es ist sehr viel praktischer als eine Fackel«, stellte der Mann anerkennend fest. »Es gibt keinen Rauch und man gerät nicht in Gefahr, sich zu verbrennen.«
»Äh, nein.« Sie hob das Handy auf, dessen Display nun einen Sprung hatte, schaltete es aus und schob es in die Hosentasche. »Ich heiße übrigens Caro.«
»Mein Name ist Peregrine. Wo kommst du her?«
Sie versuchte immer noch, Anschluss an diese neue Entwicklung zu bekommen. »Ich … ich weiß nicht, ob du die Stadt kennst. Sie heißt Frankfurt.«
Peregrine zog die Augenbrauen hoch. »Du kommst aus einer Stadt?«
»Ja.«
»Hier gibt es keine Städte.« Er musterte sie. »Bist du ein Bildvagabund?«
»Ein was?«
»Ein Bildvagabund.«
»Was ist das?«
»Oh.« Peregrine war sichtlich überrascht. »Wie bist du in den Palast geraten? Oder kommst du aus einem weit entfernten Flügel?«
»Ich … ich war plötzlich hier, als ich ein Bild …« Wieder verstummte sie. Bildvagabund?
Peregrine lächelte. »Als du ein Bild berührt hast? Dann bist du ein Bildvagabund. Nur sie können durch die Bilder reisen.« In seinen dunklen Augen blitzte es auf. »Es ist deine erste Reise, richtig? Du weißt nichts von den Bildvagabunden?«
Dieser Peregrine wusste, wie sie hergelangt war! Konnte er ihr helfen? Sie öffnete den Mund, wollte ihn bitten, ihr alles zu erklären, doch da brach es aus ihr heraus, mit der Vehemenz der Angst und Verzweiflung, die sie über die letzten Tage und Nächte verspürt hatte. Wieder wurde ihre Kehle eng, wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen.
»Ich verstehe es nicht! Ich habe das Bild von dem Flur angesehen und den Rahmen berührt, da ist es passiert! Plötzlich war ich in dem Flur und versuche seitdem, den Weg nach Hause zu finden! Aber das Einzige, was es hier gibt, sind leere Flure und Räume! Und Sklavenjäger!«
»Du hast die Garden gesehen?« Seine Stimme klang mit einem Mal scharf. »Sie haben dich nicht bemerkt?«
Caro räusperte sich, beschämt über ihren Gefühlsausbruch gegenüber einem Fremden. »Ich habe mich in einem Lavendelstrauch versteckt. Sie sind an mir vorbeigelaufen.«
»Da hast du Glück gehabt. Den Garden entgeht so schnell nichts.«
Sie erinnerte sich an die Erwähnung des Dasa, der am Bein verletzt worden war. »Diese … diese Garden sind gefährlich, oder?«