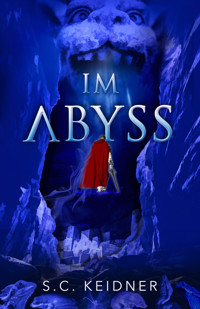Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Unvergängliches Blut
- Sprache: Deutsch
Fantasy Romance in einer fiktiven mittelalterlichen Welt … Die neunzehnjährige Taran wird von dem grausamen Vampirfürsten Raiden Tyr versklavt, der sich mit Hilfe ihres tödlichen Bluts die Macht über die Stämme sichern will. Eine Macht, die von der Rebellion, angeführt durch den idealistischen Maksim D'Aryun, bedroht wird. Während Taran verzweifelt auf Flucht sinnt, verliebt sie sich in Raidens Sohn Damien – nicht ahnend, dass Damien sich der Rebellion gegen seinen Vater angeschlossen hat ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S.C. Keidner
Unvergängliches Blut
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Impressum neobooks
Kapitel 1
»Sie ist schön«, sagte Gregorius ohne Begeisterung. Er musterte die Kette, deren silberne Glieder im Schein der Sonne glitzerten. Der Sommerwind ließ die fein gearbeiteten sichelförmigen Anhänger tanzen.
Missmutig nahm Taran ihm das Schmuckstück aus der Hand und legte es sich wieder um. Sein Mangel an Interesse kränkte sie. »Sie ist von meinem Vater. Er hat sie Mutter vor meiner Geburt geschenkt. Mutter sagt, er hätte gewollt, dass ich sie bekomme.«
»Entschuldige. Sie ist wirklich schön gearbeitet.« Er wirkte aufrichtig zerknirscht und deutete auf die Schilfmatten, die ordentlich gestapelt neben ihnen lagen. »Es ist nur, dass Aldo uns angewiesen hat, die Matten bis heute Abend fertig zu haben. Bei der Hitze wird das kein Spaß. Wir müssen uns ranhalten.«
Sie saßen am Ufer des Baches, dort, wo der Wald in die Grasländer überging, mit dem Hügel, auf dem die Siedlung im Schutz uralter Eichen und hoher Felsen lag, im Rücken. Die endlose Abfolge von Steppen und Hügeln vor ihnen verschwamm im bläulichen Dunst der Ferne, durchbrochen von Mooren, Seen und mäandernden Flüssen. Meile um Meile gab es nichts als im scharfen Wind wogende Gräser, Schilf und Sträucher, die gerade einmal kniehoch wuchsen. Im Frühjahr präsentierten sich die Grasländer in schillernden Grün- und Blautönen, doch jetzt, im späten Sommer, lagen sie ausgedörrt und braun da.
Taran seufzte. Mit der Reparatur der Schilfmatten für die Hütten hinkten sie tatsächlich hinterher. Seit Sonnenaufgang waren sie hier und sie hatte es bisher erfolgreich geschafft, Gregorius von der Arbeit abzulenken. Sie lachten miteinander und beobachteten die Viehhirten, die unterhalb der Stelle, an der sie sich niedergelassen hatten, die schweren Pferde, Ziegen und Schafe der Siedlung hüteten.
Gut, das Zuschneiden der frischen Halme hatten sie auf sein Drängen hin schon erledigt. Es war typisch Gregorius. Alles, was nicht mit der Arbeit zusammenhing, interessierte ihn kaum, sei es ihre Kette, die Geschichten, die der fliegende Händler von den Städten erzählte, oder die Flöte, die sein Bruder geschnitzt und ihm stolz gezeigt hatte. Doch sobald es um die Bestellung der Felder, das Flicken der Matten oder die erwartete Anzahl der Lämmer und Zicklein im Frühjahr ging, konnte er sich vor Eifer nicht halten.
Das Flicken der Matten. Sie hatten sich aus freien Stücken für diese mühselige Tätigkeit gemeldet, konnten sie dabei doch unter sich sein, wenn man einmal von den Viehhirten absah. Alle anderen ernteten die Felder jenseits des Hügels ab. Wegen der Wajarenüberfälle entfernten sich die Siedler nur zu mehreren von den Hütten. Eltern achteten darauf, dass sich ihre Kinder nicht heimlich davonstahlen. Natürlich zählten sie und Gregorius mit ihren neunzehn Jahren nicht zu den Kindern. Trotzdem war ihr von ihrer Mutter, Rodica, klar gemacht worden, dass sie sich am späten Nachmittag, lange bevor die Sonne unterging, in der Siedlung einzufinden hätte. Gregorius hatte von Aki, seinem Vater, eine ähnliche Anweisung bekommen. Wenn sie bis dahin fertig sein wollten, mussten sie sich wirklich beeilen. Sie drückte seine Hand, spürte die Schwielen, die die harte Arbeit hinterlassen hatte. »Du hast recht. Lass uns beginnen.«
Gregorius grinste, was seinen Zügen einen schelmischen Ausdruck gab, und küsste sie rasch auf die Wange. »Ich habe immer recht.« Er nahm einen der Schilfhalme und flocht ihn geschickt in eine Matte ein. »Hat Rodica dir mehr über deinen Vater erzählt, als sie dir die Kette schenkte?«
»Nein.« Taran zog eine Matte zu sich und nutzte ein kleines Messer, um brüchige Halme herauszuziehen. »Sie hat geweint, wie an jedem meiner Jahrestage. Wenn ich nach ihm frage, schüttelt sie den Kopf und wendet sich ab. Ich bin überrascht, dass sie mir überhaupt einmal gesagt hat, dass er Soldat war. Sie will ihr Andenken an ihn mit sich selbst ausmachen.«
»Hm«, machte Gregorius. »Möglich, dass er in den Vampirkriegen ums Leben gekommen ist. Da sind viele schlimme Dinge passiert. Vielleicht erinnert sie sich daran, wenn sie an ihn denkt.«
Gregorius und sie hatten keine Erinnerung an die Kriege, waren sie doch erst zwei Winter alt gewesen, als die Vampirstämme aus dem Qanicengebirge mordend und brandschatzend über das Niemandsland zwischen Grasländern und Bergen hergefallen waren. Es gab viele Geschichten über die Kriege und jede einzelne erzählte von Tod, Schändung, Versklavung, und sich an den Hälsen von Männern, Frauen und Kindern nährenden Vampiren, Schauergestalten mit übermenschlichen Kräften und ohne Mitgefühl oder Gewissen. Die Menschen hatten versucht, sich zu verteidigen, doch den übermächtigen Stämmen konnte niemand etwas entgegensetzen. Einzig die Sonne wies diese Wesen in ihre Schranken, machte sie abhängig von Unterschlüpfen und dem Dunkel der Nacht, was sie schließlich, nachdem kaum noch Menschen im Niemandsland zu finden gewesen waren, ins Gebirge zurückgetrieben hatte.
»Nein, mein Vater ist noch vor meiner Geburt gestorben. Aber es wäre schön, mehr über ihn zu wissen.«
»Vielleicht war er ein Prinz aus den Städten.« Gregorius grinste wieder breit.
Taran lachte. »Ich glaube nicht, dass sie in den Städten Prinzen haben. Eher reiche Kaufleute.«
»Dann eben der Sohn eines reichen Kaufmanns, der das Abenteuer gesucht hat. Das solltest du Cailina an den Kopf werfen, wenn sie dich das nächste Mal als Wechselbalg beschimpft. Ihre Familie hütet nur das Vieh.«
Er deutete mit dem Kopf zu den Hirten, Cailinas Vater und Brüdern. Einer der Jungen war auf eines der Pferde, einen Braunen, gesprungen und galoppierte laut juchzend in die Ebene hinaus. Sein Vater brüllte etwas hinter ihm her.
»Das sollte ich in der Tat. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie dann noch unverschämter werden wird.« Taran und Cailina waren von Kindesbeinen an Feindinnen gewesen. Dass sie in einer Liebesbeziehung mit Gregorius steckte, half da nicht. Cailina hatte schon lange ein Auge auf ihn geworfen und war entsetzt gewesen, als Gregorius ihr erklärte, er sei in Taran verliebt.
»Wahrscheinlich.« Gregorius zuckte mit den Schultern. »Sie ist eben einfach giftig.«
Taran beobachtete den Jungen, der das Pferd in einem großen Bogen zurück zur Herde lenkte. Wie schön wäre es, einfach eines dieser Pferde zu nehmen und durch die Weiten der Grasländer in die Städte zu reiten! Das mühselige, gefahrvolle Leben der Siedler hinter sich zu lassen! Es musste ein sonderbares Gefühl sein, mit vielen hunderten oder gar tausenden Menschen zu leben. Anders als mit den paar Dutzend Siedlern, mit denen Mutter und sie seit vielen Wintern durch das Niemandsland zogen. Die Menschen in den Städten gingen Vergnügungen nach. Sie musizierten. Sie tanzten. Im Gegensatz zum Niemandsland, wo man in ständiger Angst vor den Wajaren lebte, die die Vampirstämme des Gebirges mit Blutsklaven versorgten. Das Gebirge, das sie würde sehen können, falls sie es schaffte, auf die steilen Felsklippen hinter den Hütten zu klettern. Doch wie jeder Siedler vermied sie, soweit es ging, den Blick gen Osten. Dorthin zu sehen bedeutete, dass man die Aufmerksamkeit der Gebirgsbewohner auf sich ziehen würde. Vielleicht war es nur Aberglaube, doch es gab keinen Grund, es herauszufordern.
»Du denkst wieder daran«, sagte Gregorius und verdrehte die Augen.
»Woran?«
»Das ist dein ›Ich-will-in-den-Städten-leben‹-Blick.«
»Was ist daran so schlimm?«, verteidigte sie sich. »Das Leben in den Städten ist einfacher. Und ungefährlich. Es gibt keine Vampire.«
»Solange nicht, bis die Blutsauger Wege ersonnen haben, um die Grasländer zu queren.«
»Gregorius, bitte! Wie sollen Vampire da draußen der Sonne entgehen? In den Grasländern gibt es keine Höhlen, wo sie tagsüber unterkriechen können.«
»Keine Ahnung. Zelte?«
Taran schnaubte. »Zelte! Das Sonnenlicht dringt durch Stoffe und Leder! Die Vampire brauchen Höhlen, um ‒.« Da sah sie das Funkeln in seinen Augen. »Du ziehst mich auf!«, beschwerte sie sich und stieß ihm den Ellenbogen in die Seite.
Er lachte, griff nach ihr und küsste sie. Einer der Viehhirten pfiff und Gregorius ließ sie los. »Wenn wir so weitermachen, sitzen wir noch heute Nacht hier«, sagte er seufzend.
Taran kicherte, beugte sich vor und küsste ihn. »Heute Nacht gibt es hier nur uns und die Sterne«, flüsterte sie.
Seine Augen wurden dunkel. Auch er dachte an die Nächte, in denen sie sich aus der Siedlung geschlichen hatten, das Geräusch ihrer verstohlenen Schritte maskiert vom Wind. Das Rauschen der Blätter über ihnen, als sie sich im Schutz der tief herunterhängenden Äste einer Trauerweide liebten. Der Ruf eines Wolfs draußen in der Steppe, der sie vergessen ließ, dass ihre Familien nicht weit entfernt von ihnen schliefen. »Wir müssen weitermachen!«, sagte er streng. »Und erinnere mich nicht daran, sonst werden wir nie fertig!«
Sie schafften es trotz aller Ablenkungen, die Reparatur der Matten bis zum späten Nachmittag zu beenden. Mit Hilfe eines Pferdes brachten sie sie den Waldpfad hinauf in die Siedlung und legten sie vor die Hütten, wo sie sie am Morgen abgeholt hatten.
Mit einem unauffälligen Blick, um sicherzustellen, dass niemand sie sah, küsste Gregorius sie zum Abschied und verschwand pfeifend in Richtung der Hütte, die er mit seinen Eltern und Brüdern teilte.
Taran ging indessen zu der Kate, die sie mit Rodica bewohnte. Sie stand versteckt am Rande der Siedlung, zwischen knorrigen Eichen, hinter denen die steilen Felsen in den sommerlich blauen Himmel ragten. Als sie den Fellvorhang am Eingang hochband, war sie überrascht, ihre Mutter zu sehen, die an der Feuerstelle einen Kessel mit kochendem Wasser bewachte.
Um das Feuer stapelten sich Töpfe und Schalen, daneben lagerten die Vorräte in einer Truhe mit Eisenbeschlägen. Der Rauch des Feuers zog durch ein Loch im Dach ab. Im hinteren Teil der Hütte lagen ihre Strohsäcke, Felle und Decken, im vorderen Teil gab es zwei Stühle und einen schmalen Tisch aus Holz und Schilfgeflecht. An die Holzgitter, die die Schilfmatten hielten, hatten sie ihre Kleidung gehängt, einfache Kleider und Kittel aus ungefärbter Schafwolle. Im Winter wurden mehrere Lagen an Fellen von innen an den Holzgittern angebracht, um die bittere Kälte fernzuhalten. Im Sommer reichten die Matten, um sie vor Sonne und Regen zu schützen.
»Du bist schon von den Feldern zurück?«
Rodica nickte müde. »Olwenus ist wieder da. Aldo hat für nachher eine Zusammenkunft einberufen und uns früher zurückgeschickt. Ich will die Zeit nutzen, um die Wäsche zu machen.« Olwenus, der Fährtensucher, half den Männern, bei der Jagd das Wild aufzuspüren. Außerdem unternahmen er und seine Söhne regelmäßige Streifzüge durch das Niemandsland, um nach Spuren der Wajaren Ausschau zu halten. Es war gefährlich, aber notwendig, um die Siedlung zu schützen.
Besorgt musterte sie ihre Mutter, die etwas von der Seife aus miteinander verkochtem Öl und Lauge in das brodelnde Wasser gab. Wie an jedem von Tarans Jahrestagen sah Rodica traurig aus. Ihre Augen waren gerötet. »Geht es dir gut?«, fragte sie leise, obwohl sie wusste, wie die Antwort lauten würde.
»Natürlich«, sagte Rodica prompt und richtete sich auf. »Ich bin nur ein wenig müde von der Arbeit und dem Staub auf den Feldern. Komm, jetzt hilf mir mit der Wäsche.«
Taran seufzte resigniert und begann, die Wäsche zu sortieren, die ihre Mutter in den Kessel legte und mit einem Stock umrührte. Sie arbeiteten schweigend, Rodica gedankenversunken, Taran durch den offenen Eingang das Treiben in der Siedlung beobachtend.
Viel passierte nicht. Bis auf ein paar spielende Kinder waren die Siedler vor der Sonne nach drinnen geflüchtet, was keine Wohltat bedeutete. Die Hütten hatten sich in diesen letzten Tagen des Sommers aufgeheizt, doch niemand beschwerte sich darüber. Der Sommer mit den kurzen hellen Nächten und der Winter mit seinen Schneemassen waren die sichersten Zeiten des Jahres. Die Wajaren bevorzugten lange Nächte und freie Pfade für ihre Raubzüge. Sie waren daher eher eine Gefahr im Herbst oder nach der Schneeschmelze.
Sie erinnerte sich mit Schaudern an den letzten Überfall, bei dem zwei Familien verschleppt worden waren. Es war schon dunkel gewesen. Rodica und sie badeten nach der anstrengenden Feldarbeit in dem See, in dessen Nähe sie damals gesiedelt hatten. Die plötzlichen Schreie und die Rufe der Vampire ließen sie sich zitternd vor Angst im Röhricht verstecken. Erst lange, nachdem die Geräusche des Überfalls, das Weinen, Schreien und Stampfen der Pferdehufe verklungen war, wagten sie sich zu den Hütten zurück. Danach hatten sie die Siedlungsstelle aufgegeben und waren hierhergekommen. Irgendwann würden sie wieder losziehen müssen, um den Sklavenjägern zu entgehen.
Ihre Gedanken wanderten zu Gregorius, seinem verschmitzten Grinsen, den blitzenden Augen unter einem Schopf weizenblonder Haare. Es war schön mit ihm, seine lustige Art, seine Küsse, ihre Liebesnächte unten am Bach bei der Trauerweide. Allerdings nagte es an ihr, dass er kein Verständnis für ihre Träume zeigte. Für ihn stand fest, wie sein Leben verlaufen sollte. Er war ein Kleinbauer mit Leib und Seele, wie sein Vater und dessen Vater davor. Er würde sich eine Frau nehmen und mit ihr die nächste Generation seiner Familie hervorbringen, die durch das Niemandsland streifte, Ernten von den kleinen Feldern einfuhr und sich vor den Wajaren versteckte. Ihr fiel es schwer, sich vorzustellen, diese Frau zu sein. Das, was Gregorius wollte, war nicht ihr Leben. Doch was war es dann? Ein Leben in den Städten?
Rodica räusperte sich. »Mach hier weiter. Ich muss zum Melken der Ziegen. Morgen werden wir helfen, das Feld abzuernten. Wenigstens haben wir genug Getreidevorräte für den Winter. Falls wir nicht wieder vor den Wajaren fliehen müssen.«
Sie eilte hinaus, das Gesicht in sorgenvolle Falten gelegt, während Taran sich daran machte, die restliche Wäsche zu kochen und zu schrubben.
Kapitel 2
Die Zusammenkunft fand am Abend auf dem Platz zwischen den Hütten statt, auf den die tief stehende Sonne lange Schatten warf. Die Siedler hatten sich im Halbkreis auf der Erde niedergelassen. Taran saß neben Gregorius, was ihr einen hasserfüllten Blick von Cailina einbrachte. Die Alten und die Fährtensucher nahmen den Siedlern gegenüber Platz. Der Hitze trotzend trug Aldo sein weißes Wolfsfell, das Zeichen des Dorfältesten. Alle anderen waren in ihrer gewöhnlichen Arbeitskleidung erschienen, wollenen Hemden, Hosen, Röcken oder Kleidern und schweren ledernen Stiefeln.
Stille legte sich über den Platz, als Aldo sich erhob. »Ich danke euch, dass ihr gekommen seid«, sagte er. »Wie ihr seht, sind Olwenus und seine beiden Jungs wieder da. Sie werden uns über die Bewegungen der Wajaren berichten. Dann müssen wir entscheiden, ob wir hierbleiben oder noch vor dem Winter weiterziehen.«
Cailinas Mutter sprang auf. »Wenn wir entscheiden, dass wir weiterziehen, dann sollten wir auch entscheiden, ob wir nicht endlich in die Städte gehen.« Einige der Siedler rollten ungehalten ihre Augen, doch Taran hielt die Luft an. Sicher, die Städte wurden immer wieder angesprochen und man hatte sich bisher dagegen entschieden. Aber vielleicht dieses Mal?
»Hier draußen sind wir unsere eigenen Herren!«, sagte Gregorius. »In den Städten werden die Männer gezwungen, den Herrschern als Soldaten zu dienen! Ich will nicht in eine Stadt!«
Viele der Männer nickten zustimmend und Tarans Hoffnungen sanken rapide. Sie machte sich nicht die Mühe, etwas auf Gregorius Einwurf zu entgegnen, sondern warf ihm nur einen entmutigten Blick zu. Gregorius zuckte mit den Schultern.
Wie um dies zu bestätigen, rief eine der Frauen: »In den Städten herrschen Laster und Unzucht! Die Männer vertrinken ihr Gold in den Tavernen! Junge Mädchen verkaufen ihre Körper, um zu überleben!«
Reihum nickten die Köpfe.
Aldo hob die Hand. »Wir haben uns in der Vergangenheit entschieden, nicht in Städte zu gehen. Dabei bleibt es. Wer gehen möchte, kann dies tun. Wir zwingen niemanden, bei uns zu bleiben. Was wir heute besprechen müssen ist, ob wir hier überwintern oder uns einen anderen Ort dafür suchen.«
Cailinas Mutter setzte sich mit missmutigem Gesicht hin. Sie sagte nichts gegen Aldos Schiedsspruch. Es war richtig, dass niemand gezwungen wurde, bei den Siedlern zu bleiben. Doch sich allein, ohne Teil einer größeren und gut bewaffneten Gruppe zu sein, auf den Weg in die Städte zu machen, war blanker Wahnsinn. Die blaue Stadt lag im Süden, jenseits der Grasländer, am Meer. Kaum jemand lebte in den Grasländern. Einige wenige Rinderhirten streiften mit ihren Herden durch die Steppe. Aber es gab Banditen. Sie lauerten Reisenden auf und töteten sie, um sich ihrer Habseligkeiten zu bemächtigen. Wer abseits der Wege reiste, musste sich außerdem vor den trügerischen Mooren in Acht nehmen und aufpassen, dass er sich in dieser Landschaft, die überall gleich aussah, nicht verirrte. Die beiden anderen Städte der Menschen, Insan und Quadin, lagen weit jenseits des Qanicengebirges. Um sie zu erreichen, musste man das Gebirge queren, wobei man fast sicher in die Hände der Vampire fallen und den Rest seines Lebens als Blutsklave verbringen würde. Reisende von und zu den Städten, insbesondere Insan und Quadin, gab es daher nur wenige. Meist handelte es sich um wagemutige Händler, Fallensteller oder Jäger, die im Urwald Bären, Hirsche und Rehe erlegten und Fleisch und Felle in den Städten verkauften.
Aldo räusperte sich. »Der Bericht der Fährtensucher bitte.«
Olwenus erzählte von seinem Streifzug. Er beschrieb, wie sie nach Norden gezogen waren, immer entlang den Wäldern des Niemandslandes, das gewaltige Gebirge am Horizont zu ihrer Rechten und die Steppen der Grasländer zu ihrer Linken. Sie waren an Zeugnissen der Vampirkriege vorbeigekommen, von Efeu und Gestrüpp überwucherte Ruinen abgebrannter Höfe und Klöster, Wüstungen, wo einmal Dörfer und kleine Städte gewesen waren. Sie entdeckten einen verlassenen Kohlenmeiler mitten im Urwald und hatten sich bis zu den Ausläufern des Gebirges vorgewagt. »Wir fanden keine Anzeichen von Wajaren, keine Spuren, keine Höhlen, die ihnen als Unterschlupf dienen könnten. Wir haben allerdings einen Fährtensucher getroffen, der uns berichtete, dass man Wajaren weiter im Norden gesichtet habe. Sie haben dort eine Siedlung überfallen. Wir denken, dass wir uns nicht in unmittelbarer Gefahr befinden«, schloss er seinen Bericht.
»Was für ein Fährtensucher war das? War er allein unterwegs?«, wollte eine der Alten wissen.
»Nein. Er sagte, er käme zusammen mit einer Gruppe weiterer Fährtensucher aus einer der Siedlungen in den Urwäldern. Wir haben die Gruppe allerdings nicht gesehen, nur ihn.«
»War er vertrauenswürdig?«
Olwenus wiegte nachdenklich den Kopf. »Nun, er machte einen redlichen Eindruck. Und warum hätte er uns belügen sollen? Er hat nichts von uns verlangt und hat uns bald wieder verlassen. Aber wir haben darauf geachtet, dass er uns nicht verfolgt.«
»Hatte er Neuigkeiten von den Vampirstämmen?«, fragte Rodica, die hinten im Schatten einer Hütte saß.
»Er sagte, dass die Stämme wieder einmal Krieg untereinander führen. Im letzten Herbst ist Raiden Tyr gegen Maksim D’Aryun ins Feld gezogen, um ihm die Insignien der Macht abzunehmen und die Herrschaft über die Stämme an sich zu reißen.«
»Im letzten Herbst?«, bohrte Rodica nach. »Wie ist das ausgegangen?«
»Das wusste er nicht. Er glaubte allerdings, dass sie sich noch immer befehden.«
Die Siedler warfen sich erleichterte Blicke zu. Wenn die Vampire untereinander Krieg führten, ließen sie die Menschen weitgehendst in Ruhe. Einige Stammesfürsten wie Raiden Tyr, dem ein Ruf von Willkür und Grausamkeit vorauseilte, scheuten sich nicht, Wajaren als Söldner zu verpflichten. Dies verringerte die Anzahl der Angriffe auf die Siedlungen.
»Wir haben also keine Veranlassung weiterzuziehen«, stellte Aldo fest.
»Ich denke nicht«, sagte Olwenus.
Das Gefühl der Erlösung, das sich unter den Siedlern verbreitete, war beinahe greifbar. Nun konnte man in Ruhe die Felder abernten und Vorbereitungen für den Winter treffen.
»Was denkt ihr?« Der Alte blickte fragend in die Runde. »Bleiben wir?«
Zustimmendes Kopfnicken war die Antwort. Aldo lächelte. »In Ordnung. Eine geruhsame Nacht allen.«
Leises Gemurmel erhob sich. Cailinas Eltern debattierten den Unwillen der Siedler, in die Städte zu gehen. Die Alten riefen Olwenus zu sich. Einige Männer scherzten und lachten leise.
Gregorius gähnte und reckte sich. »Ich muss zu meinem Vater«, sagte er. »Sehen wir uns morgen?«
»Ich werde auf den Feldern sein. Mutter hat unsere Hilfe beim Abernten angekündigt.«
»Ich werde auch da sein.« Er senkte die Stimme. »Wir sollten uns bald wieder nachts rausschleichen.«
Taran kicherte. »Falls du es schaffst, ungesehen zu entkommen.«
Bei ihrem letzten Versuch einer Liebesnacht war Gregorius von seinem Vater entdeckt worden, als er aus der Hütte schlich. Statt ein Schäferstündchen mit ihr zu verbringen, hatte er sich eine Standpauke über die Wajaren anhören müssen. Er verzog das Gesicht. »Ich werde mich bemühen. Heute Nacht klappt es nicht. Vater sagt, wir gehen früh zu Bett, damit wir zu Sonnenaufgang auf den Feldern anfangen können zu arbeiten. Lass uns das morgen bereden. Ich habe schon ein paar Ideen.« Er verabschiedete sich mit einem verschmitzten Lächeln von ihr.
Zurück in ihrer Hütte legte Rodica Feuerholz nach und starrte selbstvergessen in die Flammen, bevor sie sich zu Taran umdrehte, die das Abendmahl aus eingedickter Milch, Trockenfleisch und Brot auf den Tisch stellte. »Gregorius ist ein netter junger Mann.«
Tarans Wangen wurden heiß. »Das ist er.«
»Aki hat mich gefragt, was ich davon halte, wenn du Gregorius Frau wirst.«
Panik stieg in Taran hoch, ließ ihren Puls flattern. Sie würden im nächsten Sommer ihren zwanzigsten Jahrestag begehen, das Alter, in dem man sich einen Mann oder eine Frau aussuchte. Gregorius und sie waren sich dessen bewusst, hatten sich aber keine Gedanken darüber gemacht. Andere Dinge waren viel wichtiger! Es lag doch noch ein ganzer Winter vor ihnen, bis es so weit war! »Aber … ich … ich meine, Gregorius und ich … wir haben davon noch nicht gesprochen!«
»Glaubst du, er ist der Richtige für dich?«
Verblüfft sah sie ihre Mutter an. Ob Gregorius der Richtige war? »Ich ‒«, stammelte sie überrumpelt. Welche Antwort gab man seiner Mutter auf diese Frage? Sie beschloss, ehrlich zu sein. »Ich weiß es nicht.«
Sonderbarerweise schien Rodica über diese Antwort erleichtert. »Dann ist er es nicht. Wenn er es wäre, wüsstest du es.«
Taran sank auf den Stuhl. »Wie weiß man es? Dass es der Richtige ist?«
»Dein Herz wird es dir sagen. Ein Leben ohne ihn wäre unvorstellbar für dich.« Rodica lächelte wehmütig.
Ein Leben ohne Gregorius? Der Gedanke jagte ihr keine Angst ein. Sie mochte Gregorius und verbrachte gerne Zeit mit ihm. Aber er teilte ihre Träume nicht und sie nicht die seinen. Wenn sie ihre Träume leben wollte, dann ginge das nur ohne ihn. Und wie fühlte es sich an, wenn einem das Herz zuflüsterte, wer der Richtige war? Ihr Herz sagte nichts zu Gregorius. Sie wagte es, noch einmal nach ihm zu fragen, ihrem Vater. »War … war mein Vater der Richtige für dich?«
Der Schatten großen Schmerzes flog über Rodicas Gesicht. »Ja, das war er.« Sie lächelte, doch Taran konnte sehen, dass sie die Tränen nur mit Mühe zurückhielt. »Trotzdem ich ihn verloren habe, war die Zeit mit ihm die schönste meines Lebens. Die ich um nichts missen möchte.«
Taran war verwirrt. Mutter litt so sehr an der Erinnerung an ihren Vater und doch bereute sie es nicht, ihn geliebt zu haben? War die vergangene Liebe so groß, dass sie die Schmerzen wettmachte?
Rodica legte ihre Hand auf die Tarans. »Eines Tages wirst auch du den Richtigen finden. Ich werde Aki sagen, dass wir all dies im nächsten Sommer besprechen, dann hast du genügend Zeit, um dich zu entscheiden. Und nun lass uns essen.«
Kapitel 3
Olwenus Einschätzung war falsch gewesen. Mit den ersten kalten Winden des Herbstes kamen die Wajaren. Das Laub der Bäume hatte sich bunt gefärbt und die Felder waren endlich abgeerntet. Es wurde schneller dunkel und die Siedler, die im Sommer abends lang draußen gesessen hatten, zogen sich immer früher in ihre Hütten zurück. Der kalte Wind schnitt in die Haut und ließ sie die wärmende Nähe der Feuer suchen.
In der Nacht, in der die Wajaren die Siedlung überfielen, träumte Taran von Pferden, von Rappen, Schimmeln, Braunen und Füchsen. Die Tiere jagten durch die Grasländer, die Mähnen und Schweife fliegend, das Stampfen der Hufe dumpf auf dem Boden. Sie stand auf einem Felsen und beobachtete sie, fasziniert von der Kraft ihrer Bewegungen. Die Herde schwenkte ab und galoppierte zum Horizont, an dem sich die Sonne feuerrot zur Erde neigte. Seltsamerweise wurde das Geräusch der Hufe lauter, je weiter sie sich entfernten.
Sie schreckte hoch und sah ihre Mutter wie erstarrt am Feuer stehen. Rodicas aufgerissene Augen spiegelten Entsetzen und Fassungslosigkeit wider.
Ein gellender Schrei ertönte. Hufgetrappel und triumphierendes Gebrüll.
»Lass’ den nich’ entkommen!«
»Her mit dir!«
Schreie. Weinen.
Taran sprang auf, rannte zum Eingang und schlug das Fell beiseite. Feuerschein flackerte auf. Er kam von brennenden Hütten. Unzählige Pferde und Reiter hoben sich als schwarze Schatten vor dem gelben Licht ab. Ein Reiter warf eine Fackel auf eine Hütte. Die trockenen Matten ging sofort in Flammen auf, die sein Gesicht beleuchteten. Es war hart, kantig, mit dunklen Augen. Eine Frau floh aus der Hütte. Der Reiter gab seinem Pferd die Sporen und riss sie zu sich hoch. Cailina. Sie schrie. Der Reiter lachte und verschwand mit ihr zwischen den Bäumen. Taran presste entsetzt die Faust gegen den Mund.
Rodica erwachte aus ihrer Starre. »Wajaren! Wir müssen weg!«
Sie ergriff Tarans Hand und zog sie hastig nach draußen, weg von den Reitern und dem Feuer in die Dunkelheit hinter der Hütte. Sie stolperten über Grasbüschel und tote Äste. Die Kakofonie des Überfalls, Schreie, das Prasseln des Feuers und das Gebrüll der Vampire verfolgten sie unerbittlich. Tarans Nachtkleid verhedderte sich in niedrig hängenden Zweigen und spitze Steine und Dornen stachen in ihre nackten Füße. »Das ist die falsche Richtung!«, keuchte sie. »Da vorne sind die Felsen. An denen kommen wir nicht vorbei!«
Rodica beachtete sie nicht und eilte weiter. Plötzlich standen sie vor den Klippen, die schwarz und unbezwingbar vor ihnen aufragten. Der volle Mond hing über den Felszinnen und schien höhnisch zu ihnen hinunter zu grinsen. Als die Siedler diesen Platz ausgewählt hatten, dachten sie, die Felsen würden Schutz bieten. Für Rodica und Taran waren sie zur Falle geworden.
»Wir kommen nicht weiter!«, rief Taran verzweifelt.
»Gibt es denn gar keinen Spalt, in dem wir uns verstecken können?« Rodicas Blicke irrten über die glatten Steinflächen.
»Nein!«
»Dann müssen wir am Fels entlang in den Wald! Dort können wir uns verstecken!«
»Das geht nicht, Mutter! Das Unterholz ist zu dicht! Wir müssen zurück auf den Pfad!«
»Hier sind noch zwei!« Der frohlockende Ruf ließ sie zusammenfahren.
»Lauf!«, brüllte Rodica und rannte los.
Sie war nicht schnell genug. Der Reiter erschien vor ihnen wie aus dem Erdboden gewachsen. Er sprang vom Pferd und stürzte sich auf Rodica, begrub sie unter seiner riesenhaften Gestalt.
»Mutter!«
Taran schrie auf. Eine kräftige Hand umfasste ihren Oberarm und zog sie auf ein Pferd. Sie schlug nach dem Reiter. Der drehte ihr kurzerhand die Arme auf den Rücken und hebelte sie schmerzhaft nach oben. »Schön brav sein!«, zischte er.
Sie gab die Gegenwehr wimmernd auf. Ihr Fänger lenkte das Pferd zurück zu den brennenden Hütten. Die Siedler waren zusammengetrieben worden. Weinende Kinder krallten sich in die Röcke ihrer Mütter. Viele der Frauen schluchzten, die Männer standen mit versteinerten Mienen da. Die Reiter umkreisten sie wie eine Meute hungriger Wölfe, bereit sich jeden Moment auf sie zu stürzen.
»Was haben wir?« Ein hünenhafter Mann mit schwarzem zum Pferdeschwanz gebundenem Haar war abgestiegen und ging langsam an den Siedlern vorbei. Er trug Lederhosen, schwere Stiefel und ein dunkles Hemd, darüber eine Weste aus Schaffell. Ein Schwert steckte in seinem Gürtel. Nach einer Weile deutete er auf einige der jüngeren Frauen und Männer, unter ihnen Gregorius. »Die da.« Als er sprach, blitzten seine Fangzähne im Feuerschein auf.
Seine Männer packten die so Ausgewählten grob und fesselten sie. Gregorius setzte sich nicht zur Wehr. Seine Züge waren erstarrt. Serpil hingegen, ein schmächtiger Mann, versuchte, schützend vor seine Tochter zu treten. »Nein! Nicht Irma! Bitte, seid gnädig!«, flehte er.
Einer der Reiter knurrte ungehalten und zückte sein Schwert. Es zischte durch die Luft, durchschnitt Serpils Hals. Die Siedler schrien auf, als sein Kopf mit grotesk aufgerissenem Mund ins Gras fiel. Irmas Gesicht verzerrte sich in einem stummen Laut der Fassungslosigkeit und des Entsetzens. Jetzt wehrte sich niemand mehr und auch einige der Männer begannen zu weinen.
»Sollen wir ein paar Kinder mitnehmen, Kemp?«, fragte einer der Reiter.
Die Siedler stöhnten entsetzt auf. Frauen und Männer zogen ihre Kinder noch enger an sich.
»Nein. Die würden uns nur aufhalten und bringen nicht viel ein.« Der Anführer, Kemp, musterte die Siedler weiter. »Die da noch.« Er deutete auf drei Männer, einer davon Cailinas ältester Bruder. »Nicht als Blutsklaven, aber die können arbeiten.«
Ein Reiter kam auf die Lichtung, Rodica vor sich im Sattel haltend. Ihr Kleid war aufgerissen und ihr Körper von Bisswunden übersät. Der Reiter warf sie zur Erde, wo sie leblos und mit seltsam verdrehten Gliedern liegen blieb.
Taran schrie entsetzt auf. »Mutter!«
Kemp beugte sich über Rodica, hob ihren Kopf an und ließ ihn wieder fallen. »Du Schwachkopf!«, fuhr er den Reiter an. »Die hätten wir gut verkaufen können!«
Der Reiter grinste. »Es gibt genug hier, die wir verkaufen können. Ich brauchte etwas Entspannung.« Er fasste sich in den Schritt und machte eine anzügliche Bewegung mit der Hüfte. Die Vampire grölten.
»Mutter! Nein!« Taran bäumte sich auf, doch der Mann hinter ihr ließ sie nicht los. Tränen der Verzweiflung rannen ihr die Wangen hinunter.
Kemp deutete auf sie. »Die kommt auch mit. Sie sieht mir wie eine gute Blutsklavin aus. Das reicht dann für heute Nacht. Für mehr Sklaven haben wir nicht genug Pferde.«
»Ich bin schon gespannt, wie du schmeckst«, raunte der Mann, der Taran hielt, heiser. Er roch nach Schweiß und Pferd. »Wie alt bist du? Neunzehn, zwanzig? Genau das richtige Alter, würde ich sagen.«
»Worauf wartet ihr? Nährt euch!«, befahl Kemp. »Wir müssen bald aufbrechen, wenn wir die erste Höhle noch vor Sonnenaufgang erreichen wollen.«
»Na, also«, flüsterte der Mann hinter Taran.
Er umklammerte sie noch fester, bog ihren Kopf und strich ihr langes Haar beinahe zärtlich zur Seite. Sie stöhnte gequält auf, ihr fassungsloser Blick auf den reglosen Körper ihrer Mutter gerichtet.
»Ruhig, meine Schöne.« Er lachte. Dann spürte sie mit einem unwirklichen Gefühl des Grauens Zähne auf ihrer Haut. Ein scharfer Schmerz am Hals.
Alles verschwand, Rodicas Körper, die verängstigten Siedler, die Vampire. Bilder stürzten auf Taran ein, eine verwirrende Abfolge von Geschehnissen. Erst war es ein Junge, dann ein Mann. Es gab Bilder von Schlachten, von Blut. Von Morden, Plünderungen und Schändungen. Von Frauen. Von Burgen auf nebligen Gebirgszügen. Von Ritten durch Urwälder. Das Mädchen, das auf dem Pferd vor ihm sitzt, er beißt in ihren Hals, er trinkt ihr Blut, aber es verbrennt ihn, er brüllt die unerträglichen Schmerzen hinaus in die Welt, ...
Die Bilder versanken vor dem Hintergrund der brennenden Hütten und der in Hälse und Handgelenke von schluchzenden und schreienden Siedlern verbissenen Vampire.
Ein silbriger Staub hatte sich auf sie und die Mähne des nervös tänzelnden Pferdes gelegt. Niemand hielt sie mehr. Sie glitt vom Pferd, sank zu Boden. Die Schläge ihres rasenden Herzens dröhnten in ihren Ohren. Ihre Hand fuhr zitternd an die brennende Bissstelle am Hals. Als sie sie zurückzog, hingen tiefrote Blutstropfen an ihren Fingerspitzen.
»Was zur Hölle ...?!«
Taran sah benommen hoch. Die Wajaren ließen einer nach dem anderen von den Siedlern ab und versammelten sich um sie, riesige Männer, die sie drohend anstarrten.
Kemp ging vor ihr in die Knie und fasste sie hart am Kinn, zwang sie, ihn anzusehen. »Das gibt es doch nicht!«, flüsterte er.
Sie machte eine schwache Bewegung, um seine Hand abzuschütteln, doch er hielt sie fest. »Eine Ewige!« Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Eine verdammte Ewige!«
Ein Raunen ging durch die Vampire. Im Gegensatz zu ihrem Anführer grinsten sie nicht.
»Töte sie!«, verlangte einer aufgebracht. »Sie hat Agnar umgebracht!«
»Ja! Aber wir sollten vorher unseren Spaß mit ihr haben!«
»Das is’ ‘ne Ewige! Ich rühr’ die nich’ an!«
»Was denn? Ist doch nur das Blut, das gefährlich ist!«
»Woher will’ste das wissen?«
»Haltet eure Fressen!«, brüllte Kemp. Augenblicklich legte sich Stille über die Vampire.
»Eine Ewige.« Kemp ließ endlich ihr Kinn los und erhob sich. »Dich werden wir teuer verkaufen.«
»Aber, Kemp! Sie hat Agnar umgebracht!«
»Agnar war ein Idiot.« Ein gieriger Ausdruck war in Kemps Augen getreten. »Raiden Tyr wird viel Gold für sie bezahlen. Hölle, wie lange schon ist er auf der Suche nach Ewigen! Er hat jedes Menschenweib auf seiner Burg besprungen, um einen zu zeugen! Jetzt, wo er sich mit Hilfe der Insignien zum Herrscher gemacht hat, wird er uns viel Gold für einen geben! Die hier ist mehr wert als der ganze Haufen da!«
»Ehrlich?«, fragte einer staunend und begutachtete Taran wie eine Attraktion im Kuriositätenkabinett eines Jahrmarkts.
Kemp nickte bekräftigend. »Ja, die ist was wert. Fesselt sie und bringt sie zu den anderen Sklaven. Sobald sich alle genährt haben, reiten wir los.«
Einer der Räuber, ein dürrer hoch aufgeschossener Mann mit ungepflegtem Haar, räusperte sich. »Kemp«, sagte er. Seine tiefe und wohltönende Stimme passte so gar nicht zu seiner dünnen Gestalt. »Du willst tatsächlich zu Raiden Tyr?«
»Natürlich. Wie sonst soll ich ihm die Ewige verkaufen?«
»Na ja, nach der Schlacht im letzten Herbst dachte ich, dass wir ‒.«
»Tyr hat die Schlacht gewonnen, oder? Auch ohne uns! Er wird sich die Finger nach der Ewigenlecken und uns reich entlohnen! Jetzt fesselt sie endlich und nährt euch!«
Taran wehrte sich nicht mehr, als ein grobschlächtiger Mann sie hochzog und ihr ein Seil um die Handgelenke wickelte. Er zerrte sie zu den Pferden, auf denen Gregorius und die anderen schon festgebunden worden waren.
»Hoch mit dir!« Er griff Taran an der Hüfte und hob sie auf den Rücken eines Schimmels, als wäre sie nicht schwerer als eine Feder. Der Sattel hatte einen hohen Knauf, an dem der Mann das Seil festzurrte, das er um ihre Hände geschlungen hatte. »Und mach keine Dummheiten, verstanden? Du tust, was wir sagen«, sagte er warnend. Er nahm den Zügel des Tiers und band ihn hinter dem Sattel eines anderen Pferdes fest, auf das er sich dann schwang.
Taran zitterte noch immer. Sie konnte nicht erfassen, was geschehen war. Mutter! Sie drehte sich um, versuchte, einen Blick auf die am Boden liegende Gestalt zu erlangen, doch die Vampire und ihre Pferde schirmten sie wie eine Mauer ab. Sie öffnete den Mund, um nach ihr zu rufen. Ein belegtes Krächzen bahnte sich seinen Weg durch ihre Kehle. »Mutter«, flüsterte sie heiser.
Das Pferd tat einen Schritt vorwärts. Taran keuchte leise auf. Sie würden sie von hier wegbringen. Ins Qanicengebirge. Zu Raiden Tyr.
»Nein.« Sie zerrte kraftlos an dem Strick, aber weder ihr Bewacher noch einer der anderen Vampire beachteten sie. »Bitte, nein!« Verzweifelt sah sie sich um, suchte nach einem Halt, einem Trost. Gregorius!
Er saß mit fahlem Gesicht auf einem Rappen. Seine Augen irrten zu den Siedlern. Aki starrte ihn an, Tränen liefen ihm über die Wangen. Er sagte etwas, lautlos, und versuchte, zu Gregorius zu gelangen. Ein Vampir stieß ihn zurück. Aki stolperte, hielt sich aber auf den Beinen. Gregorius wandte den Kopf ab. Sein Blick fiel auf Taran, wurde kalt. Seine Züge verhärteten sich.
Sie schluchzte auf. Sie wusste, was er fühlte. Abscheu und Ekel. Sie konnte es ihm nicht verdenken.
Kemp brüllte den Befehl zum Abritt. Die Pferde setzten sich in Bewegung. Mutter! Sie zerrte an ihren Fesseln, drehte sich um, mit den Augen verzweifelt nach dem Körper Rodicas suchend. Doch das Letzte, was sie sah, als sie in die Finsternis unter den Bäumen ritten, waren die ihnen hinterherstarrenden Siedler, beleuchtet vom roten Licht der die Hütten verzehrenden Flammen.
Kapitel 4
Sie reisten des Nachts und rasteten tagsüber.
In der Nacht des Überfalls waren sie zügig am Rande der Grasländer nach Norden geritten, bis sie auf die ersten Ausläufer der Urwälder trafen. Als sich das Licht des Morgens ankündigte, brachten die Vampire ihre Gefangenen in eine feuchte Höhle, die gerade groß genug war, um ihnen Platz zum Schlafen zu bieten. Die Pferde wurden draußen zwischen Baumriesen, die von Schlingpflanzen und Moosen überwachsen waren, angebunden.
Taran ließ alles teilnahmslos mit sich geschehen. Rodicas lebloser Körper und der Anblick der Vampire beim Aussaugen ihrer Opfer standen ihr vor Augen. Die verzweifelten Schreie der Siedler gellten in ihren Ohren. Der Staub des Vampirs Agnar schien noch um sie zu schweben. Selbst ihr Haar hatte seine silbrige Farbe angenommen.
Eine Ewige. Der Gedanke erfüllte sie mit Abscheu. Es war kein Wunder, dass Rodica nichts von ihrem Vater erzählt hatte. Sie hatte bei einem Vampir gelegen, hatte sie, Taran, durch einen Blutsauger empfangen. Nur sehr selten konnte sich ein Vampir mit einem Menschen fortpflanzen, einen Ewigen zeugen. Ein Mischling, dessen Blut Vampire tötete und den die Menschen verachteten.
Man erzählte sich Schauermärchen über Ewige. Sie sollten ebenso wie Vampire Blut saugen. Um an Blut zu gelangen, stahlen sie Menschenkinder und mussten dafür noch nicht einmal auf die Nacht warten, da sie nicht sonnenempfindlich waren. Sie wiesen den Vampiren den Weg zu den Verstecken der Menschen, damit diese versklavt werden konnten. Sie hatten übermenschliche Kräfte, konnten einen Mann mit nur einer Hand töten.
Nun wusste Taran, dass diese Geschichten nicht wahr sein konnten. Sie hatte nie Blut getrunken, ein Kind entführt oder die Siedlung an Vampire verraten. Auch hatte ihr erfolgloser Widerstand gegen den Vampir Agnar gezeigt, dass sie keine übermenschlichen Kräfte besaß.
Aber hatte Rodica ihren Vater tatsächlich geliebt? Fast wollte sie glauben, dass ihre Mutter gegen ihren Willen bei ihm gelegen hatte, doch dann erinnerte sie sich an Rodicas Beteuerung, dass die Zeit mit ihrem Vater die schönste