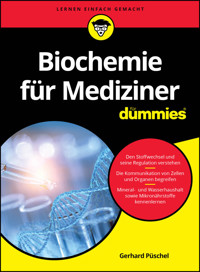
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Ihr Wegweiser durch den Dschungel der Biochemie
Sie müssen eine Biochemie-Prüfung bestehen und Biochemie erscheint Ihnen so unanschaulich und schwer verständlich, das absolute Horrorfach? In diesem Buch werden biochemische Grundlagen und Zusammenhänge leicht verständlich erklärt. Über 300 speziell für dieses Buch entworfene Abbildungen und Schemata machen den Stoff anschaulicher und helfen Ihnen, den Durchblick zu bekommen. Gerhard Püschel erklärt Ihnen Stoffwechselwege und deren Regulation, Kommunikation zwischen Zellen und Organen, Zellzykluskontrolle und vieles mehr auf wissenschaftlich aktuellem Stand, aber »gut verdaulich«, damit das Lernen auch ein wenig Spaß macht.
Sie erfahren
- Was Sie über Kohlenhydrat-, Lipid- und Proteinstoffwechsel wissen sollten
- Welche Funktion Vitamine und Spurenelemente haben
- Wie Replikation, Transkription, Translation und Kontrolle der Genexpression funktionieren
- Wie Hormone, Cytokine und deren Rezeptoren Zell- und Organfunktion steuern
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 920
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Biochemie für Mediziner für Dummies
Schummelseite
Wichtig, lesen Sie im Vorwort die Anleitung zum Lesen von Abbildungen.
Wichtige Verbindungen, die Sie unbedingt erkennen können sollten. Einzelheiten Kapitel 2 und 7.
Glykolyse, kurzgefasst. Einzelheiten Kapitel 2 und 9.
Glykolyse.
Metabolite: Glc, Glucose; G-6-P, Glucose-6-Phosphat; F-6-P, Fructose-6-Phosphat; F-1,6-BP, Fructose-1,6-Bisphosphat; GAP, Glycerinaldehyd-3-Phosphat; DHAP, Dihydroxyacetonphosphat; 1,3-BGP, 1,3-Bisphosphglycerat; 3PG, 3-Phosphoglycerat; 2PG, 2-Phosphoglycerat; PEP, Phosphoenolpyruvat; Pyr, Pyruvat; Lac, Lactat.
Enzyme: HK, Hexokinase; PHI, Phosphohexoseisomerase; PFK, Phosphofructokinase; ALD, Aldolase; PTI, Phosphotrioseisomerase; GAPDH, Glycerinaldehyd3-Phosphat-Dehydrogenase; GYK, Glycerat3-Phosphat-kinase; PGM, Phosphoglyceratmutase; ENO, Enolase; PK, Pyruvatkinase (siehe Kapitel 2).
Citratzyklus. Einzelheiten siehe Kapitel 2.
Aminosäurabbau und Citratzyklus.
Enzyme: ANase, Asparaginase; ARase, Arginase; BKADH, Verzweigtketten-(Branched-chain-)Ketosäuredehydrogenase-Komplex; FTC, Formimidoyltransferase-cyclodeaminase; GDH, Glutamatdehydrogenase; GNase, Glutaminase; HAL, Histidin-Ammoniak-Lyase; PC, Pyruvatcarboxylase; PH, Phenylalaninhydroxylase; S/TDH, Serin-Threonin-Dehydrogenase; TA, Transaminase (ohne Zusatz α Aminogruppe, δ und ε für die entsprechenden Aminogruppen);
Metabolite: Aminosäuren im Drei-Buchstaben-Code; αKG, α-Ketoglutarat; OH-Pyr, Hydroxypyruvat; OxAc, Oxalacetat; Prop-CoA, Propionyl-CoA; Pyr, Pyruvat; Succ-CoA, Succinyl-CoA. Achtung: Die Reaktionspartner und Nebenprodukte sind der Übersichtlichkeit wegen nicht gezeigt (siehe Kapitel 12).
Die mitochondriale β-Oxidation von Fettsäuren. Einzelheiten siehe Kapitel 18.
Die Atmungskette ganz kompakt. Einzelheiten siehe Kapitel 2.
WICHTIGE ABKÜRZUNGEN
Die 20 proteinogenen Aminosäuren mit Abkürzung (Drei- und Ein-Buchstaben-Code)
Alanin, Ala (A)
Arginin, Arg (R)
Asparagin, Asn (N)
Asparaginsäure, Asp (D)
Cystein, Cys (C)
Glutamin, Gln (Q)
Glutaminsäure, Glu (E)
Glycin, Gly (G)
Histidin, His (H)
Isoleucin, Ile (I)
Leucin, Leu (L)
Lysin, Lys (K)
Methionin, Met (M)
Phenylalanin, Phe (F)
Prolin, Pro (P)
Serin, Ser (S)
Threonin, Thr (T)
Trytophan, Trp (W)
Tyrosin, Tyr (Y)
Valin, Val (V)
Standard-Abkürzungen
A, Adenin
ADP, Adenosindiphosphat
AMP, Adenosinmonophosphat
C, Cytosin
cAMP, cyclisches Adenosinmonophosphat
CDP, Cytidindiphosphat
CMP, Cytidinmonophosphat
CoA/CoA-SH, Coenzym A
CTP, Cytidintriphosphat
Da, Dalton
DNA, Desoxyribonucleinsäure
ER, endoplasmatisches Retikulum
FAD, Flavinadenindinucleotid
FMN, Flavinmononucleotid
G, Guanin
GDP, Guanosindiphosphat
GMP, Guanosinmonophosphat
GSH/GSSG, Glutathion
Hb, Hämoglobin
HDL, High-Density-Lipoprotein
IDL, Intermediate-Density-Lipoprotein
Ig, Immunglobulin
ITP, Inosintriphosphat
KM, Michaelis-Menten-Konstante
kb, Kilobasenpaare (Nucleotidlänge)
kDa, Kilodalton
LDL, Low-Density-Lipoprotein
mRNA, Botenribonucleinsäure
MHC, Major-Hisocompatibility-Complex
NAD(P), Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid(-Phosphat)
NAD(P)H, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid(-Phosphat) reduziert
Pi, anorganisches Phosphat
PCR, Polymerase-Kettenreaktion
RNA, Ribonucleinsäure
rRNA, ribosomale Ribonucleinsäure
SAM, S-Adenosyl-Methionin
T, Thymin
tRNA, Transfer-Ribonucleinsäure
TTP, Thymidintriphosphat
U, Uracil
UDP, Uridindiphosphat
VLDL, Very-Low-Density-Lipoprotein
Biochemie für Mediziner für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2024© 2024 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto:BillionPhotos.com - stock.adobe.comKorrektur: Petra Heubach-Erdmann, Annette Hillig
Print ISBN: 978-3-527-72034-7ePub ISBN: 978-3-527-84082-3
Über den Autor
Gerhard Püschel studierte Medizin an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und promovierte ebendort. Danach studierte er Biochemie in Bloomington, Indiana, und habilitierte sich an der Georg-August-Universität Göttingen in Biochemie. Seit 2000 ist er Inhaber des Lehrstuhls Biochemie der Ernährung an der Universität Potsdam. Ihm wurde 2015 der Forschungspreis des Landes Berlin zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche verliehen. Er verfügt über große Lehrerfahrung auf dem Gebiet der Biochemie und ist Autor zahlreicher Originalartikel, Übersichtsartikel und Fachbücher auf dem Gebiet der Biochemie und molekularen Zellbiologie.
Über den Fachkorrektor
Thomas Kietzmann studierte Medizin in Greifswald und promovierte ebendort. Er habilitierte sich 2001 am Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie der Universität Göttingen. Seit 2009 hat er den Lehrstuhl für Zelluläre Biochemie in Oulu, Finnland inne. Er hat neben seiner international herausragenden wissenschaftlichen Tätigkeit langjährige Lehrerfahrung auf dem Gebiet der Biochemie gesammelt.
Danksagungen des Autors
Ich möchte an dieser Stelle meinem leider viel zu früh verstorbenen Mentor, Prof. Dr. Kurt Jungermann, dafür danken, dass er ein wenig Ordnung in meine vielen wirren Gedanken gebracht und mir die Grundlagen didaktisch sinnvoller Lehre beigebracht hat. Meinen Studierenden danke ich dafür, dass sie über 25 Jahre mit konstruktiver Kritik dazu beigetragen haben, die auf diesen Grundlagen aufbauende Lehre immer weiter zu verbessern. Ihnen möchte ich dieses Buch widmen.
Herrn Prof. Dr. Thomas Kietzmann möchte ich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und seine zahlreichen, konzeptionell wichtigen Änderungs- und Verbesserungsvorschläge bei der Fachkorrektur danken. Ein ganz besonderer Dank gilt auch Frau Dr. Stefanie Lieske für die sorgfältige Prüfung aller Abbildungen. Zudem möchte ich allen hier namentlich nicht aufgeführten Fachkolleginnen und -kollegen danken, die mir mit Beistand auf ihrem Spezialgebiet geholfen haben, Unklarheiten und Zweifel während des Schreibens des Manuskripts auszuräumen.
Ein großer Dank geht an Marcel Ferner vom Verlag Wiley, der mich zum Schreiben dieses Buchs angestiftet und auf dem Weg seiner Entstehung begleitet hat.
Danken möchte ich auch meiner Tochter, die mich während ihres Studiums »Sport and Exercise Science« über manchen biochemischen Tellerrand hat schauen lassen. Dank gebührt aber nicht zuletzt vor allen anderen meiner Frau, die meine wachsende Unausgeglichenheit in der etwas stressigen letzten Phase der Manuskripterstellung tapfer ertragen hat.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Über den Fachkorrektor
Danksagungen des Autors
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Was ist Biochemie und wozu braucht man sie?
Törichte Annahmen über die Leser
Konventionen in diesem Buch
Symbole in diesem Buch
Wie es weitergeht
Nicht nur Dummies machen Fehler
Teil I: Alles im Fluss: Stoffwechsel
Kapitel 1: Ein paar Gedanken zur Thermodynamik
Thermodynamisches Gleichgewicht und ΔG
Auf Leben und Tod: Das Fließgleichgewicht
Den Berg hinaufgehen – Von der Kopplung exergoner und endergoner Reaktionen
Kapitel 2: Energiegewinnung
Energie liefern und Leistung erbringen
Energiegewinnung 1, ohne Sauerstoff geht nur mit Zucker
Energiegewinnung 2, mit Sauerstoff ist mehr drin
Kapitel 3: Immer schön angepasst, Stoffwechselphasen
Wechsel zwischen Überfluss und Mangel
Feinschmecker unter den Organen
Substratfluss zwischen den Organen
Hormonelle Regulation
Bilanz und deren Messung
Kapitel 4: Stoffwechselregulation, leider nicht ohne Enzymkinetik
Regulation des Substratflusses
Den richtigen Weg einschlagen, Steuerung des Flusses durch Stoffwechselwege
Die Weichen stellen, Regulation der Enzymaktivität
Kapitel 5: Expressionskontrolle
Ebenen der Expressionskontrolle
Transkriptionskontrolle
Wegwerfmentalität und Sitzblockade – Von mRNA-Abbau und -Translatierbarkeit
Wegwerfmentalität, die Zweite
Kapitel 6: Transkription
Eine kurze Wiederholung des Grundwissens
Kontrolle des Transkriptionsstarts, der Promotor
Besonderheiten der mRNA-Synthese bei Eukaryonten
Kapitel 7: Einige einführende Gedanken zu Kohlenhydraten
Wozu braucht man Kohlenhydrate?
Ein fauler Kompromiss
Was sind eigentlich Kohlenhydrate?
Kapitel 8: Verdauung und Resorption von Kohlenhydraten
Verdauen
Resorption der Monosaccharide aus dem Darm
Proximaler Nierentubulus, der zweite Darm
Unverdaulich, aber trotzdem wertvoll
Kapitel 9: Stoffwechsel der Monosaccharide in der Leber und im Skelettmuskel
Glucose-Stoffwechsel in der Leber
Glykogensynthese
Glykogenabbau
Auch bei Glykogenauf- und -abbau gilt: Nur nicht leerlaufen!
Oxidativer Pentosephosphatweg
Heterogenität des Glucosestoffwechsels in der Leber
Stoffwechsel anderer Monosaccharide in der Leber
Glucosestoffwechsel im Skelettmuskel
Kapitel 10: Regulation der Regulatoren: Insulin, Glucagon und Adrenalin
Regulation der Insulinfreisetzung
Synthese und Regulation der Expression des Insulins
Regulation der Glucagonfreisetzung
Regulation der Adrenalinfreisetzung
Kapitel 11: Ein kurzer Blick auf Aminosäuren, Peptide und Proteine
Die Bausteine: Aminosäuren
Immer schön der Reihe nach: Primärstruktur von Proteinen
Der rechte Dreh oder Zickzack: Sekundärstruktur von Proteinen
Ordentlich falten: Tertiärstruktur von Proteinen
Gemeinsam noch stärker: Quartärstruktur von Proteinen
Analyse von Proteingemischen
Kapitel 12: Stoffwechsel von Aminosäuren
Synthese von Aminosäuren
Abbau von Aminosäuren
Entgiftung, die Entsorgung des Ammoniaks
Aminosäuren braucht man nicht nur für die Proteinsynthese
Kapitel 13: Verdauung von Proteinen, Resorption von Aminosäuren und Stickstoffbilanz
Schrittweise klein hacken: Proteolyse in Magen und Dünndarm
Große und kleine Happen: Resorption von Peptiden und Aminosäuren
Fast ein zweiter Darm: Rückresorption von Peptiden und Aminosäuren in der Niere
Bilanz des Aminosäurestoffwechsels
Kapitel 14: Proteinsynthese und Proteostase
Eine kurze Wiederholung des Schulwissens
Herstellung der Werkzeuge
Aller Anfang ist schwer, Translationsinitiation
Auch die Elongation braucht Hilfsfaktoren
Translation hört nicht einfach auf, sie wird beendet
Regulation der Translation durch Insulin und Aminosäuren
Translation von sekretorischen Proteinen und Membranproteinen
Protein falten
Protein zuckern
Qualitätskontrolle
Proteinverteilung in der Zelle
Kapitel 15: Stoffwechsel der Lipide, Grundlagen
Fettsäuren
Membranlipide
Ganz schön aggressiv: Überschuss an Fettsäuren stört Membranfunktion und muss in inerter Form gespeichert werden
Isoprenoide und Sterole
Polyketide
Die Angst vor dem anderen und andere Grenzprobleme
Kapitel 16: Verdauung und Resorption von Lipiden
Verdauung und Resorption von Triacylglyceriden und Phospholipiden
Verdauung und Resorption von Cholesterolestern und Cholesterol
Recycling der Gallensäuren
Kapitel 17: Stoffwechsel der Lipoproteine
Einteilung, Aufbau und Eigenschaften der Lipoproteine
Stoffwechsel und Funktion der Lipoproteine
Kapitel 18: Synthese, Speicherung und Verwertung von Fettsäuren
Aufbau und Mobilisation von Triglyceridspeichern im weißen Fettgewebe
Verwertung von Fettsäuren zur Energiegewinnung
Zu viel Zucker macht Fett: Fettsäuresynthese
Wie Fettsäuren ihr eigenes Schicksal bestimmen: PPARs
Kapitel 19: Stoffwechsel des Cholesterols
Endogene Cholesterolsynthese
Gute Gründe für strenge Kontrolle
Gerechte Verteilung: Cholesteroltransport zwischen Organen über Lipoproteine
An Absender zurück, reverser Cholesteroltransport
Physiologische Funktionen von Cholesterol
Kapitel 20: Stoffwechsel der Pyrimidine und Purine
Man muss schon wissen, wovon man redet: Nomenklatur
Nucleotidpool, Recycling geht vor!
Synthese von Pyrimidin-Nucleotiden
Synthese von Purin-Nucleotiden
Wie das »D« für die DNA-Bausteine gemacht wird
Abbau von Pyrimidinen und Purinen
Zufuhr über die Nahrung
Harnsäure, der Peiniger der Könige
Kapitel 21: Natrium, Kalium und Wasserhaushalt
Verteilung von Wasser zwischen Körperkompartimenten
Unglaubliche Transportleistung: Die tubuläre Rückresorption von Natrium
Zwei Enzyme und zwei Hormone, das RAAS
Wissenswertes über Aldosteron
Hormonelle Regulation des Plasmavolumens
Hormonelle Regulation der Plasmaosmolarität
Ein kurzer Blick aufs Kalium
Kapitel 22: Regulation des Calcium- und Phosphathaushalts
Calcium, ein »Mangelmengenelement«
Regulation des Serumcalcium- und Serumphosphatspiegels durch Parathormon, FGF-23 und D-Hormon (Vitamin D)
Kapitel 23: Spurenelemente
Eigentlich gar kein Spurenelement: Eisen
Kupfer, ein »Elektronenzwischenlager« in Enzymen
Molybdän
Mangan
Zink
Chrom
Kobalt
Selen, der »Schwefelersatz«
Nur für die Schilddrüse: Iod
Lokal oder systemisch, Fluorid für harte Zähne und feste Knochen
Kapitel 24: Vitamine
Radikalfänger und Redoxpartner
Elektronenschlepper
Gruppenüberträger
Rezeptorliganden
Teil II: Ohne Kommunikation läuft gar nichts: Signaltransduktion
Kapitel 25: Arbeitsteilung braucht Koordination, Grundprinzipien der Signaltransduktion
Kommunikation zwischen Zellen und Organen
Signalweiterleitung in der Zelle
So ähnlich wie Enzyme: Die Eigenschaften von Rezeptoren
Kapitel 26: Ectorezeptoren I: Ligand-aktivierte Ionenkanäle und G-Protein-gekoppelte Rezeptoren
Ligand-modulierte Ionenkanäle
Gemeinsame Merkmale G-Protein-gekoppelter Rezeptoren
Klassen der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren sind GEFs
Heterotrimere G-Proteine, eine heterogene Großfamilie
Adenylatcyclase hü oder hott: Gs- und Gi-gekoppelte Rezeptoren
Zwei second Messenger auf einen Streich: PLCβ-Signalkette
Fest in GPCR-Hand: Sehen, Schmecken und Riechen
Kapitel 27: Ectorezeptoren II: Rezeptorenzyme, Enzym-assoziierte Rezeptoren, Plattform-bildende Rezeptoren und Zelladhäsionsrezeptoren
Direkte second-Messenger-Synthese, Rezeptorguanylatcylasen
Rezeptortyrosinkinasen, die Wachstumsfaktorrezeptoren
Typ-2-Rezeptortyrosinkinasen, alles ein wenig anders
Rezeptor-Serin/Threoninkinasen, die TGFβ-Rezeptorfamilie
Tyrosinkinase-assoziierte Rezeptoren
Eigentlich gar nicht signalgebender Rezeptor, sondern Co-Ligand, der IL-6-Rezeptor
Plattformbildende Rezeptoren
Klebeprotein oder Rezeptor?
Kapitel 28: Hormonsystem I: Hypothalamisch-hypophysärer Regelkreis: Schilddrüsenhormon, Steroidhormone und Wachstumshormon
Grundprinzip des hypothalamisch-hypophysären Systems zur Kontrolle peripherer endokriner Organe
Hypothalamisch-hypophysäre Kontrolle der Schilddrüsenhormonproduktion
Schilddrüsenhormonsynthese
Wirkung der Schilddrüsenhormone
Allgemeines zu Steroidhormonen
Problematische Doppelfunktion: Die Glucocorticoide
Gleiches Prinzip bei Mann und Frau: Regulation der Geschlechtshormonproduktion
Regulation der Geschlechtshormonproduktion beim Mann
Regulation der Geschlechtshormonproduktion bei der Frau
Abbau männlicher und weiblicher Geschlechtshormone
Hormon und hypophysäres Stimulations-Hormon: Das Wachstumshormon
Kapitel 29: Hormonsystem II: Gastrointestinale Hormone, Gewebshormone, biogene Amine und Lipidmediatoren
Von saurem Segen, Pankreassäften und Gallenblasenzuckungen: Gastrointestinale Hormone
Hauptsächlich lokal wirksam, Kinine
Biogene Amine
Eikosanoide und andere Lipidmediatoren
Kapitel 30: Cytokine und Organokine
Cytokinfamilien
Sauerstoffhunger, Regulation der Erythropoietinexpression als »Organokin« der Niere
Fett oder nicht fett, Adipokine
Hepatokine
Kontrolle der Muskelmasse: Myokine, Osteokine und noch ein Hepatokin
Teil III: Ganz schön speziell: Biochemische Aspekte der Zell- und Organbiologie
Kapitel 31: Zellzykluskontrolle, DNA-Synthese und Apoptose
Zellzyklusphasen
Kontrolleure des Zellzyklus: Cycline und Cyclin-abhängige Kinasen
Verdopplung der Erbinformation, die DNA-Synthese
Überprüfung und Teilung, die G2- und M-Phase
Qualitätskontrolle während des Zellzyklus
Letzter Ausweg, Apoptose
Kapitel 32: Mutation und DNA-Reparatur
Mehr oder weniger schlecht, zwei Seiten der Mutation
Von Katastrophe bis unbemerkt, Arten der Mutation
Zufällig oder gerichtet, das ist hier die Frage
DNA-Reparatursysteme
Kapitel 33: Blut, nicht nur roter Saft
Sauerstoff- und CO
2
-Transport
Stofftransport
pH-Homöostase
Hämostase
Kapitel 34: Immunsystem
Humorale angeborene Immunabwehr, das Komplementsystem
Humorale adaptive Immunabwehr, die Antikörper
Zelluläre angeborene Immunabwehr
Zelluläre adaptive Immunabwehr, T-Lymphocyten und T-Zellrezeptoren
Auswanderung ins Gewebe
Kapitel 35: Alles in Bewegung
Extrazelluläre Matrix
Cytoskelett
Motorproteine
Muskelkontraktion
Kapitel 36: Zehn Sternstunden der Biochemie
Top 1
Top 2
Top 3
Top 4
Top 5
Top 6
Top 7
Top 8
Top 9
Top 10
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Energiegehalt (kcal/g), metabolisches Äquivalent (mE, kcal/lO
2
) und...
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Unterschiede im Glykogenstoffwechsel in Leber und Muskel
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Funktion wichtiger Apolipoproteine. LCAT, Lecitin-Cholesterol-Acyl...
Tabelle 17.2: Lipoproteine Abkürzungen: Chy, Chylomikronen; ChyR, Chylomikronenr...
Kapitel 21
Tabelle 21.1: Wirkungen des atrialen-natriuretischen-Peptids (ANP)
Kapitel 23
Tabelle 23.1: Zufuhrempfehlung für Spurenelemente entsprechend den Referenzwerte...
Tabelle 23.2: Kupferhaltige Enzyme
Kapitel 24
Tabelle 24.1: Empfohlene tägliche Zufuhrmenge für Vitamine. Die Werte gelten für...
Tabelle 24.2: Pyridoxalphosphat-abhängige Enzyme
Tabelle 24.3: Folsäure-abhängige Reaktionen
Kapitel 26
Tabelle 26.1: Familien der α-Untereinheiten der heterotrimeren G-Proteine (nach ...
Kapitel 29
Tabelle 29.1: Catecholamine und ihre Rezeptoren
Kapitel 31
Tabelle 31.1: Prokaryote DNA-Polymerasen
Tabelle 31.2: Einige wichtige humane DNA-Polymerasen. Darüber hinaus gibt es noc...
Kapitel 34
Tabelle 34.1: Wichtige Toll-like-Rezeptoren und ihre Liganden
Tabelle 34.2: Einteilung der T-Helferzellen
Kapitel 35
Tabelle 35.1: Gruppen von Intermediärfilamentproteinen (vereinfacht nach The Cel...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
9
10
11
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
649
650
651
652
653
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
Einführung
Sie beschäftigen sich im Rahmen Ihres Studiums oder Ihrer Ausbildung mit Biochemie? Davon gehe ich zumindest aus, wenn Sie diesen Text lesen. Biochemie ist ein spannendes und für Medizin und viele angrenzende Fächer auch sehr wichtiges Thema. Dieses Buch versucht, Ihnen die Biochemie so verständlich wie möglich nahezubringen. Aber vorab einmal zu der entscheidenden Frage:
Was ist Biochemie und wozu braucht man sie?
Biochemie oder physiologische Chemie mit den angrenzenden, überlappenden Fächern Molekularbiologie und molekulare Zellbiologie ist der Schlüssel zum Verständnis molekularer Grundlagen von Lebensvorgängen. Sie beschäftigt sich nicht nur mit den chemischen Vorgängen, die dem Stoffwechsel zugrunde liegen, sondern vor allem auch mit den Mechanismen, die eine Regulation der zahlreichen Prozesse, die in lebenden Zellen oder Organismen ablaufen, ermöglichen. Biochemie hilft dabei, besser zu verstehen, was bei Erkrankungen »falsch läuft« und an welchen Stellen die pharmakologische Therapie ansetzt. Gute Kenntnisse in der Biochemie erleichtern es daher, die theoretischen Zusammenhänge in den klinischen Fächern zu verstehen.
Törichte Annahmen über die Leser
Das Buch richtet sich an alle, die Biochemie lernen wollen oder müssen und die unnötige Angst vor der Biochemie verlieren wollen.
Wie der Titel sagt, richtet sich das Buch in erster Linie an Studierende der Humanmedizin und Zahnmedizin, die den Biochemiedrachen besiegen müssen. Nur Mut, statt ihn zu töten, hilft Ihnen dieses Buch vielleicht, den Biochemiedrachen zu einem nützlichen Haustier zu zähmen, das Ihnen beim Lernen anderer Fächer, besonders der Inneren Medizin und Pharmakologie, später hilft.
Ganz besonders wird das Buch auch Studierenden der Ernährungswissenschaft oder Ökotrophologie bei der Bewältigung der »Biochemie der Ernährung« helfen. Weite Teile des Textes sind auf Basis der gleichnamigen Vorlesung entstanden, wobei einige »EWI-Spezialitäten« aus Platzgründen geopfert werden mussten.
Das Buch ist auch für Studierende der »Hardcore«-Biochemie eine Fundgrube, wenn sie auf der Suche nach den physiologischen Zusammenhängen sind, die sie mit ihrem immer subtiler werdenden molekularen Detailwissen erklären können.
Das Buch ist auch interessant für Studierende und Auszubildende anderer Fächer, angefangen vom Medizinisch-Technischen-Laborassistenten bis hin zum Studierenden der Sport- und Trainingswissenschaft, denn auch sie benötigen Grundkenntnisse der Biochemie des menschlichen Körpers.
Nicht zuletzt richtet sich das Buch an alle interessierten Laien sowie Schülerinnen und Schüler, die gerne ein wenig tiefer in die Materie eintauchen und sich am Ende für die Biochemie begeistern wollen.
Konventionen in diesem Buch
Biochemie hat den Ruf, unanschaulich und kompliziert zu sein. Auch dieses Buch kommt nicht ohne Fachbegriffe und Fachsprache aus, es wird aber immer versucht, die allgemeingültigen Prinzipien in den Vordergrund zu stellen. Zudem ist der Text mit vielen, vorwiegend schematischen Abbildungen illustriert, die vorlesungserprobt sind und es Ihnen erleichtern sollen, sich zu orientieren.
Anleitung zum Lesen der Abbildungen:
In allen schematischen Abbildungen werden einheitliche Symbole verwendet, die für das bessere Verständnis hier kurz erläutertwerden (
Abbildung E.1
):
Abbildung E.1: Schwarze Pfeile mit offenen Spitzen zeigen immer den Umsatz einer Substanz in eine andere oder den Transport einer Substanz an. Grüne Pfeile mit geschlossener Spitze zeigen eine Stimulation an, rote Linien mit einem Querbalken eine Hemmung. Da Phosphat mit seinen Sauerstoffen viel zu groß ist, um es jedes Mal in Verbindungen vollständig zu zeigen, steht an seiner Stelle ein –P in einem hellblauen Kreis. Anorganisches Phosphat wird sowohl in Abbildungen als auch im Text mit »Pi« abgekürzt. Enzyme sind durch Schriftart und Farbe (dunkelblau) hervorgehoben. Stoffwechselwege sind in der Regel Kursiv und Fett beschriftet. Ein Gen mit seinem Promotor und den gebundenen Transkriptionsfaktoren (TF) sowie dem Genprodukt erkennen Sie am gezeigten Symbol … auch dort, wo nicht Gen druntersteht. und nicht immer gibt es einen Zellkern. Schließlich finden Sie in diesem Buch viele Zellen mit Organellen und zahlreichen Membranproteinen, wie Transportern und Rezeptoren. Die »Einbeulung« in der Zellmembran stellt in der Regel eine Exo- oder Endocytose dar.
Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt:
Stoffwechsel, Signaltransduktion
und
Spezielle Funktionen
. Man kann das Buch systematisch von vorne nach hinten lesen. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, da die einzelnen Kapitel so aufgebaut sind, dass sie weitgehend unabhängig von den anderen Kapiteln verständlich sind. Wo notwendig, gibt es Querverweise zu anderen Kapiteln. Man kann also auch einfach nur »schmökern«. Egal, wie Sie das Buch lesen, das Wichtigste ist, dass Sie viel Neugier mitbringen und ein wenig Spaß am Lesen des Buches haben!
Wichtige Begriffe und Enzymnamen sind
fett
gedruckt, damit man sie im Text leichter findet. Fettdruck ist aber keinesfalls automatisch eine Aufforderung, diesen Begriff auswendig zu lernen.
An wenigen Stellen werden auch einzelne Begriffe
kursiv
gesetzt, um sie im Kontext hervorzuheben und so zu verhindern, dass zum Beispiel ein essenzielles »
nicht
« überlesen wird.
Es gibt eine offizielle Konvention, die besagt, dass Proteine mit Großbuchstaben (ABCX) abgekürzt werden. Dieser Konvention wird im Prinzip gefolgt. Bei einigen alten Bekannten, deren Abkürzungen schon vor der Konvention entstanden sind, wird von der Konvention abgewichen.
Das Buch soll Lesende jeden Geschlechts ansprechen. Um den Text so verständlich wie möglich zu halten, verwende ich allerdings die männliche oder neutrale Form.
Symbole in diesem Buch
zeigt ihnen an, dass es sich hier um eine ganz besonders relevante Information handelt.
Das steht überall dort, wo die Erfahrung lehrt, dass oft fatale Fehler passieren oder Begriffe verwechselt werden.
erklärt, wie bestimmte Begriffe entstanden sind, oder gibt Erläuterungen, damit man sich Informationen besser merken kann.
Über den Tellerrand geschaut
Hier gibt es Hinweise zu praktischen, meist klinischen Bezügen der an der jeweiligen Stelle erklärten biochemischen Zusammenhänge.
Nicht nur für Streber
Diese Blöcke kann man überspringen, ohne den Faden zu verlieren. Sie enthalten aber wertvolle Zusatzinformation, die oft auch in Prüfungen relevant sind.
Wie es weitergeht
So, das ist genug der langen Vorrede. Auf geht's ins Abenteuer Biochemie. Kapitel 1 widmet sich der Thermodynamik, aber wie erwähnt, Sie können auch gerne gleich in einem anderen Kapitel anfangen, Kapitel 7, 11, 15 und 25 sind zum Einstieg in den jeweiligen Themenbereich besonders geeignet.
Nicht nur Dummies machen Fehler
sondern auch Dummies-Autoren. Ein Errata zu Fehlern in diesem Buch finden Sie unter https://www.wiley-vch.de/ISBN9783527720347.
Sollte Ihnen ein Fehler in dem Buch auffallen, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie ihn uns über unser Kontaktformular melden. Das Kontaktformular finden Sie hier: https://www.wiley-vch.de/de/dummies/kontakt.
Teil I
Alles im Fluss: Stoffwechsel
IN DIESEM TEIL …
Wieso im Stoffwechsel Energie benötigt wird und wie sie gewonnen wird.Wie der Stoffwechsel an wechselnde Bedingungen angepasst wird und welche Rolle Enzyme dabei spielen.Wie DNA transkribiert und die Genexpression kontrolliert wird.Wie Kohlenhydrate im Stoffwechsel verwertet werden.Wozu Aminosäuren außer für die Proteinsynthese benötigt werden.Welche Wege Lipide im Stoffwechsel einschlagen und was ihre vielfältigen Funktionen sind.Wo die Bausteine für die Nucleinsäuresynthese herkommen.Wie der Mineral- und Wasserhaushalt reguliert wird.Warum Vitamine und Spurenelemente trotz der geringen Menge im Körper eine so große Bedeutung haben.Kapitel 2
Energiegewinnung
IN DIESEM KAPITEL
Von Energie und LeistungsstoffwechselWie man ohne Sauerstoff ATP herstellt (anaerobe Glykolyse)Wie man Energie bei der Verbrennung von Energiesubstraten effizient konserviert (Citratzyklus)Wie man mit Sauerstoff viel mehr ATP gewinnen kann (oxidative Phosphorylierung)Wie kleine Fehler oxidativen Stress verursachen und wie man sich dagegen schütztLeben war definiert als ein Fließgleichgewicht oberhalb des thermodynamischen Gleichgewichts. Das bedeutet, dass der lebende Organismus energieverbrauchende Reaktionen durchführen muss, um seine Struktur zu erhalten. Diese Energie muss bereitgestellt werden. Autotrophe photosynthetisierende Organismen beziehen diese Energie aus dem Licht, heterotrophe Organismen, wie der Mensch, beziehen die Energie aus der Nahrung. Energiegewinnende und -verbrauchende Vorgänge müssen aneinander gekoppelt werden.
Energie liefern und Leistung erbringen
Man kann den Stoffwechsel in zwei Teilbereiche aufteilen, einen, der die »biologische Energie« zum Überleben liefert (Energiestoffwechsel), und einen, der Energie verbraucht, um lebensnotwendige »Arbeits-Prozesse« anzutreiben (Leistungsstoffwechsel) (Abbildung 2.1). Verbunden sind die beiden Bereiche durch Moleküle, die durch Übertragung von funktionellen Gruppen oder Elektronen und Protonen die Energie weitergeben. Diese Moleküle sind einerseits die Nucleosidtriphosphate (zum Beispiel ATP), deren Phosphorsäureanhydrid-Bindungen ein hohes Gruppenübertragungspotenzial haben, andererseits die reduzierten Coenzyme NAD(P)H + H+ und FADH2, die Protonen und Elektronen leicht zwischen Molekülen hin und her bewegen können. Diese Moleküle werden im Energiestoffwechsel generiert und dann im Leistungsstoffwechsel genutzt, um endergone Reaktionen anzutreiben, die eine solche Energiezufuhr benötigen. Im Leistungsstoffwechsel wird Energie nicht nur für Synthesearbeit oder mechanische Arbeit benötigt. Der überwiegende Teil der Energie wird für die Aufrechterhaltung von Konzentrationsgradienten über Kompartimentgrenzen wie zum Beispiel die Zellmembran benötigt. Dies bezeichnet man als osmotische Arbeit. Wie bei jeder Energieumwandlung geht bei allen diesen Prozessen im Energie- und Leistungsstoffwechsel ein Teil der Energie als Wärme verloren.
Abbildung 2.1: Verbindung des Energie- und Leistungsstoffwechsels. Beim Energiestoffwechsel wird »biologische Energie« in Form von ATP und reduzierten Coenzymen gebildet, im Leistungsstoffwechsel, an dem osmotische Arbeit den größten Anteil hat, wird diese Energie »verbraucht«.
Nicht nur für Streber
Folgende Strukturformeln muss man zwar nicht unbedingt auswendig hinmalen können, aber man sollte sie erkennen. Man muss auch verstehen, welche funktionellen Gruppen wichtig sind: Nucleosidtriphosphate, zum Beispiel Adenosintriphosphat(ATP) (Abbildung 2.2), die direkt oder indirekt die Energie für endergone Reaktionen im Stoffwechsel liefern. Coenzyme zur Übertragung von Elektronen und Protonen, zum Beispiel Nicotinamidadenindinucleotid(NAD+) (Abbildung 2.3) oder Flavinadenindinucleotid(FAD) (





























