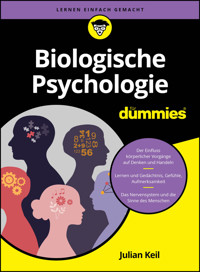
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Das Zusammenspiel des Nervensystems und wie daraus psychische Vorgänge entstehen
Wollen Sie wissen, wie Ihr Gehirn und Ihr Nervensystem aufgebaut sind, welche Aufgaben die einzelnen Anteile des Nervensystems haben und wie aus dem Zusammenspiel der einzelnen Zellen in Ihrem Nervensystem so etwas Wunderbares wie Denken, Fühlen oder Bewegungen entstehen? Julian Keil gibt Ihnen einen Überblick über die Grundlagen der modernen Neurowissenschaften, von einzelnen Zellen bis hin zum großen Zusammenspiel der neuronalen Netzwerke, um die biologischen Vorgänge zu erklären, aus denen psychische Prozesse entstehen.
Sie erfahren
- Wie Nervenzellen aufgebaut sind und welche Funktion sie erfüllen
- Wie Informationen im Nervensystem transportiert werden
- Wie Denken, Fühlen und Handeln entstehen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Biologische Psychologie für Dummies
Schummelseite
GEHIRN UND RÜCKENMARK: DAS ZENTRALE NERVENSYSTEM
Im Gehirn und im Rückenmark können die graue und die weiße Substanz unterschieden werden. In der grauen Substanz liegen die Nervenzellen, in der weißen Substanz liegen die Verbindungen.
Frontallappen: hinter der Stirn; wichtig für die Steuerung, Planung und Ausführung von HandlungenParietallappen: oben am Kopf; wichtig für die Verarbeitung der Informationen aus dem Körper und die Lage von Objekten im RaumOkzipitallappen: hinten am Kopf; wichtig für das SehenTemporallappen: seitlich am Kopf; wichtig für das Hören und das Erkennen von ObjektenInsula: zwischen Parietal- und Temporallappen versteckt; wichtig für Schmerz, Temperatur, Riechen und SchmeckenKleinhirn: hinten am Kopf, unterhalb des Okzipitallappens; wichtig für die Steuerung der BewegungenRückenmark: über den Hirnstamm mit dem Gehirn verbunden; wichtig für die Leitung zum peripheren Nervensystem und ReflexeHIRNNERVEN UND SPINALNERVEN: DAS PERIPHERE NERVENSYSTEM
Das periphere Nervensystem liegt außerhalb des Schädels und des Wirbelkanals. Es verbindet das zentrale Nervensystem mit dem Körper.
Somatisches Nervensystem: stellt die Verbindung zu den Muskeln und Sinnesorganen herVegetatives Nervensystem: stellt die Verbindung zu den inneren Organen her; der sympathische Anteil aktiviert und erregt den Körper, der parasympathische Anteil beruhigt den KörperIM VERBORGENEN: DIE SUBKORTIKALEN KERNE
Kerne sind Gruppen von Nervenzellen unterhalb der grauen Substanz des Gehirns, die eine gemeinsame Funktion erfüllen.
Thalamus: das Tor zum Bewusstsein. Bis auf den Geruch laufen hier die Informationen aus allen Sinnen durch. Er liegt links und rechts in der Mitte des Gehirns.Hypothalamus: reguliert die vegetativen Körpervorgänge und die Hormonausschüttung. Der Hypothalamus liegt unter dem Thalamus.Hippocampus: der »Bibliothekar« des Gedächtnisses. Hier werden Informationen für den Langzeitspeicher in der grauen Substanz gruppiert und kombiniert. Der Hippocampus liegt links und rechts im Temporallappen.Amygdala: eine Schaltstelle der Emotionen; hier werden Emotionen gruppiert, kombiniert und entsprechende Reaktionen vorbereitet. Sie liegt vor dem Hippocampus.Gyrus cinguli: Hier laufen sehr viele Informationen zusammen. Er ist am Lernen aus Fehlern, der Schmerzverarbeitung, der Emotionsregulation und der Entscheidungsfindung beteiligt.Basalganglien: Start- und Stoppsignal für Bewegungen. Dieses Netzwerk moduliert und begrenzt Bewegungen für präzise Handlungen und ist am Belohnungslernen beteiligt.ELEKTRISCHE POTENTIALE
Die unterschiedliche Verteilung elektrisch geladener Teilchen ist die Grundlage der Funktion des Nervensystems.
Ruhemembranpotential: Im Ruhezustand herrscht an den meisten Nervenzellen ein Potentialunterschied von –70 mV.Postsynaptisches Potential: Öffnen sich Kanäle für geladene Teilchen an den Nervenzellen, strömen geladene Teilchen in und aus der Zelle. Eine Verringerung des postsynaptischen Potentials reduziert die Aktivität, eine Erhöhung verstärkt die Aktivität der Zelle.Aktionspotential: Ist das Potential der Zelle ausreichend erhöht, dann wird ein Aktionspotential erzeugt. Dieses läuft das Axon der Zelle entlang und gibt dann die Aktivität an die nächste Zelle weiter.CHEMISCHE BOTENSTOFFE
Für die Weitergabe der Aktivität von einer Nervenzelle zu anderen Zellen gibt es chemische Botenstoffe.
Neurotransmitter: dienen der direkten Signalübertragung zwischen Nervenzellen. Glutamat führt zu einer Erhöhung des postsynaptischen Potentials, es erregt die nachfolgende Zelle. GABA führt zu einer Verringerung des postsynaptischen Potentials, es hemmt die nachfolgende Zelle.Neuromodulatoren: beeinflussen die Aktivität vieler Nervenzellen. Für jeden Neuromodulator gibt es zahlreiche unterschiedliche Rezeptoren, über die Nervenzellen gezielt erregt oder gehemmt werden können.Hormone: beeinflussen den Körper. Hormone werden im Hypothalamus, in den Hormondrüsen und im Körpergewebe gebildet. Sie können über das Blut über weite Strecken transportiert werden.
Biologische Psychologie für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverillustration: © MarLein- stock.adobe.comKorrektur: Johanna Rupp, Nußlochexternes Lektorat: Katharina Hemschemeier, Berlin
Print ISBN: 978-3-527-72150-4ePub ISBN: 978-3-527-84562-0
Über den Autor
Dr. Julian Keil promovierte in Psychologie an der Universität Konstanz. Anschließend arbeitete er als Wissenschaftler an der Université de Montréal und an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Nach diesen Stationen war er Professor für Biologische Psychologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, bevor er ein Start-up zur nichtinvasiven Hirnstimulation mitbegründete. Seine Forschung umfasst viele Themen der Biologischen Psychologie, von den Grundlagen der visuellen, auditorischen und multisensorischen Wahrnehmung, über die neuronalen Mechanismen des Gedächtnisses hin bis zu Methoden der Hirnstimulation. Seine Vorlesungen zur Biologischen Psychologie finden Sie auf seinem Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/@drjuliankeil
Über den Fachkorrektor
Dr. Guido Hesselmann ist Professor für Allgemeine und Biologische Psychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin (PHB), beschäftigt sich mit dem Sehen (und Nichtsehen) und begeistert sich für gute Lehrbücher.
Danksagung
Besonderer Dank gilt der Lektorin Katharina Hemschemeier, die trotz technischer Schwierigkeiten und meiner absoluten Unfähigkeit, Texte korrekt zu formatieren, das Projekt unterstützt hat.
Vielen Dank auch an Prof. Dr. Guido Hesselmann für die Fachkorrektur, Vanessa Schöner für den ersten Kontakt und die Akquise, und Esther Neuendorf für die Projektredaktion.
Widmung
Ich widme dieses Buch Katja für ihre nicht endende Unterstützung und Geduld der neuesten Spinnereien, und meinen Studentinnen und Studenten der Universität Kiel, ohne die ich die Vorlesung, die als Grundlage dieses Buches diente, nie gehalten hätte.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Über den Fachkorrektor
Danksagung
Widmung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über die Leserinnen und Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole in diesem Buch
Wie Sie dieses Buch lesen sollten
Teil I: Neurobiologische Grundlagen
Kapitel 1: Einführung in die Biologische Psychologie
Psychologie: Die Wissenschaft der inneren Welt
Von der Geistes- zur Naturwissenschaft: Eine kurze Geschichte der Biologischen Psychologie
Biologische Psychologie: Ein eigenes Fach innerhalb der Psychologie
Kapitel 2: Methoden der Biologischen Psychologie
Ein Experiment bedeutet Lernen aus Erfahrung
Von der Theorie zum Versuchsaufbau
Geistesblitze: Die elektrische Aktivität des Nervensystems festhalten
Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte
Nicht nur messen, sondern gezielt verändern
Kapitel 3: Die genetischen Grundlagen der Biologischen Psychologie
Der Weg von der Biologie zur Psychologie
Vom Genotyp zum Phänotyp
Der große Bauplan hinter allem: Die DNA
The Circle of Life: Mitose und Meiose
Neue Eigenschaften durch die Neukombination des Erbgutes
Gene allein sind nicht alles – die Epigenetik
Kapitel 4: Die Anatomie des Nervensystems
Was ist oben, was ist unten im Körper?
Hallo, Zentrale? Nervenbahnen zum und vom Gehirn
Gehirnanatomie – Lappen, Täler und Windungen
Die Anatomie des Rückenmarks
Alles im ZNS gut verpackt und versorgt!
Kapitel 5: Nervenzellen unter der Lupe
Alle gleich, und doch verschieden!
Die Anatomie der Nervenzellen
Das »Who's who« der Nervenzellen
Gliazellen: Sichern volle Unterstützung im Nervensystem
Kapitel 6: Kommunikationswege im Körper
Von der Ionenverteilung zur Signalübertragung
Kanäle und Rezeptoren
Neurotransmitter und Neuromodulatoren
Hormone – Signalübertragung im ganzen Körper
Kapitel 7: Netzwerke im Nervensystem und Körper
Wie sich Nerven unterscheiden lassen
Der Zusammenfluss von Informationen
Die komplexe Landschaft des Nervensystems
Gehirn und Körper beeinflussen sich gegenseitig
Teil II: Sensorische und motorische Systeme
Kapitel 8: Bewegung: Das motorische System
Muskelzellen sorgen für Bewegung
Rückmeldungen aus den Muskeln sind wichtig
Reflexe und das Rückenmark
Die Datenautobahnen für Bewegungsvorgänge
Alles nach Plan: Bewegungssteuerung im Gehirn
Basalganglien und Kleinhirn koordinieren Bewegungen
Bewegungsstörungen durch Verletzungen des Gehirns oder der Nervenbahnen
Kapitel 9: Tastsinn und Schmerz
Somatosensorik im Überblick
Die Rezeptoren des somatosensorischen Systems
Es tut weh: Das nozizeptive System
Schmerz lass nach: Die Schmerzhemmung
Kapitel 10: Das Sehen
Der Anfang des visuellen Systems: Das Auge
Aufbau und Funktion des Auges
Der Weg vom Auge zum Gehirn
Der visuelle Kortex im Okzipitallappen
Höhere visuelle Verarbeitung auf unterschiedlichen Wegen
Visuelle Informationen außerhalb des visuellen Systems
Einschränkungen und Störungen des visuellen Systems
Kapitel 11: Der Hörsinn
Das Ohr und seine Bestandteile
Der Weg vom Ohr zum Gehirn
Der auditorische Kortex im Temporallappen
Subkortikale Verarbeitung auditorischer Signale
Check 1,2,3: Störungen des Hörvorgangs
Die Gleichgewichtsorgane
Kapitel 12: Die chemischen Sinne
Stinkt das oder nicht? Der Geruchssinn
Der Geschmackssinn – mehr als nur eine Information erfassen
Der allgemeine chemische Sinn
Teil III: Biologische Grundlagen höherer kognitiver Funktionen
Kapitel 13: Aufmerksamkeit und Handlungsplanung
Aufmerksamkeitskonzepte kurz erklärt
Die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit
Die nach außen gerichtete Aufmerksamkeit
Störungen der Aufmerksamkeit
Kapitel 14: Lernen und Gedächtnis
Die unterschiedlichen Formen des Gedächtnisses
Neuronale Mechanismen des Gedächtnisses
Gedächtniseinschränkungen und Gedächtnisausfälle
Kapitel 15: Emotionen und ihr neuronaler Hintergrund
Was Emotionen ausmacht
Die Psychophysiologie der Emotionen
Neuronale Mechanismen der Emotionen
Störungen der Emotionsverarbeitung und -regulation
Teil IV: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 16: Zehn Themen der Biologischen Psychologie im Schnelldurchlauf
Unterschiedliche Zellen im Nervensystem mit unterschiedlichen Aufgaben
Nervenbahnen leiten Informationen
Informationen werden über elektrische und chemische Signale übertragen
Neurotransmitter übermitteln Informationen
Die 4+1 Lappen des Gehirns
Der Thalamus, das Tor zum Bewusstsein
Der Hippocampus, der Bibliothekar des Gedächtnisses
Die Amygdala, eine Schaltstelle der Emotionen
Basalganglien und Cerebellum justieren die Bewegungen
Woher wissen wir das alles? Die wichtigsten Messmethoden
Kapitel 17: Zehn hilfreiche Ziele im Internet
Das Gehirn unter der Lupe: Das Allen Institute
Die Funktionen des Gehirns
Mit Wissenschaftlern in Kontakt kommen
Fachgruppen für die Interessen der Biologischen Psychologie
Frei verfügbare Lehrbücher
Frei verfügbare Online-Kurse
Literaturrecherche
Aussagekräftige Abbildungen erstellen
Psychologische Experimente selbst entwerfen
Die eigene wissenschaftliche Karriere starten
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Übersicht über die glandotrop wirkenden Hormone des Hypothalamus
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Die unterschiedlichen afferenten Nerven im somatosensorischen Syst...
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Für die Weitergabe der Information aus den Photorezeptoren relevan...
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Die Bereiche des Neokortex
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Die Müller-Lyer-Täuschung
Abbildung 1.2: Zusammenhang zwischen einem Reiz (Stimulus) und einer Reaktion
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Zirkulärer Zusammenhang zwischen Theorie, Erfahrung, Induktion un...
Abbildung 2.2: Das EEG-Signal lässt sich in unterschiedliche Frequenzb...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Meiose und Mitose
Abbildung 3.2: Die gonosomal-rezessive Vererbung, am Beispiel von Gummibären erk...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Die anatomischen Achsen und Schnittebenen (© Raul Bernabeu,...
Abbildung 4.2: Schematische Einteilung des Nervensystems (© Julian Keil)
Abbildung 4.3: Die Einteilung des Gehirns in unterschiedliche Bereiche entla...
Abbildung 4.4: Der Hirnstamm (©gritsalak,...
Abbildung 4.5: Der Sagittalschnitt entlang der Mittellinie zeigt die Strukt...
Abbildung 4.6: Der Horizontalschnitt zeigt den Aufbau des Rückenmarks...
Abbildung 4.7: Die Schichten der Hirnhäute, dem Schutz- und Versorgun...
Abbildung 4.8: Die Blutversorgung des Gehirns
Kapitel 6
Abbildung 5.1: Form und Aufbau einer Nervenzelle (© reine,...
Abbildung 5.2: Schema einer chemischen Synapse. Oben: Axon mit dem Axonter...
Abbildung 5.3: Gliazellen im peripheren und zentralen Nervensystem dienen...
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Verteilung unterschiedlich geladener Atome und Proteine innerhalb...
Abbildung 6.2: Der zeitliche Ablauf eines Aktionspotentials (© JFontan,...
Abbildung 6.3: Unterschiedliche Arten von ionotropen Rezeptoren (© PATTAR...
Abbildung 6.4: Ablauf der Aktivierung eines metabotropen Rezeptors (© PH-HY...
Abbildung 6.5: Die Hormone der Adenohypophyse und ihre Wirkungsorte. LH: luteini...
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Schematische Übersicht über das Zusammenspiel von sensorischen Ne...
Abbildung 7.2: Darstellung des Homunculus des somatosensorischen und motoris...
Abbildung 7.3: Schematische Übersicht über die Verschaltung von zentralem Nerven...
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Aktin und Myosin im Inneren der Muskelzellen (© sakurra,...
Abbildung 8.2: Aufbau und Struktur einer Skelettmuskelzelle (© VectorMi...
Abbildung 8.3: Der Weg aus dem Gehirn zum Muskel (© VectorMine,...
Abbildung 8.4: Der Reflexbogen am Beispiel des Kniesehnenreflexes
Abbildung 8.5: Schematische Übersicht über die lateralen und ventromedialen Pfad...
Abbildung 8.6: Die Verschaltung der Feedbackschleifen zur Bewegungskoordination ...
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Die unterschiedlichen Rezeptoren in der Haut (© Macrovec....
Abbildung 9.2: Übersicht über die drei Leitungsbahnen im somatosensorischen Syst...
Abbildung 9.3: Die wichtigsten Stationen im somatosensorischen System
Abbildung 9.4: Neuronale Reaktion auf unterschiedlich starke elektrische Reize; ...
Abbildung 9.5: Das Zusammenspiel von C-Fasern, A-Beta-Fasern, hemmenden Interneu...
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Querschnitt durch das Auge (© yumiimage,...
Abbildung 10.2: Querschnitt durch die Retina (© inspiring...
Abbildung 10.3: Die unterschiedlichen rezeptiven Felder der ma...
Abbildung 10.4: Der Verlauf der Sehbahn vom Gesichtsfeld bis hin...
Abbildung 10.5: Zusammenfassung der Informationsverarbeitung im visuellen System...
Abbildung 10.6: Ein Selbsttest: Schauen Sie mit dem rechten Auge auf das Kreuz u...
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Querschnitt durch den Schädel mit dem Aufbau des Ohres...
Abbildung 11.2: Schematischer Aufbau einer Haarzelle (© Axel Kock,...
Abbildung 11.3: Die Stationen der Hörbahn (© pikovit,...
Abbildung 11.4: Die Verschaltungsstationen der Hörbahn von der Cochlea bis zum G...
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Die zentralen Bestandteile des olfaktorischen Systems
Abbildung 12.2: Die komplexe Verschaltung des olfaktorischen Systems
Abbildung 12.3: Lage und Form der unterschiedlichen Geschmackspapill...
Abbildung 12.4: Querschnitt durch eine Geschmacksknospe
Abbildung 12.5: Der Verlauf der Signalbahn im gustatorischen System
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Unterschiedliche Aspekte der Aufmerksamkeit und ihr Zusammenspie...
Abbildung 13.2: Die Stroop-Aufgabe: Lesen Sie beide Zeilen und benennen Sie die ...
Abbildung 13.3: Globale Objekte und lokale Eigenschaften
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Die Taxonomie des Gedächtnisses nach Larry Squire
Abbildung 14.2: Die neuronalen Mechanismen des nicht-assoziativen Lernens
Abbildung 14.3: Der Hippocampus mit den wichtigsten Nervenbahnen
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Das Zusammenspiel von emotionalen Reizen, Emotionssystem, physio...
Abbildung 15.2: Die neuronalen Kerngebiete und Verbindungen bei der Furchtkondit...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
Einleitung
Eine bei Psychologinnen und Psychologen ziemlich beliebte Frage ist: »Was denken Sie; was fühlen Sie gerade?« Darauf können Sie natürlich antworten, was Ihnen gerade dazu einfällt. Was sich Biopsychologinnen und Biopsychologen allerdings fragen, ist: Wie läuft das Denken und Fühlen denn eigentlich ab? Wie schafft ein biologisches System wie Ihr Körper eine bewusste Erfahrung? Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie so sind, wie Sie sind? Woher kommen eigentlich Ihre Gedanken? Wie reagieren Sie auf Ihre Umwelt, und was können Sie eigentlich sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen? Die Biologische Psychologie versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden, und genau darum geht es in diesem Buch. Je besser Sie den Zusammenhang zwischen den biologischen Grundlagen der Funktionen Ihres Körpers und dem Erleben dieser Funktionen kennen, desto besser können Sie psychische Vorgänge verstehen. Herzlich Willkommen zur Biologischen Psychologie, dem Wegweiser zum Zusammenhang zwischen Ihrem Körper und Ihrem Geist.
Das Verständnis der biologischen Grundlagen ist eine Voraussetzung der modernen Psychologie – kommen Sie also mit auf den Weg von der einzelnen Nervenzelle und ihren Bausteinen zum Zusammenspiel der unterschiedlichen Bereiche des Nervensystems und dem daraus entstehenden Bewusstsein. Ich hoffe, dieses Buch nimmt Sie an der Hand, damit Ihnen der Weg leichtfällt!
Über dieses Buch
Dieses Buch geht vom Kleinen zum Großen: Wir schauen uns als Erstes an, wie die einzelnen Bausteine des Nervensystems aussehen und wie sie funktionieren, und betrachten dann ihre Bedeutung bei der Steuerung des Körpers und der Wahrnehmung, um dann am Ende das Entstehen einzelner psychischer Funktionen zu untersuchen. Meistens geht es in einem Kapitel um eine bestimmte Funktion. Auch wenn die einzelnen Bausteine des Nervensystems kompliziert sind, werden Sie nach und nach die Grundprinzipien der Informationsverarbeitung verstehen. Eine Grundbotschaft dieses Buches lautet: Alles hängt zusammen. Viele Kapitel schließen mit Beispielen, wie sich Probleme der Funktion der biologischen Systeme auf das Denken, Erleben und Handeln auswirken. Dies bildet Querverbindungen zur Klinischen Psychologie, um das Verständnis des Entstehens psychischer Erkrankungen zu erleichtern. Am Ende des Buches finden Sie außerdem zehn kompakte Prinzipien, die die Biologische Psychologie beschreiben, und zehn mögliche Ausgangspunkte für Ihre eigenen Nachforschungen.
Konventionen in diesem Buch
Die meisten Lehrbücher der Biologischen Psychologie folgen einem ähnlichen Aufbau wie dieses Buch: Sie gehen von den kleinen Bausteinen hin zu den großen Funktionen. Das ist auch nur sinnvoll, da das Verständnis des Kleinen die Grundlage des Verständnisses des Großen ist.
In einigen Aspekten unterscheidet sich das Buch von seinen Kollegen im Bücherregal: Ich versuche in diesem Buch, das Wissen so leicht und so kompakt wie möglich zu vermitteln. Dieses Buch entstand aus meiner Vorlesung zur Biologischen Psychologie für Studienanfängerinnen und -anfänger. In dieser Vorlesung habe ich die Rückmeldung bekommen, dass es hilft, die zentralen Stichpunkte klar auf den Vorlesungsfolien aufzulisten. Für dieses Buch bedeutet das, dass wichtige Informationen nicht versteckt in längeren Texten stecken, in denen Sie mit dem Textmarker die wichtigen Schlüsselwörter hervorheben müssen, sondern dass die komplexe Information mit übersichtlichen Listen klar gegliedert ist.
Um einige Konventionen kommen wir aber nicht herum: Wenn wir uns mit dem Körper und seinen Funktionen beschäftigen, dann müssen wir die gängigen Bezeichnungen verwenden. Eine einheitliche Sprache erleichtert es Ihnen, Vergleiche zu anderen Büchern anzustellen oder selbst nach weiteren Informationen zu suchen. Da hilft es nicht, wenn ich das Axon als den Sender einer Zelle und die Dendriten als die Antennen bezeichne, wenn niemand sonst diese Bezeichnungen verwendet. Das wurde leider früher nicht immer so gehandhabt, weshalb viele Teile des Körpers unterschiedliche Namen haben. Zum Beispiel sind die Alpha-Nerven das gleiche wie die Ia-Nerven, einmal benannt von Erlanger und Gasser, und einmal benannt von Sherrington. Gleichzeitig gibt es viele Begriffe, die sehr ähnlich klingen, aber völlig unterschiedliche Dinge bezeichnen. Ich habe zum Beispiel etwa zehn Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das Striatum und der striäre Kortex nicht das Gleiche sind. Ich versuche, eine einheitliche Verwendung im Buch zu etablieren und auch die relevanten Bezeichnungen auf Lateinisch und Englisch zu nennen. Im Zweifel gibt es ein Stichwortverzeichnis mit den Fachbegriffen am Ende. Scheuen Sie sich nicht, dort nachzuschauen, denn dafür ist es ja da.
Eine weitere Konvention ist das Abgrenzung zwischen Geist und Körper. Sie haben vermutlich eine Vorstellung davon, wer Ihren Körper steuert: Sie selbst. Es ist aber manchmal nicht so einfach, im Kopf zu behalten, dass es keinen kleinen Steuermann gibt, der die Gedanken und Handlungen bestimmt, sondern dass all die komplexen psychischen Prozesse und geistigen Vorgänge aus dem Nervensystem selbst entstehen. Für das Entstehen komplexer psychischer Vorgänge gibt es unterschiedliche Theorien. Der Einfachheit halber konzentriere ich mich auf die Lokalisationstheorien, die psychische Vorgänge Orten oder Netzwerken im Gehirn zuordnen.
Um den Text kurz zu halten, verwende ich teils nur eine Geschlechtsbezeichnung, zum Beispiel Psychologinnen statt Psychologinnen und Psychologen. Ich hoffe, dass sich dadurch niemand ausgeschlossen fühlt, denn alle sind gemeint.
Was Sie nicht lesen müssen
Selbst wenn ich sehr stolz auf jedes einzelne Wort in diesem Buch bin und mich freue, wenn Sie jeden Absatz interessant finden, müssen Sie nicht unbedingt auch alles lesen. Je nachdem, welche Vorerfahrungen Sie mitbringen, können Sie die Einführungskapitel über den Aufbau der Zellen und des Körpers überspringen. Außerdem finden Sie in fast jedem Kapitel Kästen mit Anekdoten oder Beispielen, die zwar nett und unterhaltsam sind, für das Verständnis des Kapitels aber nicht unbedingt notwendig. Wenn Sie kein Interesse an Klinischer Psychologie haben oder schon zu dem Thema Bescheid wissen, dann können Sie die letzten Absätze einiger Kapitel überspringen.
Törichte Annahmen über die Leserinnen und Leser
Im Gegensatz zu einer Vorlesung hat ein Lehrbuch, zumindest für mich, einen entscheidenden Nachteil: Ich sehe Sie nicht und ich weiß nicht, warum Sie dieses Buch lesen möchten. Daher muss ich beim Schreiben dieses Buches einige Annahmen treffen. Ich vermute, dass Sie zu einer dieser Gruppen gehören:
Studentinnen und Studenten im Bachelorstudium Psychologie, die gerade die Vorlesung Biologische Psychologie besuchen und sich auf die anstehende Klausur vorbereiten.
Studentinnen und Studenten in einem verwandten Fach wie zum Beispiel Medizin, Soziologie, Pflegewissenschaften, Physik, Biologie oder Chemie, die im Rahmen der Wahl-Seminare in die Psychologie reinschnuppern.
Schülerinnen und Schüler, die sich auf das Abitur vorbereiten und bereits mit möglichen Studienfächern auseinandersetzen.
Fachkräfte aus den therapeutischen oder pflegenden Berufen, die für ein tieferes Verständnis oder ein Auffrischen des Wissens eine kompakte Übersicht über die Biologische Psychologie suchen.
Stolzr Besitzer eines Bewusstseins, der sich fragt, wo das eigentlich herkommt.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch hat einen einfachen Aufbau: vom Kleinen zum Großen. Bevor es an die komplexen und komplizierten Fähigkeiten des Nervensystems geht, werden erst mal die Grundlagen geschaffen: Wie ist eine Zelle aufgebaut, wie werden Informationen in einzelnen Zellen und in Netzwerken verarbeitet, und wie arbeiten sie zusammen? Darauf aufbauend geht es dann zu den Bewegungs- und Wahrnehmungssystemen.
Der Grundlagen-Teil ist in zwei Abschnitte eingeteilt: Zuerst geht es um die Biologische Psychologie als Fach, ihre Geschichte und die Methoden. Anschließend werden die biologischen Grundlagen des Nervensystems im Detail unter die Lupe genommen. Im Motorik- und Sensorik-Teil erfahren Sie mehr über die einzelnen Sinnessysteme und ihre Organe. Der Anwendungs-Teil enthält drei kognitive Prozesse (Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Emotionen) und ihre biologischen Korrelate. Der Schlussteil wartet mit hilfreichen Informationen auf und bietet Startpunkte, um mehr über das Zusammenspiel von Körper und Geist zu lernen.
Teil I: Neurobiologische Grundlagen
Bevor ich anfange, die komplexen Funktionen des Nervensystems und die Informationsverarbeitung zu erklären, müssen Sie die einzelnen Bausteine des Nervensystems kennen, da die allein schon sehr kompliziert sind. Und da das ganze Wissen über das Nervensystem nicht vom Himmel gefallen ist, gibt es im ersten Teil auch noch eine Übersicht über die Entstehung der Biologischen Psychologie.
Im ersten Kapitel geht es um das Selbstverständnis der Psychologie, insbesondere der Biologischen Psychologie. Um sich in der Welt der Biologischen Psychologie zurechtzufinden, müssen Sie sich an die Besonderheiten des Faches gewöhnen, seine Grundlagen kennenlernen und Verständnis der Fragestellung erlangen, die in der Biologischen Psychologie erforscht wird.
Kapitel zwei nimmt die Methoden der Biologischen Psychologie in den Blick, mit der diese Fragestellungen bearbeitet und beantwortet werden. Hier bekommen Sie auch einen Überblick über all die Geräte, mit denen die Aktivität des Nervensystems gemessen und beeinflusst werden kann.
Im dritten Kapitel wird die Biologie großgeschrieben. Hier geht es ins Detail: Ganz genau beschreibe ich, aus welchen Bausteinen eine Zelle besteht, nach welchen Prinzipien sie gebaut wird und wie sie funktioniert.
Nach den Details geht es in den Kapiteln vier bis sechs um den Aufbau der Zellen und ihrer Bestandteile, das Zusammenspiel der Zellen im Nervensystem und die Kommunikation der Zellen untereinander. In diesen Kapiteln lernen Sie die wichtigsten funktionellen Einheiten kennen, die in den weiteren Kapiteln eine Rolle spielen. Damit sind Sie gut vorbereitet für die Beschreibung der funktionellen Systeme in Teil II und die höheren kognitiven Funktionen in Teil III des Buches.
Teil II: Wahrnehmung und Bewegung im Detail
Die Kapitel im zweiten Teil des Buches sind entlang der unterschiedlichen Sinne gegliedert. Den Anfang macht die Beschreibung des motorischen Systems, mit dem Sie Ihren Körper steuern können. Danach geht es zum Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken. In diesen Kapiteln gibt es auch zahlreiche Querverbindungen zur Klinischen Psychologie, wenn es um die Fehlfunktionen der unterschiedlichen Systeme geht, und deren Rolle in psychischen oder neurologischen Erkrankungen.
Teil III: Die biologischen Grundlagen kognitiver Prozesse
Im dritten Teil steht das Zusammenspiel des gesamten Körpers und des gesamten Nervensystems im Vordergrund. Hier erkläre ich, wie und nach welchen Regeln daraus höhere kognitive Funktionen entstehen. Den Anfang macht die Aufmerksamkeit, gefolgt vom Gedächtnis und den Emotionen. Diese Funktionen haben gemein, dass sie nicht nur einen einzelnen Sinn oder einen einzelnen Prozess beinhalten, sondern dass sie erst aus dem Zusammenspiel vieler kleiner Prozesse entstehen. Wie auch im zweiten Teil gibt es zahlreiche Querverbindungen zu den Anwendungsfächern der Psychologie. Fast alle psychischen Erkrankungen gehen mit Veränderungen des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der Emotionsverarbeitung einher. Ein Verständnis für die biologischen Grundlagen dieser psychischen Erkrankungen ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Therapie der Leiden.
Teil IV: Der Top-Ten-Teil
Dieser letzte Teil des Buches umfasst zwei kurze Kapitel. Im ersten Kapitel dieses Teiles fasse ich kurz und bündig einige Fakten über das Nervensystem und seine Funktion zusammen. Wenn Sie nichts anderes lesen, dann bekommen Sie hier zumindest die wichtigsten Informationen aus der Biologischen Psychologie mit. Im zweiten Kapitel habe ich einige Webseiten und Software-Programme zusammengestellt, die für das Verständnis des Nervensystems hilfreich sein können und die Ihnen auf dem Weg durchs Studium oder bei eigenen Recherchen weiterhelfen.
Symbole in diesem Buch
Die kleinen Icons, die Sie an den Seitenrändern dieses Buches finden, sind Hinweiszeichen, die auf interessante Textinhalte hindeuten, an die Sie sich auch später noch erinnern sollten oder mit denen Sie auf der nächsten Party für Gesprächsstoff sorgen können.
Dieses Symbol zeigt Zusammenfassungen und besonders wichtige Informationen an. Hier werden Informationen aus dem vorhergehenden Text nochmals aufgegriffen und komprimiert.
Hier finden Sie hilfreiche weiterführende Informationen und Links zu Webseiten, die für das jeweilige Kapitel interessant sein könnten.
Dieses Symbol zeigt ihnen an, wo klare Definitionen stehen. Diese Definitionen sind wichtig, um ganz grundlegende Begriffe allgemeingültig zu klären.
Das Ausrufzeichen weist auf mögliche Missverständnisse und Fehlerquellen hin. Manchmal ganz praktisch, denn so müssen Sie die Fehler nicht selbst machen …
Dieses Symbol weist auf Fallbeispiele und Beispiele aus der Forschung hin. Hier versammeln sich berühmte Fälle, Experimente oder für das Thema relevante Forscherinnen und Forscher.
Wie Sie dieses Buch lesen sollten
Wie in den meisten Für-Dummies-Büchern können Sie mit einem beliebigen Teil beginnen und hier und da ein paar Passagen lesen, die Sie besonders interessieren. Ich empfehle jedoch, die Kapitel der Reihe nach zu lesen. Der Körper und das Nervensystem sind nach einem bestimmten Schema aufgebaut, das von einfach zu kompliziert führt: Einzelne Zellen formen Gewebe, die sich zu Organen, dann Organsystemen und ganzen Organismen verbinden. Auch das Wissen über die Biologische Psychologie baut auf vorangegangenen Informationen auf. Es ist schwer zu verstehen, wie das visuelle System funktioniert, wenn Sie sich nicht zuvor mit der Funktion einer Nervenzelle und der Organisation des Gehirns vertraut gemacht haben. Zu begreifen, wie Ihre Zellen neuronale Netzwerke bilden, um darin Erinnerungen zu speichern, ist ebenso nicht leicht, wenn Sie nicht wissen, wie Zellen Informationen codieren und miteinander kommunizieren. Natürlich können Sie aber den Lernprozess handhaben, wie Sie wollen, wenn Sie bereits Vorkenntnisse in Anatomie, Physiologie, Biologie oder Neurologie besitzen. Ein anderer Vorschlag ist, das Buch mehr als nur einmal zu lesen; eventuell lesen Sie es beim ersten Mal von vorne bis hinten durch und blättern dann von Zeit zu Zeit zurück, um gewisse Inhalte nach dem Zufallsverfahren zu wiederholen.
Ein Prinzip des Lernens ist: Viel hilft viel. Je öfter Sie über die Biologische Psychologie lesen, desto leichter verständlich wird Ihnen die Materie erscheinen. Machen Sie sich Notizen, recherchieren Sie offene Fragen selbst und versuchen Sie, die Inhalte in eigenen Worten zusammenzufassen. Nach einer Weile wird Ihnen dann das ganze Nervensystem immer weniger kompliziert erscheinen. Stattdessen wird es sich Ihnen als kunstvolle, elegant organisierte Gruppierung von miteinander interagierenden funktionellen Einheiten präsentieren.
Und bitte vergessen Sie bei all dem nicht, ausreichend zu schlafen, denn Schlaf ist wichtig für das Gedächtnis, und nur so können Sie sich an den Inhalt dieses Buchs auch später noch erinnern!
Teil I
Neurobiologische Grundlagen
IN DIESEM TEIL …
Lernen Sie, worum es in der Biologischen Psychologie geht und warum dieses noch relativ neue Forschungsgebiet so spannend ist.
Geht es erst einmal um die neurobiologischen Grundlagen, also darum, wie der Körper aufgebaut ist und wie er gesteuert wird.
Werden die wichtigsten Methoden vorgestellt, mit denen die Funktionsweise des Körpers in der Biologischen Psychologie untersuchen werden kann.
Kapitel 1
Einführung in die Biologische Psychologie
IN DIESEM KAPITEL
Von der Psychologie zur BiopsychologieVerwandte FachrichtungenWährend Sie diese Überschrift lesen, bewegen kleinste Muskeln Ihre Augen von links nach rechts über die Zeile. So kommt ein Reiz aus Ihrer Umwelt, etwa wenn Sie das Wort »Baum« in einem Text lesen, über Ihre Augen und damit verbundene Nerven zu Ihrem Gehirn. Dort wird dieses Wort zuerst in seine kleinsten Bestandteile (Striche, Kurven, Kreise und Linien) zerlegt und anschließend wieder zu einem Ganzen zusammengefügt. Diesem Ganzen wird dann eine bestimmte Bedeutung zugewiesen. Welche Bedeutung es ist, hängt vom Wort ab und davon, ob Sie diese Bedeutung irgendwann in Ihrem Leben einmal gelernt haben. Vielleicht entsteht ein Bild in Ihrem Kopf, das Sie mit dem Wort verbinden, oder Sie hören den Klang des Wortes. Und vielleicht erinnern Sie sich auch an ein Erlebnis mit einem Baum und die damit verbundenen Emotionen. Dieses faszinierende Zusammenspiel vieler gleichzeitig ablaufender Vorgänge und wie die Arbeit der kleinsten Bausteine unseres Körpers mit Denken, Fühlen und Erinnern zusammenhängt, ist die Fragestellung der Biologischen Psychologie.
Die Biologische Psychologie ist eines der Grundlagenfächer der Psychologie, das heißt, sie bildet die Grundlage für viele andere Fächer der Psychologie. Was Psychologie im Ganzen und die Biologische Psychologie im Speziellen eigentlich ist, erklärt dieses erste Kapitel. Außerdem fasst es zusammen, mit welchen anderen Disziplinen die Biologische Psychologie eng verbunden ist.
Psychologie: Die Wissenschaft der inneren Welt
Die Psychologie erforscht die subjektive Welt, also die innere Wahrnehmung und Verarbeitung der äußeren Welt. Das mag vielleicht erst mal ziemlich abstrakt klingen, aber Sie werden schnell verstehen, was damit gemeint ist.
Die Psychologie ist eine Wissenschaft, die untersucht, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen und mit ihr interagieren. Dazu gehört konkret:
welche
Reize
Sie wahrnehmen können,
welche
Reaktion
diese Reize bei Ihnen auslösen und
welche
Vorgänge des Organismus
beim Weg vom Reiz zur Reaktion eine Rolle spielen.
Auf diesem Weg von Reizen und Informationen der Umwelt zu einer Wahrnehmung sind einige Teile objektiv messbar, während andere sich nur indirekt bestimmen lassen.
Die
Eigenschaften
von Reizen aus der Umwelt lassen sich durch physikalische oder chemische Maße beschreiben. Sie können objektiv bestimmen, wie groß oder hell ein Reiz ist und aus welchen Materialien er besteht.
Die
Aufnahme der Informationen
des Reizes lässt sich ebenso durch physikalische, chemische oder biologische Prozesse beschreiben. Sie können objektiv bestimmen, welche Veränderungen ein bestimmter Reiz an einem Teil Ihres Körpers auslöst.
Das
Resultat der Aufnahme
der Informationen des Reizes, die Empfindung, ist nur Ihnen selbst zugänglich, sie ist subjektiv. Nur Sie können sagen, ob Sie einen Reiz wahrgenommen haben und einen anderen nicht. Die subjektive Welt ist damit eine nur für Sie verfügbare Repräsentation der Umwelt.
Eine zentrale Erkenntnis der Psychologie ist, dass die subjektive Repräsentation der Umwelt nicht bei allen Personen gleich ist, sich über die Zeit verändert und nicht immer den objektiven Eigenschaften der Reize entspricht. Abbildung 1.1 zeigt ein berühmtes Beispiel, die Müller-Lyer-Täuschung, die vom Psychiater Franz Müller-Lyer entdeckt wurde.
Abbildung 1.1: Die Müller-Lyer-Täuschung (© Julian Keil)
In der Abbildung sehen Sie zwei Linien:
Objektiv
sind beide Linien gleich lang (Sie können gerne nachmessen). Beiden Linien haben die gleichen physikalischen Eigenschaften, sie sind gleich lang, gleich dick, gleich schwarz.
Subjektiv
erscheint die obere Linie kürzer als die untere. Die Pfeilspitzen beeinflussen, wie Sie Informationen der Linie interpretieren.
Die Teilbereiche der Psychologie
Bei der Untersuchung der subjektiven Welt können Sie Vorgänge auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Diese unterschiedlichen Ebenen finden sich in den unterschiedlichen Teilbereichen der Psychologie wieder:
Schauen Sie sich das große Ganze an,
dann können Sie untersuchen, wie und nach welchen Regeln sich Gruppen innerhalb und zueinander verhalten und wie das einzelne Gruppenmitglied zur gesamten Gruppe steht. Dies sind Fragestellungen, mit denen sich die
Sozialpsychologie
und, insbesondere in einem Arbeitskontext, die
Arbeits- und Organisationspsychologie
oder die
Wirtschaftspsychologie
beschäftigen.
Nehmen Sie die einzelne Person in den Blick,
dann können Sie untersuchen, wie und nach welchen Regeln hier Denken und Handeln ablaufen. Sie schauen sich also an, wie denn Verhalten im Allgemeinen abläuft, und sind in der
Allgemeinen Psychologie
und der damit eng verwandten
Kognitionspsychologie
. Einige Themen der Allgemeinen Psychologie finden Sie im dritten Teil dieses Buches mit dem Blick auf die neuronalen Grundlagen im Fokus.
Wollen Sie entscheiden, ob und wie sich eine einzelne Person von einer größeren Gruppe unterscheidet,
dann beurteilen Sie das Verhalten im Vergleich zu einer genau bestimmten Stichprobe, die als die »Normstichprobe« bezeichnet wird (mehr dazu gibt es bei den Methoden in
Kapitel 2
). Diese Diagnose über das Abweichen des Verhaltens einer einzelnen Person vom »normalen« Verhalten einer Vergleichsgruppe ist die Aufgabe der
Differentiellen Psychologie
und der damit eng verwandten
Persönlichkeitspsychologie
. Verhalten, das vom »normalem« Verhalten abweicht, kann ein guter Startpunkt sein, um herauszufinden, wie dieses Verhalten mit biologischen Prozessen zusammenhängt, wie Sie im zweiten und dritten Teil dieses Buches lernen werden.
Geschieht dieser Vergleich zur Untersuchung und möglichen Therapie einer psychischen Erkrankung,
dann ist dies die Aufgabe der
Klinischen Psychologie
beziehungsweise der
Psychologischen Psychotherapie
. Hierbei steht neben dem Erkennen einer möglichen psychischen Erkrankung oder Belastung vor allem die Erstellung eines angemessenen Behandlungsplanes und einer Vorhersage des zukünftigen Verhaltens im Vordergrund. Auch hier kann der Vergleich zwischen normalem und abnormem Verhalten, Denken und Erleben zum einen wichtige Erkenntnisse über die biologischen Grundlagen liefern, aber auch Erklärungen für das Entstehen psychischer Erkrankungen bieten.
Stehen die biologischen Grundlagen von Verhalten, Denken und Handeln im Zentrum der Untersuchung,
dann sind Sie bei der
Biologischen Psychologie
angekommen. Hier schauen Sie sich an, wie Denken und Handeln einer Person mit körperlichen, also biologischen Vorgängen zusammenhängen. Diese Betrachtung der biologischen Grundlagen spielt in beinahe allen anderen Teildisziplinen der Psychologie eine Rolle. Teilweise überschneiden sich dabei die Fragestellungen, zum Beispiel bei der Frage nach den Regeln des Denkens und Handelns. Die Biologische Psychologie zieht aber immer biologische Prozesse als Grundlage der Erklärung heran.
Geistes- oder Naturwissenschaft, das ist hier die Frage
In den letzten Jahrzehnten kam es in der Biologischen Psychologie zu einer starken Konzentration auf Vorgänge in unserem Nervensystem, die von der Neurowissenschaft und insbesondere der Neuropsychologie untersucht werden. In diesem Zeitraum hat sich auch das Selbstverständnis der Psychologie gewandelt. Die Psychologie hat ihren Ursprung in der Philosophie und ist somit eine Geisteswissenschaft. Das heißt, der Ausgangspunkt der Psychologie ist das Ziel, die Regeln und Gesetzmäßigkeiten von Denken und Handeln zu verstehen.
Lange Zeit wurden in dieser geisteswissenschaftlichen Tradition des Beschreibens, Verstehens und Interpretierens von Verhalten die inneren Vorgänge im Nervensystem als »Blackbox« betrachtet, zu der es keinen objektiven Zugang gibt. Mit dem Aufkommen immer genauerer und spezialisierter Untersuchungsmethoden lässt sich Verhalten aber nicht nur beschreiben, sondern auch aufgrund der biologischen Vorgänge im Körpern erklären, oder sogar bestimmtes Verhalten aus den biologischen Vorgängen und Zuständen vorhersagen. Damit hat sich das Selbstverständnis der Psychologie zu einer Naturwissenschaft gewandelt. Das heißt, im Mittelpunkt der Psychologie steht nun das Experiment zur Erklärung der Gesetzmäßigkeiten der subjektiven Welt. Psychologinnen und Psychologen verwenden heute naturwissenschaftliche Methoden, um etwas über geistige Vorgänge herauszufinden. Je nachdem, welche Fragestellung dabei gerade interessiert, ist der Gegenstand dieser Experimente entweder eine einzelne Person oder eine Gruppe von Individuen.
Eine einzelne Person:
Wollen Sie herausfinden, welche Reize bei einer Person mit einer Angsterkrankung eine Panikattacke auslösen, um diese dann angemessen zu behandeln, so untersuchen Sie nur eine einzelne Person ganz genau.
Eine Gruppe von Individuen:
Wollen Sie hingegen allgemeingültige Aussagen über das Denken machen (zum Beispiel herausfinden wie viele Ziffern einer Telefonnummer sich Menschen merken können); untersuchen Sie möglichst repräsentative Stichproben mehrerer Personen.
Mehr zu diesen Methoden können Sie in Kapitel 2 nachlesen.
Der Weg zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis ist in den Geisteswissenschaften und in den Naturwissenschaften unterschiedlich. Hermeneutik ist die Theorie der Interpretation von Texten und des Verstehens. Sie ist die Grundlage des Erkenntnisgewinns in den Geisteswissenschaften. »Texte« sollten Sie hier aber nicht allzu wörtlich nehmen, da Texte neben Schriftzeichen auch alle anderen Arten von symbolischen Repräsentationen sein können – dazu gehören auch Sprache, Gesten und unser Denken und Handeln. Empirie ist die Gewinnung von Wissen durch Erfahrung. Sie ist die Grundlage des Erkenntnisgewinns in den Naturwissenschaften. Im Mittelpunkt steht hier das Experiment, und empirisch ist eine Erkenntnis dann, wenn sie auf überprüfbaren und wiederholbaren Beobachtungen beruht. Die Psychologie betrachtet die innere Verarbeitung der äußeren Welt und hat, je nach Fragestellung, einzelne Personen oder eine Gruppe im Blick. Erkenntnisse werden in der Wissenschaft nur durch die Interpretation von Verhalten und die Durchführung und Auswertung von Experimenten erlangt.
Von der Geistes- zur Naturwissenschaft: Eine kurze Geschichte der Biologischen Psychologie
Durch die Weiterentwicklung der Methoden zur Untersuchung des Zusammenhanges zwischen biologischen Vorgängen und psychischen Vorgängen ist der Biologischen Psychologie innerhalb der Psychologie in den letzten Jahrzehnten eine enorme Bedeutung zugekommen:
Sie erlaubt die objektive Messung der Grundlagen psychischer Vorgänge.
Sie bildet heutzutage die Grundlage für gängige Erklärungsmodelle in den unterschiedlichen Teildisziplinen der Psychologie.
Sie bildet eine Brücke zu anderen naturwissenschaftlichen Fächern wie der Physik, der Chemie, der Biologie oder der Medizin.
Die Biologische Psychologie untersucht die biologischen Grundlagen von psychischen Vorgängen, von Wahrnehmung, Denken und Handeln. Im Blick stehen hier innere Vorgänge, beobachtbares Verhalten und die vorausgehenden, begleitenden und nachfolgenden biologischen Vorgänge.
Historische Grundlagen: Von der Psychologie zur Biopsychologie
Während die Biologische Psychologie als eigenständiges Fach noch relativ jung ist, gibt es eine recht lange Geschichte der Untersuchung der biologischen Grundlagen unserer geistigen Vorgänge. Unterschiedliche Vorstellungen und Annahmen über die Funktion des Körpers und immer genauere Methoden zur Untersuchung dieser Funktionen haben sich dabei gegenseitig befeuert. Der technische Fortschritt der Untersuchungsmethoden beschleunigte diesen Prozess.
Hippokrates und Plato lehrten, dass das Gehirn der Sitz eines abstrakten, immateriellen Geistes ist, der unsere Handlungen kontrolliert.
Diese Idee eines
Dualismus
zwischen einem immateriellen Geist und einem materiellen Körper findet sich ebenfalls im neuen Testament der Bibel mit den Begriffen »soma« für den Körper und die physischen Eigenschaften einer Person und »nous« für das bewusst handelnde
Ich
. Auch im 17. Jahrhundert unterscheidet René Descartes noch zwischen einem physischen Körper und einem steuernden Geist. Allerdings beschreibt Descartes zum ersten Mal die Zusammenhänge zwischen bestimmten Reizen und Reaktionen.
Für die Reiz-Reaktions-Abfolge prägte Jean Astruc den Begriff »Reflex«.
Im Zuge eines sich beschleunigenden technischen Fortschrittes und der Beherrschung der Elektrizität stellte Luigi Galvani im 18. Jahrhundert Versuche an Froschschenkeln an und konnte so zeigen, dass die Aktivität von Muskeln mit elektrischer Aktivität zusammenhängt.
Immer genauere Studien über die Struktur und die Funktion der unterschiedlichen Anteile unseres Nervensystems ergaben sehr genaue Karten der funktionellen Spezialisierung des Gehirns.
Auch die Funktion einzelner Zellen im Nervensystem wurde dabei genauer unter die Lupe genommen. Wurde lange von einer Trennung zwischen einem physischen Körper und einem immateriellen Geist ausgegangen, überwog nun die Idee eines
Monismus
. Er reduziert geistige Vorgänge auf ihre physischen Bestandteile.
Die Psychophysik: Physikalische Reize und innere Repräsentation
Lange Zeit gab es keine Möglichkeit, die »Blackbox« der inneren Repräsentation der äußeren Welt zu öffnen. Die Psychologie war also darauf beschränkt, Beobachtungen über das Verhalten anzustellen und dann Theorien zu entwickeln, nach welchen Regeln bestimmte Reize und Reaktionen zusammenhängen.
Die
Psychophysik
untersucht die quantitativen Beziehungen zwischen den Eigenschaften der physikalischen Reize und ihrer inneren Repräsentation. Im Zentrum steht hier die Frage, welche physikalischen Eigenschaften ein Reiz haben muss, damit er wahrgenommen werden kann, und in welchem Zusammenhang Veränderungen des Reizes mit Veränderungen der Wahrnehmung stehen. Begründet wurde die Psychophysik von einer Reihe von Physiologen, insbesondere von Ernst Heinrich Weber und Gustav Theodor Fechner. Die experimentelle Untersuchung dieser Beziehungen durch Wilhelm Wundt und die Gründung des ersten Instituts für experimentelle Psychologie im Jahr 1879 in Leipzig stellen die Geburtsstunde der Psychologie als eigenständige Wissenschaft dar.
Der
Behaviorismus
stellt sich vehement gegen die Interpretation des eignen Verhaltens, die Introspektion. Er ist eine Weiterentwicklung der Psychophysik und versucht, menschliches oder tierisches Verhalten ohne Betrachtung der inneren Vorgänge zu erklären. Im Blick steht hier also ausschließlich das beobachtbare Verhalten (englisch »behavior«). Ein Vorreiter des Behaviorismus war der russische Mediziner Iwan Petrowitsch Pawlow. Am Anfang des 20. Jahrhunderts konnte er anhand einer zeitlichen Paarung von neutralen Hinweisreizen (zum Beispiel einer Glocke) und Futter zeigen, dass Hunde eine
Konditionierung
lernen können. Seine Hunde reagierten nach dem Lernen mit einer konditionierten Reaktion, dem Speichelfluss, auf einen vormals unbedeutenden, neutralen Reiz.
Weber, Fechner und die Psychophysik
Im 19. Jahrhundert war Leipzig der »Hotspot« für die Untersuchung der inneren Welt des Menschen. Den Anfang machte der sächsische Physiologe und Anatom Erst Heinrich Weber, der sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit der Mechanik des menschlichen Körpers und der Wahrnehmung beschäftigte. Er stellte sich die Frage, um wie viel ein bestimmter Reiz verstärkt werden müsste, damit Sie diese Verstärkung auch bemerken. Dabei stellte er fest, dass die Unterschiedsschwelle, also der Wert, ab dem Sie einen Unterschied zwischen zwei Reizen bemerken, proportional von der absoluten Reizstärke abhängt, und stellte das Weber-Gesetz auf. Dieses Gesetz besagt, dass der Unterschied zwischen zwei Reizen nur dann bemerkt wird, wenn er mindestens in einem, für jeden Sinn eigenen, bestimmten Verhältnis zu einem Vergleichsreiz steht. Im Tastsinn beträgt dieses Verhältnis zum Beispiel etwa zwei Prozent. Das heißt, dass Sie den Gewichtsunterschied zu einer Tafel Schokolade mit 100 Gramm schon dann bemerken, wenn die andere Tafel Schokolade mindestens 102 Gramm wiegt. Den Gewichtsunterschied bei einem Kilogramm Schokolade würden Sie dann erst ab einem Unterschied von 20 Gramm bemerken. Als Wahrnehmungsschwelle wird hier die Reizstärke bezeichnet, bei der ein Reiz überhaupt erst wahrgenommen wird.
Gustav Theodor Fechner erweiterte das Weber'sche Gesetz dann etwa 30 Jahre später im Weber-Fechner-Gesetz, aus dem sich ein logarithmischer Zusammenhang zwischen der objektiven Reizstärke und der wahrgenommenen Empfindungsstärke ergibt. Es besagt, dass bei einem exponentiellen Anstieg der Reizstärke nur ein linearer Anstieg der Empfindungsstärke zu erwarten ist. Das sind nicht nur theoretische Überlegungen, sondern diese Untersuchungen haben eine große Alltagsrelevanz. Wollen Sie zum Beispiel Schokolade naschen, ohne dass jemand etwas bemerkt, sollten Sie nur kleine Bissen nehmen, die weniger als zwei Prozent des Gewichtes der Schokolade ausmachen (oder sich gleich über die großen Vorräte hermachen).
Die kognitive Wende: Geburtsstunde der Biologischen Psychologie
Mit der kognitiven Wende in der Mitte des 20. Jahrhunderts rückte die Entschlüsselung der »Blackbox« in den Fokus und es wurden Theorien über die Struktur des Denkens und Handelns beziehungsweise der Verarbeitung von Informationen aufgestellt. Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche neue Methoden entwickelt, um die Aktivität und Struktur unseres Nervensystems zu untersuchen. Damit war es auf einmal möglich, einen Blick ins Innere unseres Denkens zu werfen und nicht nur die Umstände und Folgen von Verhalten, sondern auch den Organismus, also die damit verbundenen biologischen Vorgänge der Informationsverarbeitung genauer anzuschauen (Abbildung 1.2). Dies war die Geburtsstunde der Biologischen Psychologie als eigenständiges Fach innerhalb der Psychologie.
Abbildung 1.2: Zusammenhang zwischen einem Reiz (Stimulus) und einer Reaktion (© Julian Keil)
Nichtinvasive Methoden erlaubten nun die Untersuchung der Funktion des gesunden Nervensystems.
Während bis dahin die meisten Studien zum Zusammenhang zwischen der Struktur und der Funktion des Nervensystems anhand von Verletzungen des Nervensystems durchgeführt wurden, entwickelte der Neurologe Hans Berger in Jena in den 1920er-Jahren die
Elektroenzephalographie
(EEG). Mittels EEG ließ sich zum ersten Mal die Aktivität des Gehirns des Menschen ohne operative Eingriffe, also nichtinvasiv, untersuchen.
Durch die Entwicklung immer leistungsfähigerer Computer wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitere wichtige Methoden entwickelt, mit denen die Funktion des Nervensystems genau untersucht werden konnte.
Dazu gehören komplexe Methoden wie zum Beispiel
Computertomographie
(CT),
Positronen-Emissions-Tomographie
(PET) und
Magnet-Resonanz-Tomographie
(MRT). Außerdem wurden Methoden wie die
transkranielle Magnetstimulation
(TMS) oder
transkranielle elektrische Stimulation
entwickelt, mit denen es erstmals möglich war, die Funktion des Gehirns zu beeinflussen und psychische Vorgänge zu steuern. Diese funktionellen und bildgebenden Verfahren stellten zentrale Durchbrüche in der Entwicklung der Biologischen Psychologie als eigenständiges Fach dar. Auf einmal ließen sich die vorausgehenden, begleitenden und nachfolgenden biologischen Vorgänge unseres Denkens und Handelns untersuchen. Mehr zu diesen Methoden können Sie in
Kapitel 2
nachlesen.
Biologische Psychologie: Ein eigenes Fach innerhalb der Psychologie
Selbst wenn die Biologische Psychologie innerhalb der Psychologie noch als relativ junges Fach gilt, ist ihre Bedeutung für die Psychologie kaum zu unterschätzen. Insgesamt bildet die Biologische Psychologie die methodische Grundlage der modernen Psychologie. Erklärungsansätze, die auf biologische oder neuronale Prozesse zurückgreifen, sind heute aus keinem Teilgebiet der Psychologie mehr wegzudenken.
Dass die Biologische Psychologie innerhalb der Psychologie eine eigene Fachdisziplin ist, sehen Sie nicht nur an diesem Buch und am Aufbau des Psychologiestudiums (zu finden unter https://www.dgps.de/psychologie-studieren/infos-zum-studium/aufbau-des-psychologiestudiums/). Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gibt es Forschungsorganisationen, die die Biologische Psychologie vertreten. Diese Organisationen halten Tagungen, Konferenzen und Workshops ab, bieten eine Übersicht über Stellenangebote innerhalb und außerhalb der Wissenschaft und stehen neuen und etablierten Forscherinnen und Forschern mit Rat und Tat zur Seite.
In Deutschland wird die Biologische Psychologie als wissenschaftliches Fach durch die Fachgruppe Biologische Psychologie und Neuropsychologie innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) vertreten (
https://www.dgps.de/fachgruppen/fgbi
).
Auch die Deutsche Gesellschaft für Psychophysiologie und ihre Anwendung (DGPA) fördert die wissenschaftliche Erforschung des Zusammenwirkens von physiologischen, psychischen und sozialen Prozessen
(
https://www.dgpa.de
).
Auf europäischer Ebene schließen sich die unterschiedlichen nationalen Interessengruppen der Neurowissenschaften in der Federation of European Neuroscience Societies (FENS) zusammen (
https://www.fens.org/
).
Die weltweit größte Vertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der Erforschung des Nervensystems und der biologischen Grundlagen von Denken und Handeln beschäftigen, ist die Society for Neuroscience (SfN),
https://www.sfn.org/
).
Alles Neuro, oder was?
Insbesondere in den letzten Jahrzehnten ist die Untersuchung der biologischen Grundlagen psychischer Prozesse viel wichtiger geworden. Besonders gut lässt sich das daran ablesen, dass es zu beinahe jedem Teilgebiet der Psychologie ein Fach mit dem Zusatz »Neuro« gibt, sei es Neurokognitive Psychologie, Soziale Neurowissenschaft oder Klinische Neurowissenschaft.
Auch außerhalb der Psychologie hat die Biologische Psychologie großen Einfluss, zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften mit dem Neuromarketing, oder der Neuroökonomie. In all diesen Fächern bildet die Biologische Psychologie die Grundlage, um zu untersuchen, wie die jeweiligen Fragestellungen der spezifischen Fächer mittels biologischer oder neuronaler Prozesse erklärt werden können.
Soziale Neurowissenschaft
: Sie analysiert unter anderem, welche neuronalen Prozesse bei Gruppenprozessen aktiviert werden. Ein Beispiel dafür ist die Untersuchung, welche Bereiche Ihres Gehirns aktiv sind, wenn Sie aus einer Gruppe ausgeschlossen werden, und ob diese Aktivierung der Verarbeitung physischer Schmerzen ähnelt.
Human Factors
: Dieser Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Arbeitsumgebungen auf neuronale Prozesse oder den Anforderungen, die eine Umgebung erfüllen muss, um optimal auf unsere biologische Ausstattung zu passen. Ein großes Anwendungsgebiet dieser Fragen ist das User Interface oder User Experience Design (UI/UX).
Neurokognitive Psychologie
/Kognitive Neurowissenschaft
: Hier stehen die neuronalen Repräsentationen kognitiver Prozesse im Fokus. Wenn Sie sich im dritten Teil dieses Buches mit den biologischen Grundlagen von Denken und Handeln beschäftigen, befinden Sie sich also genau in der Schnittmenge zwischen Biologischer Psychologie und Allgemeiner Psychologie: Während die Allgemeine Psychologie versucht, allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten des Denkens und Handelns zu finden, versucht die Biologische Psychologie die Repräsentation dieser Gesetzmäßigkeiten oder Erklärungen für den Rahmen dieser Gesetzmäßigkeiten in unserem Nervensystem zu finden.
Differentielle Psychologie
und
Persönlichkeitspsychologie
: In dieser psychologischen Disziplin können Sie biologische Erklärungen dafür finden, warum eine Person ein ganz bestimmtes Verhalten zeigt oder welche Persönlichkeitsmerkmale sich durch ganz bestimmte neuronale Aktivitäten erklären lassen. Ein wichtiges Beispiel dafür sind Störungen der Kontrolle von Handlungsimpulsen, die sich durch Schäden des Frontallappens erklären lassen.
Klinische Neurowissenschaft
: Sie versucht einerseits, anhand der Biologischen Psychologie und ihren Methoden Erklärungen für das Entstehen psychischer Erkrankungen zu finden und untersucht andererseits, in welcher neuronalen Aktivität sich das veränderte Denken und Handeln von Menschen mit psychischen Erkrankungen widerspiegelt. Anhand dieser Erkenntnisse können dann gezielte Therapien entwickelt werden, die entweder mittels psychotherapeutischer Verfahren bestimmte Muster neuronaler Aktivität beeinflussen oder mittels medikamentöser Behandlung oder der Anwendung von Stimulationsverfahren direkt in die neuronalen Vorgänge eingreifen.
Manchmal treibt der Blick auf die biologischen oder neuronalen Grundlagen der Psychologie etwas absurde Blüten, wenn irgendeinem beliebigen Fach »Neuro« beigefügt wird, um einen Hauch von seriöser Naturwissenschaft zu vermitteln. Diesem Trend stellt sich die Skeptikerbewegung entgegen, die in Deutschland durch die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP, https://www.gwup.org/) vertreten wird.
Die Biologische Psychologie und verwandte Fächer
Die Biologische Psychologie als die wissenschaftliche Disziplin, die die biologischen Grundlagen unseres Denkens und Handelns untersucht, steht im Spannungsfeld zwischen den »echten« Naturwissenschaften wie Physik, Chemie oder Biologie und den Geistes- oder Gesellschaftswissenschaften. Grundlagenwissen in der Biologischen Psychologie gibt Ihnen damit ein solides Gerüst aus Halbwissen, um auch bei anderen Fächern mitreden zu können. Auf der einen Seite verwendet die Biologische Psychologie naturwissenschaftliche Methoden, auf der anderen Seite befasst sich die Biologische Psychologie aber auch mit der subjektiven Welt und versucht die innere Wahrnehmung der äußeren Welt zu ergründen. Sie untersucht also die geistigen Vorgänge oder die Veränderung dieser geistigen Vorgänge durch bestimmte situative oder gesellschaftliche Einflüsse, die nur sehr vage zu beschreiben sind. Eine Hauptaufgabe der Biologischen Psychologie besteht in der Abstraktion und Reduktion komplexer geistes- oder gesellschaftswissenschaftlicher Fragen auf naturwissenschaftliche Fragestellungen, die sich dann mit physikalischen, chemischen, oder biologischen Methoden untersuchen lassen. Einige spezielle Felder und interdisziplinäre Spezialisierungen spielen in der aktuellen Forschung eine besondere Rolle, und manchmal ist es gar nicht so leicht, die Unterschiede klar zu erkennen.
Chemie, Physik und Biologie:
Die Biologische Psychologie greift auf naturwissenschaftliche Methoden zurück, um zum Beispiel die Konzentration bestimmter chemischer Stoffe im Körper zu bestimmen, physikalische Größen wie elektrische Ströme oder magnetische Felder an Nervenzellen zu messen, oder biologische Abläufe der Funktionen einzelner Bausteine einer Nervenzelle zu untersuchen.
Statistik:
All dies tut sie im Rahmen von kontrollierten Experimenten, zu deren Durchführung und Auswertung es ganz bestimmte methodische Regeln und Verfahren der Statistik gibt, wie Sie im nächsten Kapitel sehen werden.
Anatomie:
Die Anatomie, also die Untersuchung von Gestalt, Lage und Struktur bestimmter Körperteile bildet gewissermaßen die Grundlage der Biologischen Psychologie. Bevor Sie versuchen, die biologischen Korrelate psychischer Vorgänge zu finden, müssen Sie wissen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist.
Die
Neuroanatomie
beschränkt ihre Betrachtung auf das Nervensystem.
Die
funktionelle Neuroanatomie
betrachtet neben der Struktur auch die Funktion bestimmter Anteile dieser Anatomie.
Physiologie:
Die gleichzeitige Betrachtung von Struktur und Funktion einzelner Zellen und von Bestandteilen einer Zelle ist das Feld der Physiologie. Ausgehend von der Bedeutung der Physiologie als Grundlage für das Verständnis der Funktionen und Aufgaben einzelner Körperteile für das Verständnis des menschlichen Denkens und Handelns ist es nicht überraschend, dass die Pioniere der Biologischen Psychologie häufig Physiologinnen und Physiologen waren.
Die
Physiologische Psychologie
untersucht, wie sich psychische Vorgänge durch physiologische Prozesse erklären lassen.
Die
Psychophysiologie
untersucht, wie sich psychische Vorgänge auf der Ebene der physiologischen und biochemischen Prozesse widerspiegeln.
Medizin:
In der Medizin hat in den letzten Jahrzehnten ein Sinneswandel Einzug gehalten mit der Erkenntnis, dass psychische Prozesse einen großen Einfluss auf physiologische Prozesse haben können. Während zahlreiche Standardtherapien für Krankheiten einem in erster Linie technischen oder pharmakologischen Ansatz folgen, der in vielen Fällen sehr angemessen und erfolgreich ist, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass subjektive, psychische Faktoren eine große Rolle auf die Wirksamkeit dieser Therapien spielen. Das bedeutet, dass heute zum Beispiel in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten psychologische Grundlagen eine große Rolle spielen und der psychologischen Begleitung von medizinischen Therapien zur Reduktion von Sorgen, Angst, Stress und Unsicherheit mehr Beachtung geschenkt wird.
Der
biopsychosoziale Ansatz
gibt den Rahmen für eine Integration psychischer, biologischer, sozialer und physiologischer Faktoren. Insbesondere bei chronischen (zum Beispiel Suchterkrankungen) oder neurodegenerativen Erkrankungen (zum Beispiel Demenz) spielt dabei auch die Begleitung und Integration des sozialen Umfeldes eine große Rolle.
Die
Psychoonkologie
spezialisiert sich auf die Untersuchung der psychischen Folgen und der angemessenen Begleitung einer Krebserkrankung.
Die
Psychoneuroimmunologie
und die
Neuroendokrinologie
spezialisieren sich auf die Wirkung psychischer Vorgänge auf die Funktion des Immunsystems und den Hormonhaushalt.
Pharmakologie: Insbesondere in der klinischen Psychologie spielt die Wirkung von bestimmten Substanzen, Drogen, oder Medikamenten eine wichtige Rolle. Die Untersuchung der Wirkung von Stoffen auf den Organismus ist das Feld der Pharmakologie, und die Biologische Psychologie nutzt dieses Wissen, um die Wirkung bestimmter Stoffe auf unser Denken und Handeln, die psychotrope Wirkung, zu bestimmen.
Die Psychologie als wissenschaftliche Disziplin hat mit der Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung ihren Ursprung in der Physiologie. Seit ihrer Begründung steht die Psychologie im Spannungsfeld zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Mit der Entwicklung spezieller physikalischer, chemischer und biologischer Methoden hat sich die Biologische Psychologie als die Wissenschaft der biologischen Grundlagen der subjektiven Welt herausgebildet. Im Rahmen einer verstärkten Kooperation und Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fächern und Disziplinen kommt es zur Bildung neuer spezialisierter Fächer. Die Biologische Psychologie stellt hier eine wichtige Brücke zwischen naturwissenschaftlichen Methoden und geisteswissenschaftlichen Fragestellungen dar.
Kapitel 2
Methoden der Biologischen Psychologie
IN DIESEM KAPITEL
Von der Theorie zum ExperimentDie technischen MethodenStolpersteine und FehlerquellenWenn Sie etwas über die innere Wahrnehmung der äußeren Welt erfahren möchten, dann müssen Sie Beobachtungen anstellen. Das gilt insbesondere in der Biologischen Psychologie und für die damit zusammenhängenden biologischen Vorgänge! Kurz gesagt: Sie müssen biologische Vorgänge im Zusammenhang mit Wahrnehmung, Denken und Handeln messen. Gut geplante und richtig angelegte Messungen können zu faszinierenden Ergebnissen führen. Dabei gilt es, alle wichtigen Informationen der Messung zu beachten und zu berichten, und den subjektiven Einfluss der messenden Person im Blick zu behalten.
In diesem Kapitel lesen Sie, wie in der Biologischen Psychologie empirische Experimente zur Messung des Zusammenhangs zwischen Biologie und Psychologie durchgeführt werden, und wie Sie dabei zu validen und reproduzierbaren Ergebnissen kommen.
Die Biologische Psychologie nutzt naturwissenschaftliche Methoden zur Untersuchung der subjektiven Welt. Die Grundlage dafür sind empirische Experimente, bei denen durch überprüfbare und wiederholbare Beobachtungen Erkenntnisse gewonnen werden.
Ein Experiment bedeutet Lernen aus Erfahrung
Der empirische, auf Erfahrung beruhende Forschungsprozess besteht im Großen und Ganzen aus zwei Schritten:
eine
Theorie
aufzustellen, und
diese Theorie durch
Experimente
zu überprüfen.





























