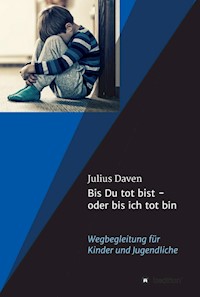
9,99 €
Mehr erfahren.
Dieses Buch informiert umfassend über den Auftrag von ehrenamtlichen Wegbegleiter:innen, die sich für junge Menschen einsetzen, die in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe groß werden und von einer Wegbegleitung profitieren. Die Geschichten aus 24 Interviews, die Julius Daven mit Betroffenen, Fürsorgeverantwortlichen und Wegbegleiter:innen geführt hat, sollen dabei helfen, die heutigen Herausforderungen von Kindern in stationären Einrichtungen oder Pflegefamilien sowie von Careleaver:innen (= Schutzverlasser:innen) besser zu verstehen und dafür zu sensibilisieren. Das Buch zeigt, dass es viele ehemalige Kinder und Jugendliche aus Einrichtungen der Jugendhilfe mit beeindruckendem Mut und großer Stärke geschafft haben, trotz teils schlimmster belastender und/oder traumatischer Erfahrungen in ihrer Kindheit, ihr (Berufs-)Leben proaktiv und positiv zu gestalten. Die Kinder, die Wegbegleiter:innen hatten, kamen besser klar, also entwickelten sich resilienzstärker als Kinder, die sich ohne Wegbegleitung durchs Leben kämpfen mussten. Julius Daven möchte mit seinen Darstellungen aufzeigen, welche besondere Bedeutung eine Wegbegleitung für die Sozialisation von jungen Menschen in stationären Einrichtungen hat. Außerdem möchte er den Leser:innen Mut machen, sich vielleicht künftig für die Übernahme einer Wegbegleitung zu entscheiden. Mit diesem Buch möchte Julius Daven - auch unabhängig von einer Wegbegleitung - insgesamt zu mehr Verständnis und Mitgefühl für benachteiligte Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen oder Pflegefamilien und für Careleaver:innen anregen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Julius Daven,
geb. 1971, kommt aus der Finanzbranche, lebt in Köln und engagiert sich heute als qualifizierter, ehrenamtlicher Wegbegleiter. Er fördert und unterstützt dabei auch Careleaver: innen(= Schutzverlasser: innen).
Julius hat sich intensiv mit der Situation von Kindern und Jugendlichen beschäftigt, die in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe groß geworden sind.
Sein Herz schlägt besonders für benachteiligte junge Menschen aus kritischen Umfeldern. So hat er sich bereits als junger Mann ehrenamtlich für Jugendliche eingesetzt. Er übernahm im Rahmen eines familienentlastenden Dienstes der Caritas über viele Jahre die Betreuung von körperlich und geistig behinderten jungen Menschen und teils auch deren Pflege.
Auch hat Julius jahrelange Erfahrung als ehrenamtlicher Telefonberater für Menschen in bestimmten Krisensituationen. Neben der Wegbegleitung ist Julius Daven als ausgebildeter, ehrenamtlicher gesetzlicher Vormund für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aktiv.
Seit kurzem macht Julius erste Erfahrungen als freier Autor mit dem Schwerpunkt auf gesellschafts- und sozialkritische Themen.
Kontakt: [email protected] (www.juliusdaven.de)
Julius Daven
Bis Du tot bist - oderbis ich tot bin
Wegbegleitung für Kinder und Jugendliche
© Herbst 2021 Julius Daven
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-41765-6
Hardcover:
978-3-347-41766-3
e-Book:
978-3-347-41767-0
Erstausgabe
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bildquelle auf dem Buchumschlag: iStock.com/Imgorthand, Stock-Fotografie-ID: 471031808 (Lizenz 2075121543)
„Liebe kann man lernen. Und niemand lernt besser als Kinder. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern, wenn sie selber lieblos werden.“
(Astrid Lindgren)
INHALTSVERZEICHNIS
1. Vorwort
2. Geleitwort zur Wegbegleitung
3. Meine Motivation für dieses Buch
4. Bis Du tot bist - oder bis ich tot bin
5. Ein Leben lang an Deiner Seite
6. Beziehungsfortschritt & Eifersucht
7. Ohnmacht und Hilflosigkeit durch körperliche Gewalt
8. Schutz im sicheren Umfeld einer stationären Einrichtung
9. Eine junge Vita geprägt von Beziehungsabbrüchen
10. Weichenstellung im Hilfeplangespräch mit Wegbegleiter: in
11. Jedes Kind braucht Nähe & Liebe
- 11.1 Elli (43 Jahre)
- 11.2 Maria (75 Jahre)
- 11.3 Tuana (53 Jahre)
- 11.4 Benno (60 Jahre)
- 11.5 Alexi (23 Jahre)
12. Belasteten Kindern eine Stimme geben
13. Careleaver: innen im und nach Übergang in ein eigenständiges Leben
- 13.1 Alva (28 Jahre)
- 13.2 Jonas (47 Jahre)
- 13.3 Fabian (46 Jahre)
- 13.4 Damian (21 Jahre)
- 13.5 Lenka (48 Jahre)
- 13.6 Charlotte (59 Jahre)
14. Anspruchsvolle Aufgaben von Bezugsbetreuer: innen
- 14.1 Barbara (35 Jahre)
- 14.2 Jessica (29 Jahre)
- 14.3 Miriam (35 Jahre)
15. Verantwortung von Einrichtungsleiter: innen im Hilfe-System der stationären Jugendhilfe
- 15.1 Josef (64 Jahre)
- 15.2 Elisabeth (60 Jahre)
- 15.3 Maria (46 Jahre)
16. Notwendige Kompetenzen der qualifizierten Wegbegleitung
- 16.1 Jakob (58 Jahre)
- 16.2 Marcus (55 Jahre)
- 16.3 Carina (47 Jahre)
- 16.4 Michaela (61 Jahre)
17. Paradebeispiel einer gelungenen Wegbegleitung
18. Befristete Wegbegleitung mit offenem Ausgang
19. Helle und dunkle Herz-Kammern und Herz-Schlüssel
20. Nachhaltige Wegbegleitung wirkt als Resilienz- Booster
21. Nachwort
22. Danke
23. Übersicht von Hilfsangeboten in Krisen-Situationen
24. Literaturverzeichnis und -empfehlung
25. Übersicht der Interview-Fragen
- 25.1 Fragenkatalog A
- 25.2 Fragenkatalog B
- 25.3 Fragenkatalog C
- 25.4 Fragenkatalog D
26. Ergänzende Informationen
- 26.1 SGB VIII
- 26.2 Begriff Betreuungsschlüssel
1. VORWORT
Dieses Buch richtet sich in erster Linie an betroffene (junge) Erwachsene, die in Wohngruppen oder Pflegefamilien als Maßnahme der stationären Jugendhilfe aufgewachsen sind und hier Unterstützung von Wegbegleiter: innen hatten oder sich Menschen gewünscht hätten, die sie ein Leben lang begleiten. Die unterschiedlichen Lebensverläufe meiner Interview-Partner: innen sollen diesen Menschen Mut machen, sich mit der eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Manchmal tut es einfach nur gut, wenn man feststellt, dass man mit seinem Kindheitsschicksal nicht alleine ist.
Das Buch richtet sich aber gleichermaßen an Anwärter: innen oder Mitarbeiter: innen aus sozialen und pädagogischen Berufen, um neue Erkenntnisse aus Kindheitserfahrungen mit Wegbegleiter: innen – unabhängig davon, ob die Kinder bei ihren Eltern aufgewachsen sind oder nicht – für die Entwicklung des Kindes bis weit in das Erwachsenenalter abzuleiten und für berufliche Zwecke zu nutzen.
Weiterhin ist es mir ein besonderes Anliegen, mit meinen Darstellungen gezielt Mitarbeiter: innen aus Einrichtungen der stationären Jugendhilfe zu erreichen und dafür zu werben, interessierten jungen Menschen in den Einrichtungen qualifizierte Wegbegleiter: innen an die Seite zu stellen.
Ich lade aber auch alle nicht-betroffenen Menschen ein, die Kinder mögen und sich für authentische Schicksale von Kindern und Jugendlichen sowie für die Herausforderungen von Careleaver: innen (= Schutzverlasser: innen) oder Care Refugees (= Schutz-Flüchtige) interessieren, dieses Buch zu lesen.
Auch diejenigen, die neugierig sind zu verstehen, welchen Auftrag Wegbegleiter: innen haben und welche Rolle sie bei belasteten und/oder traumatisierten Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden als sinnvolle Ergänzung im Hilfesystem spielen, mögen sich diesem Buch widmen.
Aus Gesprächen mit Careleaver: innen habe ich gelernt, dass hoher Wert auf eine gendergerechte Schreibweise gelegt wird, also auf eine Ausdrucksweise, welche die Gleichstellung unserer Geschlechter berücksichtigt. Daher habe ich mir Mühe gegeben, in diesem Buch besonders auf gendersensible, geschlechterinklusive, geschlechterneutrale und selbstverständlich auch auf nicht sexistische Formulierungen zu achten (vgl. genderleicht, 2021). Auch die Begriffe „Heimkinder oder Heimerziehung“ werden unter anderem durch den Bezug auf die Zustände in der NS- und Nachkriegszeit mit physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt negativ konnotiert (vgl. Aufarbeitung der Heimerziehungsgeschichte, 2021). Ebenso ist der Begriff „Heim“ als Unterbringungsort der Jugendhilfe, den man sich meist nicht aus freien Stücken aussucht, nicht durchweg positiv besetzt, im Unterschied zum Begriff „Heim“ als Ort der Bindung, der Halt und Orientierung gibt (vgl. Schleifer, 2014, 11). Daher verzichte ich in diesem Buch auf eine diskriminierende Wortwahl. Das heißt, ich verzichte auf Begriffe wie Heimkinder, Heimerziehung und Heimen und spreche in diesem Zusammenhang nur von Wohngruppen oder von stationären Einrichtungen.
Um Rückschlüsse auf die Identität meiner Protagonist: innen zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte zu vermeiden, habe ich sämtliche Namen geändert. Die Geschichten selbst basieren auf wahren Begebenheiten. Mit Ausnahme der persönlichen Erlebnisse mit meinem Wegbegleiterkind, die ich aus Rücksichtnahme auf den Jungen verändert habe.
Meine Gesprächspartner: innen haben selbst entschieden, in welcher Detailtiefe sie über ihr Leben Auskunft geben möchten und ihre Zustimmung zur Niederschrift und Veröffentlichung ihrer Erzählungen gegeben. Dieses Buch erlaubt somit einen vielseitigen Einblick in ganz unterschiedliche und authentische Biografien, Erlebnisse und in den divergenten Umgang mit dem kritischen Thema Trauma.
TRIGGERWARNUNG: Einzelne Erlebnisse, die in diesem Buch thematisiert werden, können bei traumatisierten Menschen, also Menschen mit seelischen Verletzungen, intensive Gefühle oder schlimme Erinnerungen zum Beispiel in Form von Flashbacks, also ein Wiedererleben von traumatischen Ereignissen, hervorrufen. Manche Lebensberichte können auch verstören. Achte daher bitte auf Dich, falls Du eine Angst- oder Panikreaktion bei Dir wahrnimmst. Dies kann sich durch unterschiedliche körperliche oder psychische Begleitsymptome, wie Herzrasen oder starkes Herzklopfen, Schwindel, Übelkeit oder Atemnot sowie durch weitere Symptome bemerkbar machen (vgl. Die Deutsche Trauma Stiftung klärt auf, 2021 sowie Trigger Warnung, 2019). Lege bitte dieses Buch in solchen Fällen sofort beiseite und hole Dir bitte unverzüglich Hilfe von Familienangehörigen oder Freund: innen und konsultiere auch notfalls ärztliche Hilfe, z.B. unter der Nummer des ärztlichen Notdienstes 116 117. Am Ende dieses Buches findest Du eine beispielhafte Auflistung von Hilfsangeboten.
2. GELEITWORT ZUR WEGBEGLEITUNG
Ein/e ehrenamtliche/r, ausgebildete/r Wegbegleiter: in ist ein erwachsener Mensch,
• der/die an deiner Seite steht und mit dir durch dick und dünn geht,
• der/die ein Vorbild für dich sein kann, an dem du dich orientieren kannst,
• der/die dich jederzeit unterstützt und auffängt,
• bei dem Du Dich geborgen fühlst,
• der/die keine Erwartungen an dich hat,
• der/die deinen Lebensweg so lange mit dir geht, wie du es dir wünscht,
• der/die bei dir ist und bleibt, egal was kommt, egal was passiert,
• dem/der du immer vertrauen kannst und
• der/die seine/ihre Versprechungen an dich immer einhält,
• der/die dich so akzeptiert wie du bist mit all deinen Stärken und all deinen Schwächen,
• der/die dir zuhört und mit dem/der du über alles reden kannst,
• auf den/die du dich ein Leben lang, bis einer von euch beiden tot ist, verlassen kannst.
„Schutz und Geborgenheit findest du nur bei jemanden, der mit deiner Seele umgeht, als wäre es seine eigene.“ (TagesRandBemerkung 2016)
Mit verlässlichen, liebevollen und einfühlsamen Wegbegleiter: innen machen Kinder - manchmal zum ersten Mal in ihrem Leben - langfristige positive und respektvolle Beziehungs- und Bindungserfahrungen, in denen körperliche und seelische Grausamkeiten keinen Platz mehr finden können und nachhaltiges Vertrauen in Menschen und in die Welt ermöglicht wird.
3. MEINE MOTIVATION FÜR DIESES BUCH
Nicht alle Kinder wachsen in einem behüteten Umfeld auf. Als pubertierender Junge stand ich kurz davor, mich als Folge von häuslicher Gewalt in einer stationären Einrichtung der Jugendhilfe unterbringen zu lassen. Allerdings war dies nicht mehr nötig, als eine Wegbegleiterin in mein Leben trat, die mich fortan unterstützte. Mit Ende 40 bin ich dann selbst Wegbegleiter geworden. In diesem Buch möchte ich meine Erfahrungen und die von anderen Menschen ungefiltert, ehrlich und authentisch schildern.
Vielleicht kann ich erwachsene Menschen motivieren, sich als ehrenamtliche Wegbegleiter: innen für ein belastetes oder traumatisiertes Kind zu engagieren. Meine Ausführungen sollen außerdem helfen, die heutigen Herausforderungen von Kindern in stationären Einrichtungen sowie von Careleaver: innen zu verstehen und dafür zu sensibilisieren. Der Begriff Careleaver beschreibt Personen, die in einer Form der staatlichen Fürsorge („care“) aufgewachsen sind und diese verlassen („leave“) haben oder diesen Schritt bald gehen, die sich also im Übergang ins Erwachsenenalter befinden.
Als Protagonist: innen für meine Interviews, die Einblicke in intensive Schicksale erlauben und manchmal nicht leicht zu ertragen sind, konnte ich echte Persönlichkeiten gewinnen, die ohne Scham und mit erhobenem Haupt über eine kritische Zeit aus ihrer Kindheit berichten. Sie ertrugen verschiedene Formen von menschlicher Entwürdigung, Demütigung und weiteren seelischen Schmerzen. Diese reichen von mangelndem Erleben fürsorglicher Liebe, Vernachlässigung, Verwahrlosung und Beschämung, über qualvolle Erniedrigung bis hin zu körperlicher und sexualisierter Gewalt (vgl. Baer, 2020, 16-27).
Meine Gesprächspartner: innen rezitieren ohne Ausnahme positive Erlebnisse mit Wegbegleiter: innen, die für eine Wendung ihres manchmal ausweglosen Lebensweges mit verantwortlich waren. Mit Ausnahme eines jungen Mannes, der sich heute ohne eine Wegbegleitung durchs Leben kämpfen muss. Er repräsentiert mit seinem Schicksal viele junge Menschen, die nach dem Auszug aus der Wohngruppe oder der Pflegefamilie einen strukturierten Tagesablauf noch lernen müssen und noch immer vor kleinen und großen Herausforderungen stehen. Aber auch andere Careleaver: innen hätten sich eine/n Wegbegleiter: in gewünscht, ohne hohe Ansprüche an ihn/ihr zu stellen. Einfach jemand, der/die nur da ist und zuhört und den weiteren Lebensweg mit ihnen teilt.
Mein Ziel ist, insgesamt ein unverfälschtes Bild über reale Schicksale von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu liefern, die sich noch immer hinter verschlossenen Türen abspielen und weitreichende Folgen für das spätere Leben haben, meist auch bis weit in das Erwachsenenalter hinein.
Insbesondere möchte ich die besondere Rolle der Wegbegleitung als Korrektiv für belastende und/oder traumatisierende Erfahrungen und deren Unterstützung bei der Bewältigung dieser herausstellen.
Erfahrungen zeigen, dass ehrenamtliche Wegbegleitungen nicht mit Auszug aus der Wohngruppe oder aus der Pflegefamilie enden, sondern weit bis in das Erwachsenenalter im Beziehungsgeflecht des belasteten oder traumatisierten jungen Menschen wertvoll bleiben.
Manche Wegbegleitungen scheitern aber auch in der Pubertät oder einfach daran, dass der/die Wegbegleiter: in den besonderen Erfordernissen des Kindes aus der stationären Einrichtung aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nicht mehr gerecht werden kann.
Mit diesem Buch möchte ich weiterhin pauschale Vorurteile ausräumen, dass Kinder, die Gewalt erlebt haben, selbst gewalttätig werden und Kinder aus stationären Einrichtungen oder Pflegefamilien grundsätzlich schlechter sozialisiert werden als Kinder, die nicht in Einrichtungen der Jugendhilfe groß werden. Ich erlebe bei meinem Patenjungen durch die fachkundige Erziehung in der Wohngruppe zum Beispiel ein deutlich ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, eine wachsende soziale Kompetenz und ein sich entwickelndes prosoziales Verhalten. Auch in Gesprächen mit jungen Careleaver: innen ist mir deren empathisches Gespür, verbunden mit guter Fähigkeit zur Perspektivübernahme, also eine Situation aus der Sicht des anderen zu sehen und zu bewerten, aufgefallen.
Wie überall im Leben gibt es aber auch eine Kehrseite. Nicht alle Kinder und Jugendlichen schaffen es, nach dem Verlassen der stationären Jugendhilfe ein konfliktfreies und unbeschwertes Leben zu führen.
Kann, muss oder sollte man seinen Peiniger: innen eigentlich verzeihen? Hierüber möchte ich über einen metaphorischen Einblick in Herzkammern und Herzschlüssel eine Antwort geben. Hier ist auch zu erfahren, wie verschiedenartig meine Gesprächspartner: innen mit dem Thema Verzeihen umgehen.
Die Erlebnisse mit Elias haben mich zu diesem Buch inspiriert, insbesondere der Satz, der den Titel des nächsten Kapitels trägt.
4. BIS DU TOT BIST - ODER BIS ICH TOT BIN
Nach einigen Treffen sagte ich zu Elias, dass ich jetzt immer für ihn da bin. „Bis Du tot bist?“, fragte Elias. „Ja, bis ich tot bin“, antwortete ich. „Oder bis ich tot bin“, entgegnete Elias. Mit diesen ganz einfachen Worten haben ein kleiner Junge und ein großer Erwachsener eine einzigartige Freundschaft besiegelt, die sich durch Vertrauen und Verlässlichkeit - idealerweise ein Leben lang – auszeichnen soll.
In Deutschland leben aktuell fast 150.000 Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe mit steigender Tendenz (vgl. AKJstat, 2021). Diese Kinder können vorübergehend oder auf Dauer aus vielfältigen Gründen nicht bei ihren Eltern beziehungsweise ihrer Herkunftsfamilie leben. 80% dieser Kinder müssen traumatische Erfahrungen bewältigen. Dies können Vernachlässigung, Misshandlung oder sogar Missbrauch sein. Folgen können auffälliges Bindungs-, Sozial- und Leistungsverhalten sein. 20% der Kinder kommen aus anderen Gründen in stationäre Einrichtungen, also wenn zum Beispiel die Eltern plötzlich versterben und es keine Verwandten mehr gibt, sie also nicht an anderer Stelle gesichert untergebracht werden können. Manchmal fühlen sich diese Kinder in den Einrichtungen so wohl, dass sie lieber dort als zuhause bei den Eltern weiter aufwachsen möchten. In vielen Fällen ist es aber trotz schlimmster (hoch)belastender und/oder traumatischer Erfahrungen paradoxerweise genau umgekehrt. Die Kinder möchten unbedingt wieder zurück zu ihren Eltern. Die Gründe hierfür und warum dies manchmal nicht sinnvoll ist, sind im weiteren Verlauf dieses Buches im Rahmen von Interview-Ergebnissen oder persönlichen Erläuterungen zu erfahren.
Bei den Systemsprenger: innen geht man aktuell von ca. 8.000 bis 13.000 Personen (Expertenschätzung) aus. Das sind Kinder- und Jugendliche, die wegen ihrer besonderen Verhaltensauffälligkeiten (z.B. schwere Bindungsstörung mit Enthemmung, gekennzeichnet durch mangelnde Impulskontrolle, hochgradige Aggressivität) über das normale Maß hinaus die Einrichtungen häufig wechseln müssen.
Noch ein grober Deep Dive in statistische Kennzahlen: 2019 wurden 55.500 Kindeswohlgefährdungen in Deutschland erfasst, und es gab 49.500 Inobhutnahmen. Das waren über 10% und konkret 5.100 mehr Fälle als im Jahr 2018.
Die Arten der Kindeswohlgefährdungen teilen sich auf
• in 45% Vernachlässigung,
• in 16% psychische Misshandlung,
• in 15% körperliche Misshandlung,
• in 4% sexualisierte Gewalt und
• in 20% mehrerer Gefährdungsarten gleichzeitig
(vgl. Statistisches Bundesamt, 2021 – Werte 2019).
Auch die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 weist einen besorgniserregenden Ausblick auf Gewalttaten gegen Kinder und Jugendliche aus: „Laut PKS sind im Jahr
• 152 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen,
• 115 von ihnen waren zum Zeitpunkt des Todes jünger als sechs Jahre,
• in 134 Fällen erfolgte ein Tötungsversuch.
Mit 4.918 Fällen von Misshandlungen Schutzbefohlener wurde eine Zunahme um 10 % im Vergleich zum Vorjahr registriert. Kindesmissbrauch ist um 6,8 % auf über 14.500 Fälle gestiegen“ (PKS, 2020). Im Bericht wird auch von einem hohen Dunkelfeld von Straftaten gesprochen, die nicht polizeilich erfasst wurden. Bedrohlich wirkt auf mich eine Schätzung, dass ein bis zwei Schüler: innen pro Schulklasse von sexualisierter Gewalt im familiären Umfeld betroffen sein sollen (vgl. Zahlen & Fakten zu sexueller Gewalt, 2021). Mit Blick auf die Statistik ist es wahrlich erschreckend, dass die Kindeswohlgefährdungen in Deutschland voraussichtlich weiterhin zunehmen werden.
Ich weiß nicht genau, welche gravierenden traumatischen Erlebnisse Elias in seinem kurzen Leben schon ertragen musste, aber ich kann es mittlerweile erahnen. Ich erlebe Elias als ein sehr ängstliches und misstrauisches Kind. Elias hat große Schwierigkeiten, sich auf Erwachsene einzulassen. Er ist schon so oft in seinem Leben enttäuscht worden. Im Alter von 3 Jahren, in dem andere Kleinkinder behütet und voll elterlicher Fürsorge aufwachsen, musste Elias bereits von seiner Herkunftsfamilie (= biologischer Ursprung, das heißt Mutter und/oder Vater) getrennt werden. Nach einigen Rückführungsversuchen zu seinen Eltern wohnt Elias mittlerweile seit 2 Jahren in seiner vierten stationären Einrichtung. Er wird hier voraussichtlich bleiben müssen, bis er erwachsen geworden ist. Elias ist vor kurzem 10 Jahre alt geworden.
Der Begriff „Rückführung“ ist sicherlich ein fürchterlicher Begriff, aber er beschreibt die Möglichkeit der Rückkehr eines Kindes zu seiner Herkunftsfamilie, sofern das Kindeswohl nicht oder nicht mehr gefährdet ist.
Ich frage mich, wie man aus Sicht eines (kleinen) Kindes zu erwachsenen Menschen, also zum Beispiel zu Bezugspersonen, Vertrauen aufbauen soll, wenn diese sich ohnehin nach kurzer Zeit wieder von den Kindern verabschieden. Mit den wechselnden Unterbringungen in den stationären Einrichtungen sind noch zusätzlich meist auch Orts- und Schulwechsel verbunden. Dann wechseln auch noch relativ häufig die Erzieher: innen in den Einrichtungen. Das ergibt eine Vielzahl an Wechseln und Veränderungen, mit denen Kinder klarkommen müssen. Kinder aber brauchen Stabilität, um sich fernab von den Eltern wohlfühlen zu können und die Welt in einem sicheren Hafen zu erkunden. Voraussetzung hierfür ist die Möglichkeit eines nachhaltigen Vertrauensaufbaus, der Zeit und Geduld, gerade bei belasteten und traumatisierten Kindern bedingt. Manchmal dauert es bei (kleinen) Kindern bis zu sechs Monaten, bis eine sichere Bindung – wie Psycholog: innen es nennen – zu einer neuen erwachsenen Person überhaupt entstehen kann (vgl. Zimmermann, 2021). Die Kinder brauchen Beziehungsstabilität. Und diese entsteht nicht von heute auf morgen. Sie muss behutsam und nachhaltig aufgebaut werden.
„Wenn andere am Wochenende abgeholt oder besucht werden, bleiben manche in der Wohngruppe zurück. Einige haben nie in ihrem Leben erfahren, was verlässliche Zuwendung bedeutet“, heißt es auf der Web-Plattform des Kölner Kreidekreises e.V. (vgl. Kein Kind allein, 2020). Elias ist eines dieser Kinder mit wenig sozialen Kontakten außerhalb der Wohngruppe. Der Kölner Kreidekreis sucht und qualifiziert für diese jungen Menschen Wegbegleiter: innen, die sie dann auf ihrem Lebensweg freiwillig und ehrenamtlich begleiten. Die einfach für sie da sind, sie fördern und sie nicht in Frage stellen. „Den Kindern tut es gut, dass sie so angenommen werden, wie sie sind“, heißt es weiterhin auf der Web-Plattform.
Ich habe mich also vom Kölner Kreidekreis e.V. zum Wegbegleiter ausbilden lassen und Elias kennengelernt. Ich erhielt vom Verein einen Anruf, dass es da einen 8-jährigen Jungen gibt, der mich gern kennenlernen möchte. Dann bekam ich per Post den Fragebogen des Jungen zugeschickt. Elias hatte bei seinem Lieblingstier geschrieben: „Ich mag Löwen, weil sie mutig und stark sind und weil ihnen niemand etwas antun kann.“ Dieser Satz hat mich sehr bewegt, weil er so viel aussagt, was in dem kleinen Mann so vorgeht. Möchte auch er mutig und stark sein und in seinem Leben keine Verletzungen mehr erleiden?
Das erste Treffen war ein unglaublich aufregender Moment, wie bei einem Vorstellungsgespräch und zugleich sehr emotional. Elias traute sich nicht aus seinem Zimmer. Die Erzieher: innen mussten ihm zunächst gut zureden, so dass wir uns dann langsam, als er herauskam, beschnuppern konnten.
Mittlerweile besuche ich Elias nun alle zwei Wochen und unternehme mit ihm coole Dinge. Irgendwann wird er auch einmal bei uns zuhause das Wochenende verbringen, wenn er dazu Lust hat. Unsere Beziehung wächst und gedeiht. Er freut sich genauso wie ich auf jedes Treffen und wartet meist schon an seinem Zimmerfenster zur verabredeten Zeit. Manchmal springt er mir zur Begrüßung voller Freude in die Arme. Manchmal ist er aber nicht so gut drauf, weil er sich zum Beispiel kurz vorher mit eine/m Erzieher: in oder anderen Kindern gestritten hat. An besonderen Tagen, wie zum Beispiel an seinem Geburtstag, geht es ihm nicht so gut. Sein Vater hat sich mal wieder nicht gemeldet. Darunter leidet er sehr. Und gerade dann braucht er etwas Zeit, sich auf mich einzustellen. Aber das gelingt von Mal zu Mal besser.
Als Wegbegleiter muss ich viel Geduld mitbringen und die Stärke haben, auch mal schwierige Situationen auszuhalten. Gerade hochbelastete und traumatisierte Kinder können urplötzlich ohne Vorwarnung ihre Nerven verlieren. Nichts wäre schlimmer, als wenn man dann sagt: „Das ist mir jetzt zu kompliziert. Ich lass das doch lieber.“
Über die Qualifizierungs-Seminare vom Kölner Kreidekreis bin ich zwar auf meine Aufgabe als Wegbegleiter und auf die unterschiedlichsten Verhaltensmuster von belasteten, traumatisierten und bindungsgestörten Kindern in der Theorie vorbereitet worden, in der Praxis muss ich mich aber immer wieder neu erproben. Manchmal komme ich an meine Grenzen und muss nach dem Besuch die Dinge reflektieren. Die regelmäßigen Supervisionen des Vereins helfen mir, mich hier weiterzuentwickeln und Elias Verhalten besser einzuordnen. Das erleichtert mir den künftigen Umgang mit ihm.
Grundsätzlich gefällt mir der Begriff „gestört“ nicht sonderlich, jedoch soll er zum Ausdruck bringen, dass über einen längeren Zeitraum erhebliche Belastungen durch traumatische Ereignisse eingewirkt haben. Diese Belastungen wirken sich massiv auf die Entwicklung des Kindes aus und führen häufig zu Verhaltensauffälligkeiten oder zu sonstigen Störungen. Gerade Kinder mit Bindungsproblematiken benötigen viel Zuwendung und Zeit, erlebte Traumata zu verarbeiten, um sich „ungestört“, das heißt in einem weitgehend störungsfreien Umfeld weiterzuentwickeln.
Elias zeigt mittlerweile deutliche Fortschritte in seinem Bindungs- und Beziehungsverhalten. Er kann jetzt zum Beispiel auch alleine ein Eis oder eine Pizza bestellen und den Menschen in die Augen schauen. Er konnte es vorher nicht. Das ist sicherlich nicht allein mein Verdienst. Dennoch merke ich, dass sich Elias in meiner Anwesenheit wohler und sicherer fühlt. Ich biete ihm viel Zeit und Raum, sich an meiner Seite in einem sicheren Umfeld außerhalb der stationären Einrichtung frei und individuell zu entfalten.
Ich habe Elias in unseren beiden gemeinsamen Jahren so liebgewonnen, als wäre er mein eigenes Kind. Dabei ist mir bewusst, dass ich niemals in Konkurrenz zu seiner Herkunftsfamilie, also seiner primären Identitätsbeziehung treten darf. Die Eltern bleiben immer die Eltern, ganz gleich, was geschehen ist. Dies weiß ich aus eigener Erfahrung. Elias ist nicht mein Sohn, aber ich kann ihm im Rahmen einer Art sekundären Versorgungsbeziehung viel Liebe und fürsorgliche Zuwendung geben, dass es sich für mich so anfühlt, als wäre er mein Sohn.
Ich werde manchmal gefragt, ob ich Elias nicht adoptieren wolle, damit er dauerhaft bei uns zuhause wohnen kann und wir mehr Zeit miteinander verbringen können. Aber genau dies soll und darf über eine Wegbegleitung nicht erreicht werden.
Man darf sich hier nichts vormachen. Elias wächst nicht einfach so in einer Intensiv-Wohngruppe der stationären Jugendhilfe mit einem fast 1:1 Betreuungsschlüssel auf. Er benötigt intensive qualifizierte Zuwendung, die nur erfahrene Erzieher: innen in einem dafür ausgerichteten Umfeld leisten können. Außerdem hat Elias einen Papa und eine Mama, über die er häufig redet und am liebsten sofort dorthin zurück möchte. Es gibt daher keinen Grund, ihn zu adoptieren. Auch wenn mein Partner und ich Elias bei uns zuhause dauerhaft aufnähmen, würden wir seinem professionellen Versorgungsbedarf nicht gerecht werden können. Daher ist die Wegbegleitung im zwei- wöchentlichen Abstand aus meiner Sicht eine tolle Sache, die beide Seiten bereichert. Elias hat eine Bezugsperson in Form einer Wegbegleitung außerhalb seiner Wohngruppe, auf die er sich jederzeit fest verlassen kann und ihn lange, idealerweise ein Leben lang, ergänzend zu seiner Herkunftsfamilie begleiten wird. Umgekehrt befriedige ich meine soziale Verantwortung in der Gesellschaft und kann meine väterlichen Fürsorge-Gefühle ausleben. Durch die Treffen im zwei-wöchentlichen Abstand darf ich mich jedes Mal mit voller neuer Energie auf Elias freuen und schöne Dinge mit ihm unternehmen. Irgendwann wird Elias auch die Wochenenden bei uns zuhause verbringen. Aber so weit sind wir noch nicht (Stand März 2021). Die Wegbegleitung benötigt viel Zeit und Geduld, um die Beziehung weiterhin behutsam wachsen zu lassen. Hier ist unnötige Eile eher kontraproduktiv.
5. EIN LEBEN LANG AN DEINER SEITE
Eine Wegbegleitung ist wie eine Art Patenschaft, also eine freiwillige und entgeltfreie Übernahme einer Fürsorgepflicht für ein Kind. Patenschaften selbst hat es immer schon gegeben. Angefangen vom religiösen Taufpatenamt, über Gemeinde- oder Städte-Patenschaften bis hin zu sonstigen Kinder-Patenschafts-Projekten, zum Beispiel über die SOS-Kinderdörfer. Bei einer Wegbegleitung geht es um die konkrete dauerhafte Unterstützung für einen jungen Menschen. Dabei gibt es zwei Arten von ehrenamtlichen Wegbegleitungen: Ich nenne sie normale Wegbegleitung und qualifizierte Wegbegleitung. Eine normale Wegbegleitung für Kinder kann durch jeden und jederzeit zum Beispiel durch gute Freund: innen oder durch die Großeltern erfolgen. Manche Menschen empfinden auch Religion als eine Form der normalen Wegbegleitung.
Die qualifizierte Wegbegleitung für Kinder erfordert eine gewisse Professionalität und wird über umfangreiche Schulungen über einige Vereine in Deutschland, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, sichergestellt, so zum Beispiel
• über den Kölner Kreidekreis e.V.: Wegbegleitung für Kinder aus stationären Einrichtungen,
• über die Patenkinder Berlin: Wegbegleitung für Kinder aus Pflegefamilien mit Schwerbehinderungsgrad,
• über das Patenprojekt der Diakonie Düsseldorf-Mettmann: Wegbegleitung für Kinder, die mit psychisch kranken Eltern aufwachsen oder
• über ein Projekt der Stadt Köln für ehrenamtliche Vormundschaften in Kombination mit Wegbegleitungen: Vormundschaft inklusive Wegbegleitung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen.
Die Entscheidung für eine qualifizierte Wegbegleitung sollte wohlüberlegt stattfinden, weil diese zunächst auf Lebenszeit bzw. weit über das achtzehnte Lebensjahr hinaus ausgerichtet ist. Das gibt dem Wegbegleiter-Tandem Sicherheit. Man probiert eine Wegbegleitung nicht einfach aus, weil man gerade Lust darauf hat. Das wäre egoistisch und unfair. Eine Wegbegleitung verläuft demnach auch nicht einfach so nebenher. Sie bindet Energie, Kraft und viel Zeit. Der Umgang mit belasteten, traumatisierten oder behinderten Kindern oder geflüchteten Jugendlichen ist nicht immer einfach, aber sehr lebensbereichernd. Wegbegleiter: innen sollten die wichtige Aufgabe von ganzem Herzen wollen und den vorgegebenen Rahmen vorbehaltlos akzeptieren können.
Das Konzept des Kölner Kreidekreises e.V. legt den Fokus auf die Begleitung von Kindern, die in Wohngruppen der stationären Jugendhilfe groß werden und kaum bis keinen Kontakt zur Herkunftsfamilie haben. Der Lebensmittelpunkt der Kinder ist und bleibt dauerhaft die stationäre Einrichtung. Auch langfristig darf und soll keine Pflege oder gar Adoption angestrebt werden. Der/die Wegbegleiter: in ist bewusst eine Person außerhalb der Strukturen der Jugendhilfe, die über alle Wechsel und Veränderungen für sein/ihr Wegbegleiterkind da ist und mit einer ganz anderen Sicht – weg von Akten und Befunden – mit dem Kind umgeht. Über regelmäßige Treffen sollen gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufgebaut werden. Der/die Wegbegleiter: in soll seinem/ihrem Patenkind Unterstützung dort bieten, wo es dies gerade braucht und sich wünscht. Dazu kann gehören, Interessen und Begabungen gemeinsam zu erschließen, Unterstützung beim Lernen zu leisten oder daran zu arbeiten, Defizite auszugleichen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil ist der gemeinsam gelebte Alltag in der Wohnung der Wegbegleiter: innen: So ist es für die Kinder und Jugendlichen oft mit am schönsten, wenn man einfach zusammen kocht, spielt oder gemeinsam einen Film anschaut oder einfach nur für sie da ist. Die Patenkinder sollten auch die Möglichkeit haben, bei ihren Wegbegleiter: innen zu übernachten (Vgl. Kein Kind allein, 2020). Wenn das Kind zum/r Wegbegleiter/in nach Hause kommt, lebt der/die Wegbegleiter: in dem Kind den Alltag außerhalb der stationären Jugendhilfe vor. Die Wegbegleiter: innen haben den Auftrag, den Kindern Mut zu machen, wie die Zeit und das Leben nach der Zeit in der stationären Unterbringung als Careleaver: in weitergeführt werden kann. Dabei lernt das Patenkind das private Umfeld des/der Wegbegleiter: in kennen und kann sich abschauen, wie Freundschaften, Familienleben, Beruf und Freizeit miteinander erfolgreich funktionieren.
Das Konzept der Patenkinder Berlin legt den Fokus auf Patenschaften mit Kindern, die einen Pflegegrad haben und in Pflegefamilien leben. Pflegefamilien sollen durch eine weitere Bezugsperson entlastet werden. So erhalten die Kinder, die einen hohen Bedarf an Zuwendung und Betreuung haben, auch Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten außerhalb der Pflegefamilie und erweitern so ihre sozialen Kontakte. Auch diese Patenschaft lebt von regelmäßigen Treffen, um dem Patenkind zum Beispiel etwas vorzulesen oder um tolle Ausflüge zu machen. Das Patenschafts-Tandem steigert die Lebensfreude der Kinder und ist zudem eine wirkungsvolle Möglichkeit der Entwicklungsförderung. Durch gemeinsame positive Erlebnisse und kreative Aktionen mit den Pat: innen erfahren die Kinder Wertschätzung, steigern ihr Selbstbewusstsein und haben jede Menge Spaß (vgl. Patenkinder Berlin, 2021).
Auch die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann bedient sich einer Wegbegleiter-Idee. Es werden verantwortungsvolle, vertrauenswürdige erwachsene Menschen gesucht, die den Kindern eine unbelastete Zeit im Alltag schenken. Auch diese Kinder, die schon früh eine viel zu hohe Verantwortung übernehmen müssen, weil ihre psychisch kranken Eltern sich nicht ausreichend um sie kümmern können, benötigen langfristige Vertrauenspersonen außerhalb der Familie. Das Konzept gleicht ein wenig dem des Kölner Kreidekreises mit dem Unterschied, dass die Kinder noch bei ihren Familien leben. Auch hier geht es darum, nicht die Eltern zu ersetzen, sondern diese zu ergänzen, damit die Kinder sich ebenso frei entfalten können wie Kinder von gesunden Eltern (vgl. Diakonie, 2021).
Eine weitere besondere Form einer ehrenamtlichen Wegbegleitung kann über eine spezielle ehrenamtliche Vormundschaft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge erfolgen. Diese wird mittlerweile in einigen Bundesländern in Deutschland angeboten. Bei der typischen beruflichen, also non-ehrenamtlichen Vormundschaft über Vormundschaftsvereine oder Ämter ist die Wegbegleitung eines minderjährigen Kindes meist ausgeschlossen. „Die ehrenamtliche Vormundschaft hat dabei hingegen als die für das Kindeswohl beste Form der Vormundschaft Vorrang vor allen anderen Formen – etwa der Vereinsvormundschaft oder der Amtsvormundschaft. Ehrenamtliche Vormünder können häufig eine individuellere und intensivere Betreuung der Kinder gewährleisten. So können sie den Heranwachsenden häufig Kontakt- und Begleitungsmöglichkeiten anbieten, die in anderen Formen der Vormundschaft aus zeitlichen Gründen schlicht nicht realisierbar sind. Darüber hinaus reißt in vielen Fällen auch mit dem Erreichen der Volljährigkeit des Kindes und der Beendigung der Vormundschaft das Band zwischen dem Vormund und seinem ehemaligen Mündel nicht ab. Vielfach stehen ehemalige ehrenamtliche Vormünder ihrem ehemaligen Mündel auch weiterhin als vertraute Ansprechpartner: in und Vertrauensperson noch zur Verfügung.“ (Engagiert in NRW 2021). Diese Art der ehrenamtlichen Vormundschaft wird zum Beispiel von der Stadt Köln in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln und auf Achse Treberhilfe e.V. für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angeboten (vgl. Vormundschaft Stadt Köln, 2021). Die ehrenamtlichen Vormünder, die idealerweise gleichzeitig Wegbegleiter: innen für ihre Jugendlichen sein können, werden auf ihre Tätigkeit über Schulungen vorbereitet und bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe dauerhaft unterstützt. Besondere Herausforderung ist hier die psychosoziale Situation der Jugendlichen, die geprägt ist von Belastungen im Heimatland, Belastungen auf der Flucht und erneute Belastungen im Aufnahmeland.
Für alle vier Konzepte ist trotz unterschiedlichem Schwerpunkt ein wesentlicher Erfolgs-Garant die Kontinuität in einer sicheren und vertrauensvollen Umgebung. Der/die Wegbegleiter: in oder Pat: in hat dabei die Rolle eines/r erwachsenen Freund: in, der/die das ihm/ihr anvertraute Kind ermutigt, selbstbewusst, aktiv und entschlossen die Welt zu erkunden und immer bei ihm/ihr zu bleiben und ihm/ihr die nötigen Freiheiten ermöglicht. All das bestenfalls „ein Leben lang“.
„Freunde sind Menschen,
die dir nicht den Weg zeigen,
sondern ihn einfach und lange Zeit
mit Dir gehen!“ (Visual Statements, 2021)
Dieses Buch konzentriert sich auf Wegbegleitungen für Kinder, die in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe groß werden. Der/die Wegbegleiter: in hat im Rahmen der Patenschaft als feste Größe außerhalb der stationären Unterbringung des Kindes keine Rechte aber eine Vielzahl von Pflichten. Er/sie bewegt sich also in einem fest geregelten Umfeld, das von den Mitarbeiter: innen des Jugendamtes, den Sorgeberechtigten (z.B. Vormund) und den (Bezugs-)Erzieher: innen vorgegeben wird. Dies gilt es vorbehaltlos zu akzeptieren.
6. BEZIEHUNGSFORTSCHRITT & EIFERSUCHT
Kinder, die vernachlässigt und wiederholt verletzt oder enttäuscht wurden, zeigen häufig widersprüchliche Verhaltensmuster. Jedes Kind sehnt sich nach Liebe, aber einige beleidigen manchmal lieber andere Menschen und setzen auf Angriff oder auf Rückzug. Eigentlich wollen sie nur einen Sicherheitsabstand zum Gegenüber. Sie gehen davon aus, früher oder später wieder enttäuscht oder verletzt zu werden. Damit das dann nicht so weh tut, sorgen manche sicherheitshalber vor. Andere wiederum zeigen mit ihren heftigen Aggressionen, dass sie Nähe suchen. Bevor sie sich auf eine neue Beziehung einlassen können, wollen sie ihre Bezugspersonen austesten. Das passiert mal bewusst, aber meistens eher unbewusst.
Das typische Angriffsverhalten eines traumatisierten Careleavers verkörpert auch Matt Damon als Will Hunting recht real und gut recherchiert im Filmdrama „Good Will Hunting (1997)“. Er spielt einen rebellischen, hochintelligenten jungen Mann, der ohne Eltern aufwuchs und in mehreren Pflegefamilien schwer körperlich misshandelt wurde und infolgedessen deutliche Bindungsstörungen aufweist. In einer Therapiesitzung spiegelt ihm der Therapeut Robin Williams als Sean Maguire - nach Provokation eines vernichtenden Urteils über ein Aquarell mit Bezug zu seiner verstorbenen Frau – seine Ängste durch mangelnde Bereitschaft, reale Gefühle für sein Umfeld zuzulassen. Diese könnten ihn nämlich massiv verletzen. Im weiteren Verlauf heißt es: „Es haben ihn die Leute im Stich gelassen, die ihn am meisten hätten lieben müssen. Er stößt den Menschen vor den Kopf, bevor es passiert, dass sie ihn vor den Kopf stoßen. Das ist ein Abwehrmechanismus. Er ist einsam seit 20 Jahren“.
Kinder testen manchmal aus, wie weit sie gehen können. Manche Kinder erleben auch eine Art Flashback-Erinnerung und reagieren darauf. Sie fühlen sich in kritischen Momenten wie in einer erlittenen traumatisierenden Situation. Einige ziehen sich dann spontan zurück, andere reagieren aggressiv oder depressiv. Damit zeigen sie unabsichtlich, wie Eltern oder das familiäre Umfeld mit ihnen damals umgegangen sind. Dieses mit vielerlei Angst geprägte Verhalten war für sie in stark belastenden Situationen überlebensnotwendig (vgl. Die Deutsche Trauma Stiftung klärt auf, 2021). Psycholog: innen sprechen hier von Re-Inszenierung und von Projektionsflächen, die benötigt werden, um das Trauma verarbeiten zu können.
„Die Fortgabe durch die Eltern wird als ein großes Nein empfunden, und diese Kinder und Jugendlichen sind in Gefahr, auch Nein zu sich selbst zu sagen. Sie haben Angst, erneut abgelehnt zu werden.“ (Wiemann, 2018, 56)
Attacken auf das Bindungssystem sind ein Liebesbeweis des Kindes (vgl. Wiemann, 2018, 72). Ein zunächst vermeintlich ablehnendes oder abweisendes Verhalten habe ich mit Elias schon mehrfach erlebt. Als ich ihn neulich am Wochenende mit dem Auto abholen wollte, hatte er sich kurz zuvor mit einem anderen Jungen aus der Wohngruppe gezofft. Er hatte keine Lust, im Regen loszufahren und lehnte meine Unternehmungsvorschläge ab. Er machte kehrt und ging beleidigt in die Wohngruppe zurück auf sein Zimmer. Ich wartete 10 Minuten und setzte dann mein Auto auf dem Parkplatz der Einrichtung um. Plötzlich klopfte es an meiner Fensterscheibe und ein kleiner Junge fragte aufgeregt: „Warum willst Du denn jetzt wegfahren?“. Ich erwiderte: „Elias, das möchte ich doch gar nicht, aber möchtest Du jetzt mitkommen und wir unternehmen etwas Schönes?“. Und schwuppdiwupp hüpfte Elias ins Auto, und wir konnten einen Bauernhof wie geplant besuchen. Er hat nur getestet, wie weit er gehen konnte und beobachtete von seinem Zimmerfenster aus, was passierte. Er wollte wissen, ob ich tatsächlich wegfahre. Das tat ich natürlich nicht. Scheinbar suchen verletzte Kinder ganz besonders intensiv durch bewusstes oder unbewusstes ablehnendes oder missbilligendes Verhalten nach persönlicher Wertschätzung. Man kann dies wie einen Beziehungstest verstehen: Elias wollte also wissen, wie ich reagiere. Bleibe ich bei ihm oder wende ich mich von ihm ab, wie es sein Vater getan hat. Wir fuhren dann los, so als wäre nichts gewesen. Das Ergebnis war also eine positive Beziehungserfahrung für Elias.
An einem anderen Besuchstag erlebte ich einen recht eifersüchtigen kleinen Jungen. Elias ließ mir schon vorab von einem Erzieher ausrichten, dass er nicht möchte, dass ich mich mit den anderen Jungs und Mädchen unterhalte. Er fängt langsam an, seinen Wegbegleiter für sich ganz alleine zu beanspruchen. Dies ist aber auch kein Wunder, weil er ja alle anderen Kontaktpersonen, seien es Erzieher: innen oder Lehrer: innen immer mit mehreren Kindern teilen muss. Mich als Wegbegleiter hat er jetzt ganz für sich alleine, und darauf erhebt der kleine Mann jetzt deutlich Anspruch. Die Beziehung zwischen Elias und mir wächst und gedeiht. Sie nimmt ordentlich Fahrt auf. So soll es sein. Elias fühlt sich wertvoll und sieht, dass ich jeden Besuchstermin einhalte und er sich langsam fest auf mich verlassen kann. So werden auch die „Beziehungstests“ im Laufe der Zeit immer weniger, so dass wir mittlerweile immer häufiger ein entspanntes Miteinander haben.
An einem Besuchstag fuhren wir mit dem Auto zu einem Park. Elias war gut drauf und verkündete, ich könne gar nicht Autofahren. „Ich kann viel besser Autofahren als Du“ entgegnete mir Elias. Das war dann der Beginn eines kurzen Schlagabtausches:
- „Wie, ich kann nicht Autofahren? Meinst Du, Du kannst besser Autofahren als ich?“ (Julius)
- „Klar, mindestens 1.000 Mal besser als Du!“. (Elias)
- „Na, das musst Du mir erstmal beweisen. Du kommst ja mit Deinen kurzen Beinen gar nicht an die Pedale!“ (Julius)
- „Das wirst Du schon sehen. Lass mich mal. Ich kann das auf jeden Fall viel besser als Du!“ (Elias)
Nach diesem kurzen Wortgefecht hielt ich am rechten Straßenrand an. Elias schaute mich verdutzt an:
- „So, Elias. Jetzt kannste mal beweisen, dass Du besser fahren kannst, als ich“. (Julius)
- „Wie jetzt? Ich soll Autofahren, das geht doch gar nicht!“ (Elias)
- „Eben hattest Du noch eine große Klappe. Jetzt musste beweisen, ob Du das Auto wirklich besser steuern kannst als ich.“ (Julius)
- „Ich darf doch gar nicht Autofahren. Ich zeig Dich bei der Polizei an“. (Elias)
-





























