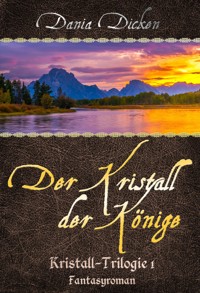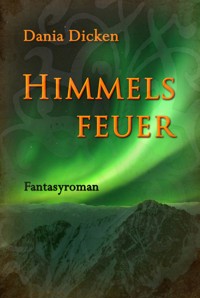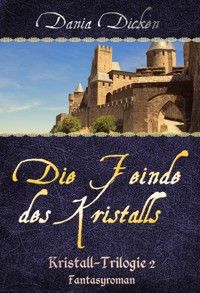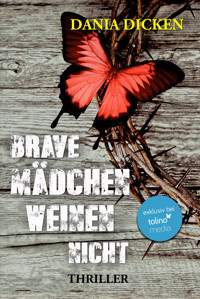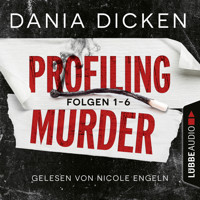4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein anonymer Brief erreicht FBI-Profilerin Julie Thornton: Der Verfasser spricht davon, einen Serienmörder zu kennen, den er aufhalten will und dafür sucht er Julies Hilfe. Mit Libbys Unterstützung versucht Julie, per Mail mit dem Unbekannten in Dialog zu treten und erhält auf diesem Weg tiefe Einblicke in ein verstörendes Seelenleben.
Zeitgleich wird Libby von einer jungen Frau namens Sophia kontaktiert, die nach einer brutalen Gewalterfahrung Unterstützung sucht, um ihr Trauma zu überwinden. Im persönlichen Gespräch vertraut sie Libby ein Tabu an, das unverhofft für eine blutige Eskalation sorgt. Und auch in Julies Fall gibt es eine überraschende Wende ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dania Dicken
Bis zum blutigen Ende
Libby Whitman 14
Thriller
Durch ein Unterlassen kann man genau so schuldig werden wie durch Handeln.
Konrad Adenauer
Prolog
„Hast du Hunger, Teddy?“
Der Teddy bewegte den Kopf, um mit seinem Nicken Zustimmung zu signalisieren. Für einen Moment blieb David reglos sitzen und überlegte. Er hatte auch Hunger. Vor allem aber hatte er Durst.
„Ich will was essen“, ließ David seinen Teddy mit Piepsstimme sprechen.
„Ja, Teddy, ich auch. Wir gucken, ob noch was da ist.“
Der Teddy nickte und David stand langsam auf. Er musste sich seinen Weg durch seine wild im Kinderzimmer verstreut liegenden Bauklötze suchen, die den einzigen Farbklecks in dem renovierungsbedürftigen Raum darstellten. In einer Mauerecke an der Decke unweit des Fensters gediehen schwarze Schimmelausblühungen, auf der anderen Seite des Raumes löste sich die Tapete von der Wand. In der Luft lag der scharfe Geruch von Urin, der von der am Boden liegenden Matratze des Vierjährigen stammte.
An einer Hand schleifte David seinen Teddy hinter sich her, während er barfuß in die Küche tappte. Er ließ den Teddy zu Boden fallen, um mit beiden Händen an der Kühlschranktür zu ziehen. Er musste seine ganze Kraft aufwenden, aber schließlich war sie offen und er legte den Kopf in den Nacken, um zu erkennen, was oben im Kühlschrank war.
Ein fauliger Geruch schlug ihm entgegen. In unerreichbarer Ferne ganz oben im Kühlschrank lag eine braune Banane, die Mortadella daneben schimmerte grünlich. Eine Flasche Ketchup stand in der Tür, auf dem Toastbrot hatte sich pelziger Schimmel in allen Schattierungen zwischen Grün und Weiß gebildet.
Enttäuscht schloss David den Kühlschrank wieder. Auf der Arbeitsplatte daneben stand noch der Milchkanister, den er am Vortag geleert hatte.
Sein Magen knurrte vernehmlich und seine Zunge fühlte sich ganz pelzig an. Er hatte schrecklichen Durst. Aber wie sollte er jetzt an den Wasserhahn kommen?
Suchend schaute er sich um und beschloss, einen der Stühle an die Spüle heranzuschieben. Motiviert bewegte der kleine Junge den Stuhl zur Küchenzeile und kletterte auf die Sitzfläche. Er versuchte angestrengt, den Drehknopf zu erreichen, mit dem er den Wasserhahn öffnen konnte, doch er war zu weit entfernt.
Frustriert gab er auf, stieg vom Stuhl und überlegte. Zaghaft hob er seinen Teddy auf und schlich hinüber zum Bad. Unsicher schaltete er das Licht ein und schluckte.
Sie lag immer noch unverändert da. Nun, da er vor seiner Mutter stand, stieg ihm der säuerliche Geruch von Erbrochenem wieder stärker in die Nase. Er schluckte hart, als er ihre blauen Lippen sah und die starren Augen, die ihn beinahe an die Augen einer Puppe erinnerten.
Mum war weg, das hatte er schon verstanden. In den letzten beiden Tagen hatte er lange bei ihr gesessen und gespürt, wie sie kälter wurde – und starr. Inzwischen war die Starre wieder gewichen, aber trotzdem bewegte sie sich nicht. Sie atmete auch nicht. Sie tat überhaupt nichts mehr.
Mit dem Oberkörper lag sie genau unter dem kleinen Waschbecken. David sah ein, dass er sich wohl auf sie stellen musste, wenn er an den Wasserhahn kommen wollte, aber dazu konnte er sich nicht überwinden. Mit Tränen in den Augen blickte er hinab zu seiner Mutter, deren Erbrochenes in ihrem Haar klebte. In ihrem Arm steckte eine Spritze, so wie er es vom Arzt kannte. Mum hatte ihm immer erklärt, dass sie krank war und Medizin brauchte, dabei hatte es für ihn so ausgesehen, als ginge es ihr durch die Medizin immer schlechter.
Nein, hier kam er auch nicht weiter. Er musste etwas tun.
David zog seinen Teddy hinter sich her, als er zur Wohnungstür ging und an der Klinke rüttelte. Er schaffte es nicht, die Tür zu öffnen. Da rührte sich überhaupt nichts.
Mit seinen kleinen Fäusten trommelte er gegen die Tür und begann, zu rufen.
„Hallo? Hallo?“
Teddy wurde hin- und hergeschleudert, während David an die Tür hämmerte und um Hilfe rief.
„Ist da jemand? Hallo?“
Er schlug immer wieder gegen die Tür. Konnte ihn denn niemand hören? War da niemand, der ihm helfen konnte?
„Bitte ... ich habe solchen Hunger ... bitte ...“
Verzweifelt begann David, gegen die Tür zu treten, doch dann kamen ihm die Tränen. Warum half ihm denn niemand?
Donnerstag, 19. Januar
Hayleys Schluchzen durchbrach die gespenstische Stille, die sie umgab. Es zerriss Libby das Herz, das ängstliche Wimmern ihrer kleinen Schwester zu hören, ohne etwas tun oder sie befreien zu können. Sie konnte sich ja nicht einmal selbst befreien.
„Da ist das Feuer, ich kann es sehen ... oh mein Gott ...“
Hayley hatte Todesangst – genau wie Libby. Sie kämpfte mit den Fesseln an ihren Handgelenken, kam aber nicht gegen sie an. Matts gehetzten Blick zu sehen, machte es nicht besser.
Sie konnten nichts tun. Gar nichts. Die Feuerwalze kam unaufhaltsam näher und brannte in Sekundenschnelle alles nieder, was sich ihr in den Weg stellte. So würde es der Jagdhütte, in der sie sich befanden, auch ergehen.
Hayley schrie. Ihre Verzweiflung fuhr Libby durch Mark und Bein – so stark, dass sie schließlich die Augen aufriss und feststellte, dass sie wohlbehalten neben Owen in ihrem Bett lag. Am Fußende hob Oreo den Kopf und blinzelte Libby schläfrig an. Libby erwiderte den Blick ihrer Katze und ließ sich wieder ins Kissen sinken. Ihr Herz raste noch immer, als sie nach ihrem Handy tastete und auf die Uhr blickte. In zehn Minuten hätte der Wecker sowieso geklingelt.
Libby konzentrierte sich darauf, sich zu beruhigen. Es war nicht das erste Mal, dass sie Alpträume von der ausweglosen Situation in der Jagdhütte im Wald hatte. Sie hatte tatsächlich Todesangst gehabt und wären die beiden Feuerwehrleute nicht rechtzeitig gekommen ...
Das Schlimmste an diesen Alpträumen war jedoch immer das verzweifelte Weinen ihrer kleinen Schwester. Libby hasste Hugh Bowman dafür, dass er ihnen das angetan hatte. Ein korrupter Sheriff.
Sie rechnete jeden Tag damit, die Vorladung zu ihrer Aussage im Prozess gegen Bowman in der Post zu finden. Sie würde mit Freuden gegen ihn aussagen.
Bis zum Weckerklingeln blieb sie liegen und hatte sich schließlich beruhigt. Als Owens Handy piepte, richtete Oreo sich auf, streckte sich und sprang vom Bett. Owen lächelte Libby zu und sah sie liebevoll an.
„Guten Morgen.“
„Guten Morgen“, erwiderte sie und lächelte.
„Irgendwie habe ich gar keine Lust heute.“
„Es ist doch schon fast Wochenende. In zwei Tagen hast du Geburtstag.“
„Stimmt.“ Owen grinste und streckte sich. „Ich bin schon verdammt gespannt auf heute Nachmittag.“
Libby wusste sofort, was er meinte. Er sprach von ihrem Termin bei dem Humangenetiker in Alexandria, den Libby vor Wochen vereinbart hatte. Seit Tagen dachte sie an nichts anderes.
„Ich auch, obwohl ich Angst habe“, gab sie zu.
„Erfahren werden wir heute ja vermutlich noch nichts.“
„Nein, aber trotzdem – ich hoffe einfach, dass er uns sagt, dass alles okay ist. Ich bin irgendwie nicht bereit für eine andere Nachricht.“
Mitfühlend sah Owen sie an und drückte ihre Hand. „Du weißt, an meiner Liebe zu dir wird das nichts ändern, egal was passiert.“
„Aber was, wenn er uns sagt, dass wir besser keine Kinder haben sollten? Oder dass es gar nicht geht, weil ... was weiß ich? Was machen wir dann?“
„Das überlegen wir uns dann. Jetzt mach dich nicht verrückt.“
Doch das war leichter gesagt als getan. Libby hätte nie für möglich gehalten, dass das so vereinnahmend sein würde. Erst hatte sie keinen Gedanken an die Familienplanung verschwendet, aber jetzt war der Gedanke immer da, lauerte ständig irgendwo im Hintergrund. Daran hatte bislang nichts etwas ändern können. Im Gegenteil, jeder sagte ihnen, dass eigentlich alles okay war und sie geduldig sein sollten. Das fiel ihr wahnsinnig schwer. Ihre Frauenärztin hatte sie gründlich untersucht und auch zur Sicherheit noch einmal abgeklärt, ob sie sich von Vincent irgendwas eingefangen hatte, das einer Schwangerschaft im Wege gestanden hätte, aber auch das war zum Glück nicht der Fall.
Doch das alles half nicht. Sie hatte jetzt schon wieder das Gefühl, das sie immer hatte, wenn ihr Zyklus sich dem Ende neigte und sie kurz vor Einsetzen der Blutung stand. Entsprechend schlecht war auch ihre Laune. Und ausgerechnet jetzt hatten sie den Termin ...
„Das wird schon“, versuchte Owen, sie aufzumuntern. „Das schaffen wir auch noch, meinst du nicht? Wir haben zusammen schon so viel gemeistert.“
„Das hört sich irgendwie traurig an“, murmelte Libby. „Ich will nicht dauernd irgendetwas meistern. Ich will einfach mal ein normales Leben führen.“
Owen nickte verstehend, sagte dann aber mit einem Augenzwinkern: „Dafür hast du dir möglicherweise den falschen Beruf ausgesucht.“
Libby schnaubte gereizt. „Mein Beruf hilft mir jetzt bei der Familienplanung auch nicht.“
„Das ist wahr. Trotzdem solltest du positiv denken. Das wird schon alles. Wurde es doch immer.“
Da hatte er irgendwie Recht. Sie liebte ihn für seinen unverwüstlichen Optimismus – und dafür, dass er immer hinter ihr stand.
Sie standen auf und frühstückten gemeinsam. Damit waren sie gerade fertig, als Julies Chevy vor dem Haus vorfuhr und Libby sich von Owen verabschiedete. Sie gab sich schweigsam, als sie in Julies Wagen stieg, was ihrer Freundin schon nach wenigen Minuten auffiel.
„Alles okay?“, erkundigte sie sich.
„Heute Nachmittag ist der Termin“, erwiderte Libby.
„Oh, stimmt. Versuch, dich nicht verrückt zu machen.“
„So was Ähnliches hat Owen vorhin auch gesagt.“
„Er hat auch Recht. Das wird schon alles.“
Libby nickte bloß. „Lass uns gleich erst mal das Profil für den Detective aus Fredericksburg fertigmachen.“
„Guter Plan. Das sollten wir ja heute eigentlich schaffen.“
Sie saßen am Täterprofil in einem brutalen Mordfall, in dem es den ermittelnden Detectives auch nach drei Wochen nicht gelungen war, einen Verdächtigen auszumachen. Den kannten Julie und Libby zwar auch noch nicht, aber sie konnten den Cops wenigstens einen Hinweis darauf geben, wonach sie suchen sollten.
Im Büro der Profiler duftete es bei ihrer Ankunft nach Kaffee. Die Kollegen waren schon fast alle da, Belinda kam aus Nicks Büro und grüßte sie freundlich. Libby und Julie setzten sich an ihre Schreibtische und Libby hatte gerade ihren Rechner eingeschaltet, als Nick aus seinem Büro zu ihnen kam und ihnen einen guten Morgen wünschte.
„Wie weit seid ihr mit dem Profil?“, fragte er.
„Fast fertig“, erwiderte Julie. „Das sollte heute noch rausgehen.“
„Ich bin neugierig – zeigt ihr es mir, bevor ihr es rausschickt?“
„Klar“, sagte Julie und Libby grinste. So war Nick. Es ging ihm dabei weniger um Kontrolle als vielmehr wirklich darum, seine Neugier zu stillen.
„Wie wäre es, wenn ihr beiden bald wieder an der Academy sprechen würdet?“, wechselte Nick das Thema. „Die neuen Rekruten sind jetzt da, die würden sicher gern hören, was ihr zu berichten habt.“
„Sicher“, sagte Libby.
„Jetzt kannst du außerdem erzählen, dass du dich für die Opferhilfe stark machst“, warf Belinda ein, die in der Nähe am Kopierer stand.
„Stimmt“, sagte Nick. „Ist die Kampagne jetzt gestartet?“
Libby nickte. „Ja, seit Anfang letzter Woche haben sie das Material fertig. Ich finde die Vorstellung ja ein bisschen unheimlich, dass man mein Gesicht in West Virginia auf Plakatwänden sieht, aber ich bin absolut für die Sache.“
„Das ist auch toll“, sagte Nick. Libby lächelte und war froh, als die Kollegen sich einem anderen Thema zuwandten. Sie stand nicht gern im Mittelpunkt – nicht die beste Voraussetzung für das, worum es hier ging, aber sie war davon überzeugt.
Anfang Dezember war sie nach Charleston geflogen und hatte ausführlich mit Nicole vom West Virginia Sexual Assault Crisis Center gesprochen. Sie hatte von ihren eigenen Erfahrungen erzählt und ein Fotograf hatte tolle Aufnahmen von ihr gemacht. Die wurden nun für die Kampagne verwendet, die die Opferhilfeorganisation bekannter machen sollte.
Auf der Homepage der Organisation konnte man nun Libbys Geschichte nachlesen – dass sie den Mann angezeigt hatte, der sie an der Uni vergewaltigt hatte, und dass es ihr gelungen war, eine Verurteilung zu erwirken. Man konnte aber auch etwas über ihre Entführung durch Vincent Bailey erfahren, von der sie selbst berichtete – und sie betonte, wie wichtig es war, solche Erfahrungen nicht mit sich allein auszumachen. Es gab nun Plakate und Flyer mit ihrem Gesicht und einer klaren Botschaft: Opfer sexueller Gewalt trifft keine Schuld, jedes hat Hilfe verdient. Die Organisation setzte sich dafür ein, die Opfer dabei zu unterstützen, Gerechtigkeit zu erwirken. Sie begleiteten Betroffene zur Polizei und vor Gericht, vermittelten Kontakte zu Ärzten, Anwälten und Therapeuten – und Selbsthilfegruppen. Libby fand diese Arbeit sehr wertvoll.
Nachdem Nick gegangen war, beschäftigten Libby und Julie sich mit der Finalisierung ihres Profils. Sie waren fast fertig, als Alex kurz vor der Mittagspause an ihrem Schreibtisch vorbeikam und Julie einen Brief überreichte.
„Post? Für mich?“, fragte Julie verdutzt.
Alex nickte bloß und ging weiter. Libby schenkte der Sache erst gar keine Aufmerksamkeit, bis Julie murmelte: „Der Brief trägt gar keinen Absender.“
„Mach ihn mal auf“, schlug Libby vor.
Sie hörte, wie Julie Papier zerschnitt, dann raschelte etwas. Es dauerte nicht lang, bis Julie murmelte: „Kommst du mal? Das musst du dir ansehen.“
„Was ist denn?“ Libby stand auf und ging um den Schreibtisch herum zu ihrer Freundin.
„Lies das mal und sag mir, was du davon hältst“, bat Julie. Libby nickte und stellte sich hinter Julie, um über ihre Schulter hinweg den Brief lesen zu können.
Das Töten muss endlich aufhören, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Für Argumente ist er nicht zugänglich. Er sagt, er kann nicht anders, aber ich ertrage es einfach nicht mehr. Diese Brutalität, diese Grausamkeit ... Ich weiß ja, warum er das tut, aber es muss doch einen anderen Weg geben.
Ich hoffe, er merkt nicht, dass ich Ihnen diesen Brief schreibe. Ich habe gelesen, dass Sie sich damit beschäftigen, warum manche Menschen zu so grausamen Taten fähig sind. Sie suchen die Ursachen in der Kindheit. Unsere war nicht schön. Sie war schrecklich. Aber kann das der Grund sein? Warum bin ich dann nicht so? Ich verabscheue Gewalt. Ich würde nie tun, was er seinen Opfern antut.
Sein letztes war Jacob Hazleton. Er hatte keinen schönen Tod. All das Blut und die qualvollen Schreie, als er bei lebendigem Leib aufgeschnitten wurde ...
Ich war dabei und ich habe es gehasst. Ich hasse es immer, wenn er sie vergewaltigt und dann aufschlitzt. Das ist kein schneller Tod. Es ist grauenhaft. Er sagt, er liebt es, die Wärme eines offenen Körpers unter den Händen zu spüren, denn nur so fühlt er sich lebendig. Ich fühle mich dann eher wie tot.
Es muss aufhören ...
Hilfesuchend blickte Julie zu Libby auf. „Was zum Teufel ist das?“
„Kein Absender, sagtest du?“, fragte Libby, die kurz überlegte und dann in den Materialraum neben der Küche lief. Dort lagen Beweismittelbeutel und Einmalhandschuhe, mit denen sie zu Julie zurückkehrte und sich erst die Handschuhe überstreifte, bevor sie den Brief mitsamt dem Umschlag eintütete.
„Hältst du das für echt?“, fragte Julie.
„Du nicht?“, erwiderte Libby. „Ich weiß es nicht, aber wir sollten es so behandeln, als wäre es echt.“
„Da hast du wohl Recht.“
Libby las den Brief noch einmal, bevor sie sich wortlos auf ihren Schreibtisch setzte und in VICAP den Namen Jacob Hazleton eingab. Die Datenbank meldete Kein Treffer. Nachdenklich hielt sie für einen Moment inne, bevor sie die Vermisstendatenbank öffnete und einen neuen Versuch startete. Diesmal erzielte sie einen Treffer.
„Jules“, sagte sie und Julie stand auf, um sich anzusehen, was Libby gefunden hatte.
Jacob Hazletons Veschwinden war im November gleich nach Thanksgiving angezeigt worden. Er war ein Student aus Norfolk, der von einem Besuch bei seiner Familie nicht in sein Wohnheim zurückgekehrt und von seinen Mitbewohnern als vermisst gemeldet worden war. Seitdem fehlte jede Spur von ihm.
„Ende November ...“ murmelte Libby nachdenklich und holte VICAP wieder in den Vordergrund. Sie begann, das Formularfeld mit verschiedenen Parametern zu füllen: männliche Leiche Anfang zwanzig, gefunden nach Ende November, dunkles Haar. Sie übernahm auch Körpergröße und Gewicht aus der Vermisstenanzeige. VICAP spuckte ihr allerdings in Virginia keine Leiche aus, auf die die Parameter passten.
Julie sagte kein Wort, sie schaute einfach zu, als Libby die Suche vertiefte. Sie nahm den Filter heraus, der die Suche auf Virginia beschränkte – und erzielte prompt einen Treffer in North Carolina. Am zerklüfteten Ufer des Lake Gaston im Norden des Bundesstaates war vor nicht einmal zwei Wochen die aufgedunsene Leiche eines jungen Mannes gefunden worden, die bislang nicht identifiziert werden konnte. Die äußerliche Beschreibung dessen, was von der Leiche noch übrig war, passte auf Jacobs Äußeres. In VICAP waren Fotos der Leiche hinterlegt – ihr fehlten die Augen, das Gesicht war durch Tierfraß halb verschwunden. Das war jedoch nicht das Schlimmste, denn ihr fehlten zahlreiche innere Organe.
„Oh mein Gott“, murmelte Julie. Libby öffnete den Obduktionsbericht und überflog ihn hastig. Männliche Leiche, geschätztes Alter Anfang zwanzig. Todesursache: Verbluten. Es war noch erkennbar, dass der Täter Jacobs Bauch von den Rippen bis zum Schambein aufgeschlitzt hatte, und der Gerichtsmediziner nahm an, dass das die Todesursache war. Es fehlten Stücke des Darms und anderer Organe. An Hand- und Fußgelenken waren noch winzige Reste von Fesselspuren erkennbar, auch wenn eine Hand komplett fehlte. Irgendetwas schien sie abgerissen zu haben. Außerdem hatte der Gerichtsmediziner Verletzungen im Analbereich konstatiert, die auf eine Vergewaltigung vor Eintritt des Todes hindeuteten.
Libby schluckte. In der Fallakte war vermerkt, dass die zuständige Polizei in Roanoke Rapids zum Abgleich mit einer Vermisstenakte vor fünf Tagen einen DNA-Test veranlasst hatte, doch weitere Informationen fehlten und es lag auch noch kein Ergebnis vor.
Wortlos griff sie zum Telefon und wählte die Nummer des zuständigen Detective.
„Roanoke Rapids PD, Sinclair“, meldete er sich knapp.
„Guten Tag, Detective, hier spricht Special Agent Libby Whitman, FBI.“
„Oh, was verschafft mir die Ehre?“
„Laut VICAP sind Sie der zuständige Ermittler im Fall einer noch nicht identifizierten männlichen Wasserleiche.“
„Das ist richtig. Warum ist das fürs FBI interessant? Weil der Mann vielleicht aus Virginia stammt?“
Für einen Moment war Libby überrascht. „Richtig, das nehmen wir an. Was glauben Sie, um wen es sich bei ihm handelt?“
„Jacob Hazleton, ein Student aus Norfolk. Wir haben vor ein paar Tagen DNA-Proben seiner Eltern ins Labor geschickt. Wenn Sie die Akte offen haben, verstehen Sie vermutlich, warum wir ihn noch nicht identifiziert haben.“
„Ja, besonders viel ist nicht von ihm übrig ...“
„So könnte man es ausdrücken. Ziemlich unschöne Sache. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen soll, aber wir sind ja hier an der Nähe zur Grenze von Virginia, deshalb habe ich auch dort gesucht und einen Treffer gefunden. Der Gerichtsmediziner meinte jedenfalls, es könnte passen, deshalb versuchen wir jetzt, seine Identität anhand eines DNA-Tests zu klären. Und wie kommen Sie auf diesen Fall?“
„Durch meine Kollegin. Sie hat heute einen Brief von einem Unbekannten bekommen, der darin den Namen Jacob Hazleton erwähnt.“
„Oh. Okay. Das ist ja eigenartig.“
„Finden wir auch. Ich wollte jetzt wissen, ob es überhaupt eine Leiche zu diesem Namen gibt – und ich wollte fragen, welche Details über den Hergang seines Todes an die Öffentlichkeit gelangt sind.“
„Da wir noch nicht wissen, ob er es wirklich ist, so gut wie gar keine. Die Leiche wurde von einem Angler entdeckt, der hat den Schock seines Lebens bekommen. Wir haben bekanntgegeben, dass eine unbekannte männliche Wasserleiche gefunden wurde, aber weil wir schon eine Idee hatten, wer er sein könnte, haben wir keine Details über ihn veröffentlicht und erst recht keine, die auf die Umstände seines Todes eingehen. Dann schreit die Presse bloß wieder Serienmörder.“
Libby lachte. „Könnte sein. Ich bin Profilerin in Quantico, das ist mein Spezialgebiet.“
„Oh, verstehe. Dann bin ich jetzt ein bisschen beruhigt, dass ich Sie schon am Apparat habe, denn möglicherweise hätte ich sowieso Hilfe bei Ihrem Team gesucht.“
„Dann verfügt der Verfasser des Briefes über Täterwissen“, murmelte Libby gedankenversunken.
„Entschuldigung?“
„In dem Brief, der mir vorliegt, ist die Rede davon, dass das Opfer aufgeschlitzt und vor dem Tod vergewaltigt wurde. Das kann ja dann eigentlich nur der Täter wissen.“
„Richtig. Könnten Sie mir einen Scan dieses Briefes schicken, wenn es Ihnen nichts ausmacht?“
Libby überlegte kurz, stimmte dann jedoch zu. „Kann ich machen. Ihre Mailadresse steht ja hier.“
„Wir rechnen mit dem Ergebnis der DNA-Analyse im Laufe der Woche. Im Übrigen würde ich sagen, dass das hier nicht der erste Mord des Täters war. Dafür ist das zu brutal.“
„Da stimme ich Ihnen zu.“
„Und er schreibt Ihnen Briefe? Warum?“
Libby grinste belustigt. „Sie würden sich wundern, wie oft so etwas vorkommt.“
„Na ja, ich weiß, dass so mancher Täter mit seiner Schuld nicht zurechtkommt und sich jemandem öffnen will – aber wer schreibt denn dann einen Brief ans FBI?“
„Der Verfasser des Briefes spricht vom Täter als einer anderen Person. Ich überlege gerade, ob es sich dabei um einen Angehörigen oder einen Mittäter handelt.“
„Wäre ja denkbar. Einen Absender gibt es nicht?“
„Nein, der Brief ist vollkommen anonym. Ich lasse ihn gleich scannen und schicke Ihnen eine Mail.“
„Okay, das klingt auf jeden Fall nicht uninteressant.“
„Haben Sie schon mal überprüft, ob es ähnliche Taten gibt?“
Sinclair bejahte. „Ich hab da noch zwei Fälle gefunden. Gucken Sie sich mal in VICAP die Akten von Tom Hatfield und Anthony Blackhurst an. Gleicher Modus Operandi, was die Ermordung angeht.“
„Also wirklich ein Serientäter.“
„Vielleicht. Genau deshalb hatte ich schon überlegt, mir Hilfe vom FBI zu holen. Sie sind mir nur zuvorgekommen.“
Libby bat ihn, die Namen der beiden anderen Opfer noch mal zu wiederholen, und schrieb sie schnell auf einen Zettel.
„Okay ... ich gebe den Brief jetzt mal ins Labor und schaue mir die anderen Fälle mit meinem Team an. Vielleicht haben wir hier einen Serienmordfall“, sagte sie.
„Gut möglich. Ich erwarte Ihre Mail.“
„Ich bin dran. Wir telefonieren“, sagte Libby und legte auf.
„Es gibt noch andere Opfer?“, fragte Julie schockiert.
„Sieht so aus. Zuallererst muss aber der Brief ins Labor, dann können die Kollegen schon mal anfangen.“
„Du kannst ihn ja hinbringen und ich schaue mir derweil schon mal die anderen Fallakten in VICAP an“, schlug Julie vor. Libby war einverstanden und wollte sich gerade mit dem Brief auf den Weg zu den Aufzügen machen, als Nick ihr von draußen entgegenkam. Er wirkte überrascht, als er Libby so zielstrebig auf sich zukommen sah.
„Was ist los? Ist was passiert?“, fragte er.
Libby blieb stehen und hielt ihm den Brief hin. „Der war für Julie in der Post. Anonym, kein Absender. Der Verfasser verfügt über Täterwissen und ich habe gerade mit dem zuständigen Detective telefoniert – es gibt noch zwei ähnliche Fälle.“
„Augenblick.“ Nick nahm den Brief und las ihn aufmerksam, bevor er Libbys Blick erwiderte.
„Klingt echt, wenn du mich fragst.“
„Ja, das fand ich auch. Ich will den Brief jetzt im Labor scannen und untersuchen lassen.“
„Mach das mal. Nicht, dass unser Team hier einen neuen Fall hat.“
Libby nickte stumm. Nick nahm die Sache sofort ernst – dann war es das auch.
Die Kollegen im Labor versprachen, sich gleich um die forensische Untersuchung des Briefes zu kümmern, ihn zu scannen und auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Als Libby ins Büro zurückkehrte, fand sie Julie konzentriert hinter ihrem Bildschirm vor, doch sie gab Libby gleich einen Wink.
„Sieh dir das an“, sagte sie. Libby zog sich ihren Stuhl neben Julies und schaute sich an, was ihre Freundin gefunden hatte.
Tom Hatfield war ein Erstsemesterstudent aus Raleigh, North Carolina, der im Frühjahr verschwunden und zwei Wochen später tot in einem Waldgebiet östlich von Charlotte aufgefunden worden war. Er hatte schneller identifiziert werden können, weil die Witterung der Leiche nicht so zugesetzt hatte. Auch Tom war regelrecht ausgeweidet und vor seinem Tod vergewaltigt worden. Von dem, was Julie ihr zeigte, wirkte es auf den ersten Blick so, als sei dort derselbe Täter am Werk gewesen.
Anthony Blackhurst stammte aus Roanoke, Virginia. Auch er war Student und im Spätsommer verschwunden. Einen Monat später hatte man seine verstümmelte Leiche in einem Wald unweit des Smith Mountain Lake entdeckt – aufgeschlitzt und ebenfalls vergewaltigt.
„Das ist eine Mordserie“, sagte Libby.
Julie nickte. „Sehe ich auch so. Beide Fälle sind noch offen, es gab keine Verdächtigen.“
„Was ist denn da los? Wie sind die Opfer denn verschwunden?“
„Das weiß keiner.“
„Waren sie schwul?“
Nun schüttelte Julie den Kopf. „Nein, darauf fanden die zuständigen Ermittler keinen Hinweis. Tom hatte sogar eine Freundin.“
„Hast du in den Obduktionsberichten einen Hinweis auf Spermaspuren entdeckt?“
Julie nickte. „Ja, konnte sichergestellt werden. Der Abgleich hat natürlich kein Ergebnis zutage gefördert, sonst hätten wir ja einen Verdächtigen. Es ist bloß klar, dass der Mörder in den Fällen Hatfield und Blackhurst derselbe ist.“
„Ich frage deshalb, weil ich sicher sein will, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben“, erklärte Libby. „Verletzungen in dem Bereich können ja auch durch Gegenstände hervorgerufen werden, das wissen wir ja noch durch Randall Howard.“
„Stimmt. Guter Punkt“, sagte Julie. „Doch, ich denke, wir können relativ sicher sein, dass der Täter ein Mann ist.“
„Okay ... er entführt unbemerkt heterosexuelle Männer, wo man sich jetzt die Frage stellen muss, wie er das gemacht hat, er hält sie irgendwo fest ... weiß man, wie lange?“
„In Toms Fall war sich der Pathologe ziemlich sicher, dass er schon ein paar Stunden nach seiner Entführung getötet wurde. Der Ablauf ist immer gleich – sie werden entführt und an einen entlegenen Ort gebracht. Der Täter fesselt sie, alle Opfer hatten Fesselspuren an Hand- und Fußgelenken, und dann vergewaltigt er sie. Bei Tom, den man ja am schnellsten gefunden hat, hat der Gerichtsmediziner auch vermutet, dass er sowohl vor als auch nach seinem Tod vergewaltigt wurde“, sagte Julie.
Libby nickte konzentriert. „Was die Profis so alles feststellen können.“
„Das beeindruckt mich auch immer wieder. Na ja ... und wenn er das getan hat, fixiert er die Opfer und schlitzt sie bei lebendigem Leib auf. Das ist in allen Fällen gleich. Er öffnet ihren Torso und lässt sie sterben.“
„Warum tut er das?“, fragte Libby. „Klar, es ist in höchstem Maße sadistisch, aber gibt ihm das was?“
„Bestimmt. Irgendwie erinnert mich das an diesen deutschen Serienmörder, den Rhein-Ruhr-Ripper Frank Gust. Damals im Masterstudium in London habe ich mich mit ihm befasst, meine Mum hat ziemlich viel Material über ihn. Sie kennt jeden Serienmordfall aus ihrer Heimat.“
„Ja, Serienmörder gibt es überall, auch im kleinen Deutschland“, sagte Libby. „Über Frank Gust weiß ich nicht so viel – warum hat er das gemacht?“
„Das kam bei ihm durch eigene Missbrauchserfahrungen. Er hat die Berührung der noch warmen Innereien seines Opfers mit Erregung verknüpft, für ihn war es der Gipfel, buchstäblich in einen Körper einzutauchen. Er hatte allerdings nicht dieses sadistische Level bei seinen Morden an Menschen, er hat seine Opfer – allesamt Frauen – erschossen, bevor er ihre Körper geöffnet hat. Das ist hier anders.“
„Hm“, machte Libby. „Siehst du hier auch so ein Szenario?“
„Irgendwas in der Richtung muss es sein. Niemand, nicht mal ein Serienmörder, weidet seine Opfer einfach so bei lebendigem Leib aus. Davon muss er sich etwas versprechen. Der Grad an Sadismus, den wir hier haben, spricht dafür, dass er sich eine Art Glücksgefühl oder Lustgewinn dadurch verschaffen will. Leider ist das auch eine schlechte Prognose, denn wie wir ja wissen, brauchen Sadisten immer mehr und hören garantiert nicht auf ...“
„Tolle Aussichten“, murmelte Libby sarkastisch.
Während die Kollegen im Labor damit beschäftigt waren, den Brief zu scannen, hatten Libby und Julie das Profil für die Ermittler in Fredericksburg fertiggestellt und Nick vorgelegt. Er hatte sie für ihre gute Arbeit gelobt und nachdem Julie das Profil nach Fredericksburg weitergeleitet hatte, erreichte sie auch schon der Scan des anonymen Briefes. Libby schickte ihn gleich an Detective Sinclair und keine fünf Minuten später klingelte ihr Telefon.
„Jack Sinclair hier“, begrüßte der Detective sie. „Danke, dass Sie mir den Brief so schnell geschickt haben. Das ist ja erschreckend. Aber ich gebe Ihnen Recht – der Verfasser hat Täterwissen. Was glauben Sie, wer er ist?“
„Ja, das ist eine gute Frage. Ein Angehöriger, vielleicht sogar ein Mittäter?“
„Der Verfasser spricht von der gemeinsamen schrecklichen Kindheit. Vielleicht sein Bruder? Seine Schwester?“
„Möglich“, sagte Libby. „Interessant finde ich, dass er oder sie sich verpflichtet fühlt, den Täter zu schützen, aber gleichzeitig nicht mit den Gewissensbissen zurechtkommt.“
„Warum hat er ausgerechnet Ihrer Kollegin diesen Brief geschickt?“
„Dr. Thornton hat sich in ihrer Doktorarbeit mit der Frage beschäftigt, wie man Sadisten präventiv begegnen kann. Vielleicht ist der Verfasser darüber gestolpert.“
„Interessant. Da scheint aber jemand ein großes Mitteilungsbedürfnis zu haben“, sagte Sinclair.
„Sieht so aus. In jedem Fall danke ich Ihnen für die Hinweise auf die beiden anderen Opfer. Die Vorgehensweise ist ja identisch, da liegt der Gedanke nah, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt.“
„Ja ... bei Tom und Anthony ist es ja auch gelungen, das über die gefundene DNA zu bestätigen, aber in meinem Fall hier war leider keine DNA mehr da, die man hätte sicherstellen können.“
„Sicher, bei der Wasserleiche ... Ich werde meinem Chef den Fall gleich ausführlich vorstellen, wir sollten uns der Sache annehmen und ein Täterprofil erstellen. Dr. Thornton und ich sind uns einig, dass der Täter nicht aufhören wird, bis wir ihn fassen. Er hat ein gewaltiges sadistisches Potenzial und wird immer weiter machen. Mit Pech sucht er sich schon bald sein nächstes Opfer, Jacob ist ja bereits vor zwei Monaten verschwunden.“
„Der Gedanke kam mir auch schon“, sagte Sinclair. „Ich habe bereits mit den Ermittlern in den anderen Fällen gesprochen und ihnen vorgeschlagen, die Fälle dem FBI vorzustellen. Einer der Detectives hält nicht viel davon, doch das hätte mich nicht davon abgehalten. Ich wollte eigentlich bloß noch das Ergebnis der DNA-Analyse abwarten, um sicher zu sein, dass die Leiche, die wir hier gefunden haben, wirklich Jacob ist.“
„Ich weiß, nicht jeder schätzt unsere Arbeit. Dennoch glaube ich, dass wir hier helfen können. Ich spreche gleich mal mit meinem Chef und halte Sie auf dem Laufenden.“
Der Detective bedankte sich und nachdem Libby aufgelegt hatte, tauschte sie bloß einen Blick mit Julie. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg in Nicks Büro. Der Teamleiter blickte interessiert auf und bot ihnen an, sich zu setzen.
„Habt ihr was für uns?“, fragte er.
Libby nickte. „Ich glaube, hier ist ein Serienmörder aktiv. Es gibt bereits drei Tote.“
„Drei“, wiederholte Nick überrascht.
„Ich denke, dass wir es hier mit einem Sadisten zu tun haben, der ein äußerst gewalttätiges Potenzial hat. Der macht weiter, bis wir ihn kriegen.“
„Okay. Das ist schlecht. Erzählt mal.“
Gemeinsam stellten Libby und Julie Nick den Fall vor. Sie nannten ihm die Namen der Opfer, so dass er sich in VICAP die Fallakten ansehen konnte, und verrieten ihm auch, welche Schlüsse sie bereits gezogen hatten.
Schließlich nickte Dormer ernst und sagte: „Ja, um diesen Fall sollten wir uns mit erhöhter Dringlichkeit kümmern. Ihr könnt auch noch jemanden dazu holen, wenn ihr möchtet. Es wäre durchaus sinnvoll, wenn Julie sich persönlich damit befasst – und auch bei dir halte ich das für sinnvoll, Libby. Wenn du keine Einwände hast.“
Libby schüttelte den Kopf. „Nein, mit dem Fall komme ich klar.“
„Okay. Es wäre auch zu überlegen, ob wir uns in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit wenden und versuchen, mit dem Verfasser des Briefes in Kontakt zu treten. Vielleicht gelingt es uns, einen Kommunikationsweg zu etablieren und ihn auf diesem Weg zu finden. So könnten wir versuchen, den Täter zu finden und zu stoppen.“
„Aber wie?“, fragte Julie.
„Ich weiß nicht, dazu könntet ihr Alex befragen. In solchen Fällen ist sie die Expertin.“
Libby und Julie waren einverstanden. Zunächst begannen sie jedoch erst einmal damit, an einer Korkpinnwand alle Informationen zusammenzutragen, die sie bislang gesammelt hatten. Sie pinnten sämtliche Informationen über die Opfer, die Vorgehensweisen und den zeitlichen Ablauf an die Korkwand und ließen alles auf sich wirken.
„Täterpaare sind ja nicht neu“, sagte Julie. „Aber dass einer der beiden Gewissensbisse kriegt, hatte ich so auch noch nicht.“
„Nein, ich auch nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwie positiv auf ihn einwirken können, denn auf diese Weise darf nicht noch ein Mensch sterben.“ Libby schaute auf die Uhr. „Mist, ich muss gleich schon los.“
„Ist doch nicht schlimm. Ich mache hier noch weiter und lese mich ein bisschen in den Fall Frank Gust ein. Der lässt mich irgendwie nicht los – das hier ist zu ähnlich.“
„In Ordnung. Sag Bescheid, falls dir noch etwas Wichtiges einfällt.“
Julie versprach es und verabschiedete sich von Libby, die Augenblicke später nervös im Aufzug stand und nicht wusste, wohin mit sich. Sie war hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Angst.
Mit Owen hatte sie verabredet, sich gleich an der Praxis von Dr. Melrose zu treffen. Während der Freeway auf der Gegenfahrbahn wieder einmal im Stau ertrank, kam Libby zügig voran und war zehn Minuten zu früh vor Ort. Als sie im Auto auf Owen wartete, stieg ihre Nervosität in ungeahnte Höhen. Es war, als krampfe sich ihr Magen zusammen, ihre Hände waren eiskalt.
Was würde der Arzt ihr sagen? Vermutlich an diesem Tag nicht besonders viel, aber sie hatte trotzdem Angst. Jetzt wurde es real.
Sie sah, wie Owens Auto auf den Parkplatz vor dem Ärztezentrum fuhr und schräg hinter ihrem Auto parkte. Schließlich stieg sie aus und ging zu ihm, wenn auch zögerlich und mit langsamen Schritten.
„Hey“, sagte er. „Der Verkehr ist die Hölle. Bin froh, dass ich etwas früher losgefahren bin.“
Libby lächelte bloß und war erleichtert, dass er sie ansonsten in Ruhe ließ. Gemeinsam betraten sie das Gebäude und fanden ohne Probleme die Arztpraxis, in der sie freundlich willkommen geheißen wurden, bevor die Sprechstundenhilfe ihre Daten aufnahm und sie anschließend ins Wartezimmer bat.
Nervös knetete Libby ihre Finger. Owen war ebenfalls angespannt – er wackelte die ganze Zeit mit einem Fuß. Als sie aufgerufen wurden, schnellte ihr Puls kurz in die Höhe, doch sie versuchte, sich zur Ordnung zu rufen, und folgte der Arzthelferin in das Sprechzimmer des Arztes. Owen nahm neben ihr Platz und es dauerte nicht lang, bis der Dr. Melrose erschien. Er war ein hagerer Mittvierziger mit Brille, der durchaus sympathisch wirkte und die beiden mit einem kräftigen Händedruck begrüßte.
„Was führt Sie denn heute zu mir?“, begann er.
Libby spürte einen Seitenblick von Owen, doch plötzlich fehlten ihr die Worte. Bereitwillig sprang er ein.
„Wir sind hier, weil wir uns ein Kind wünschen, aber in dieser Hinsicht haben wir einen gewissen Klärungsbedarf.“
„Sie sind beide noch sehr jung. Hatten Sie denn schon Fehlgeburten, die Ihren Arzt da an genetische Schwierigkeiten denken lassen, oder eine entsprechende Vorgeschichte?“ Dr. Melrose sah Libby direkt an, während er das fragte.
Sie räusperte sich und erwiderte: „Im Moment sieht es so aus, dass ich gar nicht erst schwanger werde ... aber ja, ich habe eine erbliche Vorbelastung. Ich vermute es zumindest. Ich stamme aus Utah, ich bin in der Sekte von Warren Jeffs geboren.“
Dr. Melrose nickte wissend. „Die FLDS. Verstehe. Was können Sie mir denn über Ihre Abstammung sagen?“
„Das ist es ja ... nicht besonders viel eigentlich. Meine Mutter stammte selbst aus der Sekte, aber sie ist tot, sie wurde von ihrem eigenen Mann ermordet. Sie kann ich also nicht fragen. Und mein leiblicher Vater war, so hat sie zumindest immer gesagt, kein Angehöriger der Sekte. Er war ein Mann von außerhalb, aus Las Vegas.“
„In Ordnung. Und Ihren sozialen Vater können Sie aus naheliegenden Gründen nicht zu Ihrem Stammbaum befragen.“
Libby nickte erleichtert, allmählich entspannte sie sich etwas. „Richtig. Ich habe keine Ahnung, wie mein Familienstammbaum oder der meiner Mutter aussieht ...“ Sie räusperte sich. „Wie eng meine Vorfahren miteinander verwandt waren oder ob ich vielleicht von einer der Gründerfamilien abstamme.“
„Ich verstehe – Sie sind offensichtlich im Bilde, was die genetischen Schwierigkeiten angeht, die das abgeschiedene Leben der Gemeinschaft mitbringt.“
Nett formuliert, dachte Libby, und nickte. „Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ob ich das Gen in mir trage, das Fumarazidurie begünstigt.“
„Fumarazidurie wird autosomal-rezessiv vererbt, das heißt, Sie könnten theoretisch Träger sein, ohne dass die Krankheit bei Ihnen zum Ausbruch gekommen ist. Aber selbst wenn Sie nun ein Kind mit Ihrem Mann zeugen – er müsste ebenfalls Träger des defekten Gens sein, damit sich die Erkrankung beim Kind manifestiert.“
Libby nickte. „Ich weiß. Mein Mann hat mit der Sekte zum Glück überhaupt nichts zu tun.“
„Und Sie in genetischer Hinsicht auch nur zur Hälfte, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wenn Ihr Vater nicht auch aus der Sekte stammt, kann das einen himmelweiten Unterschied machen. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass die Verwandtschaftsehen in der Sekte in genetischer Hinsicht für riesige Probleme sorgen.“
„Deshalb sind wir hier ... bis jetzt bin ich nicht schwanger geworden, aber ich mache mir Sorgen, ob ich überhaupt ein gesundes Kind haben kann.“
Der Arzt nickte verständnisvoll. „Wie lange versuchen Sie es jetzt?“
„Ein halbes Jahr.“
Er warf einen Blick auf seinen Bildschirm. „Ist in Ihrem Alter nicht weiter ungewöhnlich, manche haben da einfach Pech. Wie steht es um eine gynäkologische Abklärung? Haben Sie Vorerkrankungen?“
„Laut meiner Frauenärztin ist alles okay. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, bin aber gut eingestellt“, sagte Libby.
Der Arzt nickte. „Und Sie, Mr. Young?“
„Ich war schon beim Urologen – alles in Ordnung“, sagte Owen.
„Okay. Ich finde es gut, dass Sie beide hier sind. Ich würde auch vorschlagen, ich untersuche Sie beide, nur um sicher zu sein. Im Übrigen finde ich es vernünftig, dass Sie das abgeklärt haben wollen.“
„Ich habe vor meiner Flucht aus der Sekte genügend Kinder mit Behinderungen gesehen – ich habe sie auch sterben sehen“, sagte Libby. „Ich war vierzehn, als ich geflohen bin, und seitdem habe ich mich mit meiner Herkunft auseinandergesetzt.“
„In Ordnung. Zunächst kann ich Sie beruhigen – wenn Ihr Vater nicht aus der Sekte stammt, ist Ihr Risiko nicht mehr so groß, genetische Defekte an Ihr Kind weiterzugeben. Alles, was da vorliegen kann, kann nur von Ihrer Mutter kommen, Mrs. Whitman – diese Gene machen aber nur einen Anteil von 25 Prozent aus, wenn man das aufs Kind bezieht.“
„Das haben wir uns auch schon ausgerechnet“, sagte Owen.
„Dennoch ist es theoretisch möglich, dass auch andere Probleme auftreten können, an die noch niemand gedacht hat. Aus diesem Grund will ich auch Sie beide testen. Einfach ausgedrückt, will ich wissen, ob Sie genetisch zueinander passen. Dafür genügt tatsächlich eine Blutabnahme. Ein kleiner Piks, ich lasse Ihr Blut detailliert untersuchen und sobald ich die Ergebnisse habe, unterhalten wir uns weiter.“
„Das hört sich gut an“, fand Owen und Libby nickte zustimmend.
„Ich muss das einfach wissen, das macht mich inzwischen wahnsinnig“, gestand sie.
Dr. Melrose lächelte mitfühlend. „Dann sind Sie bei mir ganz richtig. Wir finden es schon heraus, wenn da etwas ist. Jetzt darf ich Sie bitten, nebenan zur Blutabnahme ins Labor zu gehen.“
Owen und Libby bedankten sich und verließen den Raum. Eine Arzthelferin nahm ihnen nacheinander Blut ab und vereinbarte im Anschluss einen neuen Termin zwei Wochen später, um die Ergebnisse zu besprechen.
Die Routine, mit der das Personal in der Praxis vorging, beruhigte Libby ein wenig, aber trotzdem waren ihre Handflächen schweißnass, als sie wieder in ihrem Auto saß und Owen nach Hause folgte. Erst, als sie kurz darauf zu Hause ankamen und von Oreo begrüßt wurden, ließ ihre Anspannung allmählich nach.
„Das lief doch gut“, sagte Owen in die Stille hinein. „Netter Arzt. Sehr professionell – und er schien gleich zu wissen, womit er es bei dir zu tun hat.“
„Ja ... na ja ... ein bisschen weiß man ja auch außerhalb der FLDS darüber, wohin dieser ganze Inzest führt. Die Hälfte aller weltweiten Fälle von Fumarazidurie treten in der Sekte auf, weil einer der Gründerväter das Gen in sich trug und wahnsinnig viele Mitglieder von ihm abstammen. Und wenn die dann auch noch untereinander heiraten ...“ Libby seufzte tief. „Davon hat man als Humangenetiker sicher schon mal gehört.“
„Vermutlich. Ich bin wirklich gespannt, was dabei herauskommt.“
„Ich werde wahnsinnig. Wie soll ich bloß die nächsten zwei Wochen überstehen?“, fragte Libby frustriert.
„Mach dich nicht verrückt. Es ist richtig, dass wir das machen, und ich bin sicher, dass alles gut wird.“ Owen lächelte ermutigend. „Wie war dein Tag denn sonst so?“
„Interessant ... wir haben wohl einen neuen Fall“, sagte Libby.
„Oh, was ist es diesmal?“, fragte Owen neugierig.
„Julie hat einen Brief von jemandem bekommen, der von einigen Morden weiß. Ein Mitwisser, Mittäter ... wir wissen es nicht. Jemand, der mit seinen Gewissensbissen nicht zurechtkommt, denn der Mörder entführt Männer, er vergewaltigt sie und zum Schluss weidet er sie noch bei lebendigem Leib aus.“
„Warum habe ich gleich noch gefragt?“, fragte Owen und lachte kopfschüttelnd. „Womit du dich tagsüber so beschäftigst.“
„Komm schon, du bist auch bei der Mordkommission.“
„Ja, aber du hast dauernd so was!“
Libby grinste. „Dürfte jedenfalls ein interessanter Fall werden, denn wir müssen jetzt im Prinzip zwei Täterprofile erstellen. Vielleicht haben wir Glück und der Mitwisser meldet sich wieder.“
„Das wäre ja gut. Dagegen war mein Tag ja stinklangweilig, ich war ja heute Vormittag bloß vor Gericht ...“
„Mein Beileid.“
„Ja, ich mag das auch nicht sonderlich. Aber es gehört dazu.“
„Stimmt“, sagte Libby. Einem Impuls folgend, ging sie zu Owen und umarmte ihn einfach. Er erwiderte die Geste schweigend und drückte sie fest an sich. Das brauchte sie in diesem Moment.
Freitag, 20. Januar
„Du siehst müde aus.“ Jesse blieb stehen, während er das sagte, und Julie nickte langsam.
„Alpträume. Ich habe gestern Abend noch zu viel recherchiert.“
„Oh, worüber?“
„Willst du das wirklich wissen?“
„Klar.“
„Unser neuer Fall erinnert mich sehr an den deutschen Rhein-Ruhr-Ripper, Frank Gust“, begann Julie. „Wie die meisten Täter seines Formats ist auch er recht gesprächig und ziemlich reflektiert. Meine Mum besitzt Originalquellen auf Deutsch, aber da ich ja zweisprachig aufgewachsen bin, ist das kein Problem für mich.“
„Praktisch“, fand Jesse.
„Jedenfalls hab ich mir das Zeug gestern Abend zu Hause vorgeknöpft ... Seine Geschichte ist ja ein trauriges Beispiel für ein von Menschenhand geschaffenes Monster.“
„Der Mensch ist des Menschen Wolf, oder wie war das?“, sagte Jesse. Er hatte sich interessiert an Julies Schreibtisch gelehnt und hörte zu.
„Ja, so ungefähr. Gust hatte kein stabiles familiäres Umfeld, sein Stiefvater war gewalttätig, von seiner Mutter hat er keinen Schutz erfahren. Wertschätzung sowieso nicht. Das hat ihn im Grundschulalter regelrecht in die Arme eines Mannes aus der Nachbarschaft getrieben, der ihn missbraucht haben soll. Bewiesen werden konnte es nicht, aber auch nicht widerlegt. Es gibt da einige sehr eindringliche Texte, in denen er beschreibt, dass dieser Missbrauch sich für ihn wie die Liebe angefühlt hat, nach der er so verzweifelt gesucht hat.“
„Das ist traurig“, sagte Libby.
Julie nickte. „Er war schon als kleiner Junge emotional depriviert, regelrecht ausgehungert. Zu Hause wurde er immer niedergemacht, konnte kein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen. Irgendwann gab es eine Begebenheit mit einem Meerschweinchen, das er sich in einer Zoohandlung gekauft hatte. Damit waren seine Eltern nicht einverstanden, sie haben ihn aufgefordert, sich des Tieres zu entledigen. Das hat er auch getan, da war er vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Er beschreibt detailliert, wie er seine Gedanken auf ein verhasstes Mädchen auf der Nachbarschaft umgelenkt hat, während er das Tier mit einer Schaufel erschlagen hat – und als daraufhin die Eingeweide aus dem toten Körper quollen, setzte seine Faszination dafür ein. Er hat die noch warmen Organe befühlt, was ihm ein gutes Gefühl beschert hat.“
Während Libby noch versuchte, die in ihrem Magen rumorende Übelkeit angesichts von Julies Schilderung zu ignorieren, sagte sie: „Da war ein Fetisch geboren.“
„Sozusagen, ja. Das hatte erst mal gar nichts mit dem Missbrauch zu tun, den er erfahren hat. Der Mann aus der Nachbarschaft hat sich ja Zeit gelassen, er hat sich sein Vertrauen erschlichen, ihm kleine Geschenke gemacht. Im Grooming sind Pädophile und andere Menschen, die Kinder missbrauchen, ganz großartig. Gust beschreibt, wie er sich aufgrund der Freundlichkeiten des Mannes verpflichtet gefühlt hat, ihm etwas zurückzugeben – und das lief dann auf sexueller Ebene. Er hat das in dem Moment gar nicht als so verstörend erlebt, wie wir uns das vorstellen würden. Auch dann nicht, als dieser Mann ihn an andere Männer mit pädosexuellen Neigungen weitervermittelt hat.“
„Das kann man ja irgendwie nachvollziehen“, sagte Jesse. „Ein Kind, das einfach nur Nähe und Liebe sucht – und sie dann so findet.“
„Ja, er beschreibt es so, dass man ihm immer vermittelt hat, es wäre normal, was da passiert. Notwendig auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Er ist missbraucht und vergewaltigt worden, aber man hat es ihm als normal verkauft. Ein Täter war dabei, der außerdem einen Hang zur Sodomie hatte – er hat sich im Beisein des Jungen an toten Tieren vergangen, an Hühnern, und er hat ihn aufgefordert, es ihm gleich zu tun.“
„Und dann hat es sich in seinem Kopf vermischt“, sagte Libby.
„Ja, so ungefähr. Da war schon ein Widerstand in ihm, den er erst überwinden musste. Aber dann hat er es als normal angesehen, sexuelle Handlungen an Tieren vorzunehmen – und dann kam das Bedürfnis dazu, offene Körper von Tieren vor sich zu haben. Warme, noch lebendige Körper.“
Libby verzog das Gesicht. „Ich höre besser weg.“
„Er hat auf eine absolut nachvollziehbare Weise beschrieben, wie sich bei ihm diese Transformation vollzogen hat. Er wusste es nicht besser. Er ist in einem wahnsinnig jungen Alter auf ein vollkommen perverses Verhalten geprägt worden und hat es jahrelang geübt und perfektioniert, Tiere aus der Nachbarschaft zu stehlen, um sie bei lebendigem Leib aufzuschlitzen und teilweise auch sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Das fand er nicht weiter bedenklich“, fuhr Julie fort.
„Ich bekomme allmählich eine Idee, warum du heute schlecht geschlafen hast“, sagte Jesse.
„Da war diese Schilderung, wie er ein Kaninchen ausgeweidet hat ... das war widerwärtig. Ich weiß nicht, wie viele Tiere ihm zum Opfer gefallen sind. Hunderte, schätzt er. Aber er hatte Skrupel, die sich langsam abgeschleift haben – nur, um dann nach Wochen und Monaten der Abstinenz doch wieder zurückzukehren. Irgendwann hat er eine Anhalterin mitgenommen, da war er schon erwachsen – eine Südafrikanerin, die ihn kaum verstanden hat. Und da kam ihm dann die Idee: Was, wenn ich das jetzt auch mit ihr mache? Wenn ich sie töte, sie vergewaltige und in ihrem noch warmen Körper die Organe berühre?“
Jesse machte angedeutete Würgegeräusche. „Du bist so ein verdammter Hardliner, Dr. Julie Thornton.“
„Das gehört zu unserem Job, oder nicht?“
„Ja, aber wie du das erzählst ...“
„Er hat ganz nachvollziehbar beschrieben, wie aus ihm als Opfer später ein Täter wurde. Ich finde das wichtig zu wissen, weil wir das für unseren Fall hier brauchen können.“
„Ich bin vielleicht Profiler, doch es gibt Dinge, die sind mir zu hoch. Ich verstehe vieles, aber bei Nekrophilie hört es wirklich auf.“
„Ich finde das auch nicht schön, aber es war aufschlussreich. Gust ist kein Monster in dem Sinne – Libby, ich weiß nicht, wie du Bailey erlebt hast. Ob er dir gegenüber menschliche Züge gezeigt hat, Skrupel oder irgendein Zögern. Aber bei Gust gab es das durchaus. Er musste sich anfangs überwinden, so mit Tieren umzugehen.“
Libby atmete tief durch. Sie musste sich jedes Mal dazu zwingen, über Vincent zu sprechen – aber sie tat es, weil sie es für richtig hielt. Sie suchte die Konfrontation.
„Ich habe mich mehrmals mit Vincent über seinen Werdegang unterhalten ... das war, als würde er sich von mir Antworten erhoffen. Er war ein Vergewaltiger mit einer Vorliebe für Bondage, das stand ganz am Anfang, noch bevor er sich mit Randall zusammengetan hat. Er hat da aber noch keine sadistischen Neigungen gezeigt. Für ihn war es völlig ausreichend, Frauen abzuschleppen, sie zu betäuben und über sie herzufallen, ohne dass sie es merken oder sich wehren können. Das ging aber auch darauf zurück, dass er wegen seiner ersten Vergewaltigung angezeigt und von seinem Onkel rausgepaukt wurde. Er wollte das Risiko minimieren.“
„Dann ist das doch ganz ähnlich“, sagte Jesse. „Er wurde auch dazu gemacht, oder?“
„Ja“, sagte Libby und nickte. „Von Randall, nehme ich an. Randall hat das gemacht, was Vincent bloß in seinen geheimsten Träumen durchlebt hat. Er hat Frauen entführt und gefangengehalten, um sie zu foltern. Vincent hatte ja immerhin genug Respekt vor seinem älteren Cousin, um sich jahrelang an die Regeln zu halten – ich bin ziemlich sicher, er hätte die Frauen lieber vergewaltigt, anstatt sie zu foltern. Aber durch Randall hat er gelernt, dass Foltern auch Lustgewinn bringen kann. Das war für ihn eine Ersatzbefriedigung bis zu dem Moment, als er sich von Randall emanzipiert hat. Mary Jane hatte mehr oder weniger freiwillig Sex mit ihm und als Randall tot war, wusste Vincent, dass er zum Abschuss freigegeben ist.