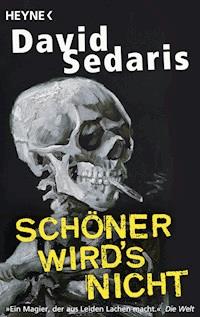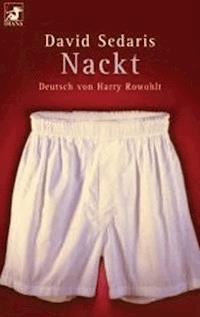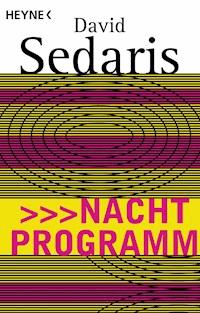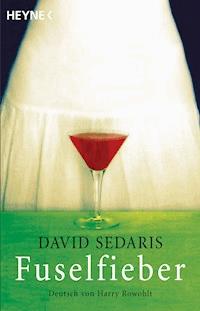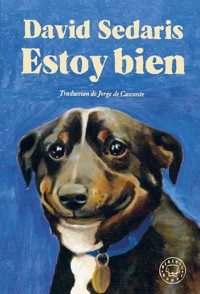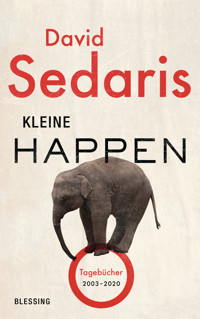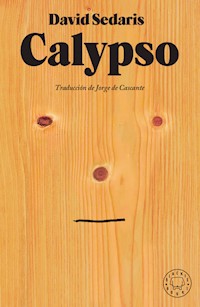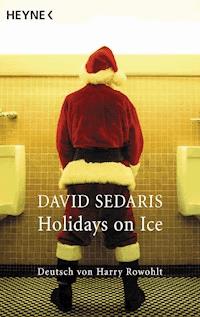19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Speisekarten noch aus Papier sind und die Entscheidung, eine Maske zu tragen oder nicht, nur an Halloween relevant ist, beschäftigt sich David Sedaris größtenteils mit den normalen Dingen des Alltags - er besucht mit seiner Schwester einen Schießstand, streift über schlammige serbische Flohmärkte und kauft Gummiwürmer, um Ameisen zu füttern.
Doch dann kommen Pandemie und Lockdown: Er wandert stundenlang durch ein leergefegtes New York City, in der Nase nur seinen eigenen Atem, und macht sich Gedanken darüber, wie Sexarbeiterinnen und Akupunkteure wohl die Quarantäne überstehen. Als sich die Welt langsam in einer neuen Realität wiederfindet und er wieder auf Tour geht, entdeckt Sedaris ein gespaltenes Amerika, dessen unterschiedliche Lager sich in Graffitis verewigen: Eat the Rich. Trump 2024. Black Lives Matter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ZUMBUCH
Als Speisekarten noch aus Papier sind und die Entscheidung, eine Maske zu tragen oder nicht, nur an Halloween relevant ist, beschäftigt sich David Sedaris größtenteils mit den normalen Dingen des Alltags – er besucht mit seiner Schwester einen Schießstand, streift über schlammige serbische Flohmärkte und kauft Gummiwürmer, um Ameisen zu füttern.
Doch dann kommen Pandemie und Lockdown: Er wandert stundenlang durch ein leergefegtes New York City, in der Nase nur seinen eigenen Atem, und macht sich Gedanken darüber, wie Sexarbeiterinnen und Akupunkteure wohl die Quarantäne überstehen. Als sich die Welt langsam in einer neuen Realität wiederfindet und er wieder auf Tour geht, entdeckt Sedaris ein gespaltenes Amerika, dessen unterschiedliche Lager sich in Graffitis verewigen: Eat the Rich. Trump 2024. Black Lives Matter.
ZUMAUTOR
David Sedaris, geboren 1956 in Johnson City, New York, aufgewachsen in Raleigh, North Carolina, lebt in England. Er schreibt u. a. für den New Yorker und BBC Radio 4. Mit seinen Büchern Naked, Fuselfieber, Ich ein Tag sprechen hübsch und Schöner wird’s nicht wurde er zum Bestsellerautor. Zuletzt erschienen im Blessing Verlag Das Leben ist kein Streichelzoo. Fiese Fabeln (2011), Sprechen wir über Eulen – und Diabetes (2013) und Calypso (2018) sowie seine vielbeachteten Tagebücher Wer’s findet, dem gehört’s (2017) und Kleine Happen (2023).
David Sedaris
Bitte lächeln!
Aus dem Amerikanischen von Georg Deggerich
Blessing
Die Originalausgabe HAPPY-GO-LUCKY erschien erstmals 2022 bei Little, Brown and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by David Sedaris
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Barbara Häusler
Umschlaggestaltung: SERIFA, Christian Otto
nach einem Originalentwurf von Loudmouth für Podium, Niederlande
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27777-2V001
www.blessing-verlag.de
Für Ted Woestendiek
Verbanne alles. Reinige alles. Vernichte alles Niederträchtige. Alles, was schlecht war oder ist, zerstöre es. Vor allem im Wald, wo du dein Leben als Baum lebst und deine Axt schwingst.
Sigmond C. Monster
INHALT
Active Shooter
Väterchen Zeit
Blauer Fleck
Eine Rede vor Hochschulabsolventen
Hurrikansaison
Schwadronin
Aufgeknöpft
Themen und Variationen
Liebesgrüße nach Serbien
Das Vakuum
Perlen
Frischer Schellfisch
Happy-Go-Lucky
Ein besserer Ort
Lady Marmalade
Bitte lächeln!
Katzenpfötchen
Lucky-Go-Happy
Active Shooter
Es war Frühling, und meine Schwester Lisa und ich waren in ihrem winzigen Wagen unterwegs vom Flughafen in Greensboro, North Carolina, zu ihrem Haus in Winston-Salem. Ich hatte früh rausgemusst, um meinen Flug von Raleigh zu erwischen, aber sie war noch eine Stunde vor mir aufgestanden. »Ich mag es, um Punkt fünf Uhr früh bei Starbucks zu sein, wenn sie aufmachen«, sagte sie. »Übrigens bin ich dort vor einigen Monaten einer Dame mit einem Äffchen begegnet. Ich weiß nicht, was für eine Rasse es war, aber es war klein – nicht viel größer als eine Puppe –, und es trug ein pinkfarbenes Rüschenkleid. Einfach skandalös. Ich wollte zu der Frau hingehen und sie fragen: ›Was wollen Sie mit diesem Ding da machen, wenn Sie kein Interesse mehr daran haben?‹«
Wie viele Haustierbesitzer, die ich kenne, ist Lisa überzeugt, dass sich niemand so gut um ein Haustier zu kümmern weiß wie sie. »Schau bloß, wie der Kerl seinen Irish Setter an der Leine zerrt«, sagt sie und zeigt auf einen Mann, der einfach nur seinen Hund spazieren führt. Oder, falls der Hund nicht angeleint ist: »Der Beagle wird gleich von einem Auto angefahren, aber seinem Besitzer ist das offensichtlich egal.« Kein Cockerspaniel hat alle notwendigen Impfungen. Kein Vogel wird richtig gefüttert oder bekommt die Krallen anständig getrimmt.
»Wieso glaubst du, die Frau könnte das Interesse an ihrem Äffchen verlieren?«
Lisa sah mich mit einem Blick an, der bedeutete: Ein Äffchen – natürlich wird sie das Interesse daran verlieren, und sagte: »Ein Äffchen – natürlich wird sie das Interesse daran verlieren.«
Genau in dem Moment kamen wir an einer Werbetafel für einen Schießstand namens ProShots vorbei.
»Ich denke, da sollten wir hinfahren und ein Schießtraining machen«, sagte Lisa.
Und so fuhren wir am kommenden Nachmittag zum vereinbarten Termin um drei Uhr hin. Ich hatte angenommen, ein Schießstand wäre im Freien, aber tatsächlich befand er sich in einem Einkaufszentrum, neben einem Laden für Traktorzubehör. Drinnen gab es Glasvitrinen voller Waffen und eine Wand mit Handtaschen, in denen eine Frau einen zierlichen Revolver verstecken kann. Von dieser Marktnische hatte ich nichts gewusst, bis ich später bei Lisa im Internet Websites fand, auf denen Westen, T-Shirts, Jacken und alles Mögliche andere angeboten wurde, um darin Waffen zu verstecken. Eine Firma verkauft Boxershorts, die hinten ein Halfter haben und die sie »Compression Concealment Shorts« nennen, wobei mir der Ausdruck »Gunderpants« passender erscheint.
Lisa und mir gefiel es, uns im Laden umzusehen. ROSSI R352 – $349,77 stand auf einem Schild neben einer Pistole. In einem Geschäft für Bürobedarf hätte ich mich zu den Preisen äußern können, aber bei Waffen habe ich nicht die leiseste Ahnung. Genauso wenig wie bei den Preisen für Pinguine oder Melkmaschinen. Meine Erfahrung mit Waffen beschränkte sich auf Luftpistolen. Lisa hatte überhaupt keine Erfahrung, sodass wir vor Betreten der Schießanlage eine dreiviertelstündige Einweisung in den sicheren Umgang mit Waffen durch einen pensionierten Polizeioffizier aus Winston-Salem namens Lonnie bekamen, der Teilhaber des Unternehmens ist und ein firmeneigenes T-Shirt trug. Der Mann war etwa Anfang fünfzig, und seine fahlen Augenbrauen und die fast unsichtbare Drahtgestellbrille wurden von einer Baseballkappe mit dem Logo der Söldnerfirma Blackwater beschattet. Man würde jemanden wie ihn nicht unbedingt zum Freund wählen, aber man hätte nichts dagegen, ihn als Nachbarn zu haben. »Ich habe deine Einfahrt vom Schnee frei geschaufelt, während du noch geschlafen hast«, würde er vielleicht sagen. »Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Mir war nach etwas Bewegung.«
Im hinteren Teil des Ladens gab es einen Unterrichtsraum, und nachdem er uns nebeneinander an einen Tisch gesetzt hatte, nahm Lonnie auf einem Stuhl gegenüber Platz. »Das Erste, was ihr über Waffensicherheit wissen müsst, ist, dass die meisten Leute dumm sind. Ich meine nicht euch persönlich, sondern die Leute im Allgemeinen. Es gibt also ein paar Regeln zu beachten. Nummer eins: Geht immer davon aus, dass eine Waffe geladen ist.«
Lisa und ich wichen zurück, als er zwei Pistolen vor uns auf den Tisch legte. Eine war irgendeine Glock und die andere – die hübscher aussah – eine stupsnasige .38 Special.
»Und, sind die hier geladen?«, fragte er.
»Ich gehe davon aus«, antwortete Lisa.
»Gut aufgepasst«, sagte Lonnie.
Ich fand einmal eine Waffe, als ich in New York ein Apartment putzte. Sie befand sich unter dem Bett, wo normalerweise die Pornohefte liegen, eingewickelt in ein T-Shirt, und lag in meinem Schoß, bevor ich realisierte, was es war. Ich erstarrte, als handelte es sich um eine Bombe. Zuletzt schob ich sie vorsichtig an ihren Platz zurück, während ich überlegte, wie ihr Besitzer, dem ich nie begegnet war, wohl aussehen mochte.
Ich hatte mir immer vorgestellt, Typen mit Bart besäßen Waffen. Als ich mich umhörte, erfuhr ich allerdings, dass die Väter von bärtigen Typen Waffen besaßen. Die Trefferquote war verblüffend. Einmal traf ich einen Amerikaner asiatischer Herkunft mit einem äußerst dürftigen Bärtchen – nicht mehr als ein Dutzend wimpernlange Haare am Kinn –, und als ich mutmaßte, sein Vater habe wohl Munition, aber keine Waffe, entgegnete er: »Oh mein Gott. Woher wussten Sie das?«
Das war zu der Zeit, bevor Bärte wieder in Mode kamen und sich jeder einen stehen ließ. Heute denke ich, dass Typen mit Baseballkappe, auf deren Schirm eine Sonnenbrille thront, eine Waffe tragen, wenn – und das ist wichtig – die Gläser der Brille verspiegelt sind oder wie bei einem Tequila Sunrise von Orange in Gelb übergehen. Was Frauen angeht, habe ich nicht die geringste Ahnung.
Lonnie war inzwischen weitergegangen und zeigte uns, wie man eine Waffe in die Hand nimmt. Wie die meisten Leute, die mit Wasserpistolen und Gewehren mit Plastikpfeilen groß geworden waren, griffen wir automatisch nach dem Abzug, ein Tabu im Großen Buch der Sicherheit. »Diese Pistolen geben keinen Schuss ab, wenn diese kleine Metallzunge nicht eingedrückt wird«, sagte Lonnie.
»Sie können nicht losgehen, wenn man sie fallen lässt?«, fragte ich.
»Ausgeschlossen«, erklärte er mir. »Fast nie. Na los, David, nimm die Glock in die Hand.«
Ich nahm all meinen Mut zusammen und folgte der Aufforderung.
»Gut gemacht!«
Als Lisa an der Reihe war, ging ihr Finger sofort zum Abzug.
»Durchgefallen«, sagte Lonnie zu ihr. »Okay, also, David, du nimmst jetzt die Achtunddreißiger, und, Lisa, du schnappst dir die Glock.«
Wir waren gerade bei Lektion zwei angelangt – richte deine Waffe niemals auf eine andere Person, es sei denn, du willst sie töten oder verletzen –, als Lisa erklärte, warum sie an dem Schießtraining teilnehme: »Angenommen, jemand versucht, auf mich zu schießen? Und zufällig lässt er die Waffe fallen? Dann will ich wissen, wie ich damit umzugehen habe.«
»Sehr gut, ein sehr vernünftiger Grund«, sagte Lonnie. »Ich sehe, du bist eine, die vorausdenkt.«
Oh, hast du eine Ahnung, dachte ich.
Unsere Sicherheitseinweisung dauerte etwas länger als vorgesehen, aber wir hatten immer noch zehn Minuten Zeit zum Schießen, was rückblickend mehr als genug war. Lisa stocksteif mit einer geladenen Glock in der Hand dastehen zu sehen, war für mich nicht weniger überraschend, als stünde sie mit schwingendem Taktstock vor einem Orchester. Ihr erster Schuss traf das Ziel – die lebensgroße Silhouette eines Mannes – und verfehlte das Herz, das Zentrum der Zielscheibe, nur um wenige Zentimeter.
Woher hat sie das?, fragte ich mich.
»Braves Mädchen!«, sagte Lonnie. »Jetzt stell die Füße etwas weiter auseinander und versuche es noch einmal.«
Ihr zweiter Schuss war noch näher dran.
»Lisa, du bist ein Naturtalent«, sagte Lonnie. »Okay, Mike, jetzt du.«
Ich sah mich verwirrt um. »Verzeihung?«
Er gab mir die .38er. »Du bist doch zum Schießen hergekommen, oder?«
Ich nahm die Pistole, und von dem Moment bis zum Schluss war mein Name Mike, was mehr als bloß ein wenig entmutigend war. Nicht das gewohnte »Moment mal – der David Sedaris?« zu hören, das ich inzwischen bei einer Begegnung mit einem Fremden erwarte, war schlimm genug, aber musste ich ausgerechnet ein Mike sein? Ich dachte an das eine Mal, als eine Frau mich in einer Hotellobby ansprach. »Entschuldigen Sie«, sagte sie, »aber sind Sie wegen des Treffens des Lions Club hier?« Das ist der Mike unter den internationalen Organisationen.
Den Namen meiner Schwester vergaß Lonnie nicht – ganz im Gegenteil, er konnte ihn gar nicht oft genug sagen. »Guter Schuss, Lisa! Und jetzt schließ beim Schuss das linke Auge.« »Was meinst du, Lisa, willst du es einmal mit der Achtunddreißiger probieren?«
»Muss ich?«, fragte sie. Tatsächlich hatte sie – hatten wir beide – schon jetzt keine Lust mehr. Bei meinem letzten Schuss dachte ich an ein Paar aus Odessa, Texas. Tom repariert Flugzeuge, deshalb leben er und Randy gleich am Flughafen, in einem Fertighaus neben dem Hangar, in dem er arbeitet. Eines späten Abends durchbrach ein großer, gestört wirkender Mann, der sich als ausgerissener Insasse einer psychiatrischen Anstalt herausstellte, mit einem Wagen den das Gelände umgebenden Maschendrahtzaun und klopfte an ihre Tür. »Ich weiß, dass meine Mutter da drin ist!«, rief er. »Ich weiß, dass du sie als Geisel hältst, du Mistkerl!«
Seine Vorwürfe waren absurd, aber er ließ sich nicht davon abbringen.
Tom und Randy drückten von innen gegen die Tür, doch als sie anfing, sich aus den Angeln zu lösen, schnappte Tom sich seine Pistole.
»Du hast eine Waffe?«, fragte ich überrascht, vermutlich, weil er schwul ist.
Tom nickte. »Ich schoss dorthin, wo ich seine Knie vermutete, aber er hatte sich in dem Augenblick gebückt, und die Kugel landete in seinem Hals.«
Dennoch wurde er nicht getötet. Wütend stieg der ausgebüxte Patient in seinen Wagen und durchbrach das massive Tor des Hangars. Anschließend krachte er durch dessen Rückwand aufs Rollfeld, wendete und fuhr in Toms und Randys Haus.
»Moment mal«, sagte ich. »Das ist ja wie im Kino, wenn der Schurke einfach nicht sterben will.«
»Ich weiß!«, stimmte Randy zu, der dem lokalen Kulturausschuss vorsteht. »Ich bin von uns beiden der Pazifist, habe nie eine Waffe in der Hand gehabt, aber jetzt fuhr dieser Verrückte an meiner Kommode vorbei, und ich brüllte: ›Töte ihn!‹«
Als Tom die Waffe hob, verlor der Mann aufgrund des Blutverlusts das Bewusstsein, und kurz darauf traf die Polizei ein. Mittlerweile hing die Tür nur noch an einem Faden und war voller Einschusslöcher, der Hangar war praktisch zerstört, und vor ihrem Bett stand ein gestohlener Wagen. Genau deshalb, dachte ich, legen sich Leute Waffen zu. Die Geschichte hätte gut als Werbung für die NRA getaugt.
Wen würde ich gerne erschießen?, fragte ich mich beim Blick auf den Pappkameraden vor mir und überlegte, ob es auch eine weibliche Version gab. Natürlich war es vollkommen gleich, wen ich mir als Opfer vorstellte. Mein Schuss ging so weit daneben, dass meine einzige Hoffnung war, mein Gegner würde sich totlachen.
Am Ende unseres Schießtrainings nahm Lonnie die Zielscheibe ab und schrieb Lisas Namen über das Einschussloch, das dem Herzen am nächsten lag. Über das am weitesten entfernte schrieb er »Mike«. Dann rollte er sie ein und gab sie uns zur Erinnerung mit. Beim Bezahlen sagte Lonnie, North Carolina habe ziemlich gute Gesetze. »Wir sind ein sehr waffenfreundlicher Staat«, sagte er.
Ich erzählte ihm, in England sei ein Mann ins Gefängnis gekommen, weil er auf einen Einbrecher in seinem Haus geschossen habe, woraufhin Lonnie die Kinnlade herunterfiel. Als hätte ich gerade gesagt, dort, wo ich herkomme, müssten die Leute von sechs Uhr morgens bis mittags auf allen vieren laufen. »Also, das ist einfach irre«, meinte er. Er wandte sich an den Typen neben ihm. »Hast du das gehört?« Dann drehte er sich wieder zu mir. »Ich sag dir, Mike, manchmal weiß ich nicht, was aus dieser Welt noch werden soll.«
Im Schaukasten unter der Theke lagen einige Aufkleber. Auf einem stand PROSHOTS: KURIERTWEICHEIERJEDERART.
»Das stand früher auf ihren Werbeplakaten, bis einige Schwule sich beschwert haben«, erzählte Lisa beim Hinausgehen.
Ich bin nicht schnell beleidigt. Mir gefällt so manches an der Welt nicht. Vieles macht mich wütend, aber das Einzige, was ich wirklich nicht ausstehen kann und was mein Gefühl von Anstand verletzt, sind Cartoons, in denen Tiere Sonnenbrillen tragen und die ganze Zeit »Wahnsinn« sagen. Da ist bei mir die Grenze überschritten. Nicht, weil das fragliche Tier – irgendein Kaninchen oder Bär oder was auch immer – nicht respektiert wird, sondern weil es Kinder zum Mittelmaß erzieht. Schwule als »Weicheier« zu bezeichnen, ist meiner Meinung nach einfach nur ärmlich.
»Was sollte das mit deinen Gründen für ein Schießtraining?«, fragte ich Lisa, als wir über den Parkplatz zu ihrem Wagen liefen. »Wieso glaubst du, dein Angreifer würde seine Pistole fallen lassen?«
Sie schloss den Wagen auf und öffnete die Tür. »Ich weiß nicht. Vielleicht trägt er Handschuhe, und sie rutscht ihm aus der Hand?«
Als wir losfuhren, fragte ich mich, ob depressive Menschen jemals an einer Sicherheitsbelehrung teilnähmen und anschließend auf dem Schießstand die Waffe gegen sich selbst richteten. »Das wäre praktischer, als extra eine Glock oder Achtunddreißiger zu kaufen, und würde keine so große Schweinerei anrichten«, meinte ich. »Zumindest nicht in den eigenen vier Wänden. Und da man erst hinterher bezahlt, würde es einen auch nichts kosten. Außer, natürlich, das Leben.«
Lisa dachte nach. »Ich habe immer gedacht, bevor ich Selbstmord begehe, würde ich zuerst Henry töten.« Sie meinte damit ihren Papagei, der spielend siebzig Jahre alt werden kann. »Versteh mich nicht falsch, ich liebe ihn über alles. Ich möchte nur nicht, dass er misshandelt wird, wenn ich nicht mehr bin.«
»Ich dachte, er kommt nach deinem Tod zu mir«, sagte ich.
Lisa setzte den Blinker. »Du würdest bald das Interesse an ihm verlieren.«
Kurz nach unserem Besuch auf dem Schießstand ereignete sich das Massaker von Sandy Hook. Zwei Monate später schickte uns ProShots per E-Mail einen Valentinsgruß, ein Foto von lauter Waffen, die ein Herz bildeten. Es waren Pistolen und halb automatische Gewehre darunter. Sogar ein paar Handgranaten. Ich las, dass die Waffenkäufe nach dem Massaker hochgingen, aus Furcht, Präsident Obama könnte den Zweiten Verfassungszusatz, das Recht auf Waffenbesitz, aufheben. Das Gleiche geschah, nachdem der Typ in Colorado in einem Kino um sich schoss und auch nach dem Massaker an der Emanuel African Methodist Episcopal Church in South Carolina.
Mir ist der Wunsch, eine Waffe zu besitzen, gänzlich fremd, besonders, wenn es sich um eine Waffe handelt, wie sie im Krieg verwendet wird. Ich weiß nicht, wieso, aber Schießen reizt mich einfach nicht. Ich habe es einmal mit Lisa ausprobiert und verspüre nicht das Bedürfnis, es noch einmal zu wiederholen. Auf YouTube ballern die Leute in ihren Gärten auf Kegel und alte Toaster, aber ich kapier’s einfach nicht. Mir ist nie in den Sinn gekommen, meine Nahrung selbst zu jagen und zu töten. Ich befürchte nicht, dass ein Krieg der Rassen bevorsteht und ich mich rechtzeitig bewaffnen muss. Auch mache ich mir keine Sorgen, ein entlaufener Psychopath könnte mitten in der Nacht meine Eingangstür einrennen. Solche Dinge passieren, aber ich würde mich lieber vorsorglich um einen Hinterausgang bemühen. An meinem jetzigen Wohnort, im Vereinigten Königreich, ist es schwer, an ein Gewehr zu kommen, und annähernd unmöglich, sich eine Handfeuerwaffe zu beschaffen. Dennoch fühlen sich die Briten frei. Liegt es daran, weil sie nicht wissen, was ihnen entgeht? Oder resultiert ihr Gefühl von Freiheit aus der fehlenden Angst, im Klassenzimmer, im Einkaufszentrum oder im Kino niedergeschossen zu werden?
Natürlich steigt die Zahl der Messerstechereien im Vereinigten Königreich sprunghaft an, aber mit einem Messer kann man nie mehr als ein paar Leute auf einmal töten. Außerdem gibt es keine Bewegung, die sich für Hieb- und Stichwaffen einsetzt wie in Amerika für den Besitz von Feuerwaffen. Ich habe noch keinen Auto-Aufkleber mit einem Schwert und der Aufschrift gesehen: HOL’S DIRODERDENKNOCHMALNACH. WEILICHESNICHTTUE. Einige Tage nach Sandy Hook stieß ich im Netz auf eine Werbeanzeige für das Bushmaster, eine der von Adam Lanza benutzten Waffen. Unter der Abbildung des Sturmgewehrs stand der Satz: DEINAUSWEISALSMANN.
Jeder Amoklauf an einer Schule ist anders und doch gleich. Wir sehen die Bilder in den Nachrichten, die schreienden Kinder, die Haufen von Blumen und Teddybären im Regen. Es gibt Berichte über den »Heilungsprozess« in der Gemeinde, und dann geht es weiter zum nächsten Massaker. Die Lösung liegt, nach Meinung der NRA, darin, mehr Menschen mit Waffen auszustatten. Als Präsident Trump im Anschluss an den Amoklauf in Parkland, Florida, vorschlug, Lehrer zu bewaffnen, rief ich Lisa an, die eher skeptisch klang. »Moment mal«, sagte sie. »Wo hast du das gelesen?«
Ich musste an ein Dinner vor einigen Jahren denken. Meine Schwester begleitete mich an einem Wochenende in Chicago und fragte meinen Freund Adam: »Kennst du eine Zeitung namens The Onion?«
»Selbstverständlich«, sagte er.
»Ich nicht, weißt du? Dann las ich einen Artikel, in dem behauptet wurde, amerikanische Schulen würden, um Geld zu sparen, das Präteritum streichen. Nachdem ich das gelesen hatte, rief ich meinen Mann an und sagte: ›Das schlägt dem Fass den Boden aus.‹ Ich war früher nämlich selbst Lehrerin, und so, wie gegenwärtig die Budgets zusammengestrichen werden, erschien mir das Ganze absolut möglich.«
»Wie will man durch die Abschaffung des Präteritums Geld sparen?«, fragte Adam.
»Keine Ahnung«, sagte Lisa. »Ich glaube, ich hab nicht genau drüber nachgedacht.«
Es ist vermutlich besser so, wenn eine derart leichtgläubige Person nicht mehr vor einer Klasse steht. Dennoch kann ich es ihr nicht verübeln, dass sie die Geschichte mit der Bewaffnung der Lehrer nicht glauben wollte. Wer hätte gedacht, dass es zu guter Letzt ausgerechnet zu diesem Lösungsvorschlag kommen würde? Einige Tage später wurden in Schulen im Blue Mountain School District im Osten Pennsylvanias Eimer mit Flusskieseln in den Klassenräumen aufgestellt, mit denen die Kids mögliche Amokläufer bewerfen sollten.
Ich denke, einige würden tatsächlich nach einem Stein greifen, aber würden die meisten nicht erstarren oder einfach zu weinen beginnen? Ich weiß, dass ich so reagieren würde.
Dann kam Santa Fe, Texas, wo der Schütze zur großen Schande meiner Familie Dimitrios Pagourtzis hieß.
Wir fühlten uns, wie sich vermutlich die Amerikaner koreanischer Abstammung nach der Schießerei an der Virginia Tech fühlten.
»Oh nein«, sagten wir. »Er ist einer von uns!«
Glücklicherweise sah der Vizegouverneur des Staates die Schuld eher bei der Anzahl der Ein- und Ausgänge des Gebäudes als bei den Griechen. »An der Schule, an der ich unterrichtet habe, gibt es jetzt Übungen, wie man sich im Fall eines Amoklaufs verhalten soll«, erzählte mir Lisa. »Die Schüler – meine waren Drittklässler – lernen, das Licht zu löschen und sich in dunkle Ecken zu verkriechen.« Sie seufzte. »Ich bin heilfroh, dass ich das nicht mehr miterleben muss.«
Als meine Schwester und ich klein waren, nahmen wir während der Kubakrise an Übungen im Fall eines Atombombenabwurfs teil. Man denkt jetzt vielleicht, unsere Lehrer hätten uns in Schutzbunker zwölf Stockwerke unter der Erde geführt, aber stattdessen wurden wir aufgefordert, uns unter unsere Tische zu kauern. Was mochten wir gedacht haben, wenn wir mit den Händen über dem Kopf auf dem Boden knieten? Glaubten wir daran, die Bomben würden im schlimmsten Fall ein paar Ziegel vom Dach fegen, und wir würden später nach Hause gehen und alles so vorfinden wie am Morgen? Unsere Eltern, die Haustiere, vielleicht ein wenig Staub auf dem bereitstehenden Mittagessen?
Erschossen zu werden, ist für Kinder einfacher zu begreifen. Wenn man einen Fernseher im Haus hat, weiß man, was ein Gewehr ist und was mit Leuten passiert, die von Kugeln getroffen werden. Man mag vielleicht keine klare Vorstellung vom Tod haben – seiner Endgültigkeit und dass er nicht mit sich handeln lässt –, aber man weiß, dass er schlecht ist. Für uns hingegen – Lisa war damals in der zweiten und ich in der ersten Klasse – war die Atombombe bloß etwas Abstraktes. Wenn ich meine Schwester nach einer Schutzübung im Bus sah – im Kleid und mit Lackschuhen, die Haare ordentlich gekämmt und sehr viel eleganter, als sie es als Erwachsene je war –, fühlte ich mich nicht erleichtert, sondern vielmehr aufgeregt, so, wie es Kindern in dem Alter ergeht, wenn sie am Ende des Tages in die Welt entlassen werden. Oh, zu leben und frei zu sein.
Väterchen Zeit
Am Abend vor der Feier zu seinem fünfundneunzigsten Geburtstag stürzte mein Vater, als er sich in der Küche herumdrehte. Meine Schwester Lisa und ihr Mann Bob kamen einige Stunden später vorbei, um seinen neuen Fernseher anzuschließen, und entdeckten ihn verstört und mit Schmerzen am Boden liegend. Nachdem sie ihn aufgerichtet hatten und er ein zweites Mal fiel, riefen sie einen Krankenwagen. Im Krankenhaus trafen sie mit unserer Schwester Gretchen und mit Amy zusammen, die zur Geburtstagsfeier, die nun abgesagt war, aus New York herübergeflogen war. »Es war wirklich seltsam«, sagte sie, als wir am nächsten Morgen miteinander telefonierten. »Dad dachte, Lisa sei Mom, und als der Arzt ihn fragte, wo er sich befinde, antwortete er: ›Syracuse‹ – dort, wo er zur Schule gegangen ist. Dann wurde er wütend und sagte: ›Sie stellen wirklich eine ganze Menge Fragen.‹ Als ob das nicht normal für einen Arzt wäre. Ich glaube, er hielt ihn für irgendeinen Typen, der sich mit ihm unterhielt.«
Zum Glück war er am folgenden Nachmittag wieder bei klarem Verstand. Das war für alle das Schlimmste gewesen – ihn so verwirrt zu sehen.
An dem Abend, als mein Vater stürzte, war ich in Princeton, New Jersey, gewesen, der vierten von achtzig Städten auf meiner Lesetour. An dem Morgen, als er vom Krankenhaus in ein Rehabilitationszentrum verlegt wurde, befand ich mich auf dem Weg nach Ann Arbor. Im Verlauf der kommenden Woche hatte er einige leichte Schlaganfälle von der Sorte, die die Leute selbst nicht einmal sofort bemerken. Einer beeinträchtigte sein peripheres Sehen, ein anderer sein Kurzzeitgedächtnis. Nach der Reha wollte er zurück nach Hause, aber zu diesem Zeitpunkt war es undenkbar, dass er weiterhin allein lebte.
Ich weiß nicht mehr genau, wo ich war, als mein Vater in ein Heim für betreutes Wohnen einzog. Die Einrichtung heißt Springmoor. Ich sah sie schließlich vier Monate nach seinem Sturz, als Hugh und ich nach North Carolina flogen. Es war Anfang August. Bei unserer Ankunft fanden wir ihn in einem Lehnsessel, aus dem Ohr floss ihm eine in meinen Augen erschreckende Menge Blut. Es sah unecht aus, wie Rote-Bete-Saft, der von einer Pflegerin weggetupft wurde. »Oh hallo«, sagte mein Vater leise mit müde klingender Stimme.
Ich dachte, er würde mich nicht erkennen, aber dann fügte er meinen Namen hinzu und streckte die Hand aus. »David.« Er sah über meine Schulter hinweg. »Hugh.« Irgendwer hatte seinen Kopf mit Mull umwickelt, und als er sich zurücklehnte, erinnerte er an die englische Dichterin Edith Sitwell, er sah äußerst bestimmend aus, beinahe gebieterisch. Seine Augenbrauen waren dünn und kaum zu erkennen. Ebenso die Wimpern. Ich vermute, sie hatten wie die Haare an Armen und Beinen das Angewachsenbleiben einfach sattgehabt.
»Was ist passiert?«, fragte ich, auch wenn ich es längst wusste. Lisa hatte mir am Morgen am Telefon erzählt, dass die Standuhr, die er nach von zu Hause mitgebracht habe, auf ihn gefallen sei. Sie war aus Walnuss und Bronze und hatte als Ziffernblatt ein abstraktes menschliches Gesicht, das von lauter schief stehenden Zahlen eingefasst war. Meine Mutter hatte sie immer als Mr. Creech bezeichnet, nach dem Künstler, der sie angefertigt hatte, aber mein Vater nennt sie Väterchen Zeit.
Nach dem Telefonat mit Lisa hatte ich zu Hugh gesagt: »Wenn man fünfundneunzig ist, und Väterchen Zeit streckt einen buchstäblich zu Boden, glaubst du nicht, dass er einem damit etwas sagen will?«
»Er bestand darauf, sie selbst zu verrücken«, sagte die Frau, die das Blut zu stoppen versuchte, »und dann ist sie an seinem Ohr entlanggeschrammt. Sie haben es im Krankenhaus genäht, aber jetzt ist es wieder aufgegangen, vielleicht wegen der Blutverdünner, deshalb haben wir einen Krankenwagen gerufen.« Sie wandte sich an meinen Vater und sagte mit lauter Stimme: »Nicht wahr, Lou? Wir haben einen Krankenwagen bestellt!«
In dem Moment platzten zwei Rettungssanitäter ins Zimmer, beide jung und bärtig wie Holzfäller. Sie packten meinen Vater am Ellbogen und halfen ihm auf die Beine.
»Gehen wir irgendwohin?«, fragte er.
»Zurück ins Krankenhaus!«, rief die Frau.
»Na schön«, sagte mein Vater. »Nur zu.«
Sie schoben ihn im Rollstuhl nach draußen, und die Frau erklärte, die Blutflecken auf dem Teppich würden vom Personal entfernt, doch die Reinigung privater Möbelstücke sei Aufgabe der Familienangehörigen. »Ich kann Ihnen ein paar Handtücher bringen«, schlug sie vor.
Kurz darauf kam eine weitere Pflegerin ins Zimmer. »Entschuldigen Sie«, sagte sie, »aber sind Sie der berühmte Sohn?«
»Ich bin eine ziemlich faule Ausrede für Berühmtheit«, sagte ich. »Aber ja, ich bin sein Sohn.«
»Dann sind Sie Dave? Dave Chappelle? Können Sie mir ein Autogramm geben? Besser gesagt, kann ich zwei bekommen?«
»Ähm, sicher«, sagte ich.
Ich hatte gerade damit begonnen, Hugh bei der Reinigung des Polstersessels zu helfen, als die Frau, die leicht nervös schien, wie es sich in der Gegenwart eines weltberühmten Comedians nicht vermeiden lässt, der jung und schwarz ist und sein ganzes Leben noch vor sich hat, zurückkehrte und um zwei weitere Autogramme bat.
»Ich bin der schlimmste Sohn auf der ganzen Welt«, sagte ich und griff nach den Zetteln, die sie mir hinhielt. »Mein Vater ist am siebten April gestürzt, und heute ist das erste Mal, dass ich ihn besuche, das erste Mal, dass ich überhaupt mit ihm rede.«
»Sie sind zu streng mit sich«, sagte sie. »Greifen Sie nur hin und wieder zum Telefon – so mache ich das mit meiner Mutter.« Sie lächelte mich nachsichtig an. »Sie können das zweite Autogramm für meinen Vorgesetzten ausstellen.« Dann nannte sie mir einen Namen.
Das Blut auf unseren feuchten Lappen sah noch künstlicher aus als das, welches meinem Vater aus dem Ohr geflossen war. Ich wischte ein paarmal halbherzig über den Sessel, die meiste Arbeit machte aber Hugh. Hauptsächlich betrachtete ich die Dinge, mit denen mein Vater sein Zimmer dekoriert hatte: Väterchen Zeit, einige der Straßenszenen, die er und meine Mutter in den Siebzigern gekauft hatten, Steine, die er von seinen Angelausflügen mitgebracht hatte, jeder mit einem Datum und dem Namen des Flusses versehen, aus dem er stammte. Auf mich wirkte das alles furchtbar deprimierend. Andererseits hätte selbst ein Einhorn an diesem Ort trostlos ausgesehen. Ich weiß nicht, ob es an der Beleuchtung lag oder an der Deckenhöhe. Vielleicht waren es auch das Krankenhausbett an der Wand oder die bodenlangen Vorhänge, die aussahen, als stammten sie aus einem Beerdigungsinstitut. Am Ende des Flurs sahen sich etwa ein Dutzend Bewohner, die meisten davon in Rollstühlen und in umgehängte Lätzchen sabbernd, im Fernsehen eine Folge von M*A*S*H an.
Ich musste an Mayview denken, das Pflegeheim, in dem mein Vater meine Mutter Mitte der Siebzigerjahre untergebracht hatte. Es kam mir wie gestern vor, dass ich sie dort mit ihm besucht hatte. Und wenn ich ihn nun hier an einem ähnlichen Ort besuchte, wäre nicht ich selbst im Handumdrehen in einem Heim für betreutes Wohnen, ein gebrechlicher Witwer, der sich mit einem einzigen Zimmer zufriedengeben muss? Bloß hätte ich keine Kinder, die nach mir sehen würden, so, wie mein Vater Lisa hatte, die sich großartig um ihn gekümmert hatte, sowie meinen Bruder Paul und Amy und Gretchen. Meine Schwägerin Kathy hatte alle übertroffen und kam manchmal sogar zweimal am Tag vorbei, um Dad zum Mittagessen zu begleiten oder ihm die Füße einzucremen. Ich war die einzige Ausnahme. Ich. Dave Chappelle.
»Darf ich ein Foto mit Ihnen machen?«, fragte eine der Schwestern auf dem Weg nach draußen.
»Ach, Moment, ich will auch eins«, sagte eine andere Frau und danach noch eine.
»Sieh nur«, hörte ich sie nachher zu Leuten sagen, »ich hab ein Foto von mir und Dave Chappelle.«
»Das ist er aber nicht«, würde man ihnen erklären.
Natürlich wäre ich bis dahin längst über alle Berge. Wie immer.
Von Springmoor aus fuhren Hugh und ich zur See-Zierung, unserem Haus auf Emerald Isle. Wenige Tage später kam sein älterer Bruder John zu Besuch und brachte zwei Jungen mit: seinen siebenjährigen Enkel Harrison und Harrisons Halbbruder Austin, der elf war. Alle drei leben in einer Kleinstadt an einer Meerenge ein paar Stunden westlich von Seattle. Die Jungen hatten noch nie Wasser erlebt, in das man hineinlaufen konnte, ohne vor Kälte zu schreien. Sie hatten noch nie feinen Sand und Pelikane gesehen. Ich dachte, sie wären begeistert, aber es war schwer, sie von der Spielekonsole wegzulotsen, die sie aus Washington mitgebracht hatten, eine Nintendo Switch.
»Wie?«, rief Harrison verärgert, nachdem er sich im Haus umgesehen hatte. »Du hast keinen Fernseher, an den wir das Teil anschließen können?«
Er gehörte zu den Kindern, die das Stadium süß übersprungen hatten und gleich zu gut aussehend übergegangen waren. Ich dachte daran, dass sich dies in den kommenden Jahrzehnten noch ändern könnte. Vielleicht würde seine Nase überproportional zum restlichen Gesicht wachsen. Oder er könnte durch irgendeinen Unfall sein Kinn oder eine Wange verlieren. Aber selbst dann hätte er immer noch seine Augen, die kornblumenblau waren, und seinen vollen, fast femininen Mund, dessen Unterlippe etwas voller war als die Oberlippe. Wohin wir auch kamen, stets war er die attraktivste Person im Raum. Ist ihm das bewusst?, fragte ich mich. Kinder seines Alters kümmert das in der Regel nicht.
Abgesehen vom Aussehen, waren Harrison und sein Halbbruder, die beide bei ihrer Mutter leben, alles andere als verzogen. Die Nintendo-Konsole hatten sie im Frühjahr von John bekommen. Zu Hause durften sie keine haben, und nach wenigen Stunden verstand ich auch, warum. Sie war morgens die erste Beschäftigung und abends die letzte vor dem Schlafengehen, wobei es an den meisten Abenden weit nach eins war.
Die Jungen schienen keine Regeln zu kennen, anders als ich in ihrem Alter. »Du kannst nicht einfach vom Tisch aufstehen«, sagte ich zu Harrison am ersten Abend ihres Besuchs, als er fertig mit essen war und Minecraft spielen wollte. »Du musst fragen, ob du gehen darfst.«
»Nein, muss ich nicht.«
»Nein, muss ich nicht, Mr. Sedaris.« Ich bestand darauf, dass sie meinen Namen sagten, und verbesserte sie, wenn sie es vergaßen. »Ich bin ein Erwachsener, und ihr seid Gäste in meinem Haus.«
»Es ist nicht dein Haus, es gehört Hugh«, sagte Harrison.
Hugh sah von seinem Teller auf. »Er hat recht. Sieh im Kaufvertrag nach. Da steht mein Name.«
»Ja, schon, aber ich habe es bezahlt«, sagte ich.
Harrison verdrehte die Augen. »Ja, eben.«
Am folgenden Nachmittag kam ich von meinem Schreibtisch nach unten und fand ihn und seinen Halbbruder beim Zocken auf dem Sofa.
»Warum legt ihr den Nintendo nicht einfach mal zur Seite und schreibt einen Brief an eure Mutter?«, sagte ich.
Harrison stieß Austin an: »Achtung vor Fremden.« Offenbar hatten sie das in der Schule gelernt. »Nicht antworten.«
»Ich bin kein Fremder, ich bin euer Gastgeber, und es täte euch gut, wenn ihr euch zur Abwechslung ein wenig an mir orientieren würdet.«
»Was ist denn so toll an dir?«, fragte Harrison.
»Zwei Dinge«, sagte ich, während ich fieberhaft nach Gründen suchte. »Ich bin reich, und ich bin berühmt.«
Er schüttelte den Kopf, den Blick fest auf sein Spiel gerichtet. »Ich glaube dir kein Wort.«
»Hugh!«, rief ich. »Sagst du Harrison mal, dass ich reich und berühmt bin?«
»Ich glaube, er ist draußen am Strand«, sagte Austin, die Augen wie die seines Halbbruders an der taschenbuchgroßen Konsole klebend, die sie sich teilten. »Was hast du gemacht, um berühmt zu werden?«
»Bücher geschrieben«, sagte ich.
»Na, ich hab noch von keinem gehört«, erklärte Harrison.
»Das liegt daran, weil du erst sieben bist«, erwiderte ich, gekränkter, als ich zugeben möchte. »Erwachsene kennen mich. Vor allem Pflegekräfte.«
Später am Nachmittag sah Hugh zum vierten Mal in dieser Woche jemanden, der Fotos von unserem Haus machte. »Ich glaube, sie haben dein letztes Buch gelesen«, meinte er.
»Siehst du!«, rief ich Harrison im Nebenzimmer zu.
Er war mit seiner Konsole beschäftigt und antwortete nicht.
»Vermutlich fotografieren sie bloß den Namenszug See-Zierung«, sagte ich zu Hugh. »Ist ja auch ein ziemlich guter Name für ein Strandhaus.« Ich erzählte ihm von einem Haus weiter oben an der Küste, von dem ich durch unseren Nachbarn Bermey erfahren hatte, das den Namen DASHASTDUNICHTGEKRIEGT, MISTSTÜCK trug. »Das wird vermutlich auch oft fotografiert. Vor allem von geschiedenen Männern.«
Das Fotografieren auf der Straßenseite des Hauses war gar nichts im Vergleich zu dem, was hinterm Haus los war. Als ich jung war, legten Meeresschildkröten ihre Eier am Strand ab, und niemand machte viel Aufhebens darum. Heute jedoch ist das eine Riesensache. Überall sieht man Aufkleber und Schilder mit Schildkröten drauf. Sie sind eine Attraktion, genau wie die Wildpferde bei Ocracoke. Die Stelle, wo sie ihre Eier abgelegt haben, wird markiert, und wenn die Jungen schlüpfen, schickt die Schildkrötenstreife ein Team Freiwilliger.
Am Fuß der Holztreppe, die von unserem Haus zum Strand führt, war ein leuchtend gelber Pfahl in den Boden gerammt worden, und am Morgen nach der Ankunft der Jungen gruben Freiwillige einen Graben, der den frisch geschlüpften Tieren den Weg zum Meer erleichtern sollte. Jetzt war der Graben auf beiden Seiten von Klappstühlen gesäumt, und die Schildkrötenstreife bewachte das Gelege. »Das ist wie der rote Teppich bei den Academy Awards«, sagte ich zu Hugh.
Strandspaziergänger, die das gelbe Sicherheitsband und den von Helfern in leuchtenden Turtle-Patrol-T-Shirts bewachten Graben sahen, kamen angeschlendert, um Fragen zu stellen, und die Menge wurde immer größer. Nachts saßen sie mit Infrarottaschenlampen da und starrten, die Kameras im Anschlag, angestrengt nach der leisesten Bewegung im Sand.
»Tatsächlich bezeichnet man das Schlüpfen der Schildkröten auch als boil«, erklärte mir Kathy. »Denn wenn die Schildkröten aus dem Ei schlüpfen und sich an die Oberfläche arbeiten, brodelt der Sand, und es sieht aus, als würde er kochen.«
»Ist das nicht spannend?«, sagte ich zu den Jungen.
»Mhm-mhm. Klar«, erwiderten sie.
»Im Ernst?«, sagte ich. »Ihr interessiert euch nicht für die Natur?« Als ich in ihrem Alter war, war das so ziemlich mein einziges Interesse – die Natur und Leute zu beklauen und zu bespitzeln. Ich erzählte ihnen von dem hässlichen silbernen Opossum, das letztes Thanksgiving die Treppe zum Haus hochgeklettert war. »Wir haben es mit Obst und Essensresten gefüttert, und ihr hättet sehen sollen, wie es die mit den Pfoten griff, beinahe wie ein Mensch. Es kam jeden Abend.«
Austin sagte höflich, aber gelangweilt: »Wow.«
Die einzige Art, die Aufmerksamkeit der Jungs zu bekommen, bestand darin, eine der Stinkbomben zu werfen, die ich in der Vorwoche auf Cape Cod gekauft hatte. Ich hatte gedacht, der Gestank sei erträglich – vielleicht wie der einer alten Socke –, aber er leerte nicht nur das Zimmer, in dem die Jungen Mario Kart spielten, sondern gleich eine ganze Haushälfte. Es roch vor allem nach Schwefel, so, wie ich es mir im Bad des Teufels vorstelle, wenn er eine Weile mit der National Review auf der Toilette gesessen hatte.
»Verdammt noch mal«, fluchte Hugh, der mit zugekniffener Nase alle Vorder- und Hintertüren aufriss und die heiße, schwüle Luft hereinließ. »Und obendrein erwarten wir auch noch Gäste!«
»Warum nur du … Buchschreiber«, schimpfte Harrison. Er trug einen Minecraft-Schlafanzug und sah aus wie ein männliches Model, das man in eine Maschine gesteckt und geschrumpft hatte.
Von den beiden Brüdern war Austin der umgänglichere. Er stellte Fragen und bot seine Hilfe an. Seine Stimme hatte etwas Altmodisches, wie die eines Jungen aus einer Radioserie. Man konnte sich vorstellen, wie er »Potzblitz!« rief, wenn dies der Name eines Computerspiels wäre, in dem Dinge in die Luft flogen und Frauen in den Hinterkopf geschossen wurde.
Verglichen mit anderen Kindern, die ich kenne, waren die beiden eigentlich ziemlich nett. Sie mochten Fisch und aßen stets ihre Teller leer. Sie stritten sich auch nicht, und, wenn doch, war es nach ein oder zwei Minuten vorbei. Es gab kein Heulen und, noch besser, kein Schmollen. Das kann ich nämlich gar nicht ertragen. »Um Gottes willen, es reicht«, sagte meine Mutter, wenn wir finster vor uns hin starrten und schworen, niemals die Ungerechtigkeit von zerquetschtem Eiersalat oder zerbröselten Kartoffelchips zu vergessen, die unten in der Tasche gelegen hatten.