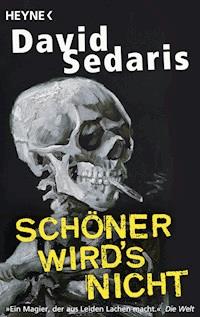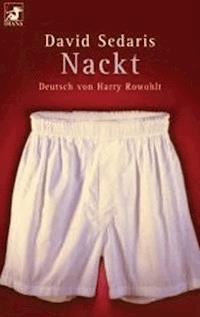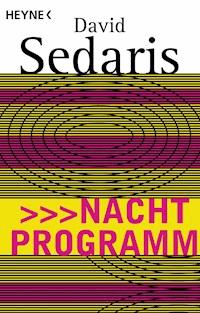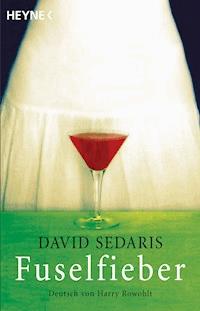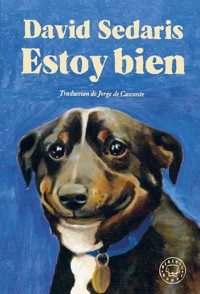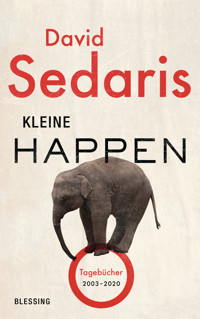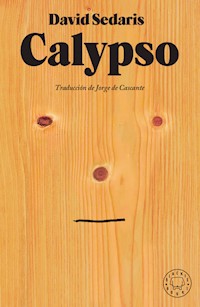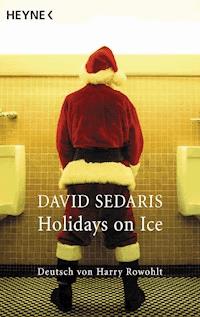14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nackt" war erst der Anfang - jetzt kommt die Fortsetzung!
David Sedaris schreibt hier seinen mit dem Erfolgstitel "Nackt" begonnenen "Roman in autobiographischen Geschichten" fort. Noch einmal wirft der Autor einen Blick zurück in die Kindheit. Wir erleben Davids Vater und dessen Jazz-Leidenschaft, gehen mit Klein David zur Logopädin, begleiten den Kunststudenten David zum ersten Mal in den Aktsaal und beobachten, wie aus David "Mr. Sedaris" wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Auch in Ich ein Tag sprechen hübsch wirft der Autor einen Blick zurück in die Kindheit: Wir erleben den Vater und seine Jazz-Leidenschaft, die zu dem übermenschlichen Versuch führt, aus den Familienmitgliedern ein zweites Dave-Brubeck-Quartett zu formen. Wir gehen mit Klein- David zur Logopädin, um dem Lithpeln den Garauth thu machen und betreten mit dem Kunststudenten David, bewaffnet mit Rötelstift und Zeichenblock, zum ersten Mal den Aktsaal. Und wir beobachten, wie aus David Mr. Sedaris wird, als dieser zur Überraschung aller zum Dozenten für ›Kreatives Schreiben‹ ernannt wird — bevor David Sedaris sich im Alter von 41 Jahren plötzlich selber auf der Schulbank wiederfindet: in einem Französischkurs für Ausländer in Paris.
Der Autor
David Sedaris, geboren 1956 in Johnson City, New York; wuchs auf in North Carolina; studierte Kunst und arbeitete als Dozent für ›Kreatives Schreiben‹ sowie als Putzmann; seine frühen Texte las er als Kolumnist in Amerikas Kultur-Radiosender National Public Radio; Kultstatus erlangten seine Weihnachstland-Tagebücher; sie machten den Autor und seine unverwechselbare Stimme berühmt, noch bevor Fuselfieber, das erste Buch mit gesammelten Radio-Kolumnen und anderen Texten, erschien. Der Durchbruch gelang David Sedaris mit seinem autobiografischen Familienroman Naked: das New York-Magazin kürte ihn zum »witzigsten New Yorker seit Dorothy Parker«; David Sedaris verließ schleunigst die Stadt und zog nach Frankreich, wo er seither lebt. Ich ein Tag sprechen hübsch handelt von seinem Leben dort.
Außerdem lieferbar: Holidays on Ice-Fuselfieber-Nachtprogramm -Naked
Für meinen Vater, Lou
Inhaltsverzeichnis
Eins
Carolina vor!
(Go Carolina)
Jeder, der auch nur ab und zu den Fernseher einschaltet, kennt die Szene: Ein Agent klopft an eine scheinbar ganz gewöhnliche Haus- oder Bürotür. Sobald geöffnet wird, fragt der Agent die Person in der Tür nach ihrem Namen. Dann sagt er: »Ich muß Sie bitten, mit mir zu kommen.«
Sie sind immer bewundernswert gelassen, diese Agenten. Wenn sie gefragt werden: »Warum, bitte schön, soll ich mit Ihnen mitkommen?« zupfen sie nur kurz an ihrer Manschette oder entfernen seelenruhig ein Haar vom Ärmel ihres Trenchcoats und antworten: »Ich denke, wir wissen beide, warum.«
Je nachdem, ob der Verdächtige sich für die harte oder die sanfte Tour entscheidet, endet die Szene mit einer Schießerei oder wie unter Gentlemen mit dem Anlegen der Handschellen. In Ausnahmefällen liegt eine Verwechslung vor, aber normalerweise weiß der Verdächtige genau, warum er abgeholt wird. Er scheint sogar darauf gewartet zu haben. Nachdem sein ganzes Leben von diesem Gedanken beherrscht war, hat das Warten nun endlich ein Ende. Manchmal soll es so aussehen, als sei der Betroffene geradezu erleichtert, aber das habe ich denen nie abgekauft. So reizvoll das Leben im Knast sein mag, ein Tag auf der Flucht schlägt einen normalen Tag im Gefängnis immer noch um Längen. Spätestens wenn die Frage ansteht, wer die untere Schlafpritsche bekommt, wird jeder einsehen, daß die Entscheidung für die harte Tour einiges für sich hat.
In meinem Fall erschien die Agentin während des Erdkundeunterrichts. Sie trat in den Raum und nickte der Lehrerin der fünften Klasse zu, die stirnrunzelnd neben einer Landkarte von Europa stand. Was mich hinterher besonders fuchste, war die Erkenntnis, daß das Ganze ein abgekartetes Spiel war. Meine Festnahme war auf Donnerstagnachmittag, Punkt zwei Uhr dreißig festgesetzt worden. Die Agentin trug ein dungfarbenes Jackett über einem roten Strickkleid mit Rollkragen und natürlich Schuhe ohne Absätze, falls der Verdächtige versuchen sollte zu fliehen.
»David«, sagte die Lehrerin. »Das hier ist Miss Samson, die dich bittet, mit ihr zu kommen.«
Sonst wurde niemand aufgerufen, warum also ausgerechnet ich? Im Schnelldurchlauf ging ich die Liste meiner jüngsten Schandtaten durch, wo man mir vielleicht was anflicken konnte. Das angeblich feuerfeste Halloween-Kostüm, das ich abgefackelt hatte, die Entwendung einer Grillzange von einer unbewachten Veranda, die kleine Veränderung an dem Wort reißen auf der Hausordnung an der Tür zur Turnhalle; nie wäre ich auf den Gedanken gekommen, ich könnte unschuldig sein.
»Nimm lieber gleich deine Bücher mit«, sagte die Lehrerin. »Und deine Jacke. Ich glaube nicht, daß du vor dem Klingeln zurück bist.«
Damals kam mir die Agentin alt vor, aber vermutlich war sie frisch vom College. Sie lief neben mir her, um plötzlich eine scheinbar harmlose, wenngleich völlig abwegige Frage zu stellen: »Wen findest du besser, State oder Carolina?«
Ihre Frage bezog sich auf die sportliche Rivalität der beiden größten Universitäten unseres Bundesstaates. Wer sich darum scherte, trug als Zeichen seiner Anhängerschaft entweder Tar-Heel-Kobaltblau oder Wolf-Pack-Rot, beides Farben, die niemandem standen. Die Frage, für welches Team man schwärmte, gehörte in unserem Teil North Carolinas zum Alltag, und die Antwort sprach nach allgemeinem Dafürhalten Bände, wer man war oder einmal werden wollte. Mich interessierte weder Fußball noch Basketball, aber ich hatte gelernt, das für mich zu behalten. Wenn ein Junge sich nichts aus Grillhähnchen oder Kartoffelchips machte, nahm man ihm das nicht weiter übel und sagte: »Nun denn, die Geschmäcker sind eben verschieden.« Man durfte über den Präsidenten, Coca-Cola und sogar über Gott herziehen, doch wer als Junge keinen Sport mochte, hatte gleich seinen Ruf weg. Kam das Thema zur Sprache, fragte ich gewöhnlich mein Gegenüber nach seiner Lieblingsmannschaft und erwiderte dann: »Echt? Ich auch!«
Als die Agentin mich nun danach fragte, hielt ich mich an ihr rotes Strickkleid und erklärte, ich wäre State-Fan. »Natürlich State. Immer schon gewesen.«
Noch Jahre später sollte ich diese Antwort bereuen.
»Hast du State gesagt?« fragte die Agentin.
»Ja, State. Das sind die Größten.«
»Verstehe.« Sie führte mich durch eine unbeschriftete Tür neben dem Büro des Rektors in einen schmalen, fensterlosen Raum mit zwei einander gegenüberstehenden Tischen. Es war die Sorte Raum, in dem man Leute bearbeitet, bis sie weichgeklopft sind, und die regelmäßig einen frischen Anstrich erhalten, um die Blutflecken zu übertünchen. Sie wies mir einen Stuhl an, der fortan zu meinem Stammplatz wurde, und fuhr in ihrer Befragung fort.
»Und was genau sind State und Carolina?«
»Colleges? Universitäten?«
Sie schlug eine Mappe auf ihrem Schreibtisch auf und sagte: »Stimmt. Die Antwort ist völlig korrekt, nur sprichst du die Wörter falsch aus. Du sagst College th und Univerthitäten, aber richtig muß es Colleges und Universitäten heißen. Du sprichst die Wörter mit einem zischelnden, statt mit einem sauber artikulierten s aus. Du hörst doch den Unterschied zwischen beiden Lauten, stimmt’s?«
Ich nickte.
»Stimmt’s?«
»Mmh.«
»›Mmh‹ ist kein Wort.«
»Okay.«
»Okay, was?«
»Okay«, sagte ich. »Ich hör ihn.«
»Sicher, ganz sicher?«
»Genau.«
Es war mein erstes Scharmützel im Krieg gegen den Buchstaben s, und ich war fest entschlossen, noch vor Sonnenuntergang meine Verteidigungsstellung auszuheben. Laut Agentin Samson, einer diplomierten Sprachtherapeutin, war mein s sibiliert, oder anders gesagt, ich lithpelte. Das war mir nicht neu.
»Wir werden gemeinsam arbeiten, bis deine Aussprache stimmt«, sagte Agentin Samson. Die übertriebene Art, in der sie ihr makelloses s aussprach, raubte einem den letzten Nerv. »Ich versuche dir zu helfen, aber je länger du diese dummen Spielchen treibst, desto länger wird es dauern.«
Die Tatsache, daß die Frau mit einem starken westlichen North-Carolina-Akzent sprach, reichte mir, ihre Autorität anzuzweifeln. Die Menschen in dieser Gegend tranken aus Tonkrügen und brüllten nach Vattern, wenn das Essen aufn Tisch stand – und so eine glaubte, mir Ratschläge erteilen zu können? Irgendeine Macke entdeckte ich an allen Sprachtherapeuten, die sich in den folgenden Jahren dem widmeten, was Miss Samson meine faule Zunge nannte. »Genau das ist das Problem«, sagte sie. »Deine Zunge ist einfach bloß faul.«
Meine Schwestern Amy und Gretchen waren zur gleichen Zeit wegen ihrer faulen Augen in Behandlung, während meine ältere Schwester Lisa mit einem faulen Bein auf die Welt gekommen war, das sich weigerte, genauso schnell wie sein Zwilling zu wachsen. In den ersten beiden Jahren hatte sie eine Beinschiene getragen und damit eine Spur der Verwüstung auf dem Kiefernparkett hinterlassen. Mir gefiel der Gedanke, daß ein Körperteil faul war – nicht gedankenlos oder feindselig, sondern einfach nur unwillig, sich zum Wohl der übrigen Mannschaft ins Zeug zu legen. Mein Vater warf meiner Mutter oft vor, faul im Geiste zu sein, während sie ihm seinen faulen Zeigefinger vorhielt, der zu bequem war, eine Telefonnummer zu wählen, obwohl er genau wußte, daß er später nach Hause kommen würde.
Meine Therapiesitzungen waren immer donnerstags um halb drei, doch redete ich außer mit meiner Mutter mit niemandem darüber. Allein das Wort Therapie schien ein kapitales Versagen meinerseits zu beinhalten. Geistesgestörte mußten zur Therapie. Normale Menschen nicht. Ich betrachtete meine Sitzungen als etwas, das man besser nicht groß hinausposaunte, aber wie meine Lehrerin zu sagen pflegte: »Sowas kann doch jedem passieren.« Ich war bestrebt, die Sache geheimzuhalten, sie, die ganze Klasse davon zu unterrichten. Wenn ich um 2:25 Uhr von meinem Platz aufstand, sagte sie: »Setz dich wieder hin, David. Deine Sprachtherapie beginnt erst in fünf Minuten.« Blieb ich bis 2:27 Uhr sitzen, hieß es: »David, vergiß nicht, daß du um halb drei zur Sprachtherapie mußt.« War ich krank zu Hause, stellte ich mir vor, wie sie vor der Klasse verkündete: »David ist heute nicht hier, aber wenn, hätte er jetzt Sprachtherapie.«
Meine Sitzungen waren von Woche zu Woche unterschiedlich. Manchmal plapperte ich dreißig Minuten lang wie ein Papagei Sätze von Agentin Samson nach. Gelegentlich betrachteten wir Schaubilder zur Zungenstellung oder lasen Vorschul-Geschichten mit lauter s-Lauten, in denen es um die Abenteuer von Seehunden oder Siedlern ging, die Sassy oder Samuel hießen. Am schlimmsten waren die Tage, an denen sie ihren Kassettenrecorder hervorholte, um mir zu demonstrieren, wie wenig Fortschritte ich machte.
»Meine Sprachtherapeutin heißt Miss Chrissy Sams on.« Sie drückte mir das Mikro in die Hand und lehnte sich mit verschränkten Armen zurück. »So, und jetzt du. Ich will, daß du hörst, wie es- bei dir klingt.«
Sie war vernarrt in den Klang ihres Namens und schien meinen Sprachfehler als persönlichen Angriff zu nehmen. Wenn ich den Rest meines Lebens als David Thedarith herumlaufen wolle, sei das meine Sache. Sie jedenfalls lege Wert darauf, als Miss Chrissy Samson angesprochen zu werden. Ohne ein s in ihrem Namen wäre sie vermutlich nie Sprachtherapeutin geworden, sondern hätte sich darauf verlegt, den Leuten gesunde Backenzähne rauszureißen oder ungewollte Klitorisbeschneidungen an afrikanischen Schulmädchen vorzunehmen. Das entsprach ihrer Persönlichkeit.
»Immer halblang«, sagte meine Mutter. »Ich bin sicher, so schlimm ist sie nun auch wieder nicht. Gib ihr eine Chance. Das Mädel versucht doch bloß, seinen Job zu erledigen.«
Als ich einmal ein paar Minuten zu früh in ihr Büro schneite, war Agentin Samson noch mit Garth Barclay beschäftigt, einem schmächtigen, verzärtelten Jungen, den ich aus der vierten Klasse kannte. »Du wartest bitte draußen im Flur, bis du an der Reihe bist«, sagte sie. Ein oder zwei Wochen darauf platzte Steve Bixler, der nur in abgehackten Sätzen redete, in meine Sitzung. Er steckte den Kopf zur Tür herein und erklärte, er könne Freitag nicht kommen, weil er mit seinen Eltern übers Wochenende wegfahre. »Ich wollte eth Ihnen nur thagen.«
Ich begann damit, die Tür zum Sprechzimmer im Auge zu behalten und mir zu merken, wer alles kam und ging. Hätte ich auch nur einen beliebten Schüler aus dem Raum kommen sehen, hätte ich meiner Mutter glauben und mein Lispeln als etwas betrachten können, das jeden treffen konnte. Leider sah ich nie einen beliebten Schüler. Chuck Coggins, Sam Shelton, Louis Delucca: Ganz offensichtlich existierte ein Zusammenhang zwischen einem sibilierten s und einem einschlägigen Desinteresse an der Frage State oder Carolina.
Nicht ein einziges Mädchen ging zur Therapie. Es waren ausnahmslos Jungen wie ich, die Fotoalben ihrer Kinostars anlegten und ihre eigenen Vorhänge schneiderten. »Das ist doch nichts für dich«, bekamen wir von den Männern in unseren Familien zu hören. »Das ist Mädchenkram.« Waffeln oder Törtchen für den Hausmeister zu backen, mit unseren Müttern Die Springfield Story zu sehen, Rosenblätter zur Herstellung eines Duft-Potpourris zu sammeln – jede sinnvolle Beschäftigung erwies sich als Mädchenkram. Um auf unsere Kosten zu kommen, legten wir uns ein zweites Gesicht zu. Auf den Cosmopolitan -Stapel kam oben ein ungelesenes Exemplar von Boy’s Life oder Sports Illustrated, während wir unsere Ausschneidearbeiten unter der Sportausrüstung versteckten, um die wir nie baten, aber stets bekamen. Die Frage, was wir einmal werden wollten, bogen wir heimlich so um, daß wir aufzählten, mit wem wir später gern ins Bett wollten: »Polizist oder Feuerwehrmann oder einer von den Burschen, die auf Hochspannungsmasten herumklettern.« Wir täuschten Krankheiten vor und ließen unsere Mütter für den Tag Entschuldigungen schreiben, an dem das schulinterne Softballturnier stattfand. Brian hatte einen Darminfekt, und Ted hatte offenbar die Ein-Tages-Grippe erwischt, die gegenwärtig kursierte.
»Eines schönen Tage bringe ich draußen an der Tür ein Schild an«, sagte Agentin Samson immer. Ihr schwebte wohl so etwas wie SPRECHZIMMER FÜR SPRACHTHERAPIE vor, obwohl AMERIKAS ZUKÜNFTIGE HOMOSEXUELLE die Sache weit besser getroffen hätte. Da brachen wir uns einen ab, um nur bloß nicht aufzufallen, und zuletzt verriet uns unsere Zunge. Wenn wir uns zu Beginn des Schuljahrs auf die Schulter klopften, weil wir es geschafft hatten, bei den anderen als normal durchzugehen, stand Agentin Samson bereits im Lehrerzimmer und ließ sich von der versammelten Lehrerschaft die Namen durchgeben: »Ich habe morgens immer einen beim Schulappell«, oder: »Bei mir sind zwei in der vierten Mathe-Klasse.« Konnten die auf die gleiche Tour die zukünftigen Alkoholiker und Depressiven herauspicken? Hofften sie, uns mit der Behebung unseres Lispelns auf eine andere Bahn zu bringen, oder wollten sie uns bloß auf eine Karriere als Tänzer oder Schauspieler vorbereiten?
Agentin Samson wies mich an, zur Bildung des s die Zungenspitze von innen gegen die oberen Schneidezähne zu setzen, genau dort, wo das Zahnfleisch begann. Das entstehende Geräusch war dem von entweichender Luft aus einem Reifen nicht unähnlich. Es klang so seltsam und peinlich, daß es noch weit mehr auffiel als mein Lispeln. Ich jedenfalls sah in dem Reifenpannen-s keine Lösung des Problems und redete wie immer; zumindest zu Hause, wo meine faule Zunge auf nicht weniger faule Ohren stieß. In der Schule, wo jeder Lehrer ein potentieller Spion war, versuchte ich den s-Laut nach Möglichkeit zu umgehen. Aus »sagen« wurde »verlautbaren« oder »artikulieren«, »sehen« wurde »erblikken«, ich packte weniger meine »Sachen« ein denn meine »Habe«. Nach mehrwöchentlichem »Vollsülzen«, wie meine Mutter es nannte, während ich von einer »wiederholt vorgetragenen Bitte« sprach, bekam ich ein Handbuch Sinn- und sachverwandte Wörter, das mich in beinahe jeder Situation mit s-freien Alternativen versorgte. Ich benutzte das Buch zu Hause wie auch in der schulischen Lerngruppe, die meine Mitschüler als ihre Klasse bezeichneten. Agentin Samson zeigte sich von meiner Wortakrobatik wenig begeistert, aber nahezu sämtliche Lehrer waren entzückt. »Was für ein ausgesuchtes Vokabular«, schwärmten sie. »Unglaublich, diese Redegewandtheit!«
Manche Personalformen waren problematischer als andere, aber ich mogelte mich rum, wo es eben ging. Statt: »Kannst du mir helfen?« sagte ich: »Ich könnte Hilfe gebrauchen«, oder: »Hilft mir wer?« Auch der Genitiv bereitete mir einiges Kopfzerbrechen, und manchmal war es einfach besser zu schweigen, als laut zu verkünden, die Handschuhe von Janet lägen vor der Tür zum Raum von ihrer Lerngruppe. Nach dem vielen Lob, das ich für meinen exklusiven Wortschatz eingeheimst hatte, schien es nur klug, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Die anderen sollten schließlich nicht denken, ich wolle mich zum Lieblingskind der Lehrer machen.
Zu Beginn meiner Sprachtherapie quälte mich der Gedanke, der Agentin-Samson-Plan könne bei allen anderen funktionieren, außer bei mir, so daß die anderen Jungen ihre Zungen flottbekämen, ihr Leben umkrempelten und nur ich einsam und abgeschlagen zurückbliebe. Zum Glück waren derartige Befürchtungen unbegründet. Trotz größter Anstrengungen unserer Lehrerin war bei niemandem irgendeine merkliche Verbesserung auszumachen. Der einzige Unterschied war, daß wir alle schweigsamer geworden waren. Dank des Kassettenrecorders von Agentin Samson hatte ich eine klare Vorstellung vom Klang meiner Stimme gewonnen. Natürlich war da das Lispeln, aber noch viel beunruhigender war der Klang meiner Stimme, schrill und piepsig wie die eines Mädchens. Wenn ich mich mittags in der Cafeteria meine Bestellung aufgeben hörte, drehte sich mir der Magen um. Wie konnte überhaupt irgend jemand diese Stimme ertragen? Alle um mich herum würden später Anwälte oder Filmstars werden, nur mir bliebe keine andere Wahl, als ein Schweigegelübde abzulegen und Mönch zu werden. Meine alten Klassenkameraden würden im Kloster anrufen, um sich nach mir zu erkundigen, und der Vorsteher würde antworten: »Sie können nicht mit ihm reden! Wissen Sie, Bruder David hat seit fünfunddreißig Jahren mit niemandem mehr gesprochen.«
»Mach dich nur nicht verrückt«, sagte meine Mutter. »Deine Stimme wird schon noch.«
»Und was, wenn nicht?«
Sie verdrehte die Augen. »Sei nicht so makaber.«
Wie sich herausstellte, war Agentin Samson eine Art rotierende Sprachtherapeutin. Sie kam für jeweils vier Monate an eine Schule, bevor sie an die nächste versetzt wurde. Unsere letzte Sitzung fand einen Tag vor den Weihnachtsferien statt. Sämtliche Klassenräume und Flure waren geschmückt, nur ihr Sprechzimmer war so nackt wie am ersten Tag. Ich hatte mich schon auf die übliche halbe Stunde mit Sassy dem Seehund eingestellt, als ich mit großer Erleichterung registrierte, daß sie mit dem Einpacken des Kassettenrecorders beschäftigt war.
»Ich dachte, heute nachmittag lassen wir es mal lockerer angehen und feiern ein bißchen, du und ich. Was hältst du davon?« Sie kramte in ihrer Schreibtischschublade und zog eine Dose Weihnachtsplätzchen hervor. »Hier, nimm eins. Habe ich selbst gebacken, mein Gott, das war vielleicht eine Sauerei! Hast du schon mal Plätzchen gebacken?«
Selbstverständlich, wollte ich sagen, ich log aber, nein, hätte ich nicht.
»Das ist eine ganz schöne Arbeit«, sagte sie. »Bes onders, wenn man keinen Mixer hat.«
Ich kannte diesen Plauderton an Agentin Samson nicht und fühlte mich unwohl, in dem kleinen, überheizten Zimmer zu sitzen und so zu tun, als führten wir eine ganz normale Unterhaltung.
»Und?« fragte sie. »Was machst du in den Ferien?«
»Och, gewöhnlich bleibe ich hier und öffne ein Geschenk von meinen Eltern.«
»Nur eins?« fragte sie.
»Vielleicht auch acht oder zehn.«
»Nie sechs oder sieben?«
»Manchmal«, erwiderte ich.
»Und was machst du am einunddreißigsten Dezember, an Silvester?«
»Am letzten Tag im Jahr plündern wir den Tannenbaum, und meine Mutter bereitet Meer-Früchte zu.«
»Du hast es wirklich raus, alle s-Laute zu meiden«, sagte sie. »Das muß ich dir lassen, die meisten anderen sind nicht so zäh.«
Ich dachte, sie würde mir weitere Fallen stellen, aber statt dessen begann sie, von ihren Ferienplänen zu erzählen. »Es ist nicht einfach, einen Verlobten in Vietnam zu haben«, sagte sie. »Letztes Jahr waren wir bei seiner Familie in Roanoke, aber dieses Jahr feier ich Weihnachten mit meiner Großmutter, draußen in Asheville. Meine Eltern kommen auch, und wir werden uns alle kräftig anstrengen, damit es ein schönes Fest wird. Am Tag darauf fahre ich mit einer Freundin nach Jacksonville, wo wir uns das Spiel Florida gegen Tennessee im Gator-Stadion ankucken.«
Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als für ein Footballspiel nach Florida zu fahren, aber ich tat so, als wäre ich beeindruckt: »Wow, da wär ich gerne dabei.«
»Letztes Jahr war ich in Memphis, als NC State im Liberty-Stadion Georgia mit vierzehn zu sieben vom Platz fegte«, sagte sie. »Und nächstes Jahr will ich im Tangerine-Stadion unbedingt einen Platz erste Reihe Mitte haben, egal, wer spielt. Warst du schon mal in Orlando? Eine absolut phantastische Stadt. Wenn mein zukünftiger Ehemann einen Job in seinem Beruf findet, wollen wir in ein, zwei Jahren da runter ziehen. Kaum zu glauben, ich unten in Florida. Du wärst bestimmt selig, stimmt’s?«
Ich wußte nicht, wie ich antworten sollte. Wer war diese Sportplatz-Fanatikerin, die keinen Mixer, dafür aber einen Verlobten in Vietnam hatte, und wieso rückte sie erst jetzt mit alldem raus? Die ganze Zeit hatte ich sie für eine kaltblütige Agentin gehalten, dabei war sie bloß eine leicht schräge, unerfahrene Sprachtherapeutin. Miss Samson war ganz bestimmt kein schlechter Mensch, aber ihr Timing war total daneben. Sie hätte sich zu Anfang des Jahres öffnen sollen, anstatt bis jetzt damit zu warten, wo ich nichts weiter tun konnte, als sie zu bedauern.
»Ich habe mein Bestes versucht, mit dir und den anderen zu arbeiten, aber was soll ich sagen? Manchmal ist das Beste nicht gut genug.« Sie nahm noch ein Plätzchen und drehte es in ihrer Hand. »Ich wollte mir beweisen, daßich anderen helfen kann, aber es ist schwer, gegen soviel Widerstand anzukämpfen. Die Schüler mögen mich nicht, aber ich denke, damit muß ich leben.«
Sie nahm eine Hand vors Gesicht, so daß ich befürchtete, sie würde jeden Moment losheulen. »Nicht doch«, flehte ich. »O Mitht!«
»Ha-ha«, sagte sie. »Hab ich dich doch noch erwischt.« Sie lachte viel mehr, als nötig gewesen wäre, auch dann noch, als sie das Formular unterschrieb, mit dem sie mich für den Therapiekurs im kommenden Jahr empfahl. »Stimmt, so ein Mitht. Du hast nämlich noch ein schönes Stück Arbeit vor dir, Mis ter.«
Meine Mutter, der ich die Geschichte erzählte, fand das alles zum Schießen. »Da siehst du’s«, sagte sie, »du bist einfach zu arglos.«
Ich gab ihr recht, nur war mir das Wort naiv lieber.
Riesenträume, Zwergentalent
(Giant Dreams, Midget Abilities)
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!