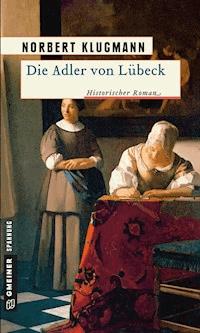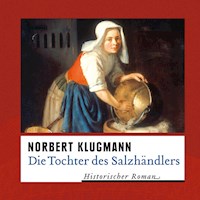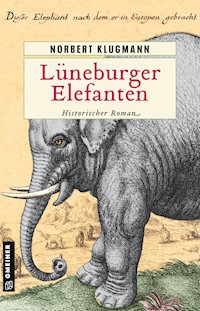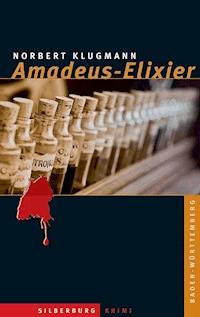10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Waitzstraße ist in den letzten Jahren der Albtraum aller deutschen KFZ-Versicherungen. Dutzende Male kam es hier zu spektakulären Unfällen beim Ein- und Ausparken. Fast immer saß ein betagter Mensch am Steuer, der nächste Crash liegt stets in der Luft. Er rauscht in ein Schaufenster oder prallt gegen eine Hauswand. Alle Schutzmaßnahmen versagen. Die beteiligten Senioren bleiben gelassen, ihre Familien, die Einzelhändler und Politiker sind entsetzt. Doch dann der Bums in Poppenbüttel. Ein Pensionär im SUV brettert in den Eingang eines Kaufhauses. Konkurrenz für Othmarschen! Was die im wilden Westen können, können sie in Poppenbüttel auch. Von wegen »gebrechliche Senioren« - mit den mobilen Rentnern muss man jederzeit rechnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Norbert Klugmann
Bitte parken Sie nicht in unserem Schaufenster
Neues aus der Waitzstraße
Zum Buch
Und dann hat’s wumms gemacht Du musst dir das so vorstellen: Sie steigen ein, der Motor springt an, der Fuß sucht und findet nicht, es knallt und scheppert, und schon ist es vorbei. Ganz einfach. Und so kam es zu den 30 Unfällen in einer einzigen Straße, der Hamburger Waitzstraße. Ein Rekord! Da kann man stolz drauf sein – oder eben auch nicht. Klar ist aber: Am schlimmsten ist immer die Woche danach. Jedes Mal, wenn wieder ein Wagen den Sprung aus der Parkposition in den fünfstelligen Sachschaden geschafft hat, ist die Besorgnis in Othmarschen besonders lebendig: Wie lange wird es diesmal bis zum nächsten Crash dauern? Doch dann der Bums in Poppenbüttel. Offenbar als Folge eines Sekunden-Blackouts am Steuer seines PS-starken Wagens rauscht ein Pensionär in den Eingang eines Kaufhauses. Konkurrenz für Othmarschen! Wer hätte das gedacht? Othmarschen versus Poppenbüttel – es kommt zum Duell. Kampflustige Senioren aus beiden Stadtteilen treffen bei einem Autowettrennen in einer Kieskuhle aufeinander. Das Einzige, was sicher ist: Der Humor stirbt zuletzt.
Norbert Klugmann, Jahrgang 1951, hat bisher 75 Romane veröffentlicht. Seine Schwerpunkte sind Krimis, Satiren und Jugendbücher. Seine Stärken sind der Dialog und die enge Nachbarschaft von Alltag und Anarchie, die in Situationskomik mündet. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in mehreren Romanen über Sport, Geschlechterkriege, Kommunalpolitik und historische Themen. Dreimal begleitete er die Hebamme Trine Deichmann durch das Lübeck des beginnenden 17. Jahrhunderts. Das süffige Genre des Weinromans bereicherte er mit drei Romanen um den legendären und rätselhaften Marchese. Gepriesen wird Klugmann auch für die beste Biografie des großen Komödianten Heinz Erhardt. Manchmal begegnet er uns als Ghostwriter, der seine Feder Prominenten leiht.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © wolfness72l / shutterstock und Roman Samborskyi / shutterstock
ISBN 978-3-8392-7338-8
Senioren in Bewegung
In den letzten Jahren ereigneten sich in der Hamburger Waitzstraße, Othmarschens bekannter Einkaufsstraße, knapp 30 Unfälle, die nach dem gleichen Muster abliefen. Jedes Mal saßen Senioren von über 70 Jahren am Steuer PS-starker Autos, meist SUVs mit Automatikgetriebe. Jedes Mal ereignete sich der Unfall beim Einparken oder beim Versuch auszuparken. Dabei wurde versehentlich Vollgas gegeben, sodass der Wagen mit wenigen Metern Anlauf auf eines der Einzelhandelsgeschäfte zuraste. Er landete im Schaufenster oder fuhr gegen die Hausfassade.
Alle Versuche, die Zahl der Unfälle, vor allem die Zahl und/oder Anordnung der Parkplätze zu verändern, blieben ohne nachhaltige Wirkung. Die öffentlichen Äußerungen der Polizei und der lokalen Medien ähneln sich seit Jahren, sie schwanken zwischen Hilflosigkeit, freundlichem Mitleid und milder Häme. Schwere Personenschäden sind bisher nicht zu verzeichnen.
Der nächste Unfall liegt in der Luft, im Stadtteil fürchtet man sich davor. Der örtliche Kunsthochschul-Professor Ehrenreich (64) agiert als Anwalt der Alten, für ihn sind sie Vertreter einer unangepassten, anarchistischen und freiheitsliebenden Bevölkerungsgruppe, die von Öffentlichkeit und eigenen Kindern gegängelt und entmündigt wird.
Überraschend entwickelt sich ein Duell mit dem Hamburger Stadtteil Poppenbüttel und dessen betagten Bewohnern. Nun erhält die Geschichte Witz, grotesken Verlauf und als Höhepunkt ein Senioren-Autowettrennen, das die Welt noch nicht gesehen hat.
1
Es rauschte, sehr kurz und gar nicht laut. Etwas rau klang es, dann knallte es, auch dies sehr kurz, aber lauter. Dann war es ruhig. Die Stille, die folgte, wirkte, als sei soeben etwas geklärt worden, das schon lange der Klärung harrte.
Danach der Ruf: »Mutti! Mein Gott, Mutti!«
Auf dem Bürgersteig voller Gestalten, von denen sich keine einzige rührte, bahnte sich die Frau den Weg. Die Schöße ihres nicht zugeknöpften Sommermantels flogen, als wolle sie Anlauf nehmen, um flatternd abzuheben. Doch das geschah nicht, die Gesetze der Physik verhinderten einen historischen Moment, der das Zeug gehabt hätte, in die Annalen des Quartiers einzugehen.
Laufend und bebend erreichte die Frau den dickbauchigen Wagen. Er war weiß, später am Tag würde sie zu ihrem Mann sagen: »Weiß, was für ein Unsinn! Weiß ist für sie doch praktisch unsichtbar.«
Und ihr Mann würde entgegnen: »Du musst die Sache von ihrem Anfang her denken. Wenn sie einen weißen Wagen sucht, ist die Chance groß, dass sie ihn nicht findet, weil sie ihn nicht sieht.«
»Die Frau muss ihn nicht sehen. Sie riecht ihn. Sie kann ja kaum noch etwas erkennen, auch wenn sie das Gegenteil behauptet. Aber manchmal, wenn sie mich anblickt, dann habe ich den Eindruck: Sie glaubt, sie sieht mich, aber sie sieht mich nicht.«
Sie wusste genau, dass ihr Mann kurz davor stand, eine Bemerkung fallenzulassen, die ihm noch leidtun würde. Aber der feige Hund verkniff sich diese Bemerkung. Dann würde er seine Strafe eben wegen Feigheit in Tateinheit mit vorsätzlichem Schweigen erhalten. Sie war eine erfahrene Gattin, sie musste die Sache nicht mehr so eng sehen wie in den ersten Jahren. Jede Frau lernt dazu, das ist die größte Gefahr für ihren Mann, größer als Krieg, Cholesterin, Corona und Einbrüche beim DAX.
Ihr Mann hatte ein Anrecht darauf, die Geschehnisse des Vormittags detailliert ausgebreitet zu bekommen. Ihr war bewusst, dass er sich auch ohne ihre Detailfreude alle für ihn notwendigen Informationen herausgepickt hätte. Im Verlauf eines Gesprächs hatte er ihre Vorliebe für Einzelheiten, die mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennbar sind, »peinigend« genannt. Das war in der Phase, in der er sich freigeschwommen hatte, beziehungstechnisch. Also die Phase, in der sie versäumt hatte, den Kerl unter Wasser zu drücken. Aber er hatte ein Anrecht auf die Wahrheit in all ihren Facetten. Sie konnte nichts dafür, dass alles im Leben, mochte es die Wahrheit sein, Lügen oder das große Gesumms zwischen diesen Polen, von massenhaft Einzelheiten behaftet war wie die Windschutzscheibe im Sommer von Insektenleichen.
»Das ist doch gar nicht Ihre Mutter«, sagte die Frau, neben der sie vor dem weißen Schlachtschiff stand und zusah, wie zwei Ersthelfer die alte Dame am Lenkrad daran hinderten, den Wagen zu verlassen.
»Ich bin heil«, protestierte die betagte Fahrerin, wenn man bereit ist, jemanden, der einen Wagen nach fünf Metern Fahrstrecke gegen die Hauswand gesetzt hat, als Fahrerin zu bezeichnen.
»Der Doktor wirft gleich einen Blick drauf«, kündigte der Ersthelfer an, der eher der handwerklichen als der technischen Berufswelt zuzurechnen war. Er war von der gegenüberliegenden Baustelle herbeigeeilt – so schnell sieht man selten einen Menschen das Gerüst hinabklettern, es sei denn, es ist Feierabend.
»Ich werde doch wissen, ob ich heil bin«, protestierte die Dame. Während die Ersthelfer sich bemühten, den Gurt zu lösen, versuchte sie, den Griff der Helfer zu lösen, denn jeder der beiden wehrte während der Beschäftigung mit dem Gurt mit seinem jeweils freien Arm die renitente Pilotin ab. Die Choreografie der vier hilfsbereiten und kundigen Arme spielte eine Melodie, die den Zuschauern das beruhigende Gefühl vermittelte, soeben Zeugen einer kontrollierten Situation zu werden. Allerdings hielt sich die Aufregung rund um den Wagen sowieso in Grenzen. Der frühere Oberstudiendirektor Doktor Schwupp war bereits zum achten Mal als Augenzeuge dabei, Debütanten waren auf den ersten Blick gar nicht auszumachen. Bei allen Malheurs der jüngeren Vergangenheit war es ohne schwere Verletzungen, wenn auch nicht in jedem Fall ohne Schürfwunden abgegangen. Einmal – jeder erinnerte sich daran – hatte eine Wunde im Kopfbereich heftig geblutet, wodurch die Szene erst die unvergessliche Dramatik und Nähe zu elementaren Zuspitzungen erhalten hatte, die sich bei einem banalen Wumms einfach nicht einstellen will.
Dann eilten auch schon die Doctores herbei. Sie erschienen von beiden Seiten, einer kam von der anderen Straßenseite. Sehr viel diagonaler kann man eine Straße kaum queren. Insgesamt waren sie zu viert, drei im Kittel, einer in Jeans und gestreiftem Hemd, aus dessen Brusttasche etwas lugte, was man auf den ersten Blick für Verbandszeug oder ein Kabel halten konnte. Aber es schien keinen medizinischen Bezug zu besitzen, denn er stopfte es, während er eilte, in die Brusttasche, als solle es niemand sehen. Er hätte es besser wissen müssen.
Drei der vier Mediziner hatten eine Gemeinsamkeit: Jeder Passant, der am Wagen versammelt war, kannte sie mit Namen, einige hätten die Sprechstundenzeiten herbeten können, allerdings kaum jemand die Telefonnummer.
»Wurde telefoniert?«, rief Doktor Endlos. Man bestätigte ihm, dass die 112 eifrig bemüht worden war. Sein Name war nicht Endlos, aber sein Name war lang, ehrlich gesagt wollte er gar nicht wieder aufhören. Der Mann hätte damit rechnen können, dass seine Patienten einen Weg finden würden, um die Sache kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Immerhin war er keiner dieser selten gewordenen Träger von Drei-Namen-Namen. Wenngleich bei Medizinern natürlich noch der unvermeidliche Doktor dazukommt, manchmal auch ein Doppeldoktor, wofür es möglicherweise sogar einen Grund gab, den aber niemand wissen wollte. Je weiter fort vom Handfesten und Knochenbrecherischen, also angenehm Soliden sich die Spezialisierung des Mediziners in Richtung auf Therapie und fernöstliches Voodoo zubewegte, umso mehr stieg die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende das Format eines herkömmlichen Medizinerschildes kaum ausreichen wollte, um alles zu fassen, was gesagt und gewusst werden sollte. Zumal sich heutzutage niemand seinen Arzt aussucht, indem er sich vor das Haus mit zwölf bis 15 Schildern stellt.
Das Erscheinen von Endlos und seiner Boygroup löste die letzten Beklemmungen bei den Augenzeugen des Wumms auf. Die Bruchpilotin war jetzt in guten Händen. Sie sah wohl auch ein, dass sie gegen vier Experten nicht ankommen würde, faltete ergeben die Hände im Schoß und ließ der Heilkunde ihren unvermeidlichen Lauf. Äußerlich wirkte sie konzentriert und präsent, wenn auch weiterhin kiebig. Aber diese Eigenschaften trafen auf die meisten Bewohner des westlichen Stadtteils zu. Bevor hier jemand als gebrechlich gilt, muss sein 90. Geburtstag in Sichtweite sein. In ärztlicher Behandlung waren alle, das gehörte zum guten Ton. Private Versicherungen waren obligatorisch, diverse Ärzte nahmen gar keine Brot-und-Butter-Patienten mehr an. In vielen Praxen verkehrten komplette Sippen, drei Generationen waren keine Seltenheit, vier Generationen kamen vor, wenngleich die jüngsten Patienten kaum in der Lage gewesen wären, aus eigener Kraft die Wahl ihres künftigen Doktors zu treffen.
In der sehr langen und schmalen Straße hatten sich über 40 Praxen angesiedelt. Manch afrikanischer Staat besitzt unterm Strich eine kleinere medizinische Versorgung. Bei dieser Zahl konnte es nicht ausbleiben, dass auch Orchideen-Fachbereiche ihr Auskommen fanden. Wer sich gesund malen und mit seinem Heiler in einer auswärtigen Sprache kommunizieren wollte, die man im besten Fall verstand oder sogar beherrschte oder deren Sinnhaftigkeit man annähernd unterbringen konnte, war hier gut bedient. Kultivierteres Kranksein ist schlechterdings nicht vorstellbar.
Schnell war die Bruchpilotin unter den ärztlichen Körpern verschwunden, schlagartig erlosch das Interesse der Umstehenden.
Im Hintergrund stand die Polizei. Die Beamten wussten, was von ihnen erwartet wurde, und hielten sich zurück, bis die Mediziner ihr in diesem Fall unblutiges Tagwerk verrichtet hatten. Der Helfer mit der Trage zeigte nur pro forma Präsenz. Das Fotografieren allerdings war unvermeidbar wie bei jedem Anlass, der über den Kauf von drei Brötchen hinausging.
Als die betagte Dame den Wagen verließ, empfing sie aufmunternder Applaus. Es war nicht so, dass sie jugendlich vom Sitz federte, aber sie stand sicher und schien zu wissen, in was für ein Spiel sie geraten war. Vielleicht war ihr sogar bewusst, dass sie in dem Stück die Hauptrolle verkörperte. Auf Berührungen oder gar Umarmungen wurde wohlweislich verzichtet. Das lag natürlich an der endlosen Pandemie, noch stärker jedoch an den leidvollen Erinnerungen an demonstrativen Überschwang in der Vergangenheit, der dazu geführt hatte, dass die betagten Bruchpiloten erst nach Ende der kollektiven Umarmungskur hilfsbedürftig waren.
»Ich weiß, dass das nicht meine Mutter ist«, sagte die Frau unwirsch, die unmittelbar nach dem Ende der kurzen Autofahrt »Mutti« gerufen hatte und losgelaufen war.
»Und dennoch nennen Sie sie Mutti«, sagte die Frau neben ihr besorgt. Man hätte die beiden für Schwestern halten können, aber niemand, der hier zu Hause war, hätte das getan. Dann hätte es nämlich Dutzende und vielleicht Hunderte von Schwestern gegeben, die die Häuser des Stadtteils und der benachbarten Quartiere nicht in jedem Fall belebten, aber jedenfalls bewohnten.
»Sie nennen Ihre Biggi doch auch Biggi. Dabei wissen wir beide, dass die Töle auf den einen Namen so schlecht hört wie auf jeden anderen Namen.«
»Biggi ist ein Hund!«
»Soll mich das trösten?«
»Sie soll trösten, dass Ihre Schwiegermutter nicht im Wagen saß. Sie sind doch froh darüber. Oder? Hören Sie mich überhaupt?«
»Wie? Ich war gerade … Nicht meine Mutter, ja natürlich.«
»Glück gehabt.«
Die Frauen blickten sich an. Die Kiebigkeit, die sie verband wie das Pflaster die Wunde, verschwand nicht schlagartig, aber das ernste Thema bremste ihre bekannte zuschnappende Art ein wenig ins Manierliche ab.
»Es wird ein nächstes Mal geben«, sagte die Frau, deren Hund Biggi hieß.
»Jede Wette.«
»Es ist wie ein Naturgesetz.«
»Nur, dass ein Naturgesetz auch mal ein wenig auf sich warten lässt.«
»Das ist nicht wahr. Naturgesetze haben keinen Feierabend, sie gelten immer.«
»Ach ja? Es regnet also jeden Tag?«
»Was hat denn der Regen mit den Naturgesetzen zu tun?«
Nach diesem aufschlussreichen Kommentar zu den Gründen der MINT-Malaise und den in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern kaum vorhandenen weiblichen Studierenden sagte Biggis Frauchen: »Ist ja auch egal.«
»Es hört einfach nicht auf.«
»Wissen Sie, was ich manchmal denke?«
»Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Mein Mann hat auch so eine fiese Art. Nimmt ständig Anlauf, aber springt dann nicht.«
»Mein Problem ist nicht, dass es nicht aufhören will. Manchmal denke ich, es hat noch gar nicht angefangen.«
»Ja, scheiß der Hund drauf. Sie trauen sich was.«
»Aber nicht weitersagen. Man will sich ja nicht unbeliebt machen.«
»Ach, das ist halb so schlimm, wie man denkt. Zuerst glaubt man, keiner redet mehr mit einem. Aber dann merken Sie: Außenseiter sein, hat auch Vorteile.«
»Nämlich?«
»Du wirst nicht mehr so oft eingeladen. Du musst dir nicht ständig diesen Kleinkram-Quatsch anhören.«
»Small Talk.«
»Das auch nicht.«
»Ist denn jemand in Ihrer Familie betroffen?«
»Wir reden alle nicht viel. Manchmal zu wenig, aber nie zu viel.«
»Ich meine die Unfälle.«
Die Frau, die »Mutti« gerufen hatte, klopfte sich gegen die Stirn. Bevor die Begriffsstutzigkeit der anderen sie noch mehr stören konnte, sagte sie: »Ich klopfe auf Holz.«
»Auch eine Spezialität der Familie?«
»Ja! Jetzt, wo Sie es sagen …«
2
Im Stadtteil gab es Polizisten, und es gab Harald Sott. Die einen waren Büttel der Zentralregierung, fremd, wichtigtuerisch und mit dem Gesichtsausdruck, der pausenlos eine einzige Aussage macht: Ich bin wichtig, mit mir ist jederzeit zu rechnen. Die Büttel tauchten aus dem Nichts auf, und am Ende verschwanden sie wieder im Nichts. In der Zeit dazwischen ertrug man sie, übersah sie mit dem routinierten Gesichtsausdruck, der es dem Büttel ermöglicht, das Gefühl zu entwickeln, dass er respektiert wird. Kein zweiter Eindruck konnte weiter neben der Realität liegen. Denn Büttel respektiert man nicht, man bringt sie hinter sich, wie man die Blähung im Bauch nach Genuss von Hülsenfrüchten hinter sich bringt. Es ist eine Frage der Zeit: Büttel kommt, Büttel geht. Was er dazwischen tut, interessiert niemanden außer den Büttel. Nie hat es eine Konsequenz, nie gibt es ein Vorher und Nachher. Nichts, was der Büttel ins Werk setzen könnte, hätte eine Konsequenz auf das Leben der Einheimischen. Nicht einmal auf den Alltag, auch nicht auf den Moment. Büttel ist, was man hinter sich bringt. Man spuckt nicht vor ihm aus, aber man grüßt auch nicht, und wenn doch, dann keineswegs als Erster. Für das Grüßen ist der Büttel zuständig. Dass er es selten und am liebsten gar nicht tut, ist in die erste persönliche Begegnung im öffentlichen Raum von vornherein eingepreist. Man wird nicht Büttel, weil sich der Traumberuf des Tanzlehrers zerschlug. Büttel ist keine Frage von Erziehung oder Charakter, sondern der Gene. Der Büttel hat keine Wahl, er muss werden, was er am Ende geworden ist. Der Büttel lebt im ewigen Irrtum. Das ist tragisch, aber nicht traurig. Büttel bemitleidet man nicht. Auch Henker, die finalen Dienstleister, hatten nicht viele Freunde. Man bediente sich ihrer, weil es einer tun musste. Nicht jeder kann beliebt sein. Nicht jeder besitzt das Talent des Lächelns. Mancher kann froh sein, wenn er Land gewinnt.
Wenn im Stadtteil uniformierte Polizisten auftauchten, wirkte sich das auf den Pulsschlag der Einheimischen nicht aus. Die Begegnung mit einem Eichhörnchen rührte die Gemüter heftiger auf, vor allem positiver. Erst wenn der Büttel Zivil trug, wurde es ernst. Bezirksliga und Zweite Liga. In der ersten spielte man selbst und war unabsteigbar.
Der Einzige, der alle Regeln brach, war Harald Sott. Der bürgernahe Beamte des Stadtteils war das Kind, das jeder gern gehabt hätte, auch wenn man es nicht zugeben würde, denn der eigene Nachwuchs war empfindlich, nahm schneller übel, als man »Papp« sagen kann, und dann brauchte es minutenlanges verbales Gewürge, um die sensible Brut wieder auf Normalnull zu bringen. »Natürlich haben wir dich lieb.«
Aber Harald Sott war einfach herzig. Der uniformierte Mittfünfziger gehörte seit 17 Jahren zum Stadtbild. In dieser Zeit hatte er sich äußerlich kaum verändert. Sein Haarwuchs war schon am Anfang nicht üppig gewesen. Und er mochte vier oder fünf Kilo mehr haben, aber so war das Leben. Und es hat langfristig gesehen eben Konsequenzen, wenn du nach den ersten fünf Jahren des Kennenlernens ein Jahrzehnt lang im Bereich der Hauptstraße von den Einheimischen nicht nur herzlich begrüßt und bespaßt und beplaudert, sondern auch ernährt wirst. Wäre Sott nicht mit eiserner Gesundheit gesegnet gewesen, hätte er sich in den letzten Jahren unweigerlich einen Diabetes angefuttert. Die Hauptstraße verfügte nicht nur über mehrere Dutzend Arztpraxen, sondern auch über eine kaum fassbare Zahl von Bäckereien und Cafés. Die Hälfte der Läden verdiente Geld damit, dass im Verlauf des Vormittags ein Einheimischer hereinsprang und darauf vertraute, dass die Bäckereifachverkäuferin ohne weiteren rhetorischen Aufwand den vor dem Schaufenster sichtbaren Sott wahrnahm, wonach sich alles Weitere wie von selbst ergab: Tüte, Zugriff mit der Zange, einmal, zweimal, über die Theke und tschüss. Manchmal lag das Geld dann auf dem Teller, manchmal passend, manchmal gar nicht. Aber das regte niemanden auf, das glich sich mit der Zeit aus.
Und der aktuelle Trend verstärkte den fließenden Tausch von Ware und Geld noch. Immer mehr Einheimische leisteten in den ersten zwei Tagen eines jungen Monats per Geldschein ihren Obolus für die folgenden vier Wochen, mit dem Obolus wurden die Franzbrötchen für Harald Sott abgerechnet. Es gab dutzendfach andere Brötchensorten und fast so viel unterschiedliches Backwerk. Aber dies war Hamburg, hier musste man nicht zeigen, wie weltläufig man ist. Hier war Franzbrötchen-Land, hier wusste man, was nicht zu toppen ist. Und niemand hatte jemals ein abwehrendes Wort von Harald Sott gehört. Kein verräterischer Muskel im Gesicht, kein Zögern in der Körperspannung und schon gar kein laut geäußertes Wort hatten verkündet, dass Sott die Franzbrötchen-Ära für beendet erklärte. Dieser Mann aß, was in die Tüte kam. Nichts rechnete man ihm höher an als die tausendfach beobachtete Tatsache, tausendmal bettelnde Schulkinder erfolgreich abgewehrt zu haben. Die Jugend wusste, wie der Hase zwischen Bäckerei und Sott lief und hätte gern daran partizipiert. Aber Sott wurde nicht müde, den kleinen Gierschlünden zu erklären, dass er sich um ihre Gesundheit, nicht zuletzt die Zahngesundheit sorgte, weshalb er die Pflicht des Franzbrötchen-Verzehrs demütig und schweren Herzens auf sich nahm. »In 20 Jahren werdet ihr mir dankbar sein«, lautete einer seiner Standards. Dafür liebten ihn alle Erwachsenen und verabscheuten ihn alle Schüler. Was sie jedoch für sich behielten. Denn mit der Empfindsamkeit ihrer kleinen Seelen rochen sie den Braten: Wer es sich mit Harald Sott verdarb, auf den wartete zu Hause der Familiengerichtshof, und dessen Urteil stand von vornherein fest: Verachtung, Fernsehverbot, Smartphone-Sperre oder im schlimmsten Fall: Arrest. Diese Strafe wurde jedoch nur im äußersten Notfall ausgesprochen, denn die Hälfte des Leids bei laufendem Stubenarrest schlug traditionell auf die Erwachsenen durch. Die darum den Anfängen wehrten, bevor die Kleinen Gelegenheit erhielten, sich an diese Art der Sanktion zu gewöhnen und womöglich Gefallen an ihr zu finden.
Jetzt neigte sich Sotts Zeit dem Ende zu. Es war nicht die Gesundheit und schon gar nicht mangelnde dienstliche Leistung. Die war so untadelig wie am ersten Tag.
Sott war bei allen Bewohnern und erst recht bei allen Einzelhändlern und den Mitgliedern des medizinischen Betriebs hoch respektiert. Kompromiss und Wegsehen – dieses nicht zwangsläufig zusammengehörende Begriffspaar hatte Sott zu unübertrefflicher Engführung gebündelt. Er hatte sich Zeit gelassen oder Zeit gebraucht, um die örtlichen Gegebenheiten zu erkennen, zu begreifen und zu akzeptieren. Er hatte herausgefunden, wie der Hase lief, wer die Richtung vorgab, wer wie zu nehmen war, um mit ihm und seinen Interessen zu einem gedeihlichen Miteinander zu finden. Niemand wusste so gut wie Sott, wer Leitwolf war, wer Mitläufer oder uninteressante Nebenfigur.
Jeder konnte Sott jederzeit ansprechen. Und acht von zehn Klagen wogen nur noch halb so schwer, nachdem man sie gegenüber einem anderen Menschen geäußert hatte. Und dann noch Harald Sott, der vielleicht beliebteste Bürgernahe Polizeibeamte der gesamten Metropole. Natürlich wurde dieser Posten aus einsichtigen Gründen nicht mit Krawallbeamten und Streithanseln besetzt. Aber auch die Zeit der kauzigen und teilweise grenzwertigen Beamten war Vergangenheit. Der Bünabe – also der Bürgernahe Beamte – ist eine Respektsperson. Aber es liegt an ihm, was er daraus macht. Sott hatte daraus örtlichen Frieden gemacht. Sein Revier war die Hamburger Schweiz. Schon vorher hatten sich hier dank der dicht beieinander liegenden sozialen Situationen und Interessen der Bewohner viele potenzielle Brennpunkte mangels Masse von allein erledigt. Vieles wurde auch auf Schienen und in Gremien erledigt, von denen nicht einmal Harald Sott Kenntnis besaß. Aber es blieb immer noch der große öffentliche Bereich. Niemand, der ernst genommen werden will, zählt die drei prominentesten städtischen Einkaufsstraßen auf, ohne die Waitzstraße auf einen der ersten Rangplätze zu setzen. Selbst das überdimensionierte Einkaufszentrum im Einzugsbereich hatte es nicht geschafft, Kaufkraft in nennenswertem oder gar bedrohlichem Umfang abzuziehen. Diese Straße war ein Zentrum der örtlichen Versorgung mit Nahrungsmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs. Aber es war noch viel mehr: das größte Ärztehaus der Stadt, die anheimelndste Atmosphäre, die gelassenste Stimmung, die an manchen Tagen den Vergleich mit südlichem Lebensstil nicht zu scheuen braucht. Dazu kamen die Kaufkraft, das Bildungsniveau, die traditionell an die Kandare genommene und geschickt gelenkte Kinderschar, die sehr überschaubare Zahl von Mitbürgern aus anderen Kulturkreisen. Natürlich hasste hier niemand Ausländer, und man wünschte den Mitbürgern in den damit befassten Stadtteilen alles Gute, vor allem gute Nerven. Aber niemand ging so weit, den Nachbarn Sott als Konfliktlöser zu empfehlen. Sott gab man nicht her, Sott gehörte dem Stadtteil, auch wenn er nicht hier wohnte. Man wusste gar nicht, ob er insgeheim eine Sehnsucht danach verspürte. Niemand hatte ihn jemals gefragt, und er hatte sich nie diesbezüglich geäußert. Sott war verheiratet und hatte Kinder, angeblich zwei. Man hatte sie nie persönlich erlebt, dabei hielten es viele für naheliegend, ja geradezu natürlich, dass er seiner Familie vorführte, wo er seine Arbeitszeit verbrachte. Immerhin ernährte der Stadtteil ja in gewisser Weise die Familie Sott. Vereinzelt waren Stimmen laut geworden, die Sott Undankbarkeit vorwarfen, auch das Wort Hochnäsigkeit war wohl gefallen. Aber die große Mehrheit ging davon aus, dass es gut war, wie es seit 17 Jahren war.
Umso größer der Schock, als sich herumsprach, dass Sotts Tage gezählt waren. Plötzlich war von einem Nachfolger die Rede, von einer Zeit nach Harald Sott. Alle Dämme brachen, man überfiel den Beamten mit Fragen, und Sott blieb die Antwort nicht schuldig. »Die Häuptlinge haben entschieden. Verjüngung des Kaders, diese Richtung.«
Hatte Sott goldene Löffel geklaut? Niemand vermisste goldene Löffel. Die im Stadtteil ansässige Berufswelt streckte ihre Fühler ins Polizeipräsidium aus. Und in der Tat: Es handelte sich um eine der in der Bürokratie unvermeidlichen hektischen Aufgeregtheiten, mit denen sich der träge Apparat Lebensenergie zuführen will, indem man Figuren hin- und herschiebt, Spielchen mit der Zuständigkeit betreibt, Hierarchien neu zusammensetzt – um am Ende zu einem einerseits neuartigen Zustand zu gelangen, der sich unterm Strich jedoch in nichts vom alten Zustand unterscheidet. Auf Harald Sott wartete der künftige Einsatz in Grundschulen, niemand im Stadtteil konnte ihn sich im Kreis von hektischen und lauten Kindern vorstellen. Sott konnte das auch nicht, aber es hatte eine kleine finanzielle Rochade stattgefunden, die Sotts Konto Monat für Monat mit 200 zusätzlichen Euro füllen würde. Frau Sott war entzückt, weil nun der Filius während seines Maschinenbaustudiums in Braunschweig mit wirkungsvollerer Unterstützung gefüttert werden konnte.
In sechs Wochen würde Sotts letztes Stündlein schlagen, alle wussten, dass es sich bei dem Mann, mit dem er heute im Stadtbild unterwegs war, um seinen Nachfolger handelte. Niemand in der Straße sprach den Neuen an, nicht einmal Sotts Nähe suchte man heute. Das lag nicht nur daran, dass Sott im Vorfeld behutsam darum ersucht hatte, ihn nicht in Verlegenheit zu bringen. Angeblich würde der potenzielle Nachfolger noch mit seiner Entscheidung ringen, da konnten persönliche Ansprachen nicht nützlich sein. Das sah man im Stadtteil ganz anders, aber niemand wollte es sich mit Sott in den letzten Tagen verderben. Doch sie hatten den Neuen im Auge, jeder hatte ihn im Auge. Und wer nicht rechtzeitig zur Stelle war, den suchte man in der Firma oder im Geschäft oder in der Familie und rief ihn ans Fenster, damit er einen Blick werfen konnte. In den blickstärksten Momenten des Tages wurde Sotts Begleiter von mehr als 50 Augenpaaren gleichzeitig beobachtet. Man fand den Neuen nichtssagend, uninteressant, wenig anziehend. Niemanden zog es in seine Nähe. Hätte man gewusst, dass sein Name Lübecker lautete, hätte ihm das weitere Minuspunkte eingebracht.
»Hier tragen die alten Leutchen also ihre Rennen aus«, sagte Lübecker. Sott konnte nicht gleich antworten, denn er speichelte gerade das zweite Franzbrötchen des Tages ein. Er hatte es dem Kollegen angeboten, doch der hatte abgelehnt. Angeblich hatte er es nicht mit Süßigkeiten. Das ging ja gut los.
»Es sind keine Rennen im eigentlichen Sinn«, sagte Sott dann. »Zum Rennen gehört ja, dass du auf Touren kommst. Sie steigen ein, der Motor springt an, der Fuß sucht und findet nicht, es knallt und scheppert, und schon ist es vorbei.«
»Verstehe ich nicht«, sagte Lübecker. »Da sind die Parkplätze, klare Sache. Du steigst ein, klare Sache. Du zündest die Ladung, fädelst dich ein und gut ist.«
»Das ist die Theorie.«
»Aber soweit ich das verstanden habe, crashen sie nur hier.«
»So sieht das aus.«
»Warum tun sie das? Warum legen sie nicht zu Hause ihren eigenen Carport flach? Oder wenigstens in ihrer Straße? Ich habe das immer wieder in der Zeitung gelesen. Es geht doch schon seit Jahren so. Und immer hört es sich an, als wenn sie extra hierherfahren, um den Wagen plattzufahren. So wie unsereins nach Timmendorf fährt, um zu baden.«
»Wir sind jetzt oft in Büsum.«
»Nach Büsum kann man doch nicht fahren.«
»Früher nicht. Jetzt bauen sie den Ort um. Wird richtig schön und hip.«
»Sieht nicht mehr aus wie in der Zeit, als Brandt Kanzler war?«
»Richtig hip.«
»Aber ihr baut in Büsum keinen Unfall.«
»Bis jetzt nicht.«
»Dann hoffen wir mal, dass das auch so bleibt.«
3
»Oh, pardon. Ist das hier nicht öffentlich?«
»Orientieren Sie sich einfach an den Türen. Wo es keine gibt, darf die Welt hinein.«
Das Paar lachte, wie nur ein langjähriges Paar lacht: so harmonisch, dass man mitten hineinschlagen wollte in so viel geil ausgestellte Harmonie.
Jörg Ehrenreich sah zu, wie sie die Pariser Aufstände an den Wänden betrachteten. Vom Alter hätten sie dabei sein können. 1968, erste große Schülerliebe, Ostern in einer Klapperkiste auf den Weg gemacht, ein Bett bei Freunden oder in einer verranzten Pension. Zwischen den Mahlzeiten ein Stündchen Revolution. Das belastet nicht den Magen und macht Hunger auf eine Portion Muscheln und etwas, das wie Weißwein aussieht, aber nur am Rand danach schmeckt.
Etwas im Professor dachte: Komm wieder runter, Junge.
Erst tauchte Knödler auf, gefolgt von Roderich. Was hatten die alten Zausel nur miteinander? Wo einer war, war sofort der andere. Dabei mochten sie sich nicht einmal. Die Villa war groß genug, um sich aus dem Weg zu gehen.
Roderich kam zum Hausherrn: »Was sehen wir uns da gerade an?«
Dass man im 21. Jahrhundert so gestelzte Fragen stellen konnte! Manchem bekommt das Altwerden ganz hervorragend, und er gewinnt mit jedem Jahr. Aber bei manchem quellen die neunmalklugen Talente auf wie jahrzehntelang verborgene Pickel, die kurz vor Torschluss doch noch ihren Weg finden. Dabei ist trockene Haut eine der wenigen Segnungen im siebten Jahrzehnt und auch danach. Endlich keine Hautunreinheiten mehr.
Die beiden Zausel standen mit Ehrenreich am Tisch. Er hatte ihn extra aufbocken lassen, damit die Fotos dichter an die Augen rückten. Nicht, weil er Probleme mit dem Sehen hatte, gute und wichtige Bilder mussten dicht bei einem sein, sonst blieb alles akademisch. Wie in einer stinknormalen Bücherei. Oder einer Galerie, die nie gelernt hat, was möglich ist.
»Volltreffer«, sagte Knödler. »Das ist wie Sex. Man verlernt es einfach nicht.« Viermal geschieden und immer noch Mut zu solchen verbalen Blamagen.
»Vorgestern«, sagte Ehrenreich. »Meine alten Nachbarn. Die letzte Brigade, auf die noch Verlass ist.«
»Was hat’s diesmal gebracht?«, fragte Roderich.
»Ein kleiner Schreck, leichtes Aua in den Handgelenken, sonst absolut nichts.«
»Ich verstehe nicht, warum sie sich jedes Mal so sehr ans Lenkrad klammern«, sagte Knödler.
»Woran sollen sie sich sonst festhalten? Ist ja kein Ritter in strahlender Rüstung in der Nähe.«
»Laufnummer?«
»21. In vier Jahren oder fünf.«
»Sauber. Das ist, als würden wir neben einem Schlachtfeld wohnen.«
Ehrenreich blickte den alten Freund so lange an, bis dem wohl klar wurde, dass nur einer in der Runde hier seinen Lebensmittelpunkt hatte. Die anderen waren Gäste, die sich hier wohl fühlten. Sehr, sehr wohl.
Roderichs Eva fragte gar nicht mehr nach, ob ihr vermisster Liebster eventuell bei Ehrenreich aufgetaucht sei. Und er reichte sie auch gleich ans Zielobjekt weiter. Small Talk hatte er mit Eva zuletzt vor 20 Jahren gehabt. Sex vor 15.
Ehrenreich sagte: »Schon ins Abendblatt geguckt?«
»Nein. Soll ich?«
»Es ist, als würden sie jedes Mal den Text vom letzten Wumms abdrucken.«
»Vielleicht tun sie’s ja. Und wir glauben es nur nicht, weil wir es nicht für möglich halten.«
»Arbeitest du seit Neuestem beim Abendblatt? Na siehst du, sie tun es nicht.«
Ehrenreich zählte die Textbausteine auf: wiederholter Crash auf der Waitzstraße im Hamburger Westen. Diesmal nicht durchs Schaufenster mitten in den Laden, sondern knapp daneben zwischen Schaufenster und Eingangstür gegen die Wand. Wieder ein Fahrer in fortgeschrittenem Alter, eine Frau von 79. Wieder nur Schreck, keine ernsthafte Verletzung. Wieder Gas und Bremse verwechselt und auf kürzestem Weg vom Schrägparkplatz ins Ziel. Und vor allem: wieder ein Klotz von Auto, wieder ein SUV, in den acht Personen passen. Aber am Steuer sitzt ein mickriges altes Fräulein, schick gekleidet. Ihren Verstand hat sie zu Hause vergessen, die Lederhandschuhe für die kurze Fahrt zum Arzt bedecken die zarten Hände und verleihen ihnen etwas Nobles. Frau von Welt fährt mit 350 PS zum Brötchenholen und Erneuern des Rezepts. Selbst der Interviewtext war austauschbar. »Ich wollte doch nur ausparken, aber dabei muss ich die Pedale verwechselt haben. Oder wie heißt das da unten, wenn es nicht das Klavier ist?«
»Jetzt wird es wieder losgehen«, murmelte Ehrenreich und sah die Bilder durch. Als gut zahlender Kunde von zwei städtischen Pressefotografen erhielt er regelmäßig aktuelle Lieferungen ihrer tagesaktuellen Arbeit. Schwerpunkte waren Demonstrationen, Gerichtsverhandlungen, Unfälle im Hafen oder in Fabriken. Auch über das internationale Netzwerk lief regelmäßig Bilderbeute ein. Alle drei, vier Jahre verwandelten sich 5.000 Fotos in eine neue Ausstellung. Der frühere Professor der hiesigen Hochschule für bildende Künste blieb seinem Thema treu, allerdings hatte er das Videomaterial weitergereicht und konzentrierte sich auf fotografische Zeugnisse von Situationen, in denen Menschen in elementare Situationen gerieten. Kämpfe gegen die Autoritäten, gegen Schwerkraft und andere Naturgesetze und gerne Verkehrsunfälle, egal ob Autos, Züge, Flugzeuge, Schiffe. Es musste nicht der Tod sein, den das Foto abbildete. Es musste der Augenblick sein, in dem es geschah oder gerade geschehen war. Der Schreck und wie die Menschen auf ihn reagierten: Verwundete, Davongekommene. Oder Todesopfer.
In seiner Villa war der alte Professor umgeben von zahllosen Dokumenten menschlichen Erlebens und Erleidens. Für ihn war das mehr als Anlass für kitschige Gedanken in platt-philosophischer Schreib- und Sprech- und Zeigeweise. Er suchte den Moment, in dem jede Autorität und jede Vorsicht ad absurdum geführt wird: kein Gurt mehr, keine Stoppschilder, keine Rettungsweste. Vor allem kein wirksamer Eingriff von Polizei und Militär und allen Vasallen, mit denen die Staaten ihre erschwindelte Macht gegen die Menschen schützen. Nicht gegen das Volk, das klang so pathetisch. Einfach gegen die Menschen. Weil der Mensch seit seiner Geburt der natürliche Feind staatlicher Ordnung ist. Und ganz besonders sehr junge und sehr alte Menschen. Weil bei ihnen die Kraft nachlässt oder noch gar nicht ausgebildet ist. Und auch, weil Kinder und Greise sich nicht um unsere Schutzvorrichtungen kümmern, sie durchbrechen sie und berühren uns im Innersten: weil sie uns leidtun, weil wir ihren Schreck und ihren Schmerz spüren. Und weil wir uns vor den Sprüchen ekeln, mit denen die angeblichen Beschützer danach auf das Geschehen reagieren: überheblich, einengend, neunmalklug. Und auch beim angeblichen Versuch, künftiges Unglück vermeiden zu wollen, rauben sie den Kleinen und den Alten Selbstbestimmung und das Recht auf eigene Entscheidungen. Das Unglück als seltener Moment von Freiheit. Unabhängig von den Fragen nach Schuld oder Unschuld, die in unserer Zeit längst zu Schmalspurfragen verfault sind, gerade gut genug, um Versicherungsansprüche zu klären.
Die Unfälle vor seiner Haustür hatten Ehrenreich vom ersten Unfall an bewegt, jeder weitere Vorfall war ihm unwirklich und immer unwirklicher erschienen, hatte ihn deshalb aber auch angefeuert. Zumal bis auf geringste Ausnahmen nie schwere körperliche Schäden zu beklagen waren. Stattdessen entstiegen alte Menschen panzerähnlichen Gefährten, mit denen sie gerade fünfstellige Sachschäden produziert hatten. Stiegen aus, zitterten ein wenig, aber meistens nicht einmal das. Und dann ließen sie herrliche Sprüche ab, die Ehrenreich jedes Mal zum Lachen brachten. Noch komischer fand er nur die Versuche der Medien, bloß keinen Lachimpuls zuzulassen. Stattdessen tat man immer so, als sei der bemitleidenswerte Senior dem Tod so gerade eben von der Schippe gesprungen. Als wäre es möglich, sich durch einen Satz von fünf Metern im Schutz eines Panzers in körperliche Gefahr zu bringen. Ehrenreich hatte sich das von Experten bestätigen lassen. Natürlich konnte man auch auf dieser Grundlage seinem Körper Verletzungen zuführen, sogar schwere. Aber das Risiko hatte eine Null vor dem Komma.