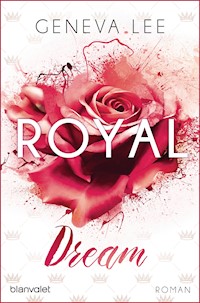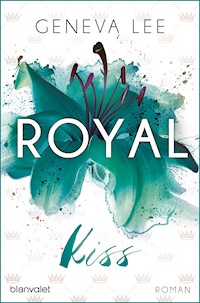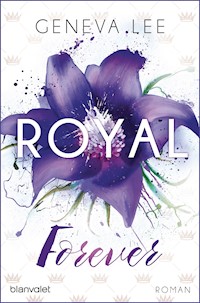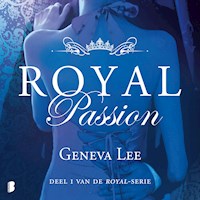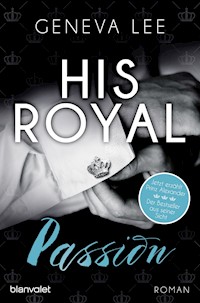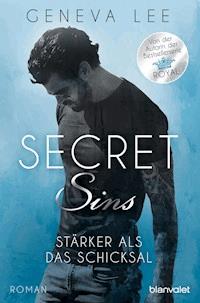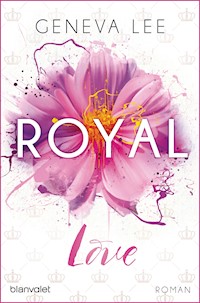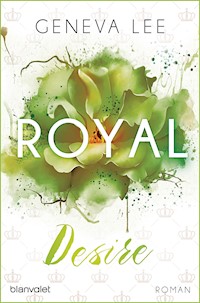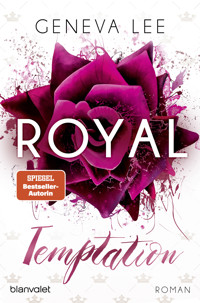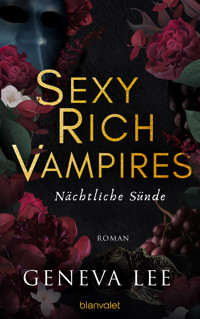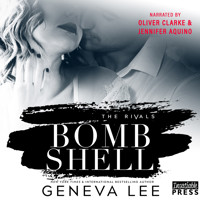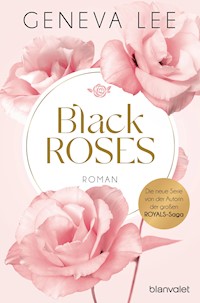
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rivals
- Sprache: Deutsch
Liebe und Hass liegen manchmal gefährlich nah beieinander ...
Adair MacLaine und Sterling Ford könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie, das hübsche College-It-Girl und verwöhnte Tochter eines reichen Medienmoguls, er, der brillante aber arme Stipendiat. Und dennoch führt das Schicksal die beiden zusammen und lässt eine Liebe so heiß und unberechenbar wie ein Wildfeuer zwischen ihnen entbrennen. Doch für Adairs Vater ist der mittellose Sterling nicht gut genug und so stellt er seiner Tochter ein Ultimatum: Sterling oder das Familienunternehmen – Adair entscheidet sich für das Vermögen.
Fünf Jahre später, ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters, trifft Adair auf den neuen Investor der Firma – die letzte Chance für das kränkelnde Unternehmen und zugleich die letzte Person, die Adair je wiedersehen wollte: Sterling Ford. Sterling will sich rächen an den MacLaines, die immer nur auf ihn herabgeschaut haben. Doch Gefühle lassen sich nicht so leicht abschalten ...
Adair & Sterling: Eine Liebe wie ein Wildfeuer – gefährlich und unberechenbar:
Bd. 1: Black Roses
Bd. 2: Black Diamonds
Bd. 3: Black Hearts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Adair MacLaine und Sterling Ford könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie, das hübsche College-It-Girl und verwöhnte Tochter eines reichen Medienmoguls, er, der brillante aber arme Stipendiat. Und dennoch führt das Schicksal die beiden zusammen und lässt eine Liebe so heiß und unberechenbar wie ein Wildfeuer zwischen ihnen entbrennen. Doch für Adairs Vater ist der mittellose Sterling nicht gut genug, und so stellt er seiner Tochter ein Ultimatum: Sterling oder das Familienunternehmen – Adair entscheidet sich für das Vermögen.
Fünf Jahre später, ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters, trifft Adair auf den neuen Investor der Firma – die letzte Chance für das kränkelnde Unternehmen und zugleich die letzte Person, die Adair je wiedersehen wollte: Sterling Ford. Sterling will sich rächen an den MacLaines, die immer nur auf ihn herabgeschaut haben. Doch Gefühle lassen sich nicht so leicht abschalten …
Autorin
Geneva Lee ist eine hoffnungslose Romantikerin und liebt Geschichten mit starken, gefährlichen Helden. Mit der »Royal«-Saga, der Liebesgeschichte zwischen dem englischen Kronprinzen Alexander und der bürgerlichen Clara, traf sie mitten ins Herz der Leserinnen und eroberte die internationalen Bestsellerlisten im Sturm. Geneva Lee lebt zusammen mit ihrer Familie im Mittleren Westen der USA.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
GENEVA LEE
Roman
Deutsch von Charlotte Seydel
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Blacklist« bei Quaintrelle Publishing+Media, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Geneva Lee
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Kilroy79; Soyka)
LA · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28058-1V002
www.blanvalet.de
In Gedenken an Trish
STERLING
Der Regen prasselt auf die Wagenkolonne aus schwarzen Mercedes-Benz und Bentleys, die auf dem Friedhof eintreffen. Jeder der Trauergäste hat am Morgen seine düsterste Limousine aus der Garage geholt. Heute sind keine knallroten Coupés oder protzigen Sportwagen unterwegs. Reiche wissen, wie man feiert, auch wenn es eine Trauerfeier ist. Keinem der Menschen, die aus ihren Wagen steigen und sich mit aufgespannten Regenschirmen zur Grabstelle begeben, läuft auch nur eine einzige Träne übers Gesicht. Der Regen nimmt mehr Anteil als die Anwesenden, mich selbst eingeschlossen.
Eine Frau stolpert, als sie mit dem Absatz im Schlamm stecken bleibt, und ich strecke den Arm aus, um sie aufzufangen. Sie blickt auf und murmelt ein Dankeschön. Um uns herum ist alles grau – der Himmel, der Regen, die Grabsteine. Selbst ihr kupferrotes Haar wirkt in dem trüben Licht beinahe silbrig. Ihre Augen jedoch sind strahlende Smaragde. Selbst nach den fünf Jahren, die vergangen sind, erkenne ich diese Augen auf Anhieb. Es hat sich viel verändert. Ich habe mich verändert. Vielleicht auch sie. Aber ihre Augen sind noch dieselben.
Als sie sich umdreht, um die Hand ihres Begleiters zu fassen, zeigt ihr Gesicht keine Regung. Er führt sie an den Kopf der Trauergemeinde, wo sie hingehört.
Ich habe mir Gottesdienst und Totenfeier gespart. Ich bin nicht hier, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, sondern um zu sehen, wie er im Boden verschwindet. Ich will die Erde riechen, die auf seinen Sarg fällt und das Schicksal der Familie MacLaine besiegelt. Fürs Geschäft ist später noch Zeit. Ich will voller Genuss zusehen, wie von einem Mann nichts als sein Vermächtnis bleibt – ein Vermächtnis, das ich zerstören werde.
Ein Priester spricht ein paar Worte. Währenddessen regnet es ununterbrochen weiter. Als die Erde auf den Sarg geworfen wird, beobachte ich die Rothaarige. Sie zuckt nicht mit der Wimper und wendet nicht den Blick ab. Vermutlich hat sie sich doch nicht verändert.
Adair MacLaine.
Die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Sie ist der eigentliche Grund, warum ich zurückgekommen bin. Dass ich es rechtzeitig zur Beerdigung geschafft habe, ist ein positiver Nebeneffekt.
Eine Stunde später halte ich in der gepflasterten kreisförmigen Auffahrt von Windfall, dem Anwesen der Familie MacLaine, und reiche dem Parkwächter den Schlüssel meines Aston Martin. Der leichten Wölbung nach zu urteilen, die auf der linken Seite seines billigen Sakkos zu sehen ist, fungiert er zugleich als Security. Anerkennend mustert er den Vanquish, dann gleitet sein Blick über meinen Anzug aus italienischer Wolle, registriert die Breitling an meinem Handgelenk und stoppt bei den schwarzen Berlutis an meinen Füßen. Er deutet mit dem Kopf zum Haus und tritt zur Seite. Anscheinend wird hier nur das äußere Erscheinungsbild überprüft.
Das ist ein Fehler.
Trauernde sind unkonzentriert. Einige sind von der Trauer abgelenkt. Andere sind von gesellschaftlichen Verpflichtungen okkupiert. Bei den MacLaines ist Letzteres der Fall. So oder so haben Menschen, die eine Beerdigung ausrichten, blinde Flecken. Wollten Sie sich immer schon mal im Haus von jemandem umsehen? Eine Beerdigung ist die perfekte Gelegenheit. Diebe, Paparazzi und Mörder wissen das. Haben Sie es auf eine hochrangige Persönlichkeit abgesehen? Bringen Sie jemanden aus dessen nahem Umfeld um, an den leichter heranzukommen ist, und warten Sie auf die Beerdigung.
Nicht, dass ich Angus MacLaine umgebracht habe. Ich hätte es allerdings gern getan, und da bin ich vermutlich nicht der Einzige.
Über einen Mangel an Feinden konnte sich der ehemalige Senator nicht beklagen. Einige hatte er sich selbst geschaffen, andere hatte er zusammen mit dem Zeitungsimperium seiner Familie geerbt. Auf jedes seriöse Blatt, das er besaß, kamen zehn Boulevardblätter. Seine Fernsehsender machten mehr Propaganda als die Rekrutierungsbüros der Armee.
Doch ich habe ihn nicht wegen seiner Geschäftspraktiken gehasst – wobei die es nicht gerade besser machten. Nein, er war ein herzloser Hurensohn. Vielleicht hatte er irgendwann ein Herz gehabt, doch das hatte er für ein Vermögen verkauft. Dann war er nach Washington gegangen, um dieses Vermögen mit allen Mitteln zu verteidigen, genau wie sein Vater vor ihm. Das ist die Vergangenheit. In der Gegenwart bin ich der Teufel, der gekommen ist, um zu kassieren.
Mit einem Lächeln im Gesicht überblicke ich das Königreich, das ich in Besitz nehmen werde. Das Anwesen der MacLaines erstreckt sich in alle Richtungen, so weit mein Auge reicht. Angus MacLaine hat es vor dreißig Jahren für zwei Millionen Dollar gebaut. Heute ist es das Zehnfache wert, und gestern habe ich das Pfandrecht erworben. In einem Interview habe ich gelesen, dass sein Familiensitz an die Pracht des alten Südens erinnern sollte, allerdings ohne den Ballast der Vergangenheit. Vermutlich meinte er damit Sklaverei und Bürgerkrieg. Es ist typisch für einen MacLaine zu meinen, er könnte ein Problem einfach wegreden. Der Architekt hat eine Meisterleistung an dem Fünfzig-Morgen-Anwesen in Valmont, Tennessee vollbracht – der renommiertesten Enklave außerhalb von Nashville. Auf den Steinsäulen der unteren Veranda ruht eine Terrasse, die sich im ersten Stock über die gesamte Vorderseite des Haupthauses erstreckt. Anders als traditionelle Vorkriegsvillen verfügt dieses Haus zu beiden Seiten über einen Flügel. Der Ostflügel beherbergt die Schlafzimmer und Privaträume der Familie – ein Bereich, den ich einst nicht betreten durfte. Der Westflügel ist von einem Wintergarten umgeben. Hinter der Außenküche wartet ein mit venezianischem Glas gekachelter Swimmingpool. Poolhäuser für sie und ihn vermitteln den dringend benötigten, wenn auch vollkommen absurden Eindruck von Anstand. Dann gibt es noch den Tennisplatz, und wenn man weit genug geht, Stallungen, in denen die Pferde der Familie untergebracht sind.
Das Haus interessiert mich jedoch einen Dreck. Ebenso wie der Tennisplatz und der Swimmingpool. Ich bin nicht wegen der modernen Kunst hier, um die Sammler aus der ganzen Welt die Familie beneiden. Irgendwann werde ich alles verkaufen. Aber jetzt noch nicht. Rache, wenn sie korrekt ausgeführt wird, zieht sich lange hin, wie das Liebesspiel. Sie erfordert Zeit. Sie steigert sich langsam und überzieht den Gegner Schicht für Schicht mit Schmerz, bis er schließlich bricht.
Ich bin im Rachegeschäft unterwegs.
Von innen ist Windfall dekadent. MacLaine kannte keine Zurückhaltung. Im Erdgeschoss, hinter der mit Marmor ausgelegten Halle, liegen alle repräsentativen Zimmer – das Esszimmer, ein Wohnzimmer, die Küche, ein Ballsaal, das Frühstückszimmer, ein Herrensalon und Gott weiß was noch. Einen Moment starre ich auf die Treppe, die sich beiderseits zu den oberen Räumen emporschwingt, und erinnere mich an das erste Mal, als ich einen Fuß in dieses Drecksloch gesetzt habe. Ich rücke meine Krawatte zurecht.
MacLaine wäre mit der Trauerfeier zufrieden, auch wenn die Hälfte der Anwesenden den Mistkerl verachtet hat. Menschen, die man vom Titelblatt von Forbes oder aus dem Fernsehen kennt, wenn man denn noch fernsieht, tummeln sich im Erdgeschoss. Ein Meer aus Schwarz, aus dem sich vereinzelt Menschengruppen lösen, von einer nichtssagenden Unterhaltung zur nächsten schlendern und sich nebenbei Kanapees in den Mund schieben.
Ein Mann in der Nähe der Bar blickt zufällig in meine Richtung und wird kreidebleich. Er hat mich erkannt. Nicht, dass er irgendjemandem sagen wird, wer ich bin. Dann müsste er ja zugeben, dass er mich kennt – dass er weiß, was ich tue. Ohne ihn weiter zu beachten, gehe ich an ihm vorbei. Er wird keine Probleme machen – ich habe es auf eine fettere Beute abgesehen.
»Ich glaube, wir kennen uns nicht«, sagt ein älterer Herr, als ich im Esszimmer stehen bleibe.
Ich weiß, wer er ist, gebe mich jedoch ahnungslos. Mr. Geldsack hier hat letztes Jahr das Hindernis für die Übernahme seines größten Konkurrenten ein für alle Mal beseitigen lassen. Fest drücke ich seine Hand. Das ist Aussage genug.
»Sterling«, sagt er. Doch ich bin mit meinen Gedanken schon woanders. Ich warte, dass sie endlich kommt.
»Was machen Sie beruflich?«, fragt er.
»Vermögensverwaltung.« Von einem vorbeikommenden Tablett schnappe ich mir ein Kaviarhäppchen und stecke es mir in den Mund.
»Für welches Unternehmen? Mein Mann geht in den Ruhestand …«, fährt er fort, und ich widerstehe dem Impuls, ihn einfach stehen zu lassen. Menschen wie ihn hält auch eine Beerdigung nicht vom Netzwerken ab.
»Ich bin selbstständig.«
Er wartet auf weitere Informationen – vielleicht eine Visitenkarte. Als ich ihm keine reiche, füllt er als höflicher Angehöriger der Great Generation die Leere mit hirnlosem Marktgeschwätz. Ich nicke und gebe vor zuzuhören, dann spüre ich es – spüre, dass sie kommt. Im Raum knistert es geradezu, die elektrischen Felder bauen sich auf, um sich in einem Blitz zu entladen – dem unvermeidlichen Knall.
ADAIR
Das darf doch nicht wahr sein!
Meine Mutter hat mir einmal erklärt, dass das Blut der MacLaines einen befähige, ein Feuer zu durchschreiten. Wenn man sich überlegt, wie oft die MacLaines Mist bauen, ist das eine nützliche Fähigkeit. Doch als er mich vorhin berührt hat, habe ich sogar im strömenden Regen das Brennen gespürt, das meinen Körper versengte. So war es immer zwischen uns. Niemand konnte etwas für die Verwüstung. Es war höhere Macht, eine Naturgewalt, nicht aufzuhalten, sobald sie einmal entfesselt war. Als sich auf dem Friedhof unsere Blicke trafen, konnte ich mich nur abwenden und hoffen, unbeschadet davonzukommen. Anders als beim letzten Mal.
Das ist das Problem, wenn man eine MacLaine ist, wir mögen zwar durchs Feuer gehen können, aber wir tragen Narben davon.
Kaum hält die Limousine in der Auffahrt, bin ich auch schon aus dem Wagen und die Stufen hinauf. Ich muss nicht weit gehen, um eine Flasche Scotch zu finden. Nicht in Windfall, dem Anwesen der Familie, das mein Vater gebaut hat. Mit den Fingern streiche ich über das Etikett. West Tennessee Whiskey. Die Lieblingsmarke meines Vaters. Mit zitternden Händen schenke ich mir ein Glas ein.
»Es ist fünf Jahre her«, sage ich leise zu mir.
Bald wird das Haus voller Leute sein. Trauergäste, die ihm die letzte Ehre erweisen wollen oder vielmehr über meinen Vater und sein Vermögen tratschen. Sie sind gekommen, um sich an dem Ratespiel zu beteiligen, das auch uns Hinterbliebene quält: Wer bekommt das Geld? Das Land? Die Firma? Was wird aus dem Erbe der MacLaines? Seit Monaten habe ich an nichts anderes mehr gedacht. Seit Jahren, wenn ich ehrlich bin. Seit Daddy krank wurde. Seit …
Und nun taucht Sterling Ford bei der Beerdigung auf.
Was nur eins bedeuten kann: Er will abrechnen.
Ich habe versucht, die Begegnung herunterzuspielen. Fünf Jahre sind vergangen. Wir sind keine Kinder mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich sehr verändert habe, zumindest nicht so sehr wie er. Als ich ihn kennenlernte, war Sterling schlank und muskulöse eins achtzig groß. Damals habe ich mich gefragt, ob er Sportler ist.
»Vielleicht war er das vorhin ja gar nicht«, sage ich in den leeren Raum. Aber ich weiß so sicher, dass er da war, wie ich weiß, dass ich atme.
Bilder blitzen aus meinem Gedächtnis auf, und ich erschauere – seine heiße, schweißnasse Haut auf meiner. Mein Körper hat ihn bereits vor meinem Verstand erkannt. Er ist nicht mehr der Junge aus meiner Erinnerung, aber ich würde ihn überall wiedererkennen. Mir wird heiß und kalt – ich bin eine fiebrige Version der Frau, die ich heute Morgen beim Aufwachen war. Ich wusste, nach heute würde ich eine andere sein. Ich dachte, ich hätte vielleicht noch eine Wahl. Jetzt weiß ich, dass ich mich getäuscht habe. Wir können uns nie ganz von der Vergangenheit befreien, egal wie tief wir sie begraben.
»Adair!«
Rasch kippe ich den restlichen Whiskey hinunter. Die Stimme meiner Schwägerin klingt immer leicht panisch.
Ich atme tief ein und lasse die Flasche auf dem Schreibtisch meines Vaters zurück. Als ich das Arbeitszimmer verlasse, treffe ich in der Halle auf Ginny, wo sie mit einem kleinen, sich windenden Mädchen in schwarzem Taft kämpft.
»Könntest du?« In ihren schokoladenbraunen Augen flackert Verzweiflung auf. »Ich muss mit dem Caterer sprechen.«
»Natürlich.« Ich nehme ihr meine Nichte aus den Armen. Sofort hört Ellie auf zu bocken und grinst zu mir hoch.
»Ellie, lass den Rock unten«, befiehlt ihre Mutter, dann streicht sie ihr schwarzes Etuikleid glatt. Ginny erträgt es nicht, wenn eine Falte nicht dort ist, wo sie sein soll. Ihr kupferfarbenes Haar ist zu einem Dutt zurückgesteckt, und nicht eine Strähne wagt es, aus dem festen Knoten zu fliehen. Ihre Porzellanhaut ist perfekt geschminkt, auf ihren Wangen liegt ein Hauch Rosa. Sie ist genau die Vorzeigeehefrau, die mein Bruder an seiner Seite haben wollte. Der einzige Makel in ihrem Leben ist Ellie, die mit dem festen Vorsatz auf die Welt gekommen ist, Chaos zu verbreiten. Ginny eilt in Richtung Küche und streicht dabei ihr Haar glatt.
Ich setze das kleine Mädchen ab und beuge mich nach unten, um mit ihr zu sprechen. Anders als die ihrer Mutter sind Ellies rotblonde Locken wirr und zerzaust. Mit finsterer Miene denke ich an die Auseinandersetzung, die ich gestern Abend mit ihren Eltern hatte. Ich habe ihnen gesagt, dass sie zu klein ist, um an der Beerdigung teilzunehmen. Bei ihnen geht es immer um den äußeren Schein. Wie würde es aussehen, wenn die Enkelin von Angus MacLaine nicht dabei wäre? Ich hätte mir beinahe die Zunge abgebissen, in dem Bemühen, nichts zu erwidern. Und nun ist Ginny natürlich pikiert, dass Ellie sich nicht benimmt. »Du hast dir den Rock hochgezogen?«
»Schau«, sagt sie ernst. Sie macht einen Schritt nach hinten, breitet die Arme aus und dreht sich im Kreis. Dabei fliegt ihr Kleid hoch und wickelt sich um sie, während sie sich immer weiter dreht.
»Sehr schön.« Ich klatschte, als sie langsamer wird und über ihre eigenen Füßchen stolpert, weil sie einen Drehwurm hat. Ich stütze sie und lächele zu ihr hinunter. »Wow. Das ist ziemlich cool, aber weißt du, warum deine Mom nicht will, dass du das machst?«
»Weil es Granddaddys Beerdigung ist.« Sie legt den Kopf schief und sieht mich mit fragendem Blick an. Ich wappne mich. »Was ist eine Berdigung?«
»Beerdigung«, korrigiere ich sanft. Irgendwie gerate ich bei Ellie immer an die schwierigen Fragen. »Es bedeutet Abschied.«
»Warum sind all diese Menschen hier, um sich zu verabschieden?« Sie hebt die Hände, um zu unterstreichen, wie merkwürdig das alles ist. »Warum können wir ihm nicht einfach winken, wenn er geht?«
Ich verfluche Ginny, weil sie dieses Gespräch nicht mit ihr geführt hat. Das ist ihre Aufgabe. Sie ist die Mutter. Doch ich weiß genau, was passiert, wenn ich sie darauf anspreche. Sie wird flattern wie ein verletztes Vögelchen. Es hat keinen Zweck, darüber zu reden. Ginny und ich stehen uns nicht sonderlich nahe. Nicht mehr.
»Er ist schon gegangen«, erkläre ich ihr sanft, »und mit dieser Party erinnern wir uns an ihn.«
»Gibt es Kuchen?«, fragt sie hoffnungsvoll.
»Wahrscheinlich.«
Ein Grinsen erscheint auf ihrem Kindergesicht, dann erstirbt es. »Er ist weg? Vermisst du ihn?«
Ich brauche einen Moment für die Antwort, denn ich bin mir nicht sicher. Sie wartet geduldig, und ich weiß, was ich sagen sollte. »Ja.«
»Wir müssen uns Kuchen holen«, sagt sie ernst, »dann geht es uns besser.«
»Guter Plan.« Ich nehme ihre kleine Hand. Sie ist warm und weich und vermag etwas von dem Eis aufzutauen, das sich seit heute Morgen um mein Herz gebildet hat. Es ist schwer, Trauer und Wut zu fühlen, wenn man mit diesem lebendigen Wesen zusammen ist.
Doch meine Zuversicht schwindet, als ich Hand in Hand mit Ellie das Wohnzimmer betrete und mein Blick auf ihn fällt. Bis jetzt hatte ich gehofft, einen Geist gesehen zu haben. Das ist nicht der Fall. Erst als Ellie ungeduldig an meinem Ärmel zupft, merke ich, dass ich ihre Hand losgelassen habe. Sie schiebt sie in meine zurück, doch diesmal fühlt es sich nicht tröstlich an.
Er unterhält sich im Nachbarraum mit einem älteren Herrn, einem Freund meines Vaters, und umfasst mit seinen kräftigen Händen die Lehne eines Mahagonistuhls. Ich versuche, ihn nicht anzustarren, kann den Blick jedoch nicht von ihm losreißen und suche nach einem Hinweis, warum er hier ist. Als ich Sterling damals kennenlernte, fragte ich mich, warum er im Vergleich zu anderen Typen in unserem Alter so muskulös war. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass er noch mehr Muskeln aufbaut. Damals war er eindrucksvoll. Und heute? Ist er einschüchternd. Selbst von hier aus erkenne ich, dass der Anzug für seine breiten Schultern maßgeschneidert wurde. Aus seinem Ärmel lugt die geschwungene Linie eines Tattoos. Das ist neu. Der Schopf schwarzer Locken ist einem Bürstenschnitt gewichen, der die markante Linie seines Kiefers betont, auf dem ein leichter Bartschatten liegt. Ich beobachte, wie er die Hand hebt und sich übers Kinn streicht. Als sein Blick durch den Raum gleitet und schließlich auf mir landet, scheint die Welt stehen zu bleiben. Er hält in der Bewegung inne, den Zeigefinger an seinem Mund, und ich könnte schwören, dass er mit den Zähnen an seiner Unterlippe nagt.
Er hat mich erwischt, wie ich ihn anstarre, dennoch kann ich den Blick nicht abwenden.
Ellie zieht ihre Hand aus meiner und holt mich in die Gegenwart und zu meinen Pflichten zurück.
»Tante Dair.« Sie zeigt auf die Speisen, die die Caterer auf dem Esstisch aufgebaut haben.
Natürlich ist er ausgerechnet in diesem Raum, wenn ich ihr Kuchen versprochen habe. Dachte er, ich komme, um mit ihm zu reden? Ist er meinetwegen hier? Vielleicht ist es nur Zufall.
Sei nicht albern. Sterling taucht doch nicht zufällig ausgerechnet heute aus dem Nichts hier auf.
Vielleicht hat er mit meinem Vater Geschäfte gemacht. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Mein Vater mochte sich hin und wieder mit dem Teufel persönlich zusammengetan haben, um einen Vertrag zum Abschluss zu bringen, aber irgendwie bezweifele ich, dass Sterling mit einem MacLaine etwas anfangen würde. Nicht noch mal. Nicht nach allem, was geschehen ist.
Andererseits sind wir jetzt erwachsen. Wahrscheinlich hat er gar nicht mehr an mich gedacht, nachdem er Valmont verlassen hatte. Und nach seinem Anzug zu urteilen, ist er ziemlich erfolgreich. Ich frage mich, wo er die letzten fünf Jahre gewesen ist.
Ellie zieht mich zum Dessertbuffet. Offenbar hat sie den Schokoladenkuchen entdeckt.
Erleichtert seufze ich auf, als ich meinen Bruder sehe: Malcolm. Ich gehe zu ihm und unterbreche sein Gespräch, das sich ohnehin um Geschäftliches zu drehen scheint. Oder um Politik. Ich weiß nicht, was auf einer Trauerfeier schlimmer ist. »Sie will Kuchen essen.«
Ohne mich oder seine Tochter eines Blickes zu würdigen, sagt er: »Dann gib ihr welchen.« Dann wendet er sich wieder seinem Gesprächspartner zu.
»Sie ist deine Tochter«, gebe ich eisig zurück, woraufhin er mich mit noch eisigerem Blick taxiert. Es ist mir zuwider, aus seinem Gesicht mit meinen grünen Augen angestarrt zu werden. Sind meine auch so leer? Malcolm hat das dunkle Haar und das derbe Aussehen meines Vaters, aber die Augen haben wir beide von meiner Mutter. Ellie ist komplett verstummt und zieht auch nicht mehr an meiner Hand. Als ich zu ihr hinuntersehe, mache ich mir Vorwürfe. Ich sage mir, dass sie noch klein ist – dass sie nicht versteht, was los ist, aber sie versteht mehr, als ich mir eingestehen möchte. Ein Stein würde die Spannungen zwischen meinem Bruder und mir bemerken. Doch das ist nicht das Schlimmste. Es ist ein Spiel geworden, Ellie hin und her zu schubsen. Ich konnte Malcolm und Ginny nicht im Stich lassen, als sie wegen der Erkrankung meines Vaters Hilfe brauchten. Das war vor einem Jahr, seither habe ich die halbe Zeit Kindermädchen gespielt. Darum landet Ellie normalerweise bei mir. Vermutlich hat ihre Mutter ein besseres Gefühl, sie bei einer Verwandten abzuladen anstatt bei jemand Fremdem. Ellies kleine Lippen beben, und ich begreife, dass sie viel mehr versteht, als ihre Eltern oder ich ihr zutrauen.
»Besorgen wir uns Kuchen«, sage ich mit angespannter Stimme. »Daddy will wohl keinen.«
Ich führe sie zum Buffet und gebe vor, ganz mit ihren Wünschen beschäftigt zu. Doch es funktioniert nicht. Mein gesamter Körper kribbelt, so deutlich nehme ich ihn wahr. Erinnerungen steigen in mir auf und wecken meine Gefühle von damals. Sie tanzen über meinen Nacken, rieseln durch meinen Körper, und mich überläuft eine Gänsehaut. Ich merke erst, dass ich ein Stück von allem nehme, auf das Ellie zeigt, als ich ihr schon einen ganzen Berg Gebäck auf den Teller geladen habe. Wenn sie überzuckert ist, lernen ihre Eltern vielleicht, sie mir nicht mehr aufs Auge zu drücken.
Ich muss nicht hinübersehen, um zu wissen, dass Sterling mich jetzt beobachtet. Ich spüre, wie sein Blick über mich gleitet und durch die Mauer dringt, die ich in den letzten fünf Jahren so sorgsam um mich errichtet habe.
Ginny taucht neben mir auf und wirft einen missbilligenden Blick auf Ellies Teller. Sie wirkt noch nervöser als vorhin. Das ist typisch. Ihre Nervosität steigert sich im Lauf des Tages. Die kleine Pillensammlung, die ihr Arzt ihr verschrieben hat, hilft nicht mehr.
Nachdem Ellie nun mit Süßem versorgt ist, lasse ich sie bei Ginny. Ich ermahne mich, nach vorn zu sehen, und schaffe es, Sterling zu entkommen. Ich möchte ihn ansehen, möchte zu ihm gehen, verbiete es mir jedoch.
Doch nun betritt zu allem Überfluss Cyrus Eaton das Wohnzimmer. Er bewegt sich ebenso geschmeidig wie Sterling und sucht mit seinen dunklen Augen den Raum nach seiner Beute ab. Als er mich entdeckt, rechne ich fast damit, dass er sich auf mich stürzt. Seine Anweisungen hat er von seiner Freundin erhalten, meiner besten Freundin Poppy. Sie steckt in Paris fest, darum hat sie ihn geschickt, damit er auf mich aufpasst. Wenn sie wüsste …
Ich habe einen Fehler gemacht. Wenn ich ehrlich bin, mehrere.
Cyrus steht vor mir. Sterling hinter mir. Einem von ihnen muss ich mich stellen. Kurz überlege ich, mich aus dem Fenster zu hechten, aber wahrscheinlich würde ich den Alarm auslösen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Darin war ich noch nie sehr gut.
Ich will wissen, warum Sterling hier ist und wo er gewesen ist. Ich habe eine Million Fragen an ihn und möchte ihm einiges vorwerfen. Aber ihm zu nahe zu kommen, ist zu gefährlich, das ist die Wahrheit nicht wert. Also gehe ich zu Cyrus. Besser der Teufel, den man kennt. Ich weiß nichts mehr über Sterling Ford. Cyrus dagegen ist ein fester Bestandteil meiner Welt. Genau wie Poppy und unsere Freunde. Wie mein Bruder und seine Familie. Sogar mein Vater.
Aber Sterling? Er war hier, als mein Leben in Trümmern lag. Er hat es wiederaufgebaut.
Vermutlich ist er nicht gekommen, um mich ein zweites Mal zu retten.
STERLING
Sie wirkt unentschlossen und bleibt lange genug stehen, sodass ich sie betrachten kann. Als wir uns kennenlernten, war Adair MacLaine ein schmächtiges Mädchen. Das Mädchen war hübsch. Die Frau ist umwerfend. Ihr einst schlanker Körper ist zu weicher Fülle herangereift, üppig und verführerisch. Ein schwarzes Kleid schmiegt sich um ihre vollen Hüften, und das tiefe Dekolleté gewährt einen Blick auf ihre festen Brüste. Sie hebt den Kopf und reckt die Nase in die Luft, und ich frage mich, ob sie je das Selbstvertrauen gewonnen hat, nach dem sie sich vor fünf Jahren so verzweifelt gesehnt hat. Vielleicht hat Daddys Geld geholfen.
Sie macht auf ihren Louboutins kehrt und geht lächelnd in Richtung Tür. Als ich mich umdrehe, sehe ich, dass sie zu einem alten Freund geht. Ich bin zehn Schritte näher bei ihm und gut einen Kopf größer, so fange ich Cyrus Eaton ab, bevor sie ihn erreicht. Jetzt muss sie sich wirklich entscheiden. Kampf oder Flucht. Vielleicht hat sie sich endlich gehäutet, um die Frau zu werden, die sie eigentlich ist. Adair zögert kurz, dann zieht sie sich zurück und verschwindet in der Menge.
Das überrascht mich nicht. Cyrus hingegen schon. Er braucht einen Moment, ehe er mich erkennt, dann schlägt er mir eine Hand auf die Schulter und zieht mich in seine Arme. »Sterling Ford. Was zum Teufel machst du hier?«
Auf seine Direktheit ist Verlass.
»Wie lange ist das her? Fünf Jahre?«, fährt er fort, als wir uns aus der Umarmung lösen. »Ich wusste nicht, dass du wieder in Valmont bist.«
»Eigentlich in Nashville«, erkläre ich.
»Zu Besuch?« Cyrus zieht einem mehr Informationen ab als ein Computervirus. Das ist seine besondere Begabung, mit der er auf dem Aktienmarkt recht erfolgreich ist. Anders als die meisten Männer, die ich kennengelernt habe und die sich einen Namen im Börsenhandel gemacht haben, zeigt Cyrus keine Anzeichen von Stress oder vorzeitiger Alterung. Wahrscheinlich weil er das Geld, das er dort verdient, niemals brauchen wird. Am Markt zu spielen, ist für ihn nicht mehr als das: ein Spiel. Nicht risikoreicher als Poker oder Black Jack. Millionen zu investieren, ist für ihn wie Monopoly. Sein wilder, blonder Schopf ist jetzt kurz geschoren, und er trägt einen Dreitagebart, aber sein katzenhaftes Lächeln ist noch wie früher.
»Ich habe eine Wohnung in der Nähe vom Broadway.« Mehr braucht er nicht zu wissen. Cyrus steht nicht auf meiner schwarzen Liste, aber das heißt nicht, dass ich ihm vertraue.
»Wir sollten bei Gelegenheit zusammen zu Abend essen. Poppy kommt Ende der Woche aus Paris zurück. Sie war mit ihrer Mutter bei den Frühlingsshows.« Er zuckt die Schultern, als wäre das ganz normal für eine erwachsene Frau. Für die Menschen hier ist es das. Ich habe nichts gegen Cyrus oder seine Freundin. Meiner Meinung nach gehören sie noch zu den anständigeren Menschen hier in dieser Stadt. Das heißt aber nicht, dass sie mit beiden Beinen auf dem Boden stehen.
Das ist das eigentliche Problem mit Valmont. Es ist eine ganz eigene exklusive Blase, sie leben nah genug an Nashville, um zu pendeln, aber weit genug entfernt, um über ausreichend Platz zu verfügen. Valmont zieht Reiche und Berühmte an. Der Immobilienmarkt ist entsprechend: Ein Haus kostet über eine Million Dollar. Aufgeblasenheit gilt hier als vornehm und selbst die Nettesten wie Cyrus und Poppy haben keinen Bezug zur Realität. Wie soll man den auch haben, wenn man mit einem Treuhandfonds geboren wird, wenn man mit Ferienhäusern und Personal aufwächst?
Es gibt zwei Tricks, mit denen man in Valmont überlebt. Der erste besteht darin, die Bewohner zu verstehen – was treibt sie an, was macht ihnen Angst, wo informieren sie sich. Der zweite ist, nie wie sie zu werden.
Ich mag seit meiner Zeit hier ein Vermögen verdient haben, aber ich werde nie einer von ihnen sein. Das würden sie niemals zulassen.
»Ist das nicht schrecklich?« Cyrus senkt die Stimme und beobachtet jemanden hinter mir. Auch ohne mich umzudrehen, weiß ich genau, von wem er spricht. Er hat immer auf Adair aufgepasst. Es gab Zeiten, in denen ich ihm dafür dankbar war. Jetzt möchte ich etwas gottverfluchten Verstand in ihn schütteln. »Den Vater zu verlieren nach …«
Halbherzig stimme ich ihm zu. Ein Teil von mir ist seiner Meinung. Der Rest ist anderer Ansicht. Viele verlieren ihre Väter. Viele haben traurige Geschichten. Warum sollte ihre wichtiger sein als die der anderen?
»Zumindest hatte sie Zeit, sich darauf vorzubereiten«, sagt er.
»War er lange krank?«, frage ich und gebe mich ahnungslos. Dabei habe ich in einem Dreisternerestaurant gefeiert und Champagner fürs Haus bestellt, als ich hörte, dass der Patriarch der MacLaines krank sei.
»Ein paar Jahre. Nett von dir, dass du gekommen bist, vor allem, nachdem du sie verlassen hast.« Er legt mir eine Hand auf die Schulter und sieht mich bedeutungsvoll an. Er weiß mehr als die meisten über das Ende meiner Beziehung mit Adair, aber er weiß nicht alles.
»Vorbei ist vorbei.« Das meine ich ernst. Ich habe kein Interesse an dem Jungen von früher oder an dem Mädchen von damals. Mich interessiert, was als Nächstes passiert. Zu viele Leute denken, bei Rache ginge es um die Vergangenheit. Doch das stimmt nicht. Es geht um die Zukunft. Die Vergangenheit kann man nicht zerstören. Man kann nur jemandes Zukunft vernichten.
»Ich sollte …« Er verstummt und lässt eine Einladung offen.
»Ich bin gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen«, sage ich. »Adair erinnert sich nicht einmal mehr an mich.«
»Ich bin sicher, dass das nicht stimmt.«
»Dann will sie mich nicht sehen«, sage ich. Cyrus würde gern widersprechen, das sehe ich. Aber wir wissen beide, dass es stimmt. Sie weiß, dass ich hier bin, ich habe sie dabei erwischt, wie sie mich angesehen hat. Frauen wie sie werfen Männer weg wie Abfall. »Ist sie mit jemandem zusammen?«
»Es gibt einige, die versucht haben, bei ihr zu landen.« Cyrus grinst verschwörerisch. »Money hat ein paar Anläufe unternommen.«
Ich unterdrücke ein Knurren. Ein paar Sachen habe ich an Tennessee vermisst – Hot Chicken, gute Musik und schwüle Sommerabende –, aber Montgomery West zählt sicher nicht dazu.
»Wie ich sehe, magst du ihn noch immer nicht«, murmelt Cyrus.
»Ach was, das ist Geschichte«, bringe ich heraus. Meine Gründe, »Money« West zu hassen, würden auch seinen ältesten Freund gegen ihn aufbringen. Doch ich behalte sie für mich. Information ist nur etwas wert, solange man sie für sich behält.
»Jetzt muss ich mich mal um Adair kümmern. Das habe ich Poppy versprochen«, wiederholt Cyrus seinen Auftrag. »Wir sollten uns aber treffen. Ich will wissen, was du in den letzten Jahren getrieben hast.«
Übersetzung: Er will wissen, wie es sein kann, dass der arme Stipendiat jetzt in einem Zweitausend-Dollar-Anzug vor ihm steht. Das ist ein Geschäftsgeheimnis, aber Cyrus ist vielleicht mein bester Kontakt hier. Wenn ich mich mit ihm treffe, wird sich einiges von selbst ergeben.
Ich hole einen silbernen Visitenkartenhalter aus meinem Sakko und reiche ihm eine Karte. Cyrus mustert einen Moment das Leinenpapier, dann steckt er sie ein. In seinen Augen lese ich eine Million Fragen, aber er stellt mir keine einzige. »Ich ruf dich an.«
»Mach das«, erwidere ich abwesend, weil ich gerade etwas Interessantes bemerke. Malcolm MacLaine und eine Handvoll anderer Männer bewegen sich zum gegenüberliegenden Flügel, wo sich die jetzt verlassenen Büroräume befinden. Cyrus entschuldigt sich, um Adair zu suchen, und gibt mir die Chance, ihnen zu folgen.
Aufgrund meiner flexiblen Moral bin ich es gewohnt, falls nötig ungesehen zu bleiben. Als die Männer in einem der Konferenzräume verschwinden, schnaube ich kurz vor Lachen. War ja klar, dass ein MacLaine bei einer Beerdigung Hof hält.
Ich schlüpfe ein paar Minuten nach ihnen in den großen Raum. Sie sind schon voll bei der Sache – es geht laut zu, die erste Runde Scotch ist bereits getrunken –, darum bemerkt niemand, dass ich leise die Tür hinter mir schließe. Ich kenne einige von MacLaines Kollegen. Der Familienanwalt Judd Harding und ich haben unsere eigene Geschichte. Der Rest der Männer ist aus demselben Grund hier wie ich: Geld. Angus MacLaine war hoch verschuldet gestorben, nachdem er gezwungen war, sich aus dem Senat zurückzuziehen – eine Aktion, mit der er sich bei den Mächtigen, die ihn dorthin gebracht hatten, nicht gerade beliebt gemacht hatte.
»Ich weiß, der Tod meines Vaters hinterlässt einige ungelöste Probleme, aber meine Kandidatur für den Senat in diesem Herbst ist eine sichere Sache.« Malcolm ist aufgeregt und rauft sich die Haare. »Sollte die Firma meine Kandidatur allerdings nicht unterstützen, werden wir alle verlieren.«
»Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu besprechen, Malcolm«, weist Harding ihn zurecht und gibt sich keine Mühe, seine Resignation zu überspielen. »Sobald das Testament eröffnet ist, können wir uns um diese Angelegenheiten kümmern.«
»Ich brauche kein gottverdammtes Testament, um zu wissen, dass die Anteile meines Vaters an der Firma mir gehören!« Malcolm schlägt mit der Faust auf den Konferenztisch und lässt die Kristallgläser vor seinen Geschäftspartnern klirren.
»Meinem Onkel gehören Anteile an MacLaine Media.« Auch von hinten erkenne ich Luca DeAngelos gelangweilten Bariton. Dezent tippt er mit dem Zeigefinger auf den Tisch. Ich kenne niemanden außer ihm, der selbst dann gelangweilt klingt, wenn er jemandem droht. Ein Grund, warum er einer meiner besten Freunde ist. Ich finde, man sollte sich mit Luca gut stellen. »Ohne die Unterstützung meiner Familie wäre die letzte Kandidatur Ihres Vaters für den Senat …«
»Entschuldigen Sie bitte«, unterbricht ihn Malcolm, als er mich entdeckt. »Das hier ist ein vertrauliches Meeting.«
»Geschäfte auf einer Trauerfeier?«, spotte ich. Malcolm MacLaine hat wahrscheinlich noch am Totenbett seines Vaters Geschäfte abgeschlossen, das Dreckskerl-Gen seiner Familie eben.
»Und Sie sind?« Er kneift die Augen zusammen und versucht, mich einzuordnen. Als es ihm nicht gelingt, lächelt er den Anzugträgern entschuldigend zu. »Ich rufe die Security …«
»Das wird nicht nötig sein«, unterbreche ich ihn und schreite durch den Raum auf den Barwagen zu. »Wenn Sie mein Angebot hören, werden Sie froh sein, dass Sie mich gebeten haben zu bleiben.«
Er antwortet nicht.
Auf eine Einladung zu einem Drink kann ich verzichten, denn alles hier gehört mir schon. Ich bediene mich und schenke mir ein Glas ein, dann wende ich mich wieder der Gruppe zu. Malcolm hat sich kein Stück auf das Telefon zubewegt, die anderen Männer beobachten mich mit einer Mischung aus Neugier und Beklommenheit. Luca wirft mir einen Blick aus seinen dunklen Augen zu, der deutlich sagt: Hat ja ganz schön lange gedauert. Ich zucke die Achseln. Ging nicht anders. Es ist nicht so, dass er einen dramatischen Auftritt nicht zu schätzen wüsste.
»Bedienen Sie sich.« Malcolm kneift die Lippen zusammen.
Am anderen Ende des Tisches, ihm gegenüber, ist noch ein Platz frei. Mit einer Hand knöpfe ich mein Sakko auf, dann setze ich mich. Die Männer drehen die Köpfe von mir zu Malcolm und wieder zurück wie Metronome, doch er glotzt mich nur an. Ich hätte ebenso gut hereinspazieren und auf den Teppich pinkeln können. Ich markiere mein Revier und ignoriere seinen Anspruch auf den Laden, und das weiß er.
»Sie können gehen.« Ich deute auf die anderen. Luca steht auf, um sich zu entschuldigen, während der Rest unterschiedlich stark errötet und protestiert. Bis auf Harding. Er geht im Geiste sein Adressbuch durch. An seinem wachsamen Blick erkenne ich, wie er die Seiten durchblättert. Als er die Antwort gefunden hat, nickt er überrascht. Trotz des Anzugs und all der Jahre, die vergangen sind, erkennt er, wer ich bin. Oder besser gesagt, wer ich war. Niemand hier weiß, wer ich jetzt bin. Das gefällt mir, und ich will, dass es so bleibt.
»Ich weiß nicht, für wen Sie sich halten«, zischt Malcolm, woraufhin ein Schwall wütender Bemerkungen von den anderen folgt.
Ich lasse den Whiskey in meinem Glas kreisen und warte.
»Tun Sie, was er sagt«, weist Harding sie entgegen den Protesten an, wirkt allerdings nicht gerade glücklich.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich für mich einsetzt, aber ein unfreiwilliger Verbündeter ist besser als gar keiner.
Die Männer gehen zögerlich aus dem Raum. Ich ignoriere die neugierigen Blicke in meine Richtung. Sie werden schon bald erfahren, wer ich bin. Keiner von ihnen sagt ein Wort. Malcolm schweigt weiterhin und starrt mich wütend an.
Ich streiche mit der Fingerspitze über den geschliffenen Rand des Glases, und ein leiser vibrierender Ton erklingt. »Kopf hoch. Das ist schließlich eine Beerdigung.«
»Wollen Sie das trinken, oder sind Sie zum Spielen hergekommen?«, fragt Malcolm trocken.
Ich lehne mich auf meinem Stuhl zurück. Ich bin tatsächlich hergekommen, um zu spielen, aber nicht so, wie er denkt. Mein Spiel ist etwas interessanter, als mich mit einem Raum voller feiger Kredithaie anzulegen. Jahrelang habe ich alles vorbereitet. MacLaine will Antworten. Ich möchte den Moment genießen.
»Sie verschwenden meine Zeit.« MacLaine schiebt den Stuhl vom Tisch und steht auf.
Ich deute mit dem Kinn auf seinen Stuhl. »Setzen Sie sich wieder hin.«
»Wenn Sie meinen …«
»Setzen«, fahre ich ihn an. Er lässt sich auf den Stuhl zurücksinken. Einen Moment koste ich meinen Triumph aus. Es ist leichter als gedacht, MacLaine zu demütigen. Er ist nicht derjenige, den ich zu meinen Füßen kriechen sehen will, aber er ist eine gute Übung.
»Diese Männer wissen es noch nicht, aber Sie haben keinen Anspruch mehr auf MacLaine Media oder auf das Vermögen Ihrer Familie«, informiere ich ihn.
Ohne dass er es verhindern kann, treten die grünen Augen aus seinem Kopf hervor. Er räuspert sich und löst den Knoten seiner silbernen Krawatte. »Ich bin mir nicht sicher, ob meine Investoren …«
»Ihre Gläubiger«, korrigiere ich. »An dem Tag, an dem Ihr Vater gestorben ist, sind alle Partnerschaften und finanziellen Vereinbarungen mit ihm gestorben. Aber das wissen Sie schon, oder? So weit wird Mr. Harding Sie informiert haben.«
Fassungslos sieht Malcolm den Mann zu seiner Rechten an. Später wird Harding ihm erklären, wer ich bin und woher er mich kennt – ich frage mich, ob er ihm die ganze Geschichte erzählen wird –, aber selbst er ist über die laufenden Ereignisse nicht informiert.
»Kein Senatssitz für Sie«, fahre ich fort. »Kein allmächtiges Mediennetzwerk. Nicht, nachdem die Hälfte der Zeitungen Ihrer Familie pleite ist. Wissen Sie, wie viele Ihrer Zeitungsredaktionen kürzlich dichtgemacht haben, Mr. MacLaine?«
»Das geht Sie nichts an.«
»Es geht mich sehr wohl etwas an. Seit heute Morgen besitze ich die Mehrheit der Anteile an MacLaine Media.« Ich halte inne, damit er die Nachricht verdauen und ich seinen Schock genießen kann. »Ihr Vater hat seine Anteile schlecht aufgeteilt. Ich bin mir sicher, das hat Harding Ihnen berichtet.«
»Wie viele besitzen Sie?« Er flüstert nur noch.
»Alle, bis auf die, die er Ihnen und Ihrer Schwester hinterlassen hat.«
Bei dieser Information funkeln seine Augen triumphierend. »Sie wissen nicht, wie viel er uns hinterlassen hat.«
»Nein, aber ich weiß, dass Ihr Vater vor seinem Tod fünfundvierzig Prozent von MacLaine Media verkauft hat. Raten Sie mal, wie viel ich davon erworben habe?« Gott, ich könnte es nicht mehr genießen, wenn ich Adair hier auf dem Tisch vor den Augen der Familie auf jede erdenkliche Weise ficken würde.
Selbst auf diese Entfernung sehe ich, wie er schluckt, um die Information zu verdauen. Vielleicht hat ihm Harding noch nicht alle schlechten Nachrichten überbracht. Es herrscht dröhnendes Schweigen. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, meine Worte abzuwägen, ehe ich sie der Welt mitteile. Malcolm ist da anders.
»Das ist unmöglich«, platzt er heraus. »Harding?«
Der Anwalt presst die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Das scheint Malcolm, der die Dinge sonst anscheinend sehr deutlich hören muss, als Antwort zu genügen.
»Morgen will ich das Testament sehen«, murmelt Malcolm.
»Die Eröffnung ist für …«
»Das ist mir egal. Richten Sie es ein. Sofort«, faucht er.
Kopfschüttelnd verlässt Harding den Raum. Fast tut er mir leid. Er hat einen Tyrannen gegen einen anderen eingetauscht, aber der hier ist schlimmer. Malcolm MacLaine ist eine Klasse unter seinem Vater. Laut meinen Recherchen ist er nur halb so gerissen und nicht annähernd so schlau. Aber gefährlich ist er trotzdem.
Nachdem der Anwalt gegangen ist, schweigen wir einen Moment. Es gibt keine Zeugen für das, was hier passiert. Er könnte sich dazu verleiten lassen, mir die Meinung zu geigen, doch jetzt gibt es andere Überlegungen. Ich kann fast hören, wie sich die Rädchen in seinem Kopf drehen. Wenn ich die Wahrheit sage – wenn mir ein bedeutender Anteil von MacLaine gehört –, ist es kein Problem für mich, seine Geschäftspartner abzusägen.
»Was wollen Sie?« Er schafft es, neutral zu klingen, obwohl die Knöchel seiner Hände, mit denen er die Tischkante umklammert, weiß hervortreten.
Das ist eine wichtige Frage. Es gibt das, was ich ihm sagen werde, und das, warum ich eigentlich hier bin, aber die zwei Wünsche sind untrennbar miteinander verwoben. Ich zögere und tue so, als würde ich nachdenken. Ich habe diesen Moment geplant, auf ihn gewartet, und Perfektion erfordert Zeit.
Ich weiß alles über Malcolm MacLaine. Ich weiß, dass er auf die Valmont University gegangen ist und mit summa cum laude abgeschlossen hat. Natürlich ist dieser Abschluss gekauft. So war das in der guten alten Zeit. Ich weiß, wie er seine Frau kennengelernt hat. Ich kenne ihr Geheimnis. Und seins. Ich mache es mir zur Aufgabe, die schmutzigen Wahrheiten der Menschen zu kennen. Wissen ist auf dieser Welt das Einzige, was noch wertvoller ist als Geld. Die richtige Information ist ein Blankoscheck. Meine Recherchen über Malcolm MacLaine deuten darauf hin, dass er ebenso herzlos ist wie sein Vater. Aber selbst die Herzlosen haben ihre Schwachpunkte. Der Schwachpunkt seines Vaters waren seine Kinder. Malcolms Schwäche ist seine Frau. Ginny MacLaine ist keine Frau, die bei einem ruinierten Mann bleibt. Wenn er sein Vermögen verliert, verliert er auch sie. Das ist uns beiden klar.
Darum weiß ich, dass er kein Problem mit meiner Forderung haben wird.
»Ihre Schwester. Ich will Ihre Schwester.«
Es folgt eine lange Pause, in der er meine Forderung verdaut. »Meine Schwester ist nicht käuflich.«
Das ist eine eindrucksvolle Vorstellung von Anstand, aber Geschäft ist Geschäft, sonst würden wir nicht hier sitzen.
»Malcolm.« Ich lehne mich auf dem Stuhl zurück und beobachte, wie er zuckt, als ich ihn wie einen alten Freund beim Vornamen nenne. »Wir wissen beide, dass alles käuflich ist, sogar Adair MacLaine.«
STERLING
FÜNFJAHREZUVOR
Valmont ist ganz anders als die Großstadt. New York war voller Leben, es strömte einem aus jeder Gasse, aus jeder Mauerritze entgegen – eine Herausforderung für die Sinne. Touristen fanden es überwältigend. Doch für mich war es mein Zuhause. Bis jetzt. Bis Francie auf einmal Pläne für meine Zukunft hatte. Bis meine Testergebnisse den Lehrern auffielen. Bis zu dem Punkt war ich nur ein Pflegekind gewesen, das dem Staat auf der Tasche lag. Anschließend warfen die Leute mit Worten wie hochbegabt und Universität um sich.
Ich füllte die Bewerbungen aus, damit Francie zufrieden war. Ich hatte genug beschissene Pflegemütter gehabt, um zu wissen, dass ich es kaum besser als bei ihr treffen konnte. Mit einer Aufnahmebestätigung rechnete ich nicht. Nicht von den Schulen, bei denen ich mich bewarb, selbst mit guten Testergebnissen und anständigen Noten.
Als sie mit dem Umschlag mit dem Wappen der Valmont University in unsere kleine Küche in Queens kam, leuchteten ihre Augen.
»Das können wir uns nicht leisten«, sagte ich rundheraus. Das war die ganze Zeit mein Plan gewesen – die Latte so hoch zu legen, dass ich locker darunter hindurchtauchen und mein Leben fortsetzen konnte – das Leben, das ich mir hier aufgebaut hatte. Ich hatte mich einigermaßen anständig benommen, sodass ich seit drei Jahren hier sein durfte. Und ich würde jetzt nicht gehen. »Das Community College ist schon in Ordnung.«
»Du bist zu klug, um hier kleben zu bleiben, Sterling.«
Da merkte ich, dass sie doch tatsächlich weinte. Das konnte ich nicht mehr ertragen – dabei hatte ich sie oft zum Weinen gebracht. In den ersten Jahren, die ich in der Obhut des Jugendamtes war, hatte ich mehrere Pflegeeltern verschlissen. So war ich überhaupt bei Francie gelandet. Ich habe nie verstanden, warum sie mich behalten hat. Aber jedes Mal, wenn ich mit einer blutigen Nase nach Hause gekommen war, hatte sie meine Wunden gesäubert, meine Kleidung gewaschen und mir etwas zu essen gemacht. Dann erst hat sie mich an die Regeln erinnert.
Es gab jede Menge Regeln in Francies Haus. Regeln, die es bei meinen Freunden nicht gab. Sie erwartete gute Noten – und damit meine ich, dass besser kein Minus hinter dem A stehen sollte. Um achtzehn Uhr wurde zu Abend gegessen. Sonntags musste ich sie zur Messe begleiten. Dafür warf sie mich nicht raus. Im ersten Jahr bei ihr schaffte ich es kaum, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Damals war sie nachsichtiger. Mit der Zeit gab ich mir mehr Mühe. Ich gehorchte, wenn sie befahl, ich sollte schwerere Kurse belegen, auch wenn das hieß, dass ich mir einiges von den Jungs gefallen lassen musste. Ich gab ihr ein paar von meinen Geschichten zu lesen, aber nicht alles, was ich schrieb. Ein Junge braucht Privatsphäre. Trotz meiner häufigen Prügeleien, so was war in unserer Gegend unumgänglich, hatte ich gute Noten bekommen und die blöde Aufnahmeprüfung fürs College gemacht – ohne wirklich hingehen zu wollen. Bis die verdammte Einladung mit der Post kam.
Ich wusste nicht, ob die Valmont University die Latte gesenkt hatte, um mich aufzunehmen. Ich hatte die Broschüre gelesen, aber das alles war etwas zu glänzend, zu sehr mit Photoshop aufpoliert, um wahr zu sein. In diese Welt gehörte ich nicht. Valmont, Tennessee mochte nur eine halbe Stunde von Nashville entfernt sein, aber es ist mit einem Fuß fest in der Vergangenheit verwurzelt, während der andere verzweifelt versucht, in die Zukunft zu schreiten.
Francie fährt mich zum Campus. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass mein Stipendium die gesamten Kosten deckt, wie sie behauptet. Dass sie auf der vierzehnstündigen Fahrt in der Raststätte das Ein-Dollar-Menü wählt, bestätigt meinen Verdacht. Francie ist besonders. Sie hätte mich an meinem achtzehnten Geburtstag rauswerfen können, aber das hat sie nicht getan. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich darauf eingelassen habe, Valmont eine Chance zu geben. Ein Semester, und ich bin raus. Noch ehe wir die Grenze von Tennessee erreichen, studiere ich bereits die örtlichen Aushilfsjobs auf meinem Smartphone. Ich bezweifle, dass sie sich meine Ausbildung hier leisten kann, egal was sie sagt.
Als wir den Campus erreichen, weicht mein Zweifel Gewissheit. Ich hab schon den einen oder anderen Campus gesehen. Die NYU liegt schließlich mitten in der verdammten Stadt. Aber dieser Gebäudekomplex hier ist eine Stadt für sich. Große schmiedeeiserne Tore öffnen sich zum University Drive, und über unseren Köpfen bilden Eichen ein Blätterdach und werfen smaragdgrüne Flecken auf die Motorhaube unseres weißen Mazda.
»Das ist die älteste noch existierende Kopfsteinpflasterstraße der Stadt«, informiert mich Francie. Sie hat vor unserer Fahrt hierher jede einzelne Information über diesen Ort verschlungen. Seufzend trommelt sie aufs Lenkrad. »Ich bin eifersüchtig.«
»Auf was? Die Scheißstraße? Mir tun die Eier weh.«
Ihr Lächeln verblasst, und sie wirft mir diesen Blick zu, der sagt, dass ihr meine Einstellung nicht gefällt. Ich habe ihr die Laune verdorben. Eine Fähigkeit, die ich ziemlich gut beherrsche: nette Menschen verletzen. Das muss erblich bedingt sein. Mein beschissener Vater war ein Meister darin.
»Es ist hübsch«, sage ich und versuche, etwas Begeisterung aufzubringen. Die Kopfsteinpflasterstraße tut mir wirklich im Schritt weh. Ich frage mich, was für kranke Typen entschieden haben, ausgerechnet dieses Stück Geschichte zu bewahren.
»Na, das klingt ja begeistert«, sagt sie stöhnend. Ich höre ihr an, dass sie es kaum erwarten kann, mich loszuwerden.
»Du hättest mich einfach rauswerfen können«, murmele ich. Das wäre einfacher gewesen.
»Wie kommst du darauf?«, fragt sie ruhig.
Was mich eigentlich ärgerte, war, wie sie alles eingefädelt hatte. Dass sie mich zu den anspruchsvollen Kursen gedrängt hatte, mich dazu gebracht hatte, mich zu den Aufnahmeprüfungen anzumelden, dass sie für meine Bewerbungen bezahlt hatte – sie wollte nicht einfach mit mir fertig sein. Francie löst Probleme nicht so wie ich. Sie bringt Leute in Ordnung.
In ihrer Blindheit erkennt sie nicht, dass ich ein aussichtsloser Fall bin. Ich hatte gesehen, was die Valmont University kostete. »Du bist nicht verpflichtet …«
»Ganz sicher nicht. Wenn deine …« Sie unterbricht sich. Immer, wenn sie versucht ist, über meine Familie zu sprechen, verstummt sie. Das ist eine eiserne Regel bei ihr – sprich nie schlecht über die Familie. Das hat sie mir eingebläut, als wir uns kennenlernten. Ich dürfe sauer und wütend auf sie sein, sie sogar hassen, aber ich dürfe nicht schlecht über meine Familie reden.
Aus Wörtern werden Handlungen, hatte sie mir erklärt.
Darüber weiß ich das eine oder andere.
Die Valmont University sieht aus wie in der Broschüre. Hohe Eichen säumen die Straße, die sich an dem zentralen Campus vorbeiwindet. Wir passieren ein Gebäude nach dem anderen, die, wie ich vermute, alle nach alten weißen Männern mit dicken Brieftaschen benannt sind. Da gibt es den Beauford Saal. Die MacLaine Journalistenschule. Die EatonBibliothek, gegenüber in dem kleinen Backsteingebäude den Tennyson Saal. Das Haus des Fachbereichs Englisch ist nach einem berühmten Dichter benannt. Ach wirklich? Mit Büchern ist wohl kein Geld zu machen. Hinter efeubewachsenen Wohnheimen überragt ein Gebäude alle anderen. Ein Schild mit der Aufschrift Studentenvereinigung West weist die Richtung. Aus jedem Gebäude, an dem wir vorbeikommen, strömen Studierende, die Taschen über der Schulter tragen. Der Unterricht beginnt erst in einer Woche. Ich frage mich, wie es wohl ist, so verdammt scharf aufs Lernen zu sein, dass man schon am ersten Tag mit seinen Büchern herumrennt. Es ist alles ein bisschen zu perfekt. Vermutlich verkauft ein College immer irgendein Ideal – den idealen Campus, die ideale Karriere, die ideale Zukunft.
»Die Studentenverbindungen sind da drüben.« Francie deutet mit dem Daumen in die entgegengesetzte Richtung.
»Und?« Die Bruder- und Schwesternschaften der Uni interessieren mich so wenig, dass ich sie gar nicht auf dem Schirm habe. Okay, ehrlich gesagt habe ich nichts dagegen zu wissen, wo die Schwesternschaften sind. Ich verstehe nur nicht, warum sie mich darauf aufmerksam macht.
»Du könntest dich bewerben. Das wäre eine Möglichkeit, Freunde zu finden.«
Ich ziehe eine Augenbraue hoch und verkneife mir die Bemerkung, die mir auf der Zunge liegt, ihr aber nicht gefallen würde. Ich weiß, sie will mir nur helfen, aber manchmal denke ich, Francie hat den Verstand verloren. »Ich bin nicht so der Brudertyp.«
Die Studentenwohnheime befinden sich außerhalb des Campus. Trotz der Schilder, Feuerwehrzufahrt: Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt, stehen vor jedem Gebäude Autos.Sie sind so eng geparkt, dass wir vor meinem Haus keine Lücke finden.
»Wir müssen wohl ein Stück zu Fuß gehen«, verkündet Francie erschöpft, nachdem wir zweimal um den Block gefahren sind. »Zum Glück hast du nicht viel zu schleppen.«
Ich zucke die Achseln. Als sie schließlich fast fünfhundert Meter vom nächsten Wohnheim entfernt einparkt, springe ich aus dem Mazda und öffne den Kofferraum, in dem mein ganzes Leben verstaut ist. Als ich zu Francie kam, besaß ich nichts außer einem Rucksack voll Kleidung und einem blauen Auge. Als ich sie jetzt verlasse, ist es nicht viel mehr. Ich nehme einen der beiden Kartons, die mit meinem Namen beschriftet sind, und als ich mich umdrehe, sehe ich, dass sie mich beobachtet und dass ihr Tränen über das Gesicht laufen.
Francie sieht kein bisschen aus wie meine Mutter. Zumindest nicht, soweit ich mich erinnere. Meine Erinnerungen an meine Mutter sehe ich in Schwarz, Weiß und Rot. Sie sind hässlich und brutal. Ihr Gesicht ist das einzig Schöne an diesen Erinnerungsbildern. Blass, mit leuchtenden Augen und pechschwarzem Haar, das seidig über mein Gesicht fiel, wenn sie sich über mich beugte, um mir einen Gutenachtkuss zu geben. Francies dunkle Haut und ihre wilden Locken haben nichts mit meiner Mom gemein. Aber für eine Sekunde sehe ich meine Mutter in ihr, und was ich in Francies Augen lese, ist mir zuwider.
Stolz.
Ich habe nichts getan, um ihn mir zu verdienen. Verlegen wende ich mich ab und konzentriere mich auf das Studentenwohnheim oben auf dem Hügel.
»Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.« Ich hoffe, ich klinge gelangweilt. Desinteressiert. Hauptsache irgendwie so, dass sie schneller von hier verschwindet. Sie hat ihren Teil geleistet, sie hat die Rolle erfüllt, die der Staat ihr vor Jahren übertragen hat. Sie braucht nichts mehr zu tun. Je eher sie geht, desto besser für uns beide.
»Du hast noch die ganze Woche«, erinnert sie mich und geht mit dem anderen Karton auf den Armen neben mir her. »In der E-Mail, die ich bekommen habe, stand, dass die Orientierungseinheit morgen anfängt. Es gibt lustige Kennenlernrunden und …«
Sie rattert eine Liste von Aktivitäten herunter, von denen sie weiß, dass sie mich nicht interessieren. Ich habe einen Stundenplan und eine Karte. Auf keinen Fall werde ich irgendwelche lustigen Aktivitäten über mich ergehen lassen, die sie den Eltern zuliebe veranstalten. Stattdessen konzentriere ich mich auf die Idioten auf den Fußwegen. Wo ich mich auch hinwende, umarmt eine schluchzende Mutter einen verlegenen Teenager. Einige Väter beobachten die Umarmungen befangen, ihr Blick springt zur Straße und zu den widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen. Ein lange unterdrücktes Gefühl steigt in meiner Brust auf, doch ich schiebe es fort.
»Das ist es«, sagt Francie fröhlich.
»Gut, dass du mitgekommen bist. Ich wäre doch glatt vorbeigelaufen.« Ich verlagere das Gewicht des Kartons auf mein linkes Knie und versuche, an den Türgriff zu kommen, dabei rutscht mir der Karton weg. Als er gerade auf den Bürgersteig fällt, schwingt die Tür auf. Der Typ, der herauskommt, springt zur Seite und starrt mich aus kalten grauen Augen an. »Pass doch auf«, schnauzt er. Er trägt ein verwaschenes Ramones-T-Shirt und Jeans, die vermutlich mehr kosten als der gesamte Inhalt des Kartons zu seinen Füßen.
In mir schäumt Wut auf, und ich öffne den Mund, um ihr freien Lauf zu lassen. Doch bevor ich dazu komme, boxt sein blonder Freund, der hinter ihm in der Tür steht, ihn gegen die Schulter.
»Sei kein Idiot.« Er rollt mit den Augen, kommt raus und beugt sich runter, um den Karton aufzuheben. »Ich helfe dir.«
»Danke.« Francie klingt etwas zu begeistert, und ich frage mich, ob es an seiner Höflichkeit liegt oder daran, dass er gut aussieht. Hoffentlich rühren ihre rosigen Wangen daher, dass sie den Karton den Hügel hinaufgeschleppt hat. Ihre Herzlichkeit lässt nach, als sie den anderen Kerl ansieht.
»Money«, spricht der, der den Karton aufgehoben hat, ihn mit merkwürdigem Spitznamen an, »was haben wir besprochen, wie wir uns anderen gegenüber verhalten?«
»Du bist ein Arsch, Eaton«, stößt dieser Money hervor, nimmt Francie jedoch den Karton ab.
Eaton. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, doch ehe ich den Namen einordnen kann, sagt Francie: »Na, das ist die Gastfreundschaft des Südens, die ich erwartet habe. Danke, Gentlemen.«
Als Francie das letzte Wort betont, verziehe ich das Gesicht. Es ist eine typische Masche von ihr, jemanden auf diese Weise indirekt zum Handeln aufzufordern. Sie glaubt nicht, dass einer von diesen Arschgesichtern ein Gentleman ist, aber das hindert sie nicht daran, sie zu zwingen, sich wie welche zu verhalten.
»Welches Zimmer?«, fragt der Nette und hält die Tür auf.
»226«, murmele ich und wünschte, sie würden uns nicht weiter begleiten. Ich kann darauf verzichten, dass Francie versucht, meinen Kommilitonen Manieren beizubringen, auch wenn sie es gebrauchen können.
Er tauscht einen Blick mit seinem Freund. »Rätsel gelöst.«
»Ich habe versucht, es dir zu sagen«, erwidert der andere mit unverhohlener Belustigung, als er den Eingang passiert.
Francies Neugier siegt über meine. »Welches Rätsel?«
»Ich wohne auch in 226. Wir sind Zimmergenossen. Cyrus«, sagt er. Er streckt die Hand aus, und ich ergreife sie vorsichtig um den Karton herum.
»Sterling«, stelle ich mich vor. »Und das ist Francie.«
»Das ist Montgomery. Wir nennen ihn Money«, fügt er hinzu.
Ich will nicht wissen, warum.
Cyrus mustert mich jetzt mit mehr Interesse. Ich weiß, was er sieht: ein verwaschenes T-Shirt, das einmal schwarz gewesen ist, eine alte, zerrissene Jeans, die etwas zu locker auf den Hüften sitzt, und den armen Kerl, der sie trägt. Francie hat mir ein paar neue Klamotten gekauft, bevor wir gefahren sind, aber sie konnte sich nicht viel leisten. Verglichen mit ihm sind wir nicht nur größenmäßig das ganze Gegenteil voneinander. Mein schwarzes Haar steht nach der langen Autofahrt wild ab, sein blondes Haar ist kunstvoll gekämmt. Ich hatte die letzten zwei Tage keine Lust, mich zu rasieren, und auf meinem Kinn wachsen dunkle Bartstoppeln. Er ist glattrasiert, was seine aristokratischen Wangenknochen unterstreicht. Seine fast schwarzen Augen sind das einzig Dunkle an ihm, genau wie an mir die blauen Augen das einzige Helle sind. Anders als der Rest von uns ist er nicht lässig gekleidet. Er trägt eine maßgeschneiderte Hose und ein Hemd und sieht nicht aus, als würde er aufs College gehen. Vielmehr sieht er aus wie ein CEO oder so was.
»Du wohnst im Studentenwohnheim?« Francie wirkt überrascht, was ich ihr nicht verübeln kann.
»Sein Vater wollte ihm eine Lektion erteilen«, sagt sein Freund Money auf dem Weg zur Treppe, und ich höre den Hohn in seiner Stimme.
»Er will, dass ich eine typische Collegeerfahrung mache.«
Ich nehme zwei Treppenstufen auf einmal, ich will das hier hinter mich bringen. Schlimm genug, dass mein Mitbewohner eindeutig reich und privilegiert ist. Jetzt habe ich auch noch seinen idiotischen Freund am Hals. Sobald Francie weg ist, kann ich mich nach einem anderen Zimmer umsehen.
»Er will dich quälen«, korrigiert Montgomery ihn.
»Das ist keine große Sache«, sagt Cyrus. »Wahrscheinlich werde ich nach der Bewerbungswoche im Verbindungshaus pennen.«
Noch ein Grund, die Studentenverbindungen zu meiden. Cyrus ist okay, aber ich würde wetten, dass die meisten Mitglieder der Bruderschaften eher wie sein Freund Money sind. Mit etwas Glück wird er nicht viel da sein. Er mag nett sein, aber wenn die Lektion seines Vaters darin besteht, dass er in etwas so Durchschnittlichem wohnen soll wie in einem Studentenwohnheim, haben wir vermutlich nicht viel gemeinsam. Mein Vater weiß noch nicht einmal, dass ich in einem anderen Staat zu studieren anfange. Er verdient es nicht, das zu wissen. Ja, ich bin kein bisschen wie diese Typen.
Unser Zimmer entspricht der Definition von durchschnittlich. Die Wände sind in einem kränklich neutralen Beige gestrichen, der Fliesenboden wahrscheinlich randvoll mit Asbest. Das obere Bett ist bereits gemacht – etwas zu ordentlich –, und es sind keine Kartons zu sehen. Entweder leidet mein neuer Mitbewohner unter einer ernsten Zwangserkrankung, oder seine Mutter ist hier gewesen.
»Magda hat das obere Bett für mich bezogen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Sie sagte, das Rauf und Runter ist gut für den Kreislauf.« Er zuckt die Achseln.
»Ist Magda deine Freundin?«, erkundigt sich Francie.
Er blinzelt und ist kurz verwirrt, doch Montgomery lacht und lässt den Karton unachtsam auf den Boden fallen. »Magda ist sein Hausmädchen. Daddy mag ihn zwar zum einfachen Leben zwingen, aber so grausam, ihn allein herzuschicken, ist er dann doch nicht.«
Wo hat Francie mich nur hingebracht?
»Ich hoffe, du hast nichts dagegen.« Cyrus wirkt ehrlich besorgt. Sein Blick gleitet zwischen Francie und mir hin und her, dann wieder zu meinen Kartons. »Hast du noch mehr? Wir können dir helfen.«
Montgomery verzieht das Gesicht, als Cyrus ungefragt seine Hilfe anbietet, aber er sagt nichts.
»Das ist alles«, antworte ich und versuche so zu klingen, als würde es mir nichts ausmachen, dass meine weltlichen Besitztümer in zwei Kartons passen, während das Hausmädchen meines Mitbewohners bereits seine Sachen ausgepackt und sein Bett bezogen hat. Ich wusste, dass ich mich wie in einer anderen Welt fühlen würde, als ich das Stipendium angenommen habe.
»Gehen wir was essen«, schlägt Cyrus seinem Freund vor. »Wir lassen dich in Ruhe auspacken.«
»Das dauert nicht lange«, murmelt Montgomery.
Er und ich werden noch Mordsspaß miteinander haben. Diesen Gedanken behalte ich jedoch für mich. Francie soll sich bei ihrem Abschied keine Sorgen machen, dass ich mich bei der erstbesten Gelegenheit prügele. Aber vermutlich werde ich Montgomerys Visage eher früher als später einen rechten Haken verpassen. Als sie gehen, entspanne ich mich. Hoffentlich macht Cyrus, was er angekündigt hat, und wohnt im Verbindungshaus.
Francie scheint meine Gedanken zu lesen. »Vielleicht solltest du dir dieses Verbindungshaus mal ansehen, für das sich dein Mitbewohner bewirbt. Er scheint nett zu sein.«
Er scheint tolerant