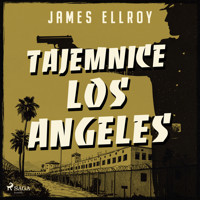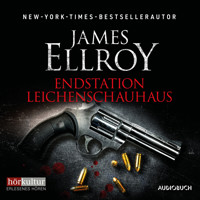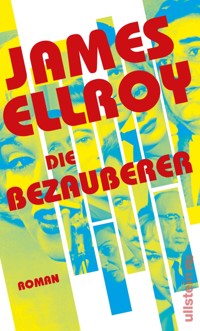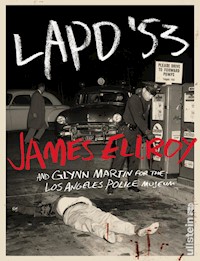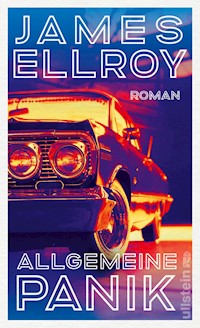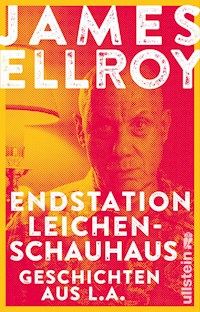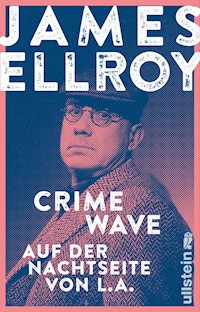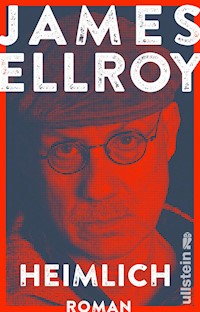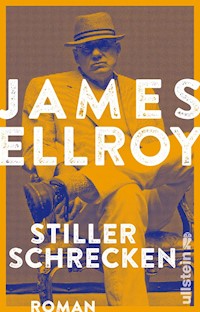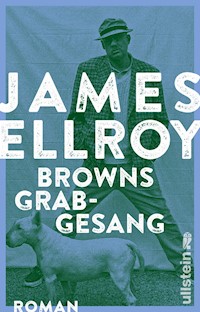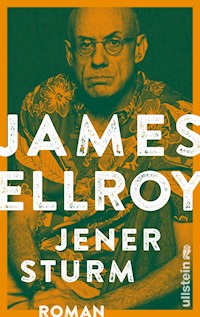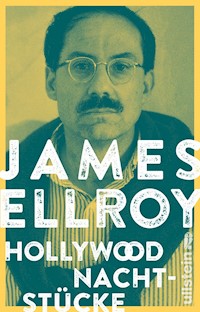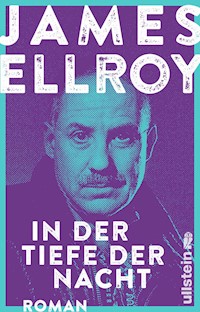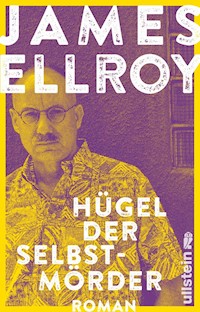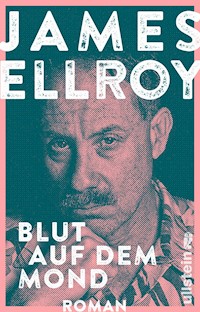
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Ellroy ist der wohl wahnsinnigste unter den lebenden Dichtern und Triebtätern der amerikanischen Literatur.« Süddeutsche Zeitung Lloyd Hopkins, ein junger und hochmotivierter Sergeant vom Los Angeles Police Department, macht Jagd auf den »Dichter« – ein psychopathischer Serienkiller, der Frauen auf grausame Weise tötet, um ihre Unschuld und ihre Seele zu schützen. Als sich die Wege der beiden Männer kreuzen, beginnt ein wahrer Alptraum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Blut auf dem Mond
Der Autor
James Ellroy, 1948 in Los Angeles geboren, lernte die dunkle Seite der amerikanischen Gesellschaft sehr früh kennen. Als Jugendlicher geriet er aus der Bahn und konnte sich erst durchs Schreiben wieder fangen. Mit »Die schwarze Dahlie« gelang ihm der internationale Durchbruch. Heute gilt er als einer der wichtigsten literarischen amerikanischen Autoren.Von James Ellroy sind in unserem Hause bereits erschienen: Blut will fließen · Blutschatten · Browns Grabgesang · Crime Wave · Der Hilliker-Fluch · Die Rothaarige · Die schwarze Dahlie · Ein amerikanischer Albtraum · Ein amerikanischer Thriller · Endstation Leichenschauhaus · Heimlich · Hollywood, Nachtstücke · Hügel der Selbstmörder · In der Tiefe der Nacht · L.A. Confidential · L.A. Noir · Perfidia · Stiller Schrecken · White Jazz
Das Buch
Einheiten vom LAPD sollen in den südlichen Innenstadtbezirken von Los Angeles für Ordnung sorgen und der schon seit Tagen andauernden Gewalt und Randale ein Ende setzen. Sergeant Lloyd Hopkins, jung und ehrgeizig, hofft auf eine Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen. Doch da ahnt er noch nicht, dass der »Dichter« geradezu für ihn bestimmt ist – ein Psychopath, der Frauen auf brutale Weise ermordet. Lloyd Hopkins nimmt die Verfolgung auf. Seine Hetzjagd mündet in Grausamkeit, Delirium und Irrsinn ...
James Ellroy
Blut auf dem Mond
Die Lloyd-Hopkins-Trilogie, Band 1
Roman
Aus dem Amerikanischen von Martin Dieckmann
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Februar 2019© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019© 2002 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München© 1986 der deutschen Ausgabe by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin© 1984 by James EllroyTitel der amerikanischen Originalausgabe: Blood on the MoonUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: getty images / © Micheline Pelletier DecauxE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-1801-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
1 Blut geleckt
1
2
2 Lieder beim Fackelschein
3
4
3 Annäherung
5
6
7
8
9
10
11
4 Monduntergang
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anhang
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1 Blut geleckt
Widmung
Zur Erinnerung an Kenneth Millar (1915–1983)
Motto
Die Lorbeerbäume im Lande sind verdorrtUnd Meteore droh’n den festen SternenDer blasse Mond scheint blutig auf die ErdeHohläugig flüstern Seher furchtbaren Wechsel
Shakespeare, Richard II
1 Blut geleckt
1
Am Freitag, dem 10. Juni 1964, begann das Goldene-Oldie-Wochenende der Radiostation KRLA, Los Angeles. Die beiden Verschwörer, die das Gelände erkundeten, wo das »Kidnapping« stattfinden sollte, drehten ihr tragbares Radio voll auf, um den Lärm der Kreissägen, Hämmer und Meißel zu übertönen – der Baulärm aus dem Klassenzimmer im dritten Stock der Highschool und die Musik der Fleetwoods versuchten, einander akustisch zu überbieten.
Larry »Birdman« Craigie hielt das Radio dicht an sein Ohr gepresst und wunderte sich über den Schwachsinn, noch eine Woche vor Beginn der Sommerferien mit den Bauarbeiten anzufangen. In diesem Moment tönte die Gruppe Gary U.S. Bonds aus dem Radio und sang: »Endlich ist die Schule überstanden, ich bin so froh, ich hab sie bestanden.« Larry krümmte sich vor Lachen und rollte sich auf dem mit Sägemehl bedeckten Fußboden. Die Schule mochte zwar zu Ende sein, bestanden hatte er sie allerdings nicht, und eigentlich war ihm das auch scheißegal. Er wälzte sich auf dem Boden herum, ohne Rücksicht auf das erst kürzlich geklaute lilafarbene Baumwollhemd.
Delbert »Whitey« Haines wurde allmählich genervt und sauer. Birdman war entweder verrückt, oder aber er tat nur so, was bedeutete, dass sein langjähriger Kumpan sich für viel schlauer hielt als er, was wiederum bedeutete, dass er über ihn lachte. Whitey wartete, bis Larrys Lachanfall vorüber war, und brachte sich dann in Liegestützposition. Er wusste, was nun folgen würde: Eine Serie blöder Bemerkungen über Liegestütze auf Ruthie Rosenberg, und wie Larry sie dazu bringen würde, ihm einen zu blasen, während er an den Ringen in der Mädchenturnhalle hing.
Larrys Lachen brach ab, und er öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Whitey ließ es erst gar nicht dazu kommen; er mochte Ruthie und hasste verletzende Äußerungen über nette Mädchen. Er drückte die Spitze seines Stiefels zwischen Larrys Schulterblätter, genau dorthin, wo es am meisten schmerzte. Larry schrie auf und fuhr hoch. Sein Radio hielt er fest an die Brust gepresst.
»Das war doch nun wirklich nicht nötig!«
»Nein«, sagte Whitey, »eigentlich nicht. Ich kann aber deine Gedanken lesen, du Psychopath. Du falscher Psychopath! Sag gefälligst nicht immer so wüste Sachen über nette Mädchen. Außerdem, wir müssen uns jetzt um den Typen kümmern, nicht um Mädchen.«
Larry nickte; die Tatsache, dass er an so wichtigen Plänen teilhaben durfte, ließ ihn die Misshandlung vergessen. Er ging zum Fenster, schaute hinaus und dachte an diesen Drecksack mit seinen Lederschuhen, seinen pfauenhaften grellen Pullovern, seinem anständigen Aussehen und seinem Poesiealbum, das er in dem Fotogeschäft in der Aluardo Street druckte, wo er als Gegenleistung für das Putzen des Ladens mietfrei wohnen durfte.
Das Marshall High Poetry Revier enthielt miserable, schnulzige Gedichte; sentimentales Liebesgesülze, von dem jedermann wusste, dass es dieser hochnäsigen, von einer Konfessionsschule übergewechselten Irin und den Gören ihres Dichter-Klubs gewidmet war und sich gegen ihn und Whitey und alle anderen richtigen Jungs vom Marshall-College richtete. Als Larry mal völlig betrunken den Folk Song Klub heimgesucht und die Hose »runtergelassen« hatte, hatte das Journal dieses Ereignis mit einer Zeichnung von ihm in Kampfuniform aufgegriffen und den ätzenden Text kommentiert: »Wir haben also ein Braunhemd namens Birdman unter uns – Analphabet und im Umgang mit Worten eher karg. Seine Waffen sind Hinterlist, und sein Geist ist wirr. Zweifellos: Ein rechter Scheißkerl …«
Whitey kam sogar noch schlechter davon: Nachdem er Big John Kafesjian in einem fairen Kampf im Rotunda Court ordentlich verprügelt hatte, hatte der Typ eine ganze Ausgabe des Journals einem »epischen« Gedicht gewidmet, das den Vorfall beschrieb und in dem Whitey als »Weißer Lumpenprolet und Provokateur« bezeichnet wurde. Es endete mit einer Prophezeiung in Form einer Grabrede:
Wohl keine Autopsie wird je beweisen,was sein nachtschwarzes Herz verbarg:dass schlaffe Muskeln, im Krampf wie Eisen,gebildet sind aus Hass und Arg.– Nehmt dies als Requiem auf einen, der nicht zählt.
Larry hatte sich bereit erklärt, Whitey bei einer kleinen Racheaktion zu unterstützen, und er tat sich damit außerdem noch selbst einen Gefallen: Der Vizepräsident des College hatte nämlich angedroht, dass er bei einer weiteren Schlägerei oder einem ähnlichen Vorfall relegiert werden würde, und der Gedanke an ein Ende der Schulzeit versetzte ihn in Begeisterung. Aber Whitey hatte eine schnelle, spektakuläre Vergeltungsaktion mit der Begründung abgelehnt: »Nein, das wäre zu einfach. Der Typ soll das Gleiche durchmachen wie wir. Er hat uns immerhin ganz schön durch den Dreck geschleift. Wir werden ihm das heimzahlen, und zwar doppelt und dreifach.«
Daraufhin wurde der Plan ausgeheckt: entkleiden, verprügeln, Genitalien anmalen und rasieren. Wenn alles funktionierte, war der richtige Zeitpunkt dafür jetzt. Larry beobachtete Whitey, wie er Hakenkreuze in das Sägemehl malte. Die Del-Viking-Version von »Come Go With Me« ging zu Ende, und die Nachrichten kamen, was bedeutete, dass es drei Uhr sein musste. Ein wenig später hörte Larry Stimmen, und er beobachtete, wie die Bauarbeiter ihr Werkzeug zusammenpackten und die Haupttreppe hinuntertrotteten; jetzt waren sie ganz allein und konnten in Ruhe auf den Dichter warten.
Larry schluckte und stieß Whitey vorsichtig an aus Angst, er könnte ihn bei seiner Beschäftigung stören.
»Bist du sicher, dass er kommt? Was ist, wenn er herausfindet, dass die Nachricht falsch ist?«
Whitey blickte auf und trat mit dem Fuß die Tür eines Spinds ein, dass sie aus ihren Scharnieren gerissen wurde. »Der wird schon kommen. Eine Nachricht von dieser irischen Fotze? Der denkt doch glatt, das ist ein Rendezvous! Aber bleib ganz cool! Meine Schwester hat die Nachricht geschrieben, auf rosa Briefpapier in Kleinmädchenschrift. Aus dem Rendezvous wird nichts. Du weißt schon, was ich meine, wie?«
Larry nickte; er wusste genau, was er meinte.
Die Verschwörer warteten in aller Ruhe; Larry träumte vor sich hin, Whitey durchsuchte die offen stehenden Schließfächer nach Liegengelassenem. Als sie eine Etage tiefer Schritte im Flur hörten, zog Larry seine Sporthose aus einer braunen Papiertüte hervor und nahm eine Tube Spezialkleber aus seiner Hosentasche. Er drückte den ganzen Inhalt der Tube über der Hose aus und presste sich gegen die Schließfächer, die der Treppe am nächsten waren. Whitey kauerte neben ihm, mit einem selbst gemachten Schlagring um die rechte Faust.
»Liebling?«
Der zögernd geflüsterte Kosename ging dem Geräusch der Schritte voraus, die immer kühner zu werden schienen, je mehr sie sich dem Treppenabsatz im dritten Stock näherten. Whitey zählte leise vor sich hin, und als er sich ausgerechnet hatte, dass der Dichter in Reichweite war, schob er Larry aus dem Weg und postierte sich neben dem Treppenrand.
»Sweetheart?«
Larry fing an zu lachen, und der Dichter blieb auf halber Treppe stehen, die Hand auf dem Geländer. Whitey packte seine Hand und riss mit einem Ruck daran, worauf der Dichter die beiden letzten Stufen hinunterstürzte. Brutal gab er dem Arm noch einen Ruck und eine geschickte Drehung genau im richtigen Winkel, mit der er den Dichter in die Knie zwang. Als sein Gegner mit hilflosen, flehenden Augen zu ihm aufsah, trat Whitey ihm in den Magen. Dann zog er das unkontrolliert zitternde Häufchen Elend hoch.
»Jetzt, Birdman!« schrie Whitey.
Larry wickelte die mit Klebstoff beschmierte Sporthose um Mund und Nase des Dichters und drückte so lange zu, bis seine Zuckungen in glucksenden Geräuschen untergingen und die Haut um seine Schläfen herum erst rosa, dann rot, dann blau anlief und er anfing, nach Luft zu schnappen.
Larry ließ ihn los und trat einen Schritt zurück, wodurch die Sporthose auf den Boden fiel. Der Dichter taumelte umher, fiel rückwärts und krachte in eine halb geöffnete Schließfachtür. Whitey stand noch immer mit geballten Fäusten an derselben Stelle, beobachtete den Dichter und sagte leise: »Wir haben ihn umgebracht. Verdammt noch mal, wir haben ihn umgebracht!«
Larry kniete nieder, ein Gebet aufsagend und sich bekreuzigend, als der Dichter endlich japsend Sauerstoff einatmete und einen mit Klebstoff vermischten Schleimkloß ausspuckte und würgend hervorstieß: »Drecks – Drecks – Drecks – Dreckschweine!«
Mit dem ersten vollen Atemzug stieß er das Wort hervor. Seine Gesichtsfarbe wurde langsam wieder normal, und er ging in die Knie. »Dreckschweine! Verdammtes weißes Lumpenpack! Penner! Verblödeter, hinterhältiger, hässlicher Abschaum!«
Whitey Haines begann, vor Erleichterung hemmungslos zu lachen. Larry Craigie seufzte erleichtert auf, und seine zum Gebet gefalteten Hände ballten sich jetzt zu Fäusten. Whiteys Gelächter wurde immer hysterischer, und der Dichter, der zwischen ihnen stand, giftete ihn an: »Hohler, schwanzloser Muskelprotz! Keine Frau würde dich jemals anfassen! Alle Mädchen, die ich kenne, lachen doch nur über dich und dein Fünfzentimeterding! Kein Schwanz, kein Sex. Kein –«
Whitey lief rot an und zitterte vor Wut. Er holte mit einem Fuß aus und trat mit voller Wucht dem Dichter in die Genitalien. Der Dichter schrie auf und fiel auf die Knie. Whitey rief: »Dreh das Radio auf, volles Rohr!« Larry gehorchte, und Beach-Boys-Musik schallte durch den Korridor, während Whitey den Dichter mit Füßen und Fäusten bearbeitete. Er rollte sich wie ein Fötus zusammen und murmelte dabei erstickt immer und immer wieder: »Abschaum, Abschaum«, als die Schläge und Tritte ihn trafen.
Als schließlich Gesicht und Arme des Dichters blutüberströmt waren, trat Whitey einen Schritt zurück, um seine Rache voll auszukosten. Er öffnete seinen Hosenschlitz, und als letzter feuchter Gnadenstoß ergoss sich ein warmer Strahl auf sein Opfer. Er spürte, wie er ihm hart wurde. Larry bemerkte es und sah seinen Anführer verdattert an. Was würde jetzt weiter geschehen? Plötzlich durchfuhr Whitey ein Schauer. Er blickte auf den Dichter hinunter, der immer noch »Abschaum« hinausstöhnte und Blut auf die Stahlkappen der Fallschirmjäger-Stiefel spuckte. Jetzt wusste Whitey mit einem Mal, was es mit dem Hartwerden auf sich hatte, und er kniete sich neben den Dichter, zog dessen Levi’s-Cordhose und Boxershorts hinunter, drückte ihm die Beine auseinander und drang unbeholfen in ihn ein. Der Dichter schrie kurz auf, als Whitey sich in ihn bohrte, dann beruhigte sich sein Atem und schlug in etwas um, das seltsamerweise einem ironischen Lachen glich. Whitey wurde fertig, zog sich zurück und sah sich Unterstützung heischend nach seinem schreckensstummen Gefolgsmann um. Um es ihm leicht zu machen, drehte er die Lautstärke des Radios so voll auf, dass Elvis Presley sich zu schrillem Gekreische verzerrte; dann sah er dabei zu, wie auch Larry sich an ihrem Opfer Befriedigung verschaffte.
Sie ließen ihn einfach dort liegen, tränenlos und ohne den Willen, mehr zu empfinden als das Gefühl, das die Schändung in ihm hinterlassen hatte. Als sie weggingen, tönte gerade »Cathy’s Clown« von den Everley Brothers aus dem Radio. Sie hatten beide lachen müssen, und Whitey versetzte ihm noch einen letzten Tritt.
Er blieb liegen, bis er Gewissheit hatte, dass der Schulhof menschenleer war. Er dachte an seine wahre Liebe und stellte sich vor, sie wäre bei ihm, ihr Kopf ruhte auf seiner Brust, und sie erzählte ihm, wie sehr sie die Sonette mochte, die er für sie geschrieben hatte.
Schließlich stand er auf. Das Gehen fiel ihm schwer, und jeder Schritt verursachte einen stechenden Schmerz vom Darm bis hoch in seine Brust. Er fasste sich ins Gesicht; es war mit einer getrockneten Masse bedeckt, die Blut sein musste. Er rieb sich wütend mit dem Ärmel übers Gesicht, bis der Schorf zusammen mit frischem Blut über glatte Haut rann. Dadurch fühlte er sich besser, und wegen der Tatsache, dass er die Tränen tapfer zurückgehalten hatte, war ihm sogar noch besser zumute. Außer ein paar Schülergruppen hier und da, die sich die Zeit vertrieben und Fangen spielten, war der Schulhof leer, und der Dichter überquerte ihn mit qualvoll langsamen Schritten. Er wurde gewahr, wie eine warme Flüssigkeit seine Beine hinunterlief. Er zog sein rechtes Hosenbein hoch und sah, dass sein Socken mit Blut durchtränkt war, das sich an den Rändern mit etwas Weißlichem mischte. Seine Socken abstreifend, humpelte er weiter in Richtung »Ruhmesbogen«, einem mit Marmor ausgelegten Wandelgang, der an die früheren Abschlussklassen der Schule erinnern sollte. Der Dichter wischte mit dem blutigen Baumwollknäuel über Maskottchen, die die »Delphianer« seit ’31 bis hin zu den »Atheniensern« von ’63 darstellen sollten, und ging dann barfuß, wobei er mit jedem Schritt kraftvoller und entschlossener auftrat, durch das Südtor der Schule auf den Griffith Park Boulevard, während sein Geist von zusammenhanglosen Gedichtfetzen und sentimentalen Reimen durchflutet wurde; alle waren nur ihr gewidmet.
Als er den Blumenladen an der Ecke Griffith Park und Hyperion erblickte, wusste er, dass er einfach hineingehen musste. Er wappnete sich gegen die Begegnung mit Menschen und ging hinein; er kaufte ein Dutzend rote Rosen, die er an eine Adresse schicken ließ, die er zwar auswendig kannte, jedoch nie aufgesucht hatte. Er legte eine Karte bei, auf deren Rückseite er einige Verse über die Liebe schrieb, die mit Blut besiegelt wird. Er bezahlte den Blumenhändler, der ihm lächelnd versicherte, dass die Blumen innerhalb einer Stunde zugestellt würden.
Der Dichter ging nach draußen, bemerkte, dass es noch zwei Stunden hell sein würde und dass es keinen Ort gab, wohin er jetzt gehen könnte. Das erschreckte ihn, und er versuchte, eine Ode an das schwindende Tageslicht aufzusetzen, um seine Angst in Grenzen zu halten. Er versuchte es immer wieder, aber sein Geist verfehlte den Rhythmus; aus Angst wurde Schrecken, und er fiel auf die Knie, schluchzend nach einem Wort oder Satz flehend, die alles wieder richtig machen könnten.
2
Als der Stadtteil Watts am 23. August 1965 in Flammen aufging, baute Lloyd Hopkins gerade Sandburgen am Strand von Malibu; er bevölkerte sie mit Mitgliedern seiner Familie und erdachte Charaktere, die seiner eigenen brillanten Fantasie entstammten.
Eine Schar Kinder, die sich nur zu gern unterhalten ließ, hatte sich um den freundlich-umgänglichen Dreiundzwanzigjährigen versammelt, und sie sah ehrfürchtig dem großen jungen Mann dabei zu, wie er mit geschickten Händen Zugbrücken, Burggräben und Wälle formte. Lloyd war eins mit den Kindern und einig mit seiner eigenen Gedankenwelt, die er als etwas Losgelöstes und Eigenständiges erlebte. Die Kinder schauten ihm zu, und er spürte genau ihr Verlangen und ihren Wunsch, bei ihm sein zu können; er wusste instinktiv, wann er sie mit einem Lächeln oder Heben der Augenbrauen belohnen musste, um sie zufrieden zu stimmen, worauf er dann zu seinem eigentlichen Spiel zurückkehren konnte.
Seine irisch-protestantischen Vorfahren kämpften gerade gegen seinen geisteskranken Bruder Tom um die Herrschaft über die Burg. Es war eine Schlacht zwischen den aufrechten Getreuen der Vergangenheit und Tom mit seinen aufrührerischen, paramilitärischen Kohorten, die der Meinung waren, dass alle Neger nach Afrika zurückverschifft werden und sämtliche Straßen in privatem Besitz sein sollten.
Die Verrückten hatten zeitweise die Übermacht – Tom und sein heimlich angelegtes Arsenal von Handgranaten und automatischen Waffen waren gewaltig –, aber die wackeren Loyalisten waren standhaft, wohingegen Tom und seine Bande feige waren; angeführt vom künftigen Police Officer Lloyd hatten die Iren die Technik überlistet und schossen nun brennende Pfeile mitten in Toms Waffenlager, worauf alles in die Luft flog. Lloyd sah in seiner Fantasie Flammen im Sand züngeln und fragte sich zum achttausendsten Mal an diesem Tag, wie die Polizeiakademie wohl sein würde. Härter als das Grundtraining? Musste ja wohl so sein, andernfalls würde die Stadt Los Angeles in arge Bedrängnis geraten.
Lloyd seufzte laut. Er und seine Getreuen hatten die Schlacht gewonnen, und seine Eltern, die ihm auf unerklärliche Weise deutlich vor Augen standen, waren gekommen, um ihren siegreichen Sohn zu feiern und die Verlierer zu beschimpfen. »Gegen ein kluges Köpfchen kann man nun mal nicht an, Doris«, sagte sein Vater zu seiner Mutter. »Ich wollte, es wäre nicht immer so, aber die schlauen Kerle regieren nun mal die Welt. Lern noch eine Fremdsprache, Lloydie; Tom kann sich ja weiter mit diesen Nichtskönnern aus der Telefonbranche herumschlagen, aber du wirst einmal alle Rätsel lösen und die Welt regieren.« Seine Mutter nickte stumm; seit ihrem Schlaganfall konnte sie nicht mehr sprechen.
Tom blickte finster dazu drein, weil er der Verlierer war. Mit einem Male hörte Lloyd Musik, die aus dem Nichts zu kommen schien, und sehr langsam und bewusst zwang er sich, in die Richtung zu sehen, aus der das störende Geräusch kam.
Ein kleines Mädchen hielt ein Radio in den Armen und versuchte mitzusingen. Als Lloyd das kleine Mädchen sah, schmolz ihm geradezu das Herz. Es konnte ja keine Ahnung davon haben, wie sehr er Musik hasste, wie sehr sie seine Gedanken durcheinanderbringen konnte. Er würde der Kleinen gegenüber sanft und zärtlich sein müssen, wie er es Frauen jeglichen Alters gegenüber auch war. Er lenkte die Aufmerksamkeit des Mädchens auf sich und sagte mit sanfter Stimme, obwohl ihn jetzt Kopfschmerzen zu plagen begannen: »Gefällt dir meine Burg, Kleine?«
»Ja … Ja«, antwortete das kleine Mädchen.
»Sie gehört dir. Die wackeren Recken haben für eine schöne Jungfrau eine Schlacht gewonnen, und die Schöne bist du.« Die Musik wurde immer ohrenbetäubender; Lloyd dachte kurz, dass die ganze Welt davon erzitterte. Das kleine Mädchen drehte kokett den Kopf, und Lloyd sagte: »Würdest du wohl das Radio ausschalten, Kleine? Dann mache ich mit dir einen Rundgang durch die Burg.«
Das Kind erfüllte ihm den Wunsch und drehte den Lautstärkeregler zurück, als die Musik abrupt aussetzte und ein Nachrichtensprecher mit ernster Stimme verkündete: »… und der Gouverneur Edmund G. Brown hat soeben bekannt gegeben, dass die Nationalgarde mit verstärkten Einheiten in die südlichen Innenstadtbezirke von Los Angeles beordert wurde, um der seit zwei Tagen andauernden Herrschaft der Gewalt, des Terrors und der Plünderungen ein Ende zu bereiten, die schon vier Tote gefordert hat. Sämtliche Angehörige der folgenden Einheiten sollen sich sofort melden …«
Das Mädchen stellte das Radio ab, und Lloyds Kopfschmerzen wichen einer absoluten Leere.
»Hast du schon mal ›Alice im Wunderland‹ gelesen, Kleine?«, fragte er.
»Meine Mami hat mir aus dem Bilderbuch vorgelesen«, sagte das Mädchen.
»Schön. Dann weißt du ja, was es heißt, wenn man dem Kaninchen hinab in seinen Bau folgt?«
»Du meinst, was Alice machte, als sie ins Wunderland ging?«
»Genau. Und genau das ist es, was der alte Lloyd jetzt machen muss – das kam gerade im Radio.«
»Bist du der ›alte Lloyd‹?«
»Ja, junge Dame.«
»Was wird dann aus deinem Schloss?«
»Das erbst du, schönes Kind – Du kannst damit machen, was du willst.«
»Wirklich?«
»Wirklich!«
Das kleine Mädchen sprang in die Luft und landete mitten in der Burg, wodurch sie völlig zerstört wurde. Lloyd rannte zu seinem Wagen und hoffte, dass dieser Einsatz zu seiner Feuertaufe werden würde.
In der Waffenkammer nahm der Diensthabende, Sergeant Beller, die Besten des Lehrgangs auf die Seite und machte ihnen das lockende Angebot, sich für ein paar Dollar waffentechnische Überlegenheit zu kaufen, damit sie im Land der schwarzen Männer nicht bei lebendigem Leibe gefressen würden und nebenbei noch ein wenig Spaß haben könnten.
Er gab Lloyd Hopkins und zwei weiteren Männern aus seiner Einheit ein Zeichen, ihm in den Waschraum zu folgen, wo er ihnen seine Ware zeigte und Erklärungen gab: »Eine .45er Automatik. Die klassische Handfeuerwaffe eines Offiziers. Wirft garantiert jeden Feuer schluckenden Nigger auf eine Entfernung von 30 Metern zu Boden, ganz gleich, wo es ihn trifft. Höchst illegal für den Privatgebrauch, aber eine hervorragende Kapitalanlage; diese Babys hier sind vollautomatisch – Maschinenpistolen mit einem von mir selbst entworfenen Elefantenclip – zwanzig Schuss, nachladbar, garantiert innerhalb fünf Sekunden; das Ding kann allerdings zu heiß werden, ich leg deshalb noch einen Spezialhandschuh drauf. Das Ding, zwei Elefantenclips und der Handschuh – zusammen für ’n Hunderter – wer will’s haben?«
Er zeigte die Waffen anreißerisch herum. Die beiden Officer von der Fahrbereitschaft starrten begehrlich und verliebt auf die beiden Stücke, winkten jedoch resigniert ab.
»Ich bin pleite, Sergeant«, meinte der eine.
»Ich bleibe hinten bei der Einsatzleitung bei den Kettenfahrzeugen, Sergeant«, sagte der andere.
Beller stöhnte und sah zu Lloyd Hopkins, dem es in den Fingern juckte. »Das Hirn« nannte man ihn allgemein in seiner Kompanie. »Hoppie, wie steht’s mit dir?«
»Ich nehm sie beide«, erwiderte Lloyd.
Bekleidet mit Kampfanzug, Gamaschen, vollen Patronengurten und Stahlhelmen der C-Klasse stand die Kompanie A des zweiten Bataillons, 46. Division der kalifornischen Nationalgarde, in Paradeformation in der Haupthalle des Waffenarsenals von Glendale und wartete darauf, Anweisungen entgegenzunehmen. Der Bataillonskommandeur, ein vierundvierzig Jahre alter Zahnarzt aus Pasadena, der den Rang eines Lieutenant-Colonel der Reserve innehatte, formulierte seine Gedanken und Befehle in einer Form, die er selbst als kurz und bündig bezeichnet hätte, und sprach ins Mikrofon: »Gentlemen, wir sind auf dem Weg in diese Feuersbrunst. Die Polizei von Los Angeles hat uns soeben darüber informiert, dass ein Gebiet von siebzig Quadratkilometern im südlichen Innenstadtbezirk von Los Angeles von Flammen eingeschlossen ist und dass ganze Geschäftsviertel geplündert und in Brand gesteckt worden sind. Wir werden da reingeschickt, um das Leben der Feuerwehrmänner, die die Flammen bekämpfen, zu schützen und um durch unsere Präsenz Plünderungen und andere kriminelle Handlungen zu unterbinden. Dies ist die einzige reguläre Infanterieeinheit innerhalb einer gepanzerten Division. Ich bin überzeugt, Männer, dass ihr die Speerspitze dieser Ruhe und Ordnung wiederherstellenden Truppe aus Zivilsoldaten sein werdet. Ihr bekommt weitere Instruktionen, sobald wir das Einsatzgebiet erreicht haben. Ich wünsche uns also einen guten Tag, und Gott sei mit euch!«
Niemand sprach mehr von Gott, als der aus Ketten- und Panzerfahrzeugen und Mannschaftswagen bestehende Konvoi Glendale in Richtung Golden State Freeway in südlicher Richtung verließ. Die Hauptgesprächsthemen waren Waffen, Sex und die Schwarzen, bis PFC Lloyd Hopkins, der in dem Teil des Mannschaftswagens hockte, der halb mit einer Plane überdacht war, schweißgebadet seine Kampfjacke auszog und das Gespräch auf Angst und Unsterblichkeit brachte:
»Vor allem eins müsst ihr euch immer wieder sagen, es laut aussprechen: ›Ich habe Angst. Ich will nicht sterben !‹ – Kapiert? Nein, sagt es lieber doch nicht laut, dadurch wird es nur abgeschwächt. Sagt es zu euch selbst. Und dann zweitens sagt euch Folgendes auf: ›Ich bin ein netter weißer Junge, der aufs College geht und der in die verdammte Nationalgarde eingetreten ist, um zwei Jahren aktivem Militärdienst zu entgehen.‹ Stimmt doch – oder?«
Die Zivilsoldaten, deren Durchschnittsalter bei zwanzig Jahren lag, nickten bestätigend vor sich hin, und ein paar unter ihnen murmelten: »Richtig, stimmt!«
»Ich höre nichts!« bellte Lloyd und versuchte, Sergeant Beller nachzuahmen.
»Richtig, ja!« riefen die Leute im Chor.
Lloyd lachte, und die anderen fielen erleichtert in sein Lachen ein. Lloyd atmete tief durch und sang, die lässigen Gebärden eines Schwarzen imitierend, einen Negro’s Shuffle.
»Ja, habt ihr denn Angst vorm Schwarzen Mann?«, sagte er in breitestem Dialekt.
Die anderen quittierten seine Frage mit Schweigen, dem ein allgemeines Murmeln und Geraune folgte. Das ärgerte Lloyd, denn er bemerkte, dass seine Hochstimmung verflog und dieser erhabenste Augenblick seines Lebens zerstört wurde. Er stieß mit dem Schaft seines Gewehrlaufs auf die Metallplatten der Ladefläche. »Stimmt!« schrie er. »Ja, es stimmt, ihr saublöden, fotzengeilen, niggerfürchtigen, verkackten Arschficker! Richtig?« Er schlug mit dem Kolben nochmals auf. »Richtig? Richtig? Richtig?«
»Jaaaü!«, erschallte es im Panzerwagen; das Gefühl der Befreiung wurde übermächtig, und das nun folgende Gelächter war vor lauter Ausgelassenheit und Bravado beinahe ohrenbetäubend.
Lloyd stieß ein letztes Mal mit dem Gewehrkolben auf den Boden und rief die Gruppe zur Ordnung. »So können sie uns nämlich nichts anhaben, versteht ihr?« Er wartete, bis er von jedem Anwesenden mit einem Nicken belohnt wurde, dann zog er sein Bajonett aus der Scheide und schnitt ein großes Loch in die Plane über sich. Da er groß war, konnte er ohne Mühe durch die Öffnung blicken. In der Ferne erkannte er die mit Rauch überzogene Ebene des Los-Angeles-Beckens. Lodernde Flammen und Rauch bedeckten dessen südlichen Teil. Lloyd dachte, dass das wohl das Erhebendste war, was er jemals gesehen hatte.
Die Division sammelte sich im McCallum Park an der Ecke Florence und Neunzigste Straße, zwei Kilometer vom Herzen der Feuersbrunst entfernt. Zunächst wurden Bäume gefällt, um Platz zu schaffen für die etwa hundert Militärfahrzeuge, voll besetzt mit bis zu den Zähnen bewaffneten Männern, die noch in dieser Nacht in den Straßen des Stadtteils Watts patrouillieren sollten. Von der Ladefläche eines Fünftonners aus wurden Essensrationen ausgegeben, während die Zugführer ihren Männern Instruktionen erteilten.
Gerüchte gingen um, die von Leuten aus dem Polizeipräsidium von Los Angeles und Verbindungsleuten des Sheriffs genährt wurden: Die moslemischen Schwarzen traten immer häufiger mit weiß bemalten Gesichtern auf. Sie waren entschlossen, die großen Ramschläden nahe der Vermont und Slauson anzugreifen. Eine große Anzahl jugendlicher Negerbanden klaute angeblich unter Drogeneinfluss jede Menge Autos und bildete »Kamikaze«-Einheiten, die in Richtung Beverly Hills und Bel Air unterwegs wären. Rob Jones, genannt »Magawambi«, und seine Afroamerikaner hätten einen drastischen Linkskurs eingeschlagen und forderten, dass Mayor Yorty ihnen acht Geschäftshäuser am Wilshire Boulevard als Entschädigung für »Verbrechen der Polizei gegen die Menschlichkeit« überlassen sollte. Falls man ihre Bedingungen nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllte, würden in diesen acht Geschäftshäusern Brandbomben gezündet werden.
Lloyd Hopkins glaubte kein Wort von alldem. Er begriff zwar die gesteigerte Angst und die Befürchtungen seiner zivilen Kameraden sowie der Cops, sich in das Töten hineinzusteigern, aber er wusste auch, dass eine Menge armer schwarzer Schweine da draußen war, die nur einen Farbfernseher und eine Kiste Whisky abstauben wollten und dabei sterben würden.
Lloyd schlang gierig seine Essensration hinunter und hörte den Kompanieführer, Lieutenant Campion, dem Manager von »Bob’s-Big-Boy«-Restaurant, zu, der die Befehle erläuterte, die von den höheren Rängen ausgegeben worden waren: »Wir als Infanterie werden eine Patrouille stellen, die den gepanzerten Jungs vorausgeht und Eingänge und Ausfahrten durchsucht und unsere Präsenz unterstreicht. Bajonett in Vorhalte-, Kampfstellung, na, ihr wisst schon! Ihr müsst hart aussehen. Die Panzereinheit, mit der wir letzten Sommer im Lager trainiert haben, ist heute Nacht dieselbe. Fragen? Kennt jeder seinen Zugführer? Gibt es irgendwelche Neuen, die noch Fragen haben?«
Sergeant Beller, der vor einem Panzerwagen auf dem Rasen ausgestreckt lag, hob seine Hand und sagte: »Lieutenant, Sie wissen doch, dass unsere Kompanie vier Männer zu viel hat? Sie hat vierundfünfzig Männer!«
Campion räusperte sich. »Äh, ja, ja, Sergeant, ich weiß.«
»Sir, wissen Sie auch, dass drei Männer dabei sind, die die Spezialausbildung mitgemacht haben? Drei sind keine einfachen Nullachtfünfzehn-Soldaten!«
»Sie meinen …«
»Ich meine, Sir, dass Hopkins und Jensen Infanteriekundschafter sind, und ich bin sicher, Sie werden mir zustimmen, dass wir bei dieser Operation nützlicher wären, wenn wir dem Zug ein gutes Stück vorausgingen. Sehe ich das richtig, Sir?«
Lloyd beobachtete, wie der Lieutenant unsicher wurde, und ihm ging mit einem Mal auf, dass er eigentlich dasselbe wie Beller wollte. Er hob die Hand und sagte: »Sir, Sergeant Beller hat recht; wir könnten ein gutes Stück vorausgehen, den Zug dadurch besser schützen und ihn unabhängiger machen. Der Zug hat mehr Leute, als nötig sind, und …«
Der Lieutenant gab nach. »Also gut dann«, sagte er, »Beller, Hopkins und Jensen, ihr geht dem Konvoi genau zweihundert Meter voraus. Seid vorsichtig, haltet die Entfernung genau ein! Keine weiteren Fragen? Kompanie weggetreten!«
Lloyd und Beller stießen aufeinander, als gerade die Motoren der Panzerfahrzeuge angelassen wurden, wodurch die Abendluft mit Schwaden von Abgasen angereichert wurde. Beller lächelte; Lloyd lächelte zurück wie ein Komplize.
»Weit voraus, Sergeant?«
»Sehr weit voraus, Hoppie.«
»Was ist mit Jensen?«
»Der ist doch noch ein Kind. Ich sag ihm, er soll hinter uns beim Zug bleiben. Wir haben doch genug Deckung. Wir haben ja freie Hand, und das ist das Wichtigste.«
»Jeder übernimmt eine Straßenseite?«
»Hört sich gut an. Pfeif zweimal, wenn’s kritisch wird. Warum nennt man Sie eigentlich ›das Hirn‹?«
»Weil ich ziemlich intelligent bin.«
»Intelligent genug, um zu wissen, dass die Nigger das ganze verdammte Land ruinieren werden?«
»Nein, zu intelligent für so’n Scheiß. Jeder, der auch nur ein bisschen Grips hat, weiß doch, dass der Tanz bald vorüber sein wird und dass danach alles wieder seinen normalen Gang gehen wird. Ich bin hier, weil ich ein paar unschuldige Leben retten will.«
Beller sagte verächtlich: »So ein Quatsch! Das beweist doch nur, dass Hirne viel zu hoch eingeschätzt werden. Was zählt, ist Mut.«
»Hirne regieren die Welt.«
»Aber die Welt ist doch irrsinnig!«
»Das meinen Sie! Aber lassen Sie uns lieber mal nachsehen, wie die Welt da draußen aussieht.«
»Ja, es wird höchste Zeit.« Beller begann wohl schon, sich allmählich Sorgen zu machen. Hoppie hörte sich ja fast wie ein Niggerfreund an. Sie setzten sich von der Truppe ab und gingen in südliche Richtung, dorthin, wo die Flammen am höchsten schlugen und der Lärm der Schießerei am lautesten war.
Lloyd ging auf der Nordseite der Dreiundneunzigsten Straße; Beller übernahm die Südseite, das Gewehr mit aufgesetztem Bajonett im Anschlag und die Augen jede Querstraße gründlich absuchend. Es war eine Gegend, in der die schäbigen Holzhäuser von schwarzen Familien standen, die aus hell erleuchteten Fenstern starrten oder auf den Veranden saßen und tranken, rauchten und quatschten und darauf warteten, dass endlich etwas passieren würde.
Sie kamen auf die Central-Querstraße. Lloyd schluckte und spürte, wie der Schweiß in seine Unterhose lief, die inzwischen unterhalb der Hüftknochen hing, weil die beiden Automatikwaffen in ihren Spezialhalterungen schwer an seinem Gürtel zogen.
Beller pfiff von der gegenüberliegenden Straßenseite und deutete nach vorn. Lloyd nickte und witterte Rauch. Sie gingen in südliche Richtung, und Lloyd brauchte einige Zeit, um die Selbstverständlichkeit der Selbstzerstörung, die er sah, zu begreifen und in sich aufzunehmen.
Schnapsläden, Nachtklubs, Kleinbetriebe und Kirchen, die wie Lädchen aussahen, hier und da unterbrochen von Freiflächen voller abgestellter Fahrzeuge, brannten völlig aus; ein vom Brand zerstörtes und ausgeraubtes Geschäft nach dem anderen, überall herumgeworfene Schnapsflaschen, überall zerbrochenes Glas; die Rinnsteine waren gefüllt mit billigen elektrischen Geräten und Gegenständen, die hastig zusammengerafft und schließlich doch liegen gelassen worden waren, wenn die Plünderer sahen, dass sie für sie wertlos waren.
Lloyd schob sein M-14 durch zerbrochene Fensterscheiben, stierte in dunkle Innenräume und spitzte die Ohren, wie er es bei Hunden gesehen hatte, um das leiseste Geräusch oder die kleinste Bewegung mitzubekommen. Er stieß auf nichts – nur Sirenengeheul und Schusswechsel waren in weiter Entfernung zu hören.
Beller überquerte gerade die Straße, als ein schwarz-weißer Polizeiwagen von der Vierundneunzigsten in die Central einbog. Zwei Officer im Flakanzug sprangen aus dem Wagen. Der Fahrer lief auf Lloyd zu und fragte ihn: »Was zum Teufel macht ihr denn hier?«
Beller antwortete ihm, und die Polizisten griffen vorsichtshalber zu ihren .38ern. »Spähtrupp, Officer! Mein Kumpel und ich haben den Auftrag, unserer Truppe vorauszugehen und Heckenschützen ausfindig zu machen. Wir sind Kundschafter der Infanterie.«
Lloyd war klar, dass die Cops ihm das nicht abkauften und dass er unbedingt ohne seinen bescheuerten Partner das Wunder der Gewalt in Watts auf sich wirken lassen wollte. Er blickte hastig zu Beller hin und sagte: »Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Wir sollten eigentlich nur drei Querstraßen vorangehen, aber wir sind irgendwo falsch abgebogen. Die Häuser in diesen nummerierten Straßen sehen alle gleich aus.« Er zögerte einen Moment und versuchte, verwirrt auszusehen.
Beller verstand den Wink und sagte: »Ja, genau. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Und all die Nigger, die auf den Stufen sitzen und ihren Stoff saufen, sehen auch gleich aus.«
Der Ältere der beiden Cops nickte, zeigte dann in südliche Richtung und sagte: »Gehört ihr zu der Artillerie unten in der Einhundertundzweiten Straße? Zu der Spezialeinheit von Niggerjägern?«
Lloyd und Beller blickten einander an. Beller leckte sich die Lippen, um nicht lachen zu müssen. »Ja«, sagten beide gleichzeitig.
»Dann steigt in den Wagen. Ihr braucht nicht weiter hier herumzuirren.« Als sie ohne Blinklicht und Sirene in Richtung Süden unterwegs waren, erzählte Lloyd den Cops, dass er im Oktober in die Polizeiakademie eintreten werde und dass er diese Ausschreitungen gern zum Thema seiner Abschlussprüfung machen wolle. Der jüngere Cop pfiff durch die Zähne und sagte: »Dann sind diese Krawalle für dich ja ein ideales Übungsfeld. Wie groß bist du, ein Meter neunzig? Zwei Meter? Bei deiner Größe schicken sie dich bestimmt direkt zum Revier in der Siebenundsiebzigsten Straße in Watts; das ist genau die Gegend, durch die wir gerade fahren. Wenn der Rauch erst wieder abgezogen ist, kommen die Scheißliberalen wieder daher und erzählen uns, dass die Nigger Opfer der Armut wären, und dann wird es wieder heißen, dass wir nur eine Handvoll besonders gewalttätiger Rädelsführer unter den Niggern, die Blut geleckt haben, im Auge behalten müssten. Wie heißt du, Junge?«
»Hopkins.«
»Hast du schon mal jemanden getötet, Hopkins?«
»Nein, Sir.«
»Nenn mich nicht ›Sir‹. Du bist noch kein Cop, und ich bin nur ein einfacher Streifencop. Ja, ja, ich hab ’nen Haufen Leute in Korea umgebracht. Immer mehr und immer mehr, und das hat mich sehr verändert. Heute sieht alles ganz anders aus. Wirklich vollkommen anders. Ich habe mit anderen darüber geredet, die auch sehr viel da unten mitgemacht haben, und wir sind alle derselben Meinung: Du lernst, die Dinge anders zu sehen. Du siehst ganz unschuldige Leute, zum Beispiel kleine Kinder, und du möchtest, dass sie so bleiben, wie sie sind, weil du selbst nicht ganz so unschuldig bist. Dinge wie kleine Kinder mit ihren Puppen und ihrem Spielzeug bedeuten dir was, weil du weißt, dass auch sie in diesem beschissenen Strom mitschwimmen werden, aber dass du das nicht willst. Dann siehst du Leute, die keine Achtung haben vor liebenswerten Dingen, vor Anstand und Anständigkeit, und die musst du hart anfassen. Man muss die Unschuld in der Welt schützen; aus diesem Grund bin ich Cop geworden. Für mich siehst du unschuldig aus, Hopkins. Und auch eifrig. Verstehst du, was ich meine?«
Lloyd nickte und spürte prickelnde Erregung. Er roch den Rauch, der durch das offene Fenster des Polizeiwagens drang, aber die Empfindung verflog, als ihm klar wurde, dass der Cop instinktiv Lloyds irisch-protestantische Herkunft gewittert hatte. »Ich verstehe genau, was Sie meinen«, sagte er.
»Gut, mein Junge. Dann fängt heute Nacht für dich alles an. Halt mal an, Kollege!«
Der ältere Cop fuhr den Wagen an den Straßenrand.
»Es hängt alles von dir ab, mein Junge«, sagte der Jüngere und langte mit seinem Arm zu Lloyd hinüber, um ihm aufmunternd auf seinen Helm zu klopfen.
»Wir nehmen deinen Kumpel mit zu seiner Einheit. Du kannst ja mal sehen, ob du irgendwas auf eigene Faust in Ordnung bringen kannst.«
Lloyd stolperte so schnell aus dem Streifenwagen, dass er seinem Wohltäter nicht einmal mehr einen Dank zurufen konnte. Sie ließen zum Abschied die Sirene aufheulen.
In der Einhundertundzweiten Straße, Ecke Central, herrschte absolutes Chaos: schwelende Ruinen, das Zischen der Feuerwehrschläuche, quietschende Reifen auf den mittlerweile überschwemmten Bürgersteigen; der ganze Einsatz wurde von Hubschraubern aus dirigiert, die in der Luft über der Szene hingen und Flutlicht in die Fensterhöhlen strahlten, um den Feuerwehrleuten mit ihren Scheinwerfern die Arbeit zu erleichtern.
Lloyd marschierte in das dichte Gewühl hinein und grinste breit; er war noch immer ganz von der eindrucksvollen Zusammenfassung seiner eigenen Philosophie erfüllt. Er beobachtete, wie ein Panzerwagen mit aufmontiertem Maschinengewehr, Kaliber fünfzig, langsam die Straße entlangfuhr. Aus der Fahrerkabine brüllte ein Soldat der Nationalgarde in einen Lautsprecher: »In fünf Minuten beginnt die Ausgangssperre! In diesem Distrikt herrscht Ausnahmezustand! Jeder, der nach neun Uhr auf der Straße angetroffen wird, wird festgenommen. Jeder, der versucht, die Polizeisperren zu durchbrechen, wird erschossen. Ich wiederhole: In fünf Minuten beginnt die Ausgangssperre!«
Die in drohendem Befehlston vorgebrachten Worte hallten laut über die Straße und hatten hastige Aktivität zur Folge. Innerhalb von Sekunden sah Lloyd Dutzende junger Leute aus ausgebrannten Gebäuden herausschießen, die, ohne von den Scheinwerfern erfasst zu werden, in alle Richtungen davonstoben. Er rieb sich die Augen und blinzelte, um besser sehen zu können, ob die Männer geraubte Ware bei sich hatten; sie waren bereits verschwunden, bevor er sie anrufen und sein M-14 auf sie richten konnte.
Lloyd ging kopfschüttelnd weiter und passierte eine Gruppe Feuerwehrleute, die vor einem verwüsteten Schnapsladen herumliefen. Sie sahen ihn alle, aber keinem erschien es ungewöhnlich, dass ein einzelner Nationalgardist allein und zu Fuß patrouillierte. Dadurch ermutigt, beschloss Lloyd, das Innere des Hauses genauer zu untersuchen.
Das machte ihm wirklich Spaß. Die Dunkelheit in dem ausgebrannten Laden wirkte beruhigend auf ihn, und er spürte, dass die schattenhafte Stille wichtige Aufschlüsse für ihn bereithielt. Er blieb stehen, holte eine Rolle Klebeband aus der Jackentasche seines Kampfanzugs und befestigte damit seine Taschenlampe am Schaft des Bajonetts. Er bewegte sein Gewehr in einer großen »Acht« über die Wand und bewunderte den Erfolg: in welche Richtung sein M-14 auch zeigte, er würde immer ausreichend Licht haben. Überall stieß er auf Haufen verkohlter Bretter, herausgerissener Leitungen und zerschmetterter Schnapsflaschen. Überall benutzte Kondome. Lloyd kicherte bei dem Gedanken an heimlichen Geschlechtsverkehr in einem Schnapsladen, erstarrte dann aber plötzlich, als sein Kichern erwidert wurde. Dann kam ein hässliches tiefes Stöhnen.