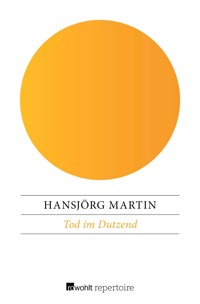9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Judomatte klappt auseinander, und eine Hand wird sichtbar. Erschreckt rollen Kitty Boll und Franz Zwicknagel die Matte ganz auf … Thea Neulitz liegt vor ihnen, die wie sie am Franz-Liszt-Gymnasium unterrichtet – nein, unterrichtete. Denn Thea Neulitz ist tot. Die beiden jungen Lehrer wollten am Wochenende Vorbereitungen für das am Montag stattfindende Schulsportfest treffen. Beim Aufstellen der Geräte war die zusammengerollte Matte im Weg gewesen; sie hatten sie aus der Gerätekammer gezerrt, sie hatte sich dabei teilweise geöffnet … Ratlos stehen sie in der leeren Turnhalle. Der Schulleiter ist nicht zu erreichen. Sein Stellvertreter auch nicht. Der dritte in der Hierarchie – und die Hierarchie spielt eine große Rolle im Franz-Liszt-Gymnasium –, der dritte kommt. Die Polizei kommt. Der Amtsarzt kommt. Der Krankenwagen kommt. Nur Helmut Vorrath kommt nicht – das heißt, er kommt nicht nach Hause. Und bei Sextanern ist das bedenklich. Dann wird ein zweiter Schüler der Anstalt vermißt. Ein Lehrer und seine Frau werden unter ziemlich eindeutigen Umständen gasvergiftet in ihrer Wohnung gefunden … Was geht vor im Franz-Liszt-Gymnasium?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Blut ist dunkler als rote Tinte
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die Judomatte klappt auseinander, und eine Hand wird sichtbar. Erschreckt rollen Kitty Boll und Franz Zwicknagel die Matte ganz auf … Thea Neulitz liegt vor ihnen, die wie sie am Franz-Liszt-Gymnasium unterrichtet – nein, unterrichtete. Denn Thea Neulitz ist tot.
Die beiden jungen Lehrer wollten am Wochenende Vorbereitungen für das am Montag stattfindende Schulsportfest treffen. Beim Aufstellen der Geräte war die zusammengerollte Matte im Weg gewesen; sie hatten sie aus der Gerätekammer gezerrt, sie hatte sich dabei teilweise geöffnet … Ratlos stehen sie in der leeren Turnhalle.
Der Schulleiter ist nicht zu erreichen. Sein Stellvertreter auch nicht. Der dritte in der Hierarchie – und die Hierarchie spielt eine große Rolle im Franz-Liszt-Gymnasium –, der dritte kommt. Die Polizei kommt. Der Amtsarzt kommt. Der Krankenwagen kommt.
Nur Helmut Vorrath kommt nicht – das heißt, er kommt nicht nach Hause. Und bei Sextanern ist das bedenklich. Dann wird ein zweiter Schüler der Anstalt vermißt. Ein Lehrer und seine Frau werden unter ziemlich eindeutigen Umständen gasvergiftet in ihrer Wohnung gefunden …
Was geht vor im Franz-Liszt-Gymnasium?
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Kitty Boll
verliert eine Mütze und findet gelegentlich Tote.
Franz Zwicknagel
assistiert bei letzterem und erweist sich auch anderweitig als hilfreich.
Thea Neulitz
ist nicht mehr zu helfen.
Dr. Linke
verwechselt Macht mit Autorität.
Dr. Brobiel
weiß mehr von alten Römern als von jungen Menschen.
Dr. Jennewein
spielt mit dem Feuer und verbrennt sich und andere.
Ulrich Jennewein
liebt hoffnungslos, aber nicht lange.
Helmut Vorrath
sieht fast alles und begreift fast nichts.
Frau Jennewein
übermittelt eine Nachricht und hat es zu bedauern.
Oberkommissar Unger
brüllt.
Kommissar Nebelung
brüllt nicht.
Dies ist ein Roman. Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Für Helmut Plüschau – und die gute Handvoll mutiger Mütter und veritabler Väter von W.
1
Ich trat aus dem kühlen Hausflur, der nach Sonntagsnachmittagskaffee, Sauberkeit und Seife roch, in die flimmernde Hitze vor dem hohen Wohnblock.
Es war sehr still für hiesige Verhältnisse.
Kein Kindergeschrei, keine keifende Frauenstimme, kein Staubsauger, kein Teppichklopfer … Nur halblaute Radioklänge aus offenen Fenstern: ein Reporter, dessen Sprechtempo sich steigerte, überschlug und in einem enttäuschten „Aus! Aus!“ verebbte, und aus einer anderen Richtung das unvermeidliche Operettenpotpourri –“ … machen wir’s den Schwalben nach …“
Die sieben Birken um den quadratischen Spielplatz mit der Sandkiste standen grau und ohne daß sich ein Blatt rührte vor dem schmerzhaft blendenden Weiß der Nachbarhauswand.
Ich ging den Kiesweg entlang, spürte die Steine durch die dünnen Sohlen meiner Sandaletten, wurde vom Geruch der Gosse getroffen und blinzelte im Kreis nach den Regenwolken, die er ankündigte.
Aber da waren keine.
Der Himmel hatte rundum die Farbe von Perlmutt.
Als ich um den alten Wacholderbusch bog, kam mir von der Straße her eine Frau entgegen.
Sie lief hastig, stolpernd, ruderte mit den Armen und sah schon von weitem so aufgeregt wie ein Huhn aus, das nichtsahnend Entenküken ausgebrütet hat und nun entsetzt erlebt, wie die sich aufs Wasser wagen. Ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen, da sie die Sonne im Rücken hatte.
Ich wollte in den schmalen Pfad einbiegen, der zum Parkplatz führt, da rief sie:
„Fräulein Boll!“ Sie rief es laut und atemlos und schwenkte den Arm, als ob ich ein Schiff sei, das in See stach.
„Hallo, Fräulein Boll!“
Ich blieb stehen und sah ihr entgegen.
Ihr hastiger Stolperschritt ging in einen Laufschritt über. Sie bewegte wie eine richtige Leichtathletin die Fäuste vor der Brust und lief mit weitausholenden Schritten.
Es sah sehr komisch aus, weil die Gangart schlecht zu dem großgeblümten Kleid paßte, das sich um ihre gedrungene Figur spannte.
Jetzt erkannte ich sie auch. Das heißt, ich erkannte das Gesicht, ohne daß mir der Name einfiel.
„Ja?“ sagte ich.
Sie hatte mich erreicht. Schwer atmend stand sie vor mir. Eine Haarsträhne hing ihr vor dem linken Auge. Sie wischte sie mit dem Handrücken beiseite, und sie klebte an der schweißbeperlten Stirn fest und sah wie eine erstaunt hochgezogene Augenbraue aus.
„Ich komme … Ich wollte …“ stammelte die Frau, noch immer nach Luft schnappend. „Haben Sie meinen Jungen nicht gesehen?“
„Eh, ja …“ Jetzt war ich dran zu stottern. „Oder vielmehr …“
Die Frau war die Mutter eines Jungen aus meiner Klasse. Soweit klar. Aber welches Jungen? Ich hatte keine Ahnung und suchte verzweifelt in ihrem Gesicht nach einer Ähnlichkeit. Ich hatte zweiunddreißig Jungen und Mädchen in dieser Sexta, jede Woche sechs Stunden bei ihnen und fast ein Vierteljahr gebraucht, um mir die Namen einzuprägen, die zu den Kindergesichtern gehörten. Daß ich alle zweiunddreißig Mütter und Väter kennen sollte, war in meinem Dienstvertrag nicht vorgesehen. Aber das konnte ich der Frau nicht sagen.
Da jeder Mensch von sich glaubt, der Mittelpunkt der Welt zu sein, setzt jeder voraus, daß alle Welt ihn kennt. „Er ist seit gestern abend nicht zu Hause gewesen!“ sagte die Frau.
„Aber es ist jetzt vier Uhr nachmittag“, erwiderte ich. „Wieso …“
„Wir sind erst mittag wiedergekommen, mein Mann und ich. Wir waren bei meiner Schwiegermutter in Hahnefeld. Sie ist krank. Krebs, wissen Sie. Und …“
Ich wußte nichts vom Krebs der Schwiegermutter, und ich wollte es auch nicht wissen. Ich wollte aus der Hitze raus und das tun, was ich vorgehabt hatte: mit dem Motorroller zur Schule fahren und in aller Ruhe zusammen mit Franz Zwicknagel die Turnhalle für morgen vorbereiten.
„Aber was kann ich denn tun?“ fragte ich. „Haben Sie schon bei den Nachbarn gefragt? Bei seinen Freunden? Bei der Polizei?“
„Bei der Polizei noch nicht“, sagte sie. „Aber sonst überall … Mein Mann meint, vielleicht hat Helmut Ihnen was gesagt.“
Helmut! Helmut Vorrath, der Kleine mit dem hellblonden Schopf und den braunen Augen. Gut, daß ich nur einen Helmut in der Klasse hatte.
„Nein“, sagte ich, erleichtert, den Namen zu haben, „das tut mir leid, Frau Vorrath … aber ich weiß nichts.“ In ihrem Blick ging das Licht aus. Ihre Augen hatten nun die Farbe eines schlecht glasierten Bierkrugs aus graner Tonerde. „Nein …?“
Ich schüttelte den Kopf und wußte nicht, was ich sagen sollte.
Sie schob ihre zuckende Unterlippe vor und begann zu schluchzen. Ihr mächtiger Busen wackelte bei jedem Schluchzer, und die grauen Tonerde-Augen bekamen eine glitzernde Tränenglasur. Die ersten dicken Tropfen kippten über die unteren Lider und rollten langsam die Wangen hinab.
Ich hatte noch nie so dicke Tränen gesehen.
„Aber, aber, Frau Vorrath“, sagte ich, „Sie müssen nicht weinen! Das ist bestimmt irgendein Dummerjungenstreich. Abenteuerlust, als Schiffsjunge nach Afrika – was weiß ich! Helmut hat doch keinen Grund auszureißen … schulisch, meine ich.“
„Nein“, schluchzte Frau Vorrath, „er ist ein guter Junge. Aber es kann ja doch sonst was passiert sein. Er ist doch kein Herumtreiber …“ Sie fuhr sich mit einem zerknautschten Taschentuch über die Augen und sah mich an.
Die Stimme aus dem Fenster wurde von einem großen Gebrüll übertönt. Dann war sie wieder zu hören: „Toooor!“ schrie sie. „Toooor!“ Hell und heiser und hysterisch. Hupen bellten, Glocken bimmelten, Trillerpfeifen schrillten.
Ich wandte irritiert den Kopf. Frau Vorrath griff nach meinem Arm. Ihre Hand war heiß und feucht und rauh wie eine Hundezunge.
„Woher wissen Sie“, fragte ich, „seit wann Helmut weg ist?“
„Er war nicht im Bett“, sagte sie. „Das Abendbrot, das ich hingestellt hatte, hat er gegessen. Aber nichts zum Frühstück.“
„Fehlt Geld?“ wollte ich wissen. „Hat er eine Sparbüchse? Ist die noch da?“
„Geld?“ Auf Frau Vorraths rundem Gesicht stand Überraschung. „Ich … ich habe nicht nachgesehen. Aber warum …?“
„Weil das ein Zeichen dafür wäre, daß er ausgebüchst ist“, erklärte ich, „und dann brauchten Sie sich keine unnötigen Sorgen zu machen. Das heißt – ich meine, dann …“
„Ich verstehe“, sagte sie. „Danke schön, Fräulein Boll. Aber was sollen wir nun machen?“
„Gehen Sie nach Hause“, riet ich. „Stellen Sie fest, wie das ist mit dem Geld, und benachrichtigen Sie auf jeden Fall die Polizei. Und, bitte, geben Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendwas erfahren, ja? Ich bin bis sechs, halb sieben in der Schule, in der Turnhalle, und dann wieder hier. Wenn ich was höre, rufe ich Sie gleich an. Haben Sie Telefon?“
„Ja“, sagte Frau Vorrath und gab mir die Nummer. Sie schien beruhigt zu sein, obschon ich ihr ja eigentlich nichts weiter gesagt hatte als etwas, worauf sie leicht hätte selber kommen können.
„Vielen Dank, Fräulein Boll!“ Sie drückte mir mit ihrer Hundezungenhand den Arm, den sie noch nicht wieder losgelassen hatte, und probierte mit den Mundwinkeln ein Lächeln, aber das gelang ihr nicht so recht, weil ihre stumpfen Augen der Ausbreitung eines Lächelns über das ganze Gesicht im Wege standen.
„Keine Ursache“, sagte ich und machte mich sanft los. „Vergessen Sie bitte nicht, mich zu benachrichtigen. Wiedersehen!“
„Auf Wiedersehen, Fräulein Boll.“
Sie ging den Weg, den sie im Laufschritt gekommen war, langsam zurück. Die Farben der großen Blumen auf ihrem Kleid erloschen, als sie in den Schatten des Hauses kam.
Im Augenblick, da ich meinen Motorroller auf dem Parkplatz erreichte, drang ein zweites „Toooor!“-Gebrüll aus dem Fenster quer über den Platz zwischen den Häusern.
Zwei zu null – oder eins zu eins –, ich würde es nie erfahren. Es interessierte mich wie eine Tageszeitung vom vorigen Herbst.
Der Kunststoffsattel und die schwarzen Gummihandgriffe an der Lenkstange meines Motorrollers waren heiß. Ich holte die alten ölfleckigen Handschuhe aus dem Werkzeugfach unter dem Sattel und startete, gewiß komisch anzusehen: helle Hose, leuchtender kurzer Rock, Handtäschchen und dazu diese Cowboyhandschuhe.
Ich verscheuchte die Bedrückung, die Frau Vorraths Auftritt in mir hervorgerufen hatte; der Fahrtwind half mir dabei und blies sie weg. Ich freute mich wieder auf den Nachmittag, wie ich mich vorher darauf gefreut hatte, gab Gas und brummte, schneller als erlaubt, durch das sonntägliche Städtchen zum Gymnasium.
2
Das Städtchen, zu dieser Stunde sehr ruhig, ist aber auch an Wochentagen nicht gerade mit pulsierendem Leben erfüllt. Es heißt Walbach, hat etwa dreißigtausend Einwohner, eine evangelische und eine katholische Kirche, vier Volksschulen, eine Realschule, eine Berufsschule, eine Sonderschule und das Gymnasium.
Diesem Gymnasium, dessen Lehrkörper auch ich als Sport-, Erdkunde- und Nadelarbeitslehrerin seit drei Jahren anzugehören die Ehre und das nicht immer ungetrübte Vergnügen hatte, diesem Gymnasium also war seinerzeit von einem mittelmäßig, aber leidenschaftlich gern Klavier spielenden Bürgermeister der Name Franz-Liszt-Gymnasium verliehen worden, obwohl Franz Liszt nie in irgendeiner Weise mit Walbach in Berührung gekommen ist. Da jedoch auch sämtliche anderen potentiellen Namenspatrone offenbar einen Bogen um Walbach gemacht haben, kam’s nicht so drauf an. Sie wollten die Schule halt irgendwie nennen. Verständlich. Ich habe nichts gegen Franz Liszt.
Walbach hat ferner eine Volkshochschule, die zweimal jährlich einen Kammermusikabend veranstaltet, alle Vierteljahr eine sogenannte Dichterlesung und jeden Monat einen Lichtbilderabend – Der Einfluß der frühtibetischen Kultur auf den Städtebau des zwanzigsten Jahrhunderts oder so ähnlich. Daneben gibt’s die wöchentlichen Schreibmaschinen-, Buchführungs-, Englisch-, Mütter- und Zeichenkurse zur Vertreibung der Langeweile, an der – an der Vertreibung – auch noch zwei Kinos mitarbeiten, in denen meist ‚atemberaubende‘ Western, ‚schonungslose‘ Sex-Filme oder die verlogenen Ehe-, Arzt-, Heimatoder Sozialproblemstücke laufen, mit deren Herstellung man lichtempfindlich beschichtete Zelluloidstreifen in aller Welt vergeudet.
Ich fuhr also durch Walbach, fuhr die Lindenstraße entlang, die früher, als da noch richtige Linden gestanden haben, sehr hübsch gewesen sein soll, die jetzt aber – wie viele Straßen des Städtchens – von nichtssagenden Neubaufassaden gesäumt ist.
Zwei Dutzend kleine Geschäfte, ein Supermarkt, dem die Bezeichnung ‚Super‘ paßt wie einem Fünfjährigen der Zylinder des Großvaters, eine Apotheke und eben Hauseingänge – nüchtern, zweckmäßig, zeitgemäß. Aber wenn das mit dem Einfluß der frühtibetischen Kultur stimmen sollte, dann kann nicht viel mit ihr losgewesen sein.
Die Wolkenstores vor den Fenstern wetteiferten in Weiß und Wolkig. Die Autos vor den Häusern waren so schön poliert, daß man merkte, welche finanzielle Belastung sie für die Besitzer bedeuteten. Es ist schweißtreibend, dem sogenannten Mittelstand anzugehören.
Ich fuhr an dem kleinen Bahnhof vorbei, kam durch eine Bungalowsiedlung, in der ich nicht hätte begraben sein mögen, weil in fast jedem zweiten der Konfektionshäuser ein Lehrerkollege wohnte, fuhr über den alten Marktplatz, der als Hauptschauplatz der Geschichte Walbachs offenbar so hoch geachtet wird, daß man sogar das mittelalterliche Kopfsteinpflaster unter Denkmalschutz gestellt hat.
Ich kam an der Polizeiwache vorbei, wo ich das Tempo drosselte, weil einer der Polizisten auf der Straße stand und mit einem kleinen Jungen schimpfte, und bog schließlich in die schmale Straße ein, die zum Gymnasium führt. Sie ist so schmal und gewunden und holperig, daß sie – wenn man’s symbolisch sieht – mit vollem Recht den Namen Schulstraße führt.
Franz Zwicknagels grasgrüner VW stand schon auf dem sonntäglich leeren Lehrerparkplatz. Ich stellte meinen Roller daneben.
Die Fenster der Hausmeisterwohnung im Nebengebäude waren geschlossen und alle Vorhänge zugezogen.
Es war sehr still.
Ich ging über den asphaltierten Schulhof auf das große, rotbraune Gebäude zu. Der Asphalt war weich geworden in der Hitze. Ich hatte plötzlich die verrückte Vorstellung, über Moor zu gehen, und lief schneller, um die rettenden Steinplatten vor dem Eingang zu erreichen.
Oberhalb der schweren Eichentür hatten ehrfurchtslose Schwalben in einer Nische ihr Nest gebaut. Sie waren in ihrer Respektlosigkeit so weit gegangen, das letzte Wort des weisen Spruches, der da in Stein gemeißelt stand, grauweiß zu bekleckern.
Non scholae sed vitae … war schön sauber, aber … discimus war, mit Verlaub, beschissen.
Oberstudiendirektor Linke hatte, als die Kleckerei anfing, in einem Anfall von demokratischem Empfinden der Lehrerkonferenz die Frage vorgelegt, ob das Nest entfernt werden sollte. Es war ein heißer Streit zwischen stockkonservativen Humanisten und fortschrittlichen Naturwissenschaftlern entbrannt. Zum Schluß war sogar abgestimmt worden. Die Partei der Naturwissenschaftler hatte mit knapper Mehrheit gesiegt. Die Schwalben durften weiter auf discimus kleckern.
Ich mußte lächeln, als ich an jene Konferenz dachte, denn Franz Zwicknagel, der Biologie und Sport gab, hatte in der Diskussion ins Feld geführt, daß ja sogar Heiligenfiguren aus Stein an Kirchen und Kathedralen von Vögeln aller Art, auch von viel größeren, auf Häupter und Nasen … na ja – ohne daß ihre Heiligkeit sichtbar darunter litte. Das hatte nun wieder den Kaplan, der am Gymnasium katholischen Religionsunterricht gab, erzürnt. Es war sehr erbaulich gewesen.
Ich drückte die Eichentür auf und ließ sie hinter mir weit offen, denn in der Schule stand, wie eine Mauer aus warmer Watte, die eingesperrte Luft, angedickt mit den Gerüchen, die wohl alle Schulen auf Gottes Erdboden haben: Schweißdunst, Kreidegeruch, der Duft nach billigem Bohnerwachs; das Miefgemisch aus Kaserne, Katheder, Karbolineum und Kindern; der Dunst aus Macht und Machtmißbrauch, aus angeschlagenen oder toten Idealen und aus Angst, aussichtsloser Auflehnung und kriechender Anpassung.
In dem niedrigen Gang, der das Treppenhaus des Hauptgebäudes mit der Turnhalle verbindet, konnte ich kaum Luft holen, so heiß war es da.
Ich versuchte, eins der Zwei-Meter-Fenster aufzuschieben, aber ich kam nicht gleich damit zurecht. Als ich es schließlich schaffte, gab es hinter mir einen lauten Knall. Die große Tür war durch den Gegenzug zugeschlagen.
Sehr viel Erfrischung brachte das geöffnete Fenster nicht, denn draußen herrschte noch immer die nahezu bewegungslose Hitze, in der die Luft über dem Asphalt des Schulhofs zitterte.
Kurz darauf, als ich die Tür zum Turnhallentrakt öffnete, krachte es noch mal, aber nicht so laut wie vorher. In dem Umkleideraum vor der Turnhalle fiel eins der kleinen Fenster zu. Um es abzuriegeln, mußte ich auf die Holzbank steigen, die darunter stand. Das weißlackierte Fensterbrett war schmutzig, als wäre jemand mit dreckigen Schuhen daraufgetreten.
In der ersten Duschkabine tröpfelte ein Wasserhahn. Ich drehte ihn zu und ging in die Turnhalle.
Franz Zwicknagel war nicht zu sehen.
„Hallo!“ rief ich.
Keine Antwort.
Ich ging quer durch die Turnhalle, öffnete auf der anderen Seite die Tür zum Geräteraum und sah hinein. Ein eigenartiger, süßlich-muffiger Geruch hing darin. Alles lag und stand ordentlich an seinem Platz: die Keulen, die Gewichte, die Meßlatte, die Bälle, die schweren Matten, das Pferd, die beiden Barren, das kleine Rhönrad … Aber Zwicknagel war nicht da. Komisch.
Der Geruch war nicht stark, aber ekelhaft.
„Hallo!“ rief ich noch mal.
Eins der Tamburins im Regal neben dem Fenster schepperte leise. Hastig schloß ich die Tür zum Geräteraum. Die Stille war bedrückend. Und wo steckte Franz Zwicknagel? Sein Wagen war draußen, die Schultür war nicht zu gewesen. Er mußte im Gebäude sein.
Ich lief zurück ins Haupthaus und rief: „Herr Zwicknagel!“ Laut und mit einem ganz langen i.
„Ja!“ antwortete er von weitem. „Ich bin hier oben … Im Bio-Saal.“
Ich stieg die Treppe hinauf. Im Treppenhaus war es dämmrig und kühler. Der Biologiesaal war offen.
Franz Zwicknagel lag längelang auf der Erde. Nur seine Beine, sein Hinterteil und ein Stück Rücken waren zu sehen. Schultern und Kopf steckten unter einem der großen Glasschränke, in denen ausgestopfte Vögel und kleinere Pelztiere, Lurche, Frösche und Schlangen in Spiritus, alle möglichen Versteinerungen und aufgespießte tote Schmetterlinge aufbewahrt wurden.
„Nanu?“ fragte ich. „Was treiben Sie denn hier?“
„Ich liege auf dem Bauch, wie Sie sehen. Und auf der Lauer.“
„Aha!“ sagte ich. „Und worauf lauern Sie, wenn ich fragen darf?“
„Auf Napoleon“, erwiderte er.
„Auf Na … Wie bitte?“ Ich sah mich um, ob vielleicht irgendwo eine leere Schnapsflasche stand.
„Ganz recht“, brummte Franz Zwicknagels Baß, „auf Napoleon. Ich wollte ihn füttern, da ist eine Tür zugeschlagen, und das Luder hat sich erschreckt und ist ausgekniffen.“
Ich kapierte, daß es sich um irgendein Tier handelte. „Singen Sie ihm doch die Marseillaise vor!“ riet ich. „Vielleicht, daß er dann, vom Nationalstolz getrieben, herauskommt.“
„Glaub ich nicht … Außerdem kann er nur Arabisch.“
„Ach so“, sagte ich, „er ist ein Kamel!“
„Beinahe erraten.“
„Ein Maulesel?“
„Wärmer!“
„Ein Wüstenfuchs?“
„Großartig – fast richtig!“
„Eine Springmaus? Oder …“
„Achtung!“ rief er plötzlich. „Da drüben, Kitty … Los, kriegen Sie ihn! Da rennt er!“
An der Scheuerleiste entlang wuselte ein winziges, hellbraunes Etwas wie auf unsichtbaren Rädern.
„Iiii!“ schrie ich.
„Halten Sie ihn doch!“ brüllte Zwicknagel und wand sich unter dem Glasschrank hervor, während das kleine Ding hinter dem Papierkorb verschwand.
„Was ist das denn?“ fragte ich noch etwas eingeschüchtert.
„Ein Goldhamster“, erklärte Franz Zwicknagel und richtete sich mit knallrotem Kopf auf. „Wo ist er?“
„Da …“ ich zeigte auf das neue Versteck Napoleons.
„Na so was!“ knurrte Franz, ließ sich wieder auf die Knie nieder und kroch auf den Papierkorb zu. Es war sehr spannend anzusehen, wie er sich langsam anschlich.
„Wieso spricht er nur Arabisch?“ fragte ich flüsternd.
„Er ist ein syrischer Goldhamster.“ Franz flüsterte ebenfalls und unterbrach für die Dauer seiner Erläuterungen die Pirsch. „Und in Syrien ist die Amtssprache Arabisch.“
Ich kicherte.
„Psst!“ zischte er und schlich weiter. Er war jetzt nur noch einen halben Meter von Napoleons Deckung entfernt. Noch ein paar Zentimeter. Er griff zu, warf den Plastikbehälter mit einem Ruck beiseite und grapschte mit beiden Händen nach dem kleinen Nagetier. „Uff!“
„Tun Sie ihm nicht weh!“ rief ich.
„Aber nein“, erwiderte er und stand auf.
Napoleon saß in seinen hohlen Händen und steckte die kleine rosa Schnauze und zwei kohlschwarze Knopfaugen heraus.
„Süß!“ sagte ich und beugte mich zu dem Gefangenen.
„Ja“, meinte Franz Zwicknagel. „Sehr süß, wirklich!“
Dabei sah er mich an.
Ich spürte, wie ich rot wurde, weil er so guckte und das so sagte, daß … nun, daß ich einfach rot werden mußte. Ich trat verwirrt zurück und rettete mich in die Schnoddrigkeit:
„Tierliebende Männer sind richtig rührend“, sagte ich und versuchte, spöttisch zu lächeln.
Franz Zwicknagel sah mich an, grinste und brachte dann den Goldhamster in seinen Käfig, der zwischen einer Reihe Aquarien an der Innenwand des Biologiesaals stand.
„Wenn Sie dann gelegentlich mit Ihrer Großwildjagd fertig werden sollten“, sagte ich, „können wir ja vielleicht doch noch die Turnhalle für morgen vorbereiten, Herr Kollege.“
„Auch pflichtbewußte Pädagoginnen sind richtig rührend“, gab Franz Zwicknagel zurück, strich sich eine widerspenstige braune Locke aus der Stirn und ließ seinen Zeigefinger an Napoleons Gitterstäben entlangrappeln. „Tschüs, Napoleon. Schlaf schön bis morgen.“
Der Goldhamster war in die kleine hölzerne Hütte gekrochen, die in seinem Käfig stand.
3
Während wir nebeneinander durch die stille Schule gingen, fragte ich:
„Kennen Sie den kleinen Helmut Vorrath aus meiner Klasse?“
„Ja“, erwiderte er. „So’n Strohblonder, nicht wahr? Guter Turner. Ziemlich ehrgeizig … Was ist mit dem?“
„Seine Mutter kam vorhin zu mir, gerade als ich losfahren wollte. Sie war furchtbar aufgeregt. Der Junge ist verschwunden. Frau Vorrath war mit ihrem Mann irgendwo auf dem Land – bei der kranken Schwiegermutter, wenn ich’s richtig verstanden habe. Und Helmut ist allein zu Hause geblieben. Er war nicht im Bett letzte Nacht und ist bis heute mittag auch nicht wiederaufgetaucht.“
„Haben die Eltern die Polizei benachrichtigt?“
„Nein – bisher nicht. Ich habe das der Frau auch gleich geraten.“
„Hat er irgendwas ausgefressen, eine Scheibe eingeschlagen oder ’ne Sechs geschrieben oder so?“
„Sechs glaube ich nicht … Sonst? Ich weiß nicht.“
„Hm“, machte Zwicknagel nachdenklich. „Wie alt ist der Junge?“
„Elf.“
„Haben Sie gefragt, was er liest – oder in letzter Zeit gelesen hat?“
„Daran hab ich nicht gedacht“, gab ich zu; „ich habe nur gefragt, ob seine Sparbüchse noch da ist oder ob sonst Geld fehlt – aber das wußte Frau Vorrath nicht.“
„Hoffen wir, daß er bloß ‚Huckleberry Finn