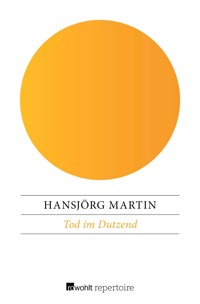9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es muß nicht immer Mord sein. Bei Hansjörg Martin schon gar nicht. Die Mehrzahl der im vorliegenden Band enthaltenen Kriminalstories handelt von kleinen Gaunern und Menschen wie Du und Ich, die, umstände- oder veranlagungsbedingt, in etwas hineinschlittern, dem sie dann nicht gewachsen sind. Generell kann man sagen: Die Frage «Wer ist der Täter?» interessiert Martin einfach nicht. Ihm geht es darum, warum einer stiehlt, betrügt, erpreßt oder – ja, das auch – mordet. Er sagt mit seinen Worten – mal flapsig, mal gedämpft-poetisch (aber immer ohne Pathos), was schon in der «Dreigroschenoper» steht: Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Das alles schwingt auch in den Stories dieses Bandes mit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Dreck am Stecken
Kriminalstories
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Es muß nicht immer Mord sein.
Bei Hansjörg Martin schon gar nicht. Die Mehrzahl der im vorliegenden Band enthaltenen Kriminalstories handelt von kleinen Gaunern und Menschen wie Du und Ich, die, umstände- oder veranlagungsbedingt, in etwas hineinschlittern, dem sie dann nicht gewachsen sind.
Generell kann man sagen: Die Frage «Wer ist der Täter?» interessiert Martin einfach nicht. Ihm geht es darum, warum einer stiehlt, betrügt, erpreßt oder – ja, das auch – mordet. Er sagt mit seinen Worten – mal flapsig, mal gedämpft-poetisch (aber immer ohne Pathos), was schon in der «Dreigroschenoper» steht: Doch die Verhältnisse, die sind nicht so.
Das alles schwingt auch in den Stories dieses Bandes mit.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Black is beautiful
Der kleine Mann, der an jenem Dienstagnachmittag vor der Universität stand, sah nach nichts aus.
Er hatte ein Durchschnittsgesicht, eine Durchschnittsfigur und trug einen Durchschnittsanzug. Er konnte ein kaufmännischer Angestellter sein, ein kleiner Beamter vielleicht oder ein Gewerbetreibender aus einem wenig ertragreichen Wirtschaftszweig … Vertretung von Büromaterial, Bürstenware, Scherzartikeln – jedenfalls sah der kleine Mann nicht nach einem Gut- oder gar Großverdiener aus. Man sieht das meist schon an der Haltung, am Blick, an der Gestik – jedenfalls wäre gewiß niemand, der ihn da so stehen gesehen hätte, auf den Gedanken gekommen, daß dieser kleine Mann innerhalb der nächsten sechs oder sieben Stunden Werte in der Höhe eines Generaldirektoren-Jahreseinkommens besitzen würde, zumal sich zur Zeit in der Tasche seines graugestreiften Durchschnittsjacketts nur zwei Mark und fünfzehn Pfennige befanden. Ein einsames Zwei-Mark-Stück, ein Zehn-Pfennig-Stück und fünf Pfennig in Kupfermünzen – das gesamte Barvermögen des kleinen Mannes.
Sein Besitz an beweglichen wie unbeweglichen Gütern war gleich Null, wenn man von dem einfachen Konfektionsanzug absah, den der kleine Mann aber nicht veräußern konnte, weil er sonst hätte nackt laufen müssen.
Dazu war es wiederum zu kühl: Apriltage in norddeutschen Großstädten sind nicht fürs Nacktlaufen geeignet … Halt:
In der rechten Hand hielt der kleine Mann noch eine Aktentasche aus Kunstleder mit Gebrauchsspuren, in der sich ein ebenfalls stark gebrauchtes und außerdem unvollständiges Reisenecessaire befand und ein Kleidungsstück, auf das wir später zurückkommen werden, das jedoch zum unerläßlichen Betriebskapital des kleinen Mannes gehörte, wie wir in Kürze sehen werden.
Der kleine Mann vor der Universität, der nach nichts aussah, sah sich suchend um.
Sein Blick glitt achtlos und uninteressiert über die mehr und minder hübschen Studentinnen, über die vielen Studenten: lange und kurze, blonde und brünette, schwarzhaarige, wildgekleidete, blasse, rotbäckige, mit und ohne Büchertaschen, Brillen oder Bärten. Ihn interessierten die diversen Plakate und Parolen nicht, die an der Mauer klebten oder darauf geschrieben waren. Es schien ihm gleichgültig, ob die Spartakusgenossen zum Kampf, die Sozialisten zum Vorlesungsboykott, die Kommunisten zur Demonstration, die Christdemokraten zu einem Tanzabend einluden oder aufforderten.
Aber jedesmal, wenn ein dunkelhäutiger Student auftauchte, wurde der suchende Blick des kleinen Mannes wachsam und scharf. Er prüfte die studierenden Söhne der Sonne vor allem auf ihre Kleidung, ging aber auch ein paar Schritte unauffällig neben oder hinter ihnen her, um zu hören, wie es um ihre Sprachkenntnisse bestellt war, und sah ihnen manchmal zweifelnd nach oder schüttelte ablehnend ein wenig den runden Kopf, wenn sie zu fließend deutsch sprachen.
Mehr als eine gute Stunde stand er dort, bis der tiefschwarzhäutige Obuwa Obinwa aus Ghana vorbeikam, der gerade mühsam versuchte, seinem deutschen Kommilitonen klarzumachen, daß er mit seiner Zimmerwirtin massiven Ärger gehabt hatte.
Der kleine Mann machte große Augen. Dieser junge Neger war genau das, was er sich für seine Sache vorgestellt hatte: Sehr groß, sehr fremd wirkend – dazu die randlose Intellektuellenbrille vor gelblichen Kulleraugen und – geradezu ideal – die deutlich hörbar miserablen deutschen Sprachkenntnisse.
Das war der, den er brauchte!
Der kleine Mann lief in einigem Abstand hinter Obuwa Obinwa her, wartete, bis dieser sich von seinem Studienkollegen verabschiedet hatte, und sprach schließlich den jungen Afrikaner an, nachdem er einen vorsichtigen Blick in die Runde geworfen und sich vergewissert hatte, daß er unbeobachtet war.
«Ich habe eben zufällig gehört», sagte er laut und langsam, wie man meist mit Schwerhörigen, Dummen oder Kindern spricht, wenn man etwas von ihnen will, «daß Sie Ärger haben mit Ihrer Wirtin. Suchen Sie ein anderes Zimmer?»
Obuwa Obinwa, der Häuptlingssohn aus Ghana, seit fünf Monaten im Rahmen der bundesrepublikanischen Förderungsmaßnahmen als Medizinstudent hier, Obuwa also verstand nicht alles, was der Fremde sagte. Er war es nicht gewöhnt, so freundlich angesprochen zu werden. Es überraschte ihn. Er fragte nach.
Der kleine Mann wiederholte – noch langsamer – seine letzte Frage: «Suchen Sie ein anderes Zimmer?»
«Ja – oh – ja!» sagte Obuwa. «Ich suchen Zimmer schnell bald. Noch fort, sofort, diesen Tag ziehen um, wenn possible. Sie, Wirtin, furchtbarer Frau … immer immer papapapa immerzu mit Mund, und so laut, so laut – Sie wissen, verstehen?»
«Ich verstehe», sagte der kleine Mann und wollte weiterreden.
Aber Obuwa, froh, sein Herz ausschütten zu können, fuhr fort: «Ganzer afternoon, Nachmittag gestern … sie papapapa … nur weil ich kochte ein Maisbrei mit – wie heißt – mit Gewürz von zu Hause in das Küche, was ich muß immer bezahl extra so, verstehen? Sagt, sie nicht kann vertragen des Geruch von mein Essen … papapapa … schrecklich. Und so immer laut. – Haben Sie eine Zimmer? Vielleicht ohn einer Wirtin, ja? Haben Sie vielleicht?»
«Ich glaube wohl», sagte der kleine Mann und nickte eifrig.
«Und was ist der Preis es kosten wieviel?» wollte Obuwa Obinwa wissen, denn er hatte schon sehr schlechte Erfahrungen hinter sich in den paar Monaten, Erfahrungen, bei denen ihm beinahe das Fell, das schwarze, über die Ohren gezogen worden wäre.
«Hundertfünfzig Mark», sagte der kleine Mann, «inklusive Heizung und Küchenbenutzung, Bad und Strom. Und eine sehr verständnisvolle Frau, die nichts gegen, eh … Gewürze hat. Meine Frau. Sie kommt selbst aus Afrika!»
«Oh», staunte Obuwa Obinwa. «Sie haben schwarze Frau?»
«Nicht direkt», erwiderte der kleine Mann; «meine Frau ist weiß, aber sie ist in – eh – in Tansania geboren und aufgewachsen. Sie liebt Afrika!»
Obuwa Obinwa strahlte. «Soll ich komm mit Ihn direkt, gleich?» fragte er, um nur ja die traumhafte Chance nicht zu verpassen, ein so billiges Zimmer bei einer Wirtin zu kriegen, die in Afrika aufgewachsen war und es liebte.
«Besser am Nachmittag», meinte der kleine Mann, «wenn es Ihnen recht ist. Wir müssen vier Stationen mit der U-Bahn fahren – treffen wir uns um zwei vor der Imbiß-Stube im Hauptbahnhof. Einverstanden? Wissen Sie, wo das ist?»
Er mußte das noch mal erklären und tat das mit großer Geduld, bis Obuwa alles richtig verstanden hatte. Aber einverstanden war der Negerstudent natürlich. Die beiden schüttelten sich die Hände. Der junge Schwarze fuhr zu seiner schimpfenden Wirtin, um seine Siebensachen zu packen – und der kleine Mann verließ zufrieden das Universitätsgelände und lächelte vor sich hin.
Drei Stunden später, kurz vor 14 Uhr, trat der kleine Mann – noch immer lächelnd – auf den gut gekleideten Obinwa zu, der, zwei große Koffer, eine Aktentasche, einen Pappkarton und eine bildschöne krokodillederne Reisetasche neben sich, wartend an der vereinbarten Stelle stand und glücklich seine 32 schneeweißen Zähne blitzen ließ, als er den vermeintlichen neuen Zimmerwirt erblickte.
Der kleine Mann hatte sich nur unwesentlich, aber doch ins Auge fallend, verändert. Er trug unter seinem graugestreiften Konfektionsjackett jetzt eine jener schwarzen, hochgeschlossenen Blusen, Collar genannt, die zur außerdienstlichen Kleidung geistlicher Herrn gehört.
Auch den schmalen weißen Bündchenkragen hatte er angelegt und eine breitgerandete dunkle Hornbrille aufgesetzt, die sein Durchschnittsgesicht stark veränderte und ihm das Aussehen eines geistig schaffenden Mannes gab.
Die Kunstlederaktentasche des kleinen Mannes enthielt nun nur noch das schäbige Reisenecessaire und ein zerknautschtes Oberhemd, das er auf der Bahnhofstoilette gegen den Collar getauscht hatte.
Obawa Obinwa, vom neuen Äußeren des kleinen Mannes sehr beeindruckt, wagte nicht, ihn zu fragen, ob er denn vielleicht ein Priester sei. Das konnte ja wohl auch kaum der Fall sein – es war ja vorhin von einer Frau die Rede gewesen … Also schwieg Obuwa Obinwa und beschloß, abzuwarten.
Er war voller Vertrauen, jetzt, angesichts des priesterlichen Habits fast noch mehr als zuvor, und er konnte ja beim besten Willen zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, daß er sehr lange würde abwarten müssen …
Zunächst einmal bat der kleine Mann den dunklen Studenten, das Gepäck in einem der Schließfächer unterzubringen, denn er müsse noch einige Besorgungen machen, ehe er mit ihm die paar U-Bahn-Stationen nach Hause fahren könne, wo sein Zimmer bereits vorbereitet werde.
«Ich würde mich sehr freuen», sagte er lächelnd, «wenn Sie mich auf den paar Wegen, die ich noch zu erledigen habe, begleiten und mir Gesellschaft leisten könnten.»
«Ja», sagte Obinwa, obschon er eigentlich keine Lust hatte, zumal er nicht wußte, wie lange das dauern würde. Aber er mochte nicht unhöflich sein, verstaute sein Gepäck in zwei Schließfächern und trottete geduldig und gottergeben neben dem kleinen Mann her, der ihn in ein freundliches, wenn auch ziemlich mühsames Gespräch verwickelte.
Der erste Weg führte den kleinen Mann im priesterlichen Collar mit seinem schwarzhäutigen Begleiter in ein großes Fotogeschäft der Innenstadt.
Das war ein sehr schönes, bekanntes Geschäft, elegant eingerichtet, teuer, von renommierten Fachkräften der Branche geleitet und allgemein berühmt für seine Seriosität.
Der kleine Mann fragte nach dem Geschäftsführer und bedeutete den jungen Obinwa, einen Augenblick in einem der gepolsterten Stühle Platz zu nehmen, die da in kleinen Gruppen um schwarze Marmortischchen standen. Obinwa setzte sich brav und blätterte in einer der ausliegenden Fotozeitschriften.
Der Geschäftsführer kam. Er sah eher wie ein Graf aus einem Schloß-Roman aus – silberne Favoris, englischer Schnurrbart, Perle in der Seidenkrawatte.
Der kleine Mann stellte sich vor. «Leichsenring», sagte er mit einer angedeuteten Verbeugung dezent, vornehm und halblaut – gerade so laut, daß Obuwa Obinwa, der ohnehin wenig verstand, nichts mehr verstand. «Ich komme im Auftrag Seiner Exzellenz, unseres hochwürdigen Herrn Bischofs –»
Der Geschäftsführer knickte leicht in der Hüfte ein und machte ein ehrfürchtiges Gesicht.
«… wir erwarten», fuhr der kleine Mann, der sich Leichsenring nannte, fort, «heute abend eine Reihe von Amtsbrüdern aus den Entwicklungsländern, die zum Abschluß einer mehrwöchigen Reise durch die Bundesrepublik … Na, Sie werden davon gelesen haben, denke ich.»
«Gewiß, Hochwürden», sagte der Geschäftsführer beflissen, obschon er durchaus nichts gelesen hatte – aber was soll man denn auch alles wissen und lesen heutzutage, noch dazu, wo einen in Norddeutschland kirchliche und speziell katholische Ereignisse und Vorgänge ohnehin nicht sonderlich interessieren, wenn man auch wußte, immerhin, daß es einen Bischof gab. Er war einem zwar noch nicht zu Gesicht gekommen, doch das hatte man bisher nicht als Versäumnis empfunden.
«… heute abend also zu einem Empfang im bischöflichen Palais», setzte der kleine Mann, äh, Hochwürden Leichsenring, seine Rede fort. «Und die Herren – zwei Bischöfe und andere hohe kirchliche und weltliche Würdenträger aus Tansania, Ghana und so weiter, die Herren also möchte unser Hochwürdiger Herr Bischof nun gern mit einem Geschenk erfreuen. Aus diesem Grunde bin ich mit dem Sekretär des Bischofs von Ghana unterwegs …» Herr Leichsenring deutete auf den ahnungslosen Obinwa, der leise gelangweilt noch immer in den Fotomagazinen blätterte und sprach weiter: «… um das Geeignete zu finden, was den Herren Freude bereiten und als gute und auch zugleich praktische Erinnerung an ihren Deutschland-Besuch geeignet sein würde. Sie verstehen mich?»
Der Geschäftsführer nickte voller Eifer. Das sah nach einem guten Geschäft aus!
«Wir haben da also unter anderem», meinte Leichsenring weiter, «an Kameras, Fotoapparate gedacht. Gute Kameras aus der berühmten deutschen Produktion – aber keine allzu komplizierten Geräte, wenn Sie wissen, was ich meine, obschon die Herren durchweg einen hohen Bildungsgrad … Na, ja, also …» Er verhedderte sich und schien verlegen.
«Ich bin durchaus im Bilde», sagte der Geschäftsführer, um Hochwürden Leichsenring aus der Verlegenheit zu helfen.
«Eventuell auch Schmalfilmkameras mit dem nötigen Zubehör», sagte Leichsenring freundlich lächelnd. «Und ich möchte Sie bitten, mir da beratend zur Seite zu stehen und zu helfen, denn ich bin in solchen Dingen nicht so versiert, wie es eigentlich für einen Einkauf dieser Art und Größenordnung angemessen und nötig wäre …»
Diesem Wunsch des kleinen Mannes im Collar kam der Geschäftsführer selbstverständlich sofort und gern nach. Die Beratung dauerte etwa zwanzig Minuten, dann hatte der Beauftragte Seiner Exzellenz des hochwürdigen Herrn Bischofs für etwa 25000 Mark Fotoapparate, Filmgeräte und Zubehör ausgesucht – nicht ohne zwischendurch zum ‹Sekretär des ghanesischen Würdenträgers› zu gehen, sich mit ihm über die Art der Geschenke zu besprechen und seine Meinung einzuholen («… ein bißchen Geduld, junger Freund, ja – nur noch eine kleine Weile, ja?» – woraufhin Obuwa Obinwa natürlich zustimmend nickte und mit dem Stoizismus seiner afrikanischen Mentalität die weißen Zähne blitzen ließ).
Der kleine Herr Leichsenring bat, die Kameras, Filmgeräte usw. in Geschenkpapier zu verpacken und das Ganze in einen normalen, einfachen Karton – ohne Firmenaufschrift, wenn möglich … Und daß man diesen Karton freundlicherweise heute nachmittag – aber bitte pünktlich um 16 Uhr! – im Palais Seiner Exzellenz des Hochwürdigsten Herrn Bischof … Die Adresse sei ja wohl bekannt? Die Rechnung in einem gesonderten Kuvert oder per Post …
Dann verließ der kleine Mann, gefolgt von vielen Bücklingen des Geschäftsführers und zweier Verkäufer – denn auch in einem so renommierten und seriösen Geschäft gehören Aufträge in dieser Größenordnung nicht unbedingt zur Tagesordnung – mit seinem schwarzen Begleiter freundlich lächelnd den vornehmen Laden. Er schenkte dem Geschäftsführer beim Hinausgehen neben seinem Lächeln ein Winken, das einer segnenden Handbewegung recht ähnlich war und das den Herrn im grauen Zweireiher irritierte, weil er noch nie in seinem sechsundvierzigjährigen evangelischen Leben gesegnet worden war.
Der Vorgang – Frage nach dem Geschäftsführer, Vorstellung, Bitte um Beratung, Auswahl kostbarer Gegenstände, Verabschiedung inklusive segnendem Winken – wiederholte sich in den nächsten knapp zwei Stunden in fünf weiteren Geschäften der Stadt. Er wiederholte sich, fast minuziös gleich im Ablauf, in vier weiteren Fotogeschäften und bei zwei Juwelieren der Spitzenklasse. Fast überall wurde der kleine Herr Leichsenring mit ‹Hochwürden› angesprochen, was der mittrottende, brav-geduldige Obuwa Obinwa nicht so recht kapierte, weil er in seinem bisherigen Deutschunterricht das Wort Hochwürden noch nie gehört hatte.
In den Juwelierläden der Spitzenklasse, wo es noch vornehmer zuging als in den feinen Fotogeschäften, erstand der kleine Mann Armbanduhren, goldene Zigarettenetuis, edelsteinbesetzte Feuerzeuge und anderen teuren Krimskrams für die Herren aus den Entwicklungsgebieten und die Damen der Attacheés …
Zehn Minuten vor vier Uhr brachte der kleine Mann den armen Mohren, der nun seine Schuldigkeit getan hatte, ohne es zu ahnen, zum Hauptbahnhof. Er bat ihn, im Wartesaal noch ein weiteres kleines Viertelstündchen zu warten, weil er eben schnell hinüber müsse, zur Post, um ein zeitlich befristetes Ferngespräch zu führen. Er winkte dem immer noch breit-geduldig und verständnislos lächelnden Obinwa segnend zu und entschwand.
Punkt vier stand der kleine Mann in der dämmerigen, feierlichfulminanten Halle des bischöflichen Palais, die – wie immer zu dieser Tageszeit – leer war. Nur ein älterer Pförtner saß in einem Glasgehäuse, dem der kleine Mann erklärte, daß er hier für den Missionsverein St. Ansgar ein paar Pakete in Empfang nehmen müsse, die gleich gebracht würden. Der alte Mann glaube dem kleinen Collarträger und nickte beflissen.
Im Laufe der folgenden halben Stunde trafen Boten der Fotohäuser und Juweliergeschäfte ein, überreichten Hochwürden Leichsenring ihre Pakete, nahmen in der stillen Halle mit ehrfürchtigem Diener (aber leiser Enttäuschung über das ausbleibende Trinkgeld) die von Hochwürden abgezeichneten Lieferscheine in Empfang und zogen ab.
Der kleine Mann verstaute die Pakete in zwei mitgebrachten Koffern, billige Kaufhausqualität, aber ganz durabel, wartete nach dem Erscheinen des letzten Boten nicht länger und verließ, als es vom Kirchturm nebenan 16 Uhr 45 schlug, mit den vollen und nicht ganz leichten Koffern das Palais Seiner Exzellenz unseres Hochwürdigsten Herrn Bischofs zufrieden lächelnd. Er eilte zum Bahnhof, denn er besaß neben den 2 Mark 15 bar auch noch eine Fahrkarte zur nächsten Großstadt.
Er paßte sehr gut auf, daß ihm auf dem Bahnhof nicht etwa Obuwa Obinwa über den Weg lief, erreichte den D-Zug kurz nach 17 Uhr und stemmte stöhnend, aber mit sich zufrieden seine Koffer ins Gepäcknetz, was ihm, seiner geringen Körpergröße wegen, einige Mühe bereitete.
Die erste Rechnung, die einige Tage darauf im bischöflichen Sekretariat eintraf, wurde zunächst für einen Irrtum, für eine Verwechslung gehalten. Von der dritten an wußte man, daß der kleine Herr Leichsenring – aber diesen Namen wußte man eben nicht – im Gewand des Amtsbruders ein gewiefter Gauner war.
Für 87445 Mark und 60 Pfennig (inklusive Mehrwertsteuer) hatte er in gut zwei Stunden eingekauft.
Das gleiche – Ergebnis: 71700 Mark und 40 Pfennig – geschah am nächsten Tage in der Stadt, in die Leichsenring gefahren war; das gleiche – Ergebnis 100003 Mark und 10 Pfennig (immer inklusive Mehrwertsteuer) passierte am dritten Tage in einer dritten Stadt.
Und der arme Obuwa Obinwa sowie seine schwarzen Kommilitonen in den anderen Städten saßen stundenlang vergeblich, um auf ihren Wohltäter zu warten, der ihnen ein Zimmer oder einen Job oder eine günstige Einkaufsquelle versprochen hatte.
Aber auch die Fotohändler und Juweliere haben bis heute noch nichts wieder von Hochwürden Leichsenring, dem Beauftragten Seiner Exzellenz unseres Hochwürdigsten Herrn Bischofs gesehen.
Die Kripo auch nicht.
Vom Segen der Einsamkeit
Als der Vorhang zu dieser Geschichte aufging, sah es aus, als würde ein Biedermeier-Stück daraus, eine Lokalposse von Nestroy oder Niebergall, mit allem, was dazugehört … Die Dekoration zumindest hätte zu einer Posse mit Gesang gepaßt, wie extra dafür entworfen und gebaut. Da fehlte nichts: Das kleine Häuschen mit dem spitzen Giebel und der Fachwerkfassade war da und auch der grüne Gartenzaun, die ebenfalls grünen Fensterladen und die großen Sonnenblumen – und sogar das Mädchen war da.
Es trug zwar keinen Schutenhut, keine weiße Puffärmelbluse, kein kornblumenblaues Mieder und keine weißen Strümpfe und schwarzen Lackschuhe, sondern eine verwaschene Rippelsamthose und so ein indisches Schlotterbaumwollhemd, verschossen und zwei Nummern zu weit. Aber es kam im dramaturgisch genau richtigen Moment auf die Bühne – nein, die Straße entlang geradelt und lachte mich an.
Mich – nicht den dicken Makler, neben dem ich im Garten stand. Mich, mich lachte das Mädchen an. Mich!
Es lachte mich so an, daß ich das kleine Haus doch kaufte, obschon ich 737 Bedenken gehabt hatte, bevor das Mädchen mich anlachte.
Aber nein, ich muß das weniger metaphorisch erzählen, denn es endete ja schließlich durchaus nicht als Biedermeier-Stück, ganz und gar nicht wie eine Lokalposse mit Gesang und Tanz – es endete ja eher wie ein Drama, mit Trauer und Erschrecken. Wenigstens was den dritten Akt angeht.
Der Schluß glich dann wieder einem der modernen Stücke, einem mit «offenem Ende» – wo man rausgeht aus dem Theater und nicht genau weiß, ob Godot nun kommt, ob es ihn überhaupt gibt, ob das ein Traum war, ein Alptraum natürlich … Oder was? Oder wie?
Zunächst kaufte ich das Haus. Nichtsahnend. Natürlich nichtsahnend.
Wer ahnt schon, wenn er ein kleines Haus kauft, was ihm da widerfahren wird.
Es war nicht teuer. Ich hätte es ja sonst auch nicht kaufen können. Gesucht hatte ich schon viele Monate, hatte manches Wochenende damit verbracht, rund um die Stadt die «Gelegenheiten» abzuklappern und zu besichtigen, hatte die irresten Grundstücke und Häuser gesehen – vom selbstgebastelten Schloß en miniature mit Zinnen und Türmchen auf einem Zweihundert-Quadratmeter-Grundstück bis hin zur Strohdachkate (renovierbedürftig), die offensichtlich nur noch vom Strohdach zusammengehalten wurde, aber als «einmalige Gelegenheit, rustikal zu leben» mit einem Höchstpreis angeboten wurde (was immer man auch unter «rustikal leben» verstehen mochte).
Ich habe vorhin gesagt, daß die Geschichte, das Stück, mit Erschrecken und Trauer endete. Das ist nicht ganz richtig, denn ich kann nichts beweisen, weil die Tat … Ach, ich muß das wirklich der Reihe nach berichten, dafür bitte ich um Verständnis, denn sonst verfitze ich mich völlig.
Aber das mit der Trauer ist richtig. Ich war so traurig, daß ich sogar den Ärger vergaß, die Enttäuschung überwand, die Ernüchterung nicht spürte, die mich sonst sicher sehr mitgenommen haben würde.
Also, Schritt für Schritt: Ich kaufte das Häuschen Ende August.
Es war nicht per Annonce angeboten worden, sondern ich hatte davon durch den Bruder eines Kollegen erfahren, dessen Frau wiederum mit der Sekretärin des Maklers jeden Donnerstag zum ‹Fitness-Training› ging, also das tat, was man früher schlicht Turnen nannte.
Das Häuschen war, wie gesagt, nicht groß. Dreieinhalb Zimmer, das halbe nur winzig, wie ein Abstellkämmerchen; zwei Räume im ersten Stock, groß genug zum Schlafen und Arbeiten. Daneben Klo und Duschbad. Doch das Erdgeschoßzimmer neben der kleinen Küche (mit Durchreiche) war schön groß, richtig groß, man konnte dreimal tief Atem holen, ehe man es diagonal durchquert hatte.
Den September hindurch wartete ich darauf, daß der Mieter ausziehen würde, was er eigentlich sofort hatte tun sollen.
Im Oktober war das Häuschen leer, und ich wartete auf die Handwerker, die dies und das streichen, hobeln, schrauben sollten. Was da zu tun war, wäre für Heimwerker (wie ich keiner bin) zweimal ein Wochenende gewesen. Für Stundenlohnempfänger war es ein halber Monat Arbeit.
Anfang Oktober kamen die zwei ersten Stundenlohnempfänger. Mitte Oktober drei weitere. Anfang November war alles so weit, daß ich einziehen konnte.
Der Tag war grau und neblig und naß. Meine 34 Bücherkisten mußten auf dem Weg vom Möbelwagen durch den Garten bis ins Haus mit Plastikplanen abgedeckt werden, weil es natürlich gerade beim Ausladen der viel zu vielen Sachen in Strömen goß.
Das war ein Montag. Am Mittwoch sah ich Land. Am Freitag fing ich an, mich heimisch zu fühlen. Am Samstag früh fuhr ich zum erstenmal die drei Kilometer ins Dorf zum Einkaufen. Es regnete immer noch. Mir kam es vor, als sei der Regen hier weit draußen am Stadtrand sehr viel nasser als in der Innenstadt. Als ich zurückkam, stellte ich fest, daß die vordere Dachrinne leckte. Das Wasser pladderte auf die leeren Kisten, die draußen standen. Das klang wie Gewitter.
Weil es mir auf die Nerven ging, zog ich einen alten Trenchcoat an, setzte einen Hut auf und tauchte in den Regen, um die Kisten aus dem Wasserfall zu zerren.
Als ich die elfte Kiste gerade fluchend zur Seite gewuchtet hatte, rief von der Straße her eine Stimme.
«Hallo! Hallo, Sie!» rief die Stimme. Eine helle Stimme.
Ich sah durch den Wasserschleier eine Gestalt im Friesennerz mit Gummistiefeln.
«Ja?» rief ich zurück.
«Haben Sie eine Luftpumpe?» rief die Stimme.
Ich hatte eine. «Augenblick!» rief ich.
Wo war das Dings?