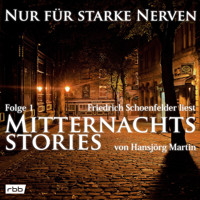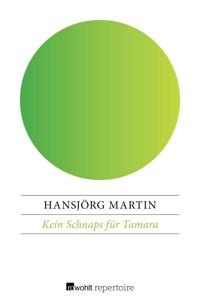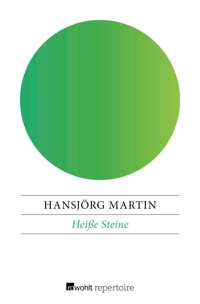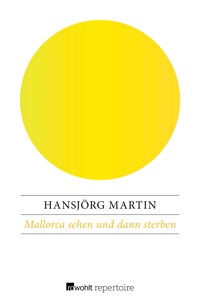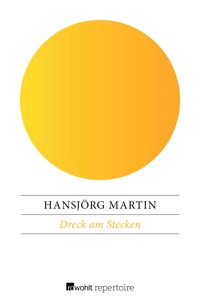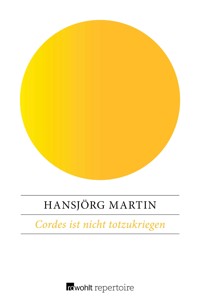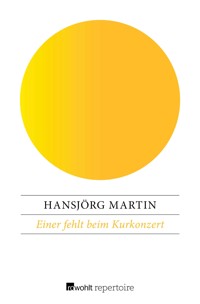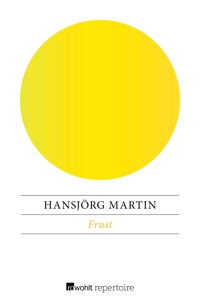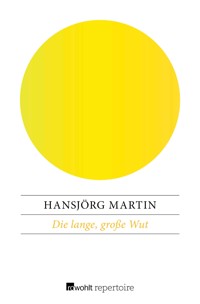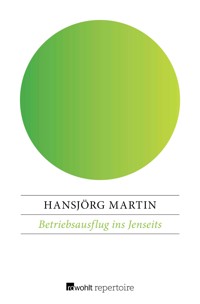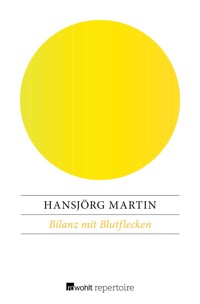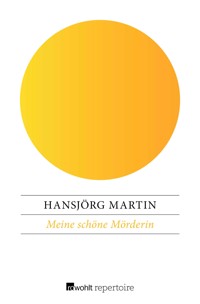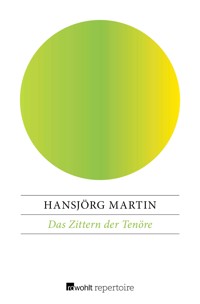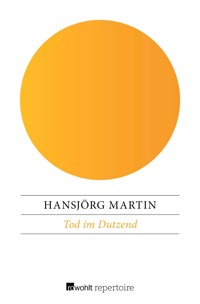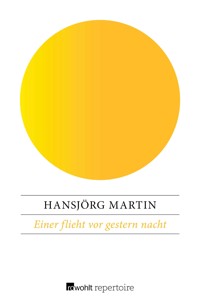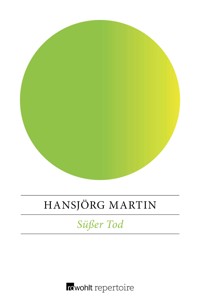
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Direktor Hebestreit ist entsetzt. In der Auktionshalle seiner Viehzuchtgenossenschaft finden zwei Putzfrauen die Leiche einer jungen Frau. Niemand kennt sie. Und noch weniger weiß jemand, warum sie ausgerechnet hier sterben mußte. Gerade jetzt, zwei Wochen vor den Vorstandswahlen, kann sich Hebestreit schlechte Publicity nicht leisten. Das könnte ihn glatt seinen Job kosten. Hoffentlich klärt dieser Leo Klipp diese schreckliche Angelegenheit schleunigst auf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Süßer Tod
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Direktor Hebestreit ist entsetzt. In der Auktionshalle seiner Viehzuchtgenossenschaft finden zwei Putzfrauen die Leiche einer jungen Frau. Niemand kennt sie. Und noch weniger weiß jemand, warum sie ausgerechnet hier sterben mußte. Gerade jetzt, zwei Wochen vor den Vorstandswahlen, kann sich Hebestreit schlechte Publicity nicht leisten. Das könnte ihn glatt seinen Job kosten. Hoffentlich klärt dieser Leo Klipp diese schreckliche Angelegenheit schleunigst auf ...
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Kimet Schinassi Muhibbe Seyfeddin
machen eine entsetzliche Entdeckung.
Arthur Ruschke
fühlt sich als Pascha im Harem.
Direktor Rudolf Hebestreit
fürchtet um seine Existenz.
Doktor Senftleben
pflegt lässigen Umgang mit Leichen.
Doktor Schlobohm
kennt keine Dienstzeiten im Kampf gegen Zahnschmerzen.
Peter Janssen
schwärmt für seine Freundin und Motorräder.
Hildegunde Vierkant
verursacht viel Wirbel.
Ludwig Vierkant
haßt Abtrünnige.
Elfriede Klein
sorgt sich um ihre Untermieterin.
Alma Strobel
bekommt keine Kinokarten.
Leo Klipp
verliert einen Dienstwagen.
I.
Die Tote wurde am Sonnabend, dem 7. März, acht Uhr zweiunddreißig, in der großen Auktionshalle der Viehzuchtgenossenschaft in Lübeck gefunden.
Sie wurde von den zwei türkischen Raumpflegerinnen Kimet Schinassi, 29, und Muhibbe Seyfeddin, 25, zwischen der ersten und zweiten Klappstuhlreihe gefunden – und die beiden Frauen reagierten sehr unterschiedlich auf die entsetzliche Entdeckung. Kimet, die ältere, aus der winzigen christlichen Diaspora bei San Stefano, südlich Konstantinopel, stammend, faßte sich betend an die vollen Lippen, wurde blaß und flüsterte:
«Jesus Christus!» – wobei sie sich flink zweimal bekreuzigte und zitternd: «Heilige Mutter …!» hinzufügte.
Muhibbe, die aus dem islamischen Pülümür kam, wurde rot, riß die schwarzen Augen auf und stöhnte:
«Allah …!»
Dann setzten beide – fast im gleichen Takt – ihre Scheuereimer ab, lehnten die Schrubber gegen die Stuhlreihe, hinter der die Tote lag, machten kehrt und liefen mit laut klappernden Holzschuhen aus der Auktionshalle, wie vom Teufel – dem für Christen und Andersgläubige gleichermaßen zuständigen – gejagt.
«Herr Ruschke!» rief Kimet, die schon neun Jahre in der BRD lebte und gut Deutsch konnte. «Herr Ruschke!» schrie sie lauter, als sich niemand meldete – und zum drittenmal: «Herr Ruuuschke!» laut, mit langem U …
Und da kam endlich die Stimme des Hausmeisters aus dem langen Gang, der zu den Ställen führte:
«Ja … Was ist denn los, Mädchen? Warum schreist du so, verdammich! Ich komm ja schon!»
Arthur Ruschke, ein knorpeliger kleiner Mann Mitte Fünfzig, der mit einem Adonis soviel Ähnlichkeit hatte, wie ein Mops mit einem Lipizzaner – Arthur Ruschke also plierte mit gefurchter Stirn die beiden Frauen aus seinen wässerigen Augen an und fragte barsch:
«Nu? Was gibt’s denn, ihr aufgeregten Hühner? ’ne Maus, wie? Oder …?»
Er war der felsenfesten Meinung, daß die ihm untergebenen Türkinnen dumm seien, wie übrigens alle Frauen, und die Ausländerinnen sowieso, ganz besonders die aus dem Balkan «und der ganzen Gegend …»
Er hatte sieben davon unter seiner Fuchtel, redete am abendlichen Stammtisch nur von «meinen Weibern», was ihm den Spitznamen ‹Pascha› eingetragen hatte, einen Spitznamen, den er fast geschmeichelt duldete. Und er sagte (und glaubte), daß er die sieben «straff aber gerecht» behandele.
Zu Hause mit seiner Angetrauten sprach er kaum davon, denn da hatte er ohnehin nicht viel zu sagen.
«Nu mal los», raunzte er jetzt die aufgeregten Frauen an. «Nu mal raus mit der Sprache! Was ist denn passiert?»
Kimet gab sich einen Ruck: «In der Halle, Herr Ruschke», sagte sie mit noch immer zitternden Lippen, «in der Halle … direkt neben Gang zwischen Manege und Stühle … Oh, o Gott!»
Sie brach ab, sah den Hausmeister an, wußte nicht weiter und fingerte abermals an ihrem halboffenen Mund herum.
Ruschke begann zu ahnen, daß irgendwas geschehen sein mußte, was die täglichen kleinen Aufregungen überstieg.
«Was denn, zum Kuckuck?» schnauzte er.
«Tote Frau!» sagte Muhibbe. «Da liegen tote Frau, Herr Ruschke! Voll ganz tot! Augen so … offen!»
«Ihr seid wohl nicht ganz dicht?» raunzte Ruschke. «Wie soll denn …?»
Aber er wandte sich schon der breiten Doppeltür zu, die zur Auktionshalle führte, und lief los, immer noch der Ansicht, daß die hysterischen Weiber irgendeinem Hirngespinst aufgesessen seien. Wie, zum Teufel, sollte denn eine tote Frau auf das Gelände der Viehzuchtgenossenschaft geraten? Auf sein, Ruschkes, Gelände, für das er verantwortlich war.
Seit dreiundzwanzig Jahren war Arthur Ruschke hier Hausmeister. Er kannte jeden Winkel der Gebäude, vom Wiegehäuschen vorn am Eingang über die Büroräume, die Sitzungszimmer, die Labors, die Material- und Futterkammern, die Ställe bis zur großen Auktionshalle, die mit ihrer rechteckigen Manege und den gestaffelten Tribünen rundum etwas von einem Zirkus hatte, was Ruschke jedoch nicht gern hörte.
Er hatte zu allen Türen Schlüssel, sogar zur Zimmertür des Direktors und natürlich auch zu den Kammertüren der Arbeiter, die über den Ställen wohnten.
Und er kontrollierte mit preußischem Pflichtbewußtsein immerzu und mit Zuverlässigkeit alles – denn er war in einem Dorfe bei Schenkenberg, halbwegs zwischen Brandenburg und Potsdam, wo ja bekanntlich Pflichtbewußtsein und Gehorsam erfunden worden sind, geboren und aufgewachsen.
Er sorgte für Ordnung, war morgens als erster im «Dienst» und schloß abends als letzter sorgfältig alles ab, akkurat wie ein pünktlicher Postbeamter. Sein Schlüsselbund, Zeichen seiner Würde und Macht, ließ er nie aus den Augen, obschon es schwer und sperrig war, bereits manches Hosentaschenfutter zerrissen hatte und bei jedem Schritt klirrte. Selbst in der Nacht lag es griffbereit auf seinem Nachttisch.
Außer Ruschke besaß nur Direktor Hebestreit, der Chef der Viehzuchtgenossenschaft, die Schlüssel zu den Gebäuden, doch der benutzte lediglich seinen Büro- und den Haupteingangsschlüssel. Die vier Arbeiter, die auf dem Gelände wohnten, hatten jeder einen für den Seitenausgang an den Ställen, über denen ihre Kammern lagen.
Aber die Arbeiter waren an diesem Wochenende nicht da. Gestern, Freitag, am Nachmittag waren die drei, die Dienst hatten, nach dem Abschluß der Jungstierkörung und dem Säubern der leeren Ställe weggefahren. Der eine, soviel Ruschke wußte, zu seinen Eltern nach Hamburg, die zwei anderen mit ihrem Fußballverein zu einem Oberligaspiel irgendwo in der Nähe von Mainz oder Wiesbaden.
Der vierte lag seit sieben oder acht Tagen im städtischen Krankenhaus auf der chirurgischen Station, nachdem ihn der 30-Zentner-Preisstier Wotan Mitte voriger Woche an die Stallwand gedrückt und ihm dabei vier Rippen, das Schlüsselbein und den linken Arm gebrochen sowie eine Niere gequetscht hatte.
Ruschke hatte das kommen sehen, so ruppig wie der Mann mit dem Tier umgegangen war …
Es konnte demnach niemand in das Hallengebäude.
«Ausgeschlossen, daß irgendwer aufgeschlossen hat …» murmelte Ruschke, aber er bemerkte das Wortspiel nicht und hatte auch keine Gelegenheit, sich darüber zu amüsieren, denn er war inzwischen, von den beiden Türkinnen gefolgt, am Ostende der Halle angelangt und sah die Tote.
«Verflixt …» ächzte er und war nun auch selbst so verwirrterschrocken, daß er nicht gleich wußte, was er tun, sagen und lassen sollte. Er zwinkerte ratlos und bohrte die Zungenspitze an die Innenseite seiner Backe.
Die Türkinnen waren in vier, fünf Metern Abstand hinter ihm stehengeblieben und sahen abwechselnd den Hausmeister und die Tote an. Ihre Münder waren vor Neugier und Entsetzen geöffnet.
Es war sehr still in der großen Halle.
Nur Ruschkes Schlüsselbund klirrte leise, als er ratlos von einem Fuß auf den anderen trat.
«Na, so was …» flüsterte er schließlich, schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf, als wolle er ein lästiges Insekt oder einen bösen Traum verscheuchen, gab sich dann aber einen Ruck und fragte über die Schulter:
«Kennt ihr die?»
«Nein, nicht …» sagte Kimet.
«Ich nicht …» sagte Muhibbe.
Kimet trat näher.
«Nichts anfassen!» befahl Ruschke überflüssigerweise, nachdem er sich langsam berappelt hatte, und streckte den linken Arm wie eine Schranke zwischen die Tote und die türkischen Frauen.
«Ihr bleibt jetzt hier!» ordnete er an. «Ich ruf den Chef an, klar?! Wartet, bis ich wiederkomme – aber nichts anfassen und nichts verändern, klar?»
«Oh, ich nicht will bleiben hier!» rief Muhibbe ängstlich.
Auch Kimet hob abwehrend die Hände.
«Ich auch nicht. Ich habe Angst!» sagte sie.
«So’n Blödsinn …!» knurrte der Hausmeister. «Die tut euch nichts mehr! Aber meinetwegen, bleibt auf dem Gang vor der Tür, Mädchen! Laßt aber niemanden rein, verstanden? Und zu keinem ein Wort!»
«Ja», sagte Kimet erleichtert.
«Jaja, Herr Ruschke!» fügte Muhibbe hinzu.
«Wo sind denn die anderen?» wollte Ruschke wissen, indem er – diesmal hinter den eilig hinauslaufenden Frauen – die Halle verließ.
«Drei da oben. Machen die Büros sauber», sagte Kimet. «Und zwei bei den Toiletten und im Duschraum!»
«Ist gut!» sagte Ruschke nickend, ließ die beiden Frauen vor der Doppeltür stehen und lief, so schnell seine kurzen krummen Beine es erlaubten, mit klirrendem Schlüsselbund zum Telefon.
Zum Glück erreichte er Direktor Rudolf Hebestreit zu Hause.
«Was gibt’s denn, Ruschke? Nun mal langsam … Brennt’s?» unterbrach der Chef das erste Gestammel seines Hausmeisters. «Machen Sie’s kurz und fix – ich will gerade zu meinem Boot!»
«Sie müssen herkommen, tut mir leid, Herr Direktor – aber Sie müssen herkommen!» sagte der Hausmeister. «Wir haben eben … eben haben wir … eine Leiche haben wir in der Auktionshalle gefunden!»
«Eine … eine was?» fragte Hebestreit erschrocken.
«Eine Leiche, jawoll, Herr Direktor, eine Tote. Zwischen den Stuhlreihen!» erwiderte Ruschke.
«Ich werd auf der Stelle verrückt!» sagte Hebestreit leise. «Eine Tote?»
«Jawoll, Herr Direktor, junge Frau – keine Ahnung, wieso … Aber wir müssen die Polizei – und …» stammelte Ruschke. «Oder wollen Sie …?»
«Rufen Sie sofort an! Rufen Sie sofort die Polizei an, Ruschke!» befahl Direktor Hebestreit. «Ich bin in zehn Minuten da! Das ist ja …! Eine Leiche! Und hören Sie: Zu niemandem auch nur ein einziges Sterbenswörtchen, verstehen Sie? Das fehlte mir noch: Titelzeile: ‹Leiche in der VZG› – zwei Wochen vor den Vorstandswahlen –, also bis gleich! Rufen Sie an! Ich komme sofort!»
«Jawoll, Herr Direktor!» sagte Ruschke zackig, aber das hörte Hebestreit nicht mehr, weil er aufgelegt hatte.
II.
Der Alarmruf erreichte mich auf dem bürokratisch vorgeschriebenen Dienstwege kurz vor neun Uhr zu Hause.
‹Zu Hause› ist nicht ganz richtig: Ich wohnte zwar seit fünfeinhalb Monaten in dieser Zweieinhalbzimmermansarde, hatte auch alle meine gewohnten und geliebten Sachen – Möbel, Bilder, Schallplatten, Bücher – um mich herum, aber zu Hause fühlte ich mich noch immer nicht, obschon es eine wirklich sehr hübsche Wohnung war, die ein pfiffiger Architekt in das steile Dachgeschoß des zweihundert Jahre alten, echt historischen Patrizierhauses gezaubert hatte, hundert Schritt neben der Marienkirche, in naher Nachbarschaft zur Mengstraße und der ganzen Buddenbrookatmosphäre.
Die schrägen Wände mit den sehr geschickt konstruierten Gaupen, durch die viel Licht kam, das spezielle Lübecker Licht, oft silbern am Morgen und rosa-dunstig gegen Abend, die dunkel gebeizten, dicken Eichenbalken im Wohnraum, die knorrigen, aber merkwürdigerweise nicht knarrenden Dielenbretter, die weißen Wände mit Kirchenputz lebendig gemacht … und vor allem der unbeschreiblich aufregende Blick über die erstaunlich vielfältig geschachtelten und gewinkelten Dächer, deren Farbigkeit vom Schiefergraublauschwarz über mehrere Spielarten Ziegelrot bis zum Silber heller Dachpfannen reichte … Das war alles sehr schön und gefiel mir. Aber ich hatte trotzdem Mühe, in der berühmten Stadt an der Trave heimisch zu werden.
Dafür gab es eine ganze Reihe von Gründen: Erstens ist mein Beruf nicht gerade die ideale Voraussetzung für schnelle oder gar freundschaftliche Kontakte und die daraus resultierende Aufnahme in die – meist geschlossene – Gesellschaft. Denn wer pflegt schon ohne Vorbehalte und Vorurteile geselligen Umgang mit einem Kriminalbeamten – und noch dazu mit einem aus der Mordkommission?
Wenn unsereiner eingeladen wird, dann doch meist nur aus Neugier, und man kann zehn zu eins wetten, daß spätestens nach dem Pudding oder dem zweiten Glas Wein irgendwann eine Frage kommt: «Sagen Sie mal: Ist das nicht ein schrecklicher Job, Herr Kommissar? Immerzu Leichen und so …?» oder: «Seien Sie nett und erzählen Sie mal, wenn’s Ihnen nichts ausmacht, Herr Kommissar: Was war denn Ihr aufregendster Fall?»
Gelegentlich habe ich auch schon den Verdacht gehabt, daß Leute mich als Alibi, richtiger: als Feigenblatt eingeladen haben. Damit die anderen Gäste den Eindruck gewinnen: «So schlimm kann es um Lehmanns nicht stehen, die hatten vorgestern sogar einen Kriminalbeamten auf ihrer Party. Das wird wohl ein Gerücht sein, daß sie kurz vor der Pleite sind, wie? Übrigens ’n ganz netter Mann. Na ja, Mordkommission, ich weiß ja nicht … bißchen unheimlich schon … ob ich so einen einladen würde? …» und so weiter.
Den Vertretern anderer, kaum weniger ungewöhnlicher Berufe geht das seltsamerweise nicht so, glaube ich.
Der erfolgreiche Chirurg, der renommierte Leichenbestatter, der tüchtige Schlachthofdirektor, der korrekte Leiter einer Strafanstalt – sie alle werden ohne Zögern in die sogenannten gutbürgerlichen Zirkel eingeladen, dort anerkannt, aufgenommen und zu den Honoratioren gerechnet. Sie dürfen mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, höheren Beamten, Immobilienmaklern und sogar Studienräten Brüderschaft trinken und Zötchen reißen – aber ein Kriminalbeamter, und noch dazu einer von der Mordkommission, hat da so seine Schwierigkeiten, obschon gerade Chirurgen, Immobilienmakler, Steuerberater, Rechtsanwälte und gelegentlich selbst höhere Beamte, inklusive Studienräte, unter Umständen manchmal mehr mit Kriminalität zu tun haben als einer wie ich.
Nun habe ich zwar keine allzu große Sehnsucht nach Klub-, Stammtisch- oder geselligen Abenden mit Chirurgen, Leichenbestattern, Rechtsanwälten und Steuerberatern – von Studienräten ganz zu schweigen –, und ich kann mir auch durchaus anderen Zeitvertreib vorstellen und verschaffen als Smalltalk über die beste Geldanlage, den besten Schneider, das beste Auto, die aufregendste Zweitfrau und so fort.
Aber es kam noch einiges andere hinzu, das mir die Eingewöhnung in der malerischen Stadt mühsam machte.
Am zweiten Grund war ich selber schuld. Ich hatte ja selbst in Hamburg den Wunsch geäußert, auf die freigewordene Stelle nach Lübeck versetzt zu werden, weil ich – neben der Lust auf neue Tapeten – gehofft und geglaubt hatte, mir würde mit der Erfüllung des Versetzungswunsches auch ein – viel wichtigerer – anderer Wunsch erfüllt werden. Doch der – viel wichtigere – andere Mensch, richtiger: die Hoffnung und der Glaube auf seine Erfüllung, hatten sich wenige Wochen nach der Versetzung als Flop erwiesen. Kurzum: die Dame, deretwegen ich in die berühmte Stadt an der Trave gezogen war, hatte mir einen Korb gegeben. Einen mächtigen Korb, einen mit Henkel, einen Korb, an dem ich schwer zu kauen, pardon, zu tragen hatte. Aber das ist ganz allein mein Bier.
Da saß ich also, hatte zwar einen höheren Dienstgrad, ein besseres Gehalt, eine wirklich angenehme und originelle Behausung mit schönem Blick, hatte nicht annähernd soviel zu tun wie früher in Hamburg – aber ich haderte mit dem Schicksal.
Zahnschmerzen wechselnder Heftigkeit plagten mich außerdem seit drei Wochen. Der Zahnarzt, bei dem ich in Behandlung war, hatte gleich beim ersten Besuch ein ernstes Gesicht gemacht und mir mitgeteilt, daß wir wohl eine ganze Weile miteinander zu tun haben würden. Das sei ja kein Gebiß, sondern ein Steinbruch – und zwar leider kein Granitsteinbruch, eher einer mit bröckeligem Muschelkalk oder Sandstein.
Verständlicherweise reagierte ich nicht übermäßig begeistert auf diese witzigen Eröffnungen des Dr. med. dent., zu dem ich auf Empfehlung mehrerer Kollegen gegangen war. Er hätte mir, dachte ich, das auch ein bißchen schonender beibringen können.
Psychologie ist jedoch nicht jedermanns Sache, und schon gar nicht die eines Maulklempners.
Also verdrängte ich meine spontane Antipathie gegen den Herrn und überließ mich seinen – zugegebenermaßen sehr tüchtigen – Händen. Ich verdrängte meine Abneigung nicht ohne Mühe, denn der kleine, rundum feiste, schütter-silberhaarige Doktor ging nicht nur mit seinen Patienten, bzw. mit der Psyche seiner Patienten so rauhbeinig um, sondern er grobschte auch seine Sprechstundenhilfe an wie ein spanischer Bauer sein Maultier.
«Sperr die Augen auf, Lilli!» schimpfte er zum Beispiel mit einer Polterstimme, die zu seiner Haut-, Augen- und Haarfarbe paßte wie das Nageln eines kalten Dieselmotors zu Hummelsummen. Oder er sagte: «Bißchen fix! Schlaf nicht!» oder «Watte, Lilli, zum Donner noch mal!» und so weiter.
Und das Mädchen, das ich von meinem Folterstuhl aus nur gelegentlich flüchtig aus den Augenwinkeln sehen konnte, ließ sich diese Tonart widerspruchslos gefallen.
Na ja – nicht mein Problem!
Doch der Doktor arbeitete gut, schnell, geschickt, relativ schmerzlos und sicher, und er arbeitete ohne das Medizinmänner-Brimborium, das manche Herren aus dieser Branche an sich haben. Da spielte meine Abneigung also keine große Rolle.
Das alles: Unerwartete Isolation, Zahnschmerzen und enttäuschte Hoffnung hob natürlich meine Stimmung nicht. Und an diesem Sonnabendvormittag war sie ganz besonders tief im Keller, weil der neue Warmwasserboiler plötzlich nicht mehr funktionierte und ich jählings in einem Eisstrahl gestanden hatte, als ich gerade von Kopf bis Knie eingeseift gewesen war.
Es gibt solche Tage, an denen zu inneren Nöten auch noch äußere Unbill kommt: ein abgerissener Knopf, ein Eigelbfleck auf dem frischen Hemd, ein verbranntes Toastbrot, überkochende Milch und lauter solche Widerwärtigkeiten.
Dann flüchtet man sich am besten gleich wieder ins Bett, zieht die Decke über den Kopf und läßt die Unglückssträhne vorübergehen.
Dazu war ich gerade entschlossen, da klingelte das Telefon.
«Ja …?» sagte ich in die Sprechmuschel, weil es uns aus irgendwelchen Anti-Terroristen-Sicherheitsgründen amtlich untersagt ist, unseren Namen zu nennen, was ich zwar für albern halte … aber na!
Mein «Ja …?» klang wie das Röhren eines älteren Damhirsches im Herbst, weil es das erste Wort war, das ich an diesem Morgen sprach. Ich pflege noch nicht mit mir selbst zu reden.
«Herr Klipp? Sind Sie ’s?» fragte mich eine Männerstimme ins Ohr, deren Inhaber hörbar von meinem Brumm-Krächzlaut irritiert war.
Ich räusperte mich.
«Das ist richtig!» erwiderte ich. «Und mit wem habe ich das Vergnügen, bitte?»
«Ach so, ja … Verzeihung», sagte die Stimme fröhlich. «Hier Zentrale, Meisel, ich verbinde … Ob’s allerdings ein Vergnügen wird – das kann ich nicht sagen.»
Ehe ich den morgendlich-dynamischen Frohsinn mit einem Anranzer dämpfen konnte, knackte es in der Leitung.
Dann meldete sich der Kollege Steinhauer, der überhaupt nicht so aussieht. Er müßte ‹Breirührer› heißen, so weich und milde, wie der in die Welt guckt. Aber er hat als Kriminalbeamter erstaunliche Erfolge mit seinem milden Äußeren.
«Tut mir ja wirklich aufrichtig leid, Kollege Klipp, daß ich Sie am heiligen Sonnabendmorgen stören muß», sagte er, und es klang so, als ob es ihm wirklich aufrichtig leid täte – obwohl das sehr unwahrscheinlich war. «Aber wir haben soeben einen Leichenfund gemeldet bekommen. Und die Kollegen Reese und Badekow sind beide unterwegs. Der eine nach Timmendorf und der andere nach Schwartau. Zwei Raubüberfälle. Möglicherweise eine Bande. Ich muß in der Dienststelle Stallwache halten – ja, und da hat der Chef eben angeordnet, Sie möchten sich der Sache annehmen und das ansehen. Eine tote Frau …»
«Okay», sagte ich, kam mir sehr diszipliniert vor, weil ich nicht ‹Scheiße!› gesagt hatte, und fragte: «Wo?»
Er beschrieb mir den Fundort, und da ich nicht wußte, wo das Gelände der Viehzuchtgenossenschaft lag, erklärte er mir den Weg dorthin.
«Den diensthabenden Arzt verständige ich gleich», sagte er. «Wenn ’s was Ernstes ist, rufen Sie an, Herr Kollege Klipp, ja! Damit ich Ihnen die Spurensicherung und so weiter hinschicke!»
«Heißen Dank», gab ich unwirsch zurück. «Darauf wäre ich nach zweiundzwanzig Jahren Praxis in dieser Branche von allein bestimmt nicht gekommen!»
«Hilfe!» rief er. «Sind Sie etwas schlechter Laune?»