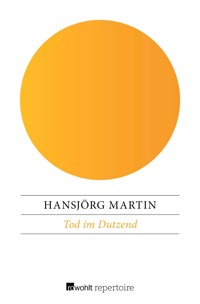9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Herr Klipp, o Gott … o Gott … o Gott, Herr Klipp!» stöhnte sie und schloß die Augen. Ich war bereit, sie aufzufangen, falls sie ohnmächtig würde. Aber sie wurde nur weich in den Knien, setzte sich auf eine Treppenstufe und holte tief Luft. «Was ist denn, Frau Drojahn», sagte ich. «Nun beruhigen Sie sich doch!» Ich klopfte ihr leise den Arm. «Der Herr Brocksiepen … ist … er liegt … in seinem Zimmer … o Gott … o Gott … o Gott!» Wenn die biedere Inhaberin einer Nordseeinsel-Familienpension zwischen Frühstück und Mittagessen in einem ihrer Fremdenzimmer einen erstochenen Playboy findet, kann man auch keine sehr klare Lagemeldung von ihr erwarten. Dabei hat sie Glück: Herr Klipp, der sich als ‹Fachlehrer› vorgestellt hat, ist von Beruf Kriminalbeamter. Leo Klipp wiederum hat Pech – die zuständigen Polizeidienststellen sitzen auf dem Festland und können erst am späten Abend eintreffen; so muß er sich plötzlich in seinem Urlaub mit sieben Verdächtigen beschäftigen – nein, es sind nur sechs; einem sehr netten Mädchen kann er selber ein Alibi für die Tatzeit ausstellen, wenn auch ein Alibi sehr persönlicher Natur …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Einer fehlt beim Kurkonzert
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Herr Klipp, o Gott … o Gott … o Gott, Herr Klipp!» stöhnte sie und schloß die Augen.
Ich war bereit, sie aufzufangen, falls sie ohnmächtig würde. Aber sie wurde nur weich in den Knien, setzte sich auf eine Treppenstufe und holte tief Luft.
«Was ist denn, Frau Drojahn», sagte ich. «Nun beruhigen Sie sich doch!» Ich klopfte ihr leise den Arm.
«Der Herr Brocksiepen … ist … er liegt … in seinem Zimmer … o Gott … o Gott … o Gott!»
Wenn die biedere Inhaberin einer Nordseeinsel-Familienpension zwischen Frühstück und Mittagessen in einem ihrer Fremdenzimmer einen erstochenen Playboy findet, kann man auch keine sehr klare Lagemeldung von ihr erwarten. Dabei hat sie Glück: Herr Klipp, der sich als ‹Fachlehrer› vorgestellt hat, ist von Beruf Kriminalbeamter. Leo Klipp wiederum hat Pech – die zuständigen Polizeidienststellen sitzen auf dem Festland und können erst am späten Abend eintreffen; so muß er sich plötzlich in seinem Urlaub mit sieben Verdächtigen beschäftigen – nein, es sind nur sechs; einem sehr netten Mädchen kann er selber ein Alibi für die Tatzeit ausstellen, wenn auch ein Alibi sehr persönlicher Natur …
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Harald Brocksiepen
findet ein vorzeitiges Ende
Frau Drojahn
findet die Leiche
finden sich plötzlich ihres Mündels beraubt
Gesine
findet im richtigen Augenblick keinen Mut
Dr. Eisenreich
findet im falschen Augenblick ein Messer
Sylvia Eisenreich
findet einen schlafenden Liebhaber
Uschi Marckhoff
findet etwas in einem Papierkorb
Dr. Knopf
findet den Unschuldsbeweis für einen geständigen Mörder
Obermeister Maybom
findet das alles schrecklich aufregend
Oberkommissar Klipp
findet nacheinander drei Täter für ein und denselben Mord
Für W.W.
Die Mole ist etwa achtzig Meter breit und ragt vom Festland aus ungefähr vierhundert Meter ins Wattenmeer hinaus.
Backbord liegen die schneeweiß gestrichenen Schiffe, die Lebensmittel, Spirituosen, Tanzkapellen, Kellner und Kurgäste zu den Inseln bringen. Rechts schaukeln die bunten Kutter der Krabbenfischer, an deren Bug friesische Frauennamen gemalt sind, manchmal – der Unterscheidung wegen – mit römischen Ziffern dahinter: WIEBKEIV oder THEDAII.
Auf der Mole steht ein flaches Ziegelhaus, in dem das Reedereibüro ist. An seine Südwand sind drei oder vier Kioske geklebt. Da kann man Ansichtspostkarten kaufen, Kekse, Zeitungen, Muschelkästen, getrocknete Seesterne, Sonnenöl und Papiertaschentücher.
Es riecht nach Salzwasser, Schlick, Teer und Ölfarbe …
Ich fuhr mein Auto in die NORDSEEGARAGE, mußte die Hälfte der Vier-Wochen-Miete im voraus bezahlen, tätschelte ihm abschiednehmend den Rücken und schleppte meine Koffer zum Schiff, das mich auf die Insel Langeney bringen sollte. Das Schiff war noch leer. Ein Mann lud Milchkannen ab. Auf dem Vorderdeck im Schatten des Schornsteins saßen zwei andere, tranken Bier aus der Flasche und erwiderten meinen Gruß mit einem langsamen Nicken. Der eine verstieg sich sogar dazu, mit zwei Fingern an die Mütze zu tippen. Ich zog mir einen der Deckstühle an eine windgeschützte, sonnige Stelle und machte mir’s gemütlich. In einer guten Stunde, bei auflaufendem Wasser, würde die dreistündige Überfahrt losgehen. Ich war neugierig auf die Insel, auf die Pension, in der ich Quartier bestellt hatte, auf die vier Urlaubswochen, die vor mir lagen. Ich hatte vor, mich gründlich zu erholen, zu faulenzen, zu schlafen, zu lesen – Aufregungen aus dem Wege zu gehen. Sollten die Aufregungen zweibeinig, langhaarig und hübsch gewachsen sein, so war ich nicht ganz so fest entschlossen, sie zu meiden.
Man soll sich da nicht festlegen. Menschen mit allzu starren Prinzipien werden ohnehin leicht unsympathisch.
Ich lag an Deck, malte mir aus, was mich erwartete, und freute mich darauf. Wenn ich geahnt hätte, was mich wirklich erwartete, wäre meine Vorfreude gewiß geringer gewesen. Abgesehen von der Begegnung mit Uschi waren das außerordentlich unerwünschte Aufregungen …
«Doch wer weiß, was in der Zeiten Hintergrunde schlummert», pflegte meiner Mutter Mutter mit Schiller zu sagen.
Seltsamerweise muß ich, gerade wenn ich mich der Ereignisse auf Langeney erinnere, immer an die alte Dame und ihre Sprichwörterweisheiten denken. Bei ihr verging keine Stunde ohne Zitat. Das Repertoire, über das sie verfügte, reichte vom Alten Testament über den sogenannten Volksmund bis zur Berliner Schnoddrigkeit, von «Auge um Auge …» über «Sich regen bringt Segen» bis «Uff mir Schiefertafel» («Auf mich können Sie rechnen!») …
Ich wußte noch nichts von dem Toten oben im zweiten Stock der Inselpension DÜNENFRIEDEN, als wir am Vormittag meines fünften Urlaubstages in der Veranda beisammensaßen und von Messerwerfern sprachen.
Wenn meiner Mutter Mutter noch lebte, und ich würde ihr diese Begebenheit berichten, käme bestimmt postwendend von ihr die Weisheit: «Im Hause des Gehängten redet man nicht vom Strick!» – Obschon dies auf jene Situation nur bedingt zutreffen würde.
Denn wir alle wußten nichts – halt, doch, natürlich: Drei wußten schon, daß da ein Toter lag. So tot wie man nur sein kann mit einem Brotmesser bis zum Griff im Herzen. Aber die drei ließen sich nichts anmerken. Wie gut sich auch ungeübte Menschen verstellen können, wenn es brenzlig ist.
Doch ich greife vor – und das hat gerade bei dieser Geschichte keinen Sinn.
«Gut Ding will Weile haben», würde meine Großmutter sagen.
Die Musiker machten gerade Pause, als ich am Vormittag nach meiner Ankunft zum Kurpark kam. Sie hatten ihre Instrumente auf die Stühle gelegt, standen im Schatten der Holunderbüsche neben der Konzertmuschel und rauchten. Sie standen in ihren schwarzen Anzügen zwischen dem vielen Grün wie Krähen am Rande eines Saatfeldes. Der erste Teil des vormittäglichen Kurkonzertes war vorbei.
Ich warf einen Blick auf den Programmzettel, sah, daß der zweite Teil des Konzerts meine schlimmsten Erwartungen erfüllte, und überlegte, ob ich die Musik über mich ergehen lassen – oder ob ich mich im Orte gleich heute morgen nach einer Kneipe umsehen sollte, die ich zum Hauptquartier im Kampf gegen Ferienlangeweile ernennen konnte. Aber ich ließ mich von meiner Trägheit treiben, verschob die Hauptquartiersuche auf später und ließ mich am Rande der Promenade, etwas außerhalb der direkten Konzertmuschelschallwellen, auf einer Bank nieder, auf der eine ältere Dame saß und Pfefferminzdragees kaute. Zwischen dieser Bank und dem Promenadenweg wuchsen mehrere niedrige Rhododendronbüsche Schulter an Schulter. Ich konnte also die Füße der Vorüberpromenierenden nicht sehen. Dadurch entstand – von der Gleichmäßigkeit des allgemeinen Schrittrhythmus unterstützt – der Eindruck, die Menschen stünden auf einem Fließband, das sie gemächlich um die Musikmuschel transportiere. Das sah sehr komisch aus.
Das Orchester hatte sich wieder versammelt. Ein langhaariger dünner Dirigent klopfte an sein Pult. Die Streicher hoben ihre Geigen ans Kinn, die Bläser ihre Fagotte und Flöten an den Mund – los ging’s.
Als das erste Stück vorüber war, sagte die mollige Pfefferminzdame an meiner Seite: «Sie wohnen auch im ‹Dünenfrieden›, nicht wahr?»
Ich erschrak ein bißchen, denn ich war auf die Anrede nicht gefaßt gewesen. Zudem hatte sie eine Stimme, die an 45er Schallplatten denken ließ, die einer mit 78 Umdrehungen laufen läßt. Und drittens war sie – die Stimme zweifellos und die Dame damit auch – aus Sachsen. Tiefstes Sachsen – irgendwo zwischen Wurzen, Glauchau und Probstheida. Schon das Wort ‹Diehnfrieden› rief in mir die schreckliche Ahnung ungezählter Stunden trauter Geselligkeit hervor, die jeder auf sich nimmt, der dem steten Kontaktbegehren jenes Stammes nachgibt.
«Ja», sagte ich trotzdem, deutete im Sitzen eine Verbeugung an und lüftete noch einmal meinen Hut, wie ich’s beim Hinsetzen vorhin schon getan hatte.
«Ich wohne nämlich auch dort!» verkündete sie … sonst wäre sie dran erstickt.
Ich sah sie an, lächelte verbindlich und nickte. Sie hatte ein kolossales Gesicht, dessen Haut ins Gelbe – unter den Augen und in den tiefen Tälern der Fettwülste sogar ins Olivgrüne spielte. Ihre Augen selbst waren klein und schwarz und flink. Ihr Mund war groß, wabblig, von unbestimmbarer Form und imponierend beweglich. Vom Gebirge ihres Busens glitzerte eine bonbonrote Glaskette mit dem riesigen Ring an ihrer linken Hand um die Wette.
Der Ring siegte, denn er bestand aus richtigem rotem Gold und einem noch richtigeren phantastischen Brillanten.
Die Dame griff zu der Schachtel neben sich und hielt sie mir vor’s Gesicht: «Bitte, Herr Klipp», sagte sie, «bedienen Sie sich!»
Ich bin – das bringt schon mein Beruf mit sich, von dem noch die Rede sein wird – nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Aber jetzt und hier war ich so verwirrt, daß ich tatsächlich zugriff, mich stammelnd bedankte und ein Pfefferminzdragee in den Mund steckte, obschon ich die Dinger nicht ausstehen kann.
Die Dame nutzte meine Verwirrung und eine Pause im Bemühen der Musikanten: «Ja, ich weiß», sagte sie lächelnd, «Sie sind gestern abend eingetroffen! Aus Hamburg. Und Sie heißen Klipp und sind Lehrer!» Nun lachte sie und freute sich über meine Verblüffung. «Man muß sich doch orientieren», schmunzelte sie.
Es klang wie ‹oochschendieren›, und ich brauchte drei Sekunden, um zu verstehen, was gemeint war. Dazu drohte sie mir aus unerfindlichen Gründen mit ihrem Zeigefinger.
«Lehrer sind Sie, nicht wahr?»
«Ja, Fachlehrer», sagte ich eingeschüchtert und hätte beinahe noch ein zweites Mal in die angebotene Schachtel gegriffen.
Die Musiker verschafften mir eine Atempause, indem sie so vehement fiedelten und bliesen, daß auch die Dame nicht dagegen ankam. Aber dann kam wieder was Leises, mit zartem Glöckchengebimmel und Flötengetriller, und als ob die Dame meine Fluchtgedanken geahnt hätte, legte sie mir die Hand mit dem Fünfkarätigen auf den Unterarm.
«Mein Mann war auch Lehrer», teilte sie mit. «Er ist vor fünf Jahren gestorben. Das Herz. Er ist auf Magen behandelt worden – die Ärzte, na, wissen Sie!» Sie schob ihre lila Unterlippe vor und schnaubte verächtlich.
Plötzlich wich ihre Verachtung für die Ärzteschaft einem gespannten Gesichtsausdruck. Sie tätschelte aufgeregt meinen Arm und wies mit dem gewaltigen Kinn zur Promenade. «Kennen Sie die dort?» zischelte sie.
«Wen bitte?» fragte ich und versuchte ihrem Blick zu folgen.
«Die zwei Damen in Gelb dort!»
Ich sah jetzt zwei ältere Frauen in gleichen neapelgelben Kostümen, die Arm in Arm hinter den Rhododendronbüschen vorbeiglitten. Sie waren das ganze Gegenteil meiner voluminösen Nachbarin, machten einen kultivierten, scheuen Eindruck, der von ihren weißen, gepflegten Frisuren und von der Behutsamkeit ihrer Bewegungen noch verstärkt wurde.
«Das sind die Schwestern Brocksiepen», erklärte die zutrauliche Dame an meiner Seite. Sie sprach sehr schnell, um die Konzertpause auch richtig auszunutzen. «Die linke, Agathe, heißt zwar anders, denn sie ist verwitwet, aber zusammen laufen sie nur unter dem Namen Brocksiepen. Agathe ist die Ältere, man sieht’s ja kaum. Sie sind auch nur zwei Jahre auseinander. Das macht dann nichts mehr – über die Mitte Sechzig … die andere, rechts die, ist unverheiratet. Läßt sich ‹Fräulein› titulieren – na, das ist Geschmackssache. Sie haben ihren Neffen mit – warten Sie –, nein, ich sehe ihn im Augenblick nicht. Aber da ist er, der fehlt nie beim Kurkonzert. Er ist zwanzig, ein bildhübscher Bengel. Studiert in Bonn. Sehr vermögend. Die Fräuleins, oder richtiger die Tanten, sind beide Vormund. Denn der Vater des Jungen ist vor drei Jahren kurz nach seiner Frau gestorben. Das war eine tragische Sache. Ja! Erst sah es sogar aus, als ob da ein Verbrechen – Mord und so –, aber dann hat die Polizei doch Selbstmord festgestellt …»
Ihre schwarzen Augen glitzerten fast wollüstig, als sie mir das alles mit flatternden Lippen erzählte.
Ich erinnerte mich an den Fall Brocksiepen. Er hatte seinerzeit einiges Aufsehen erregt. Brocksiepen – hieß er nicht Alexander? … na, egal – war mit einem Messer im Herzen aufgefunden worden. Er hinterließ einen Sohn von damals siebzehn, einen Brief, aus dem das Motiv zum Selbstmord deutlich hervorging und einen hübschen Haufen Geld.
Wir hatten im Unterricht sogar mal Dias vorgeführt, die eine Rekonstruktion jenes ungewöhnlichen Selbstmordes zeigten.
Ich bin nämlich – das nebenbei – Lehrer an der Polizeischule in Hamburg und bilde Kriminalbeamte aus. Meine Fächer: ‹Spurensicherung› und ‹Verhörtaktik›.
Aber – dafür bitte ich um Verständnis – ich nenne mich im Privatleben stets nur ‹Fachlehrer› und nicht ‹Kriminaloberkommissar›. Diese sowieso zu lange Bezeichnung ist wie eine schwarze Augenklappe. Sie macht alle Menschen verrückt vor Neugier, was wohl dahinter los ist, warum und wieso … und «Aber nein, wie interessant»… und «Sagen Sie doch mal bitte, wie ist das mit den Verbrechern …» und so weiter und so weiter …
So, so, das waren also die Schwestern Brocksiepen. Sie interessierten mich nicht für fünf Pfennig. Jedenfalls noch nicht zu diesem Zeitpunkt, da ich ergeben der Kurkapelle lauschte und den Informationen der besitzergreifenden Sächsin an meiner Seite und verzweifelt durch die Nase atmete, weil ein Atmen durch den Mund den abscheulichen Pfefferminzgeschmack verstärkte, den ich auf der Zunge hatte.
‹Ein Bier!› dachte ich inbrünstig. Aber es gab kein Entrinnen. Die Kurmusik verschaffte mir vorübergehende Erholung. Doch mittendrin, gerade an einer Fortissimo-Blechbläser-Pauken-Becken-Explosion schubste und schüttelte mich die Dame und wies auf die vorübergleitende Menge. Ich nickte freundlich. Sie merkte jedoch, daß ich nicht sah, was ich sehen sollte. Deshalb rutschte sie ganz dicht an mich heran, bettete ungeniert meinen Oberarm in das tiefe Tal ihres Wogebusens und schrie mir, intensive Minzdüfte ausströmend, ins Ohr, daß der junge Mann dort – da, rechts neben der blonden Frau mit dem grünen Kleid – ja, der dort! –, der junge Brocksiepen sei.
Er sah älter aus als zwanzig. Ich hätte ihn sogar auf dreißig geschätzt. Aber er sah sehr gut aus. Groß, breitschultrig, braungebrannt, ging er mit selbstsicheren, lässigen Bewegungen, die denen junger Negersportler glichen, neben der Blonden her.
Ich habe an sich eine heftige Aversion gegen so sehr schöne Männer und höre und verbreite gern alle möglichen abwertenden Urteile über sie: daß sie schlechte Liebhaber, daß sie langweilige Ehemänner, daß sie unverbesserliche Egoisten wären – und so weiter. Aber ich bin gar nicht sicher, wieviel von meiner Abneigung auf das Konto Neid oder Minderwertigkeitskomplex geht … denn ich selbst bin, was Wohlgestalt angeht, nicht sonderlich gesegnet. Mich tröstet, daß mir schon einige Frauen gesagt haben, sie fänden interessante Männer unvergleichbar liebenswerter als schöne. Und eine hat gesagt, ich sei interessant …
Dieser junge Mann jedoch, Harald Brocksiepen, sah so gut aus, daß ich die Frau an seiner Seite, die hingerissen zu ihm aufsah, verstehen konnte.
Es war eine sehr aparte Frau um die Dreißig. Ihr Haar, das kurzgeschnitten den reizenden Kopf krönte, glänzte wie poliertes Messing. Das Jerseykleid, giftgrün und leuchtend, spannte sich über einen der hübschesten Popos, den ich je gesehen hatte.
Es gelang mir, meinen Arm aus dem sächsischen Gebirge zu befreien und einige Zentimeter Abstand zu gewinnen. Zu Hilfe kam mir dabei das Kurorchester, das Walzertakte intonierte und damit den Oberkörper meiner Nachbarin in Schwingungen versetzte. Aber sie war wiederum nicht so walzerselig, daß sie darüber vergessen hatte, mich mit Namen, Daten und Charakteranalysen der Prominierenden zu versorgen. Ohne es zu wollen, erfuhr ich also, daß die attraktive Blondine eine Frau Eisenreich sei, aus Münster. Den dazugehörigen Gemahl, einen Doktor, bekam ich gezeigt und geschildert …«So ein feiner, stiller Mensch», der zehn Schritte hinter seiner Frau im großen Kreis glitt und lang, dünn, düster, mit schwarzen, langen Haaren eher einem Zauberkünstler glich als einem Privatdozenten für Literaturgeschichte – «Liddreduhr», sagte meine Informantin. Ich erfuhr, daß Frau Eisenreich steinreich von Hause aus sei, sah mit geringer Anteilnahme die zwei Kinder des Ehepaares und bemerkte voller Wohlgefallen das Kindermädchen der Familie, ein süßes, wuschelköpfiges Wesen mit ein wenig schlacksigen Bewegungen und einer Figur, die noch viel hübscher anzusehen war als die grünumspannte der Herrin.
Plötzlich – zwischen einem Harfensolo und einem großen Finale, fiel meinem Nachrichtenbüro ein, sich vorzustellen: «Wulze!» sagte sie ohne Vorbereitung, machte eine Art Verbeugung und reichte mir die Hand. Nun wußte ich es.
«Es hat mich sehr gefreut, gnädige Frau!» verkündete ich wild entschlossen, stand auf, schüttelte die dargebotene Hand herzlich und heftig, zog wieder einmal den Hut und ging schnell davon. Den Vornamen wollte ich nicht mehr wissen. Sie würde Emma heißen – obschon sie nicht wie eine Möwe aussah. Vornamen sind immer unpassend. Ich heiße Leo.
Ein sicherer Instinkt führte mich um die Ecke des Kurhauses zielbewußt in eine kleine Straße. Dort sah ich ein Schild mit der Aufschrift STÖRTEBEKERKRUG.
Ich brauchte zwei halbe Liter Bier, drei jener wundervollen klaren Schnäpse, die unter Kennern ‹Friesischer Landwein› genannt werden und eine dreiviertel Stunde, um mich zu erholen. Im dort ausliegenden Badekurier fand ich alle soeben gehörten Namen wieder und entdeckte, daß zu den zehn Gästen der Pension DÜNENFRIEDEN ein Fräulein Ursula Marckhoff gehörte, wohnhaft in Münster. Woraus ich messerscharf schloß, dies sei das entzückende Kindermädchen der Literarhistorikerfamilie. Ich kam zu dem Attribut entzückend, obschon ich die Beine des Mädchens noch nicht gesehen hatte. Bei den Beinen und einem vierten friesischen Landwein angelangt, sagte ich strafend «Leo!» zu mir selber und wiederholte: «Leo, kusch!» Und ich wiederholte das mit betontem Ausrufezeichen.
Während des Mittagessens ärgerte ich mich, meinen Platz bei der Ankunft gestern abend in einer Nische gewählt zu haben, denn ich hatte so keine Chance, von dem entzückenden Mädchen namens Ursula mehr als den linken Arm zu sehen. Gewiß, der Arm war – noch dazu so sommerlich unbekleidet und braun gebrannt – reizend, und er versprach hübsche Fortsetzungen herzwärts. Aber er allein war zu wenig als Blickpunkt für die halbe Stunde zwischen Suppe und Apfelmus.
Es geschah nichts an diesem und gar nichts am nächsten Tag. Ich war doch ziemlich angeschlagen nach elf Monaten Umgang mit Leuten, die von mir in die Geheimnisse des Umgangs mit Verbrechern eingeweiht werden wollten. Also verschlief ich annähernd zwanzig von vierundvierzig ereignislosen Stunden, bewunderte während fünf Mahlzeiten den hübschen Arm der entzückenden Ursula und vertrödelte die Zeit. Es gelang mir, mit lächelnden Grüßen der Frau Wulze zu entgehen. Es gelang mir nicht, weder mit Lächeln noch mit Grüßen, das Mädchen Ursula kennenzulernen.
«Sie gestatten?» fragte ich am Vormittag des dritten Tages und nahm, als der Mann mit dem großen Strohhut nickte, neben ihm auf der Bank Platz. Mein Urlaub spielte sich bisher im Bett, am Eßtisch der Pension, an der Störtebeker-Theke und – auf Promenadenbänken ab. Im Wasser war ich noch nicht gewesen. Ich hatte es nicht so eilig mit dem Sport.
Diesmal war es eine Bank an der Strandpromenade. Es war sonnig heute und der stete Wind blies relativ mild aus Osten. Es gab viel zu sehen. Ich legte mein Buch zwischen den Strohhutinhaber und mich auf die Bank. Es war ein Band Dickens, Die Pickwickier – eines der herrlichen weitschweifigen Bücher, die man nur im Urlaub oder nach einer Grippe im Bett mit Genuß lesen kann.
Der Mann neben mir beugte sich etwas nach rechts, studierte den Titel und hob den Kopf, um mich anzusehen. Es war der Doktor mit dem eisernen Namen – Steineisen oder Eisenhut … Ich hatte ihn unter seiner Strohkrempe nicht erkannt.
«Mögen Sie Dickens?» fragte er mit einer dunklen, ein wenig brüchigen Stimme.
«Wenn ich Zeit für ihn habe, mag ich ihn gern», erwiderte ich.
«Ich habe mit einer Arbeit über ihn promoviert. Dickens und die Geburt der sozialistischen Literatur …» Er schwieg. «Bitte, entschuldigen Sie, ich möchte nicht aufdringlich …» fuhr er fort.
«Aber nein!» unterbrach ich.
«Eisenreich!» sagte er.
«Klipp!» sagte ich. «Angenehm! Im übrigen wohnen wir unterm gleichen Dach.»
«Oh!» Er war verdutzt. «Aber ich habe Sie noch nicht …»
«Nein», sagte ich, «das glaube ich. Ich sitze im Schmollwinkel. Außerdem bin ich erst vor kurzem angekommen und habe die meiste Zeit geschlafen!»
Es entstand eine Verlegenheitspause. Ich griff zum Allheilmittel, kramte meine Zigaretten heraus und bot ihm eine an. Er hatte sehr schmale, nervige Hände. Zwei Streichhölzer blies uns der Wind aus. Erst als wir näher zusammenrückten, glückte es, im Schatten seines großen Hutes die Glimmstengel in Brand zu setzen.
«Ich bin immer ein bißchen froh», sagte er, «wenn ich mal jemanden Dickens lesen sehe. Das ist selten heutzutage. Meine Studenten lesen ihn, weil es zum Pensum gehört. Aber sonst …» Er hob resignierend die Schultern.
«Ja», sagte ich, «die Zeit …»
Ich war nicht so recht bei der Sache. Es gingen viele hübsche und hübsch zurechtgemachte Frauen vorüber, und fünfzig Meter entfernt hatte ich das Mädchen Ursula entdeckt, das am Wasser mit den Kindern Ball spielte. Auch der Dickens-Doktor schien mir im Augenblick nicht sonderlich interessiert an der Geburt der sozialen Literatur. Er sog nervös an der Zigarette und guckte immerzu zum Strand hinunter. Wenn er mir wirklich mal für drei, vier Sekunden den Blick zugewandt hatte, so war sein Kopf doch immer wieder in die Richtung geschnellt, in der ihn irgendwas beunruhigte. Es war eine seltsame Kälte in seinen Augen unter dem Hut.
Als ich entdeckte, was er beobachtete, wurde mir klar, daß ihm Dickens, Sozialismus, Literatur und überhaupt die ganze Welt bis auf einen Punkt völlig schnurz war: Vor einem rot-weiß gestreiften Strandkorb saß seine Angetraute in einem Badeanzug, dessen Stoffmenge kaum für den linken Handschuh eines Liliputaners gereicht haben würde. Giftgrün – dies war wohl ihre Lieblingsfarbe – bedeckten die drei Dreiecke, von schwarzen Kordeln gehalten, das Allernotwendigste. Vor den grünen Stoffpröbchen auf der reizvollen braungebrannten Damenhaut hockte im Schneidersitz der schöne Harald Brocksiepen. Er trug auf seinem klassischen Haupt ein kleines, rundes Mützchen mit einem dicken roten Pompon, hatte sich über die breiten Schultern ein weißes Flauschhemd gehängt, dessen Ärmel unter seinem Kinn zu einem dicken Knoten geschlungen waren, und balancierte eine große Sonnenbrille auf seiner geraden Nase.
Die zwei saßen viel zu weit entfernt, als daß auf unserer Bank ein Wort ihres Gesprächs zu verstehen gewesen wäre. Aber was sich da an Gespreize, Geziere und Gehabe tat, war geeignet, Unruhe zu stiften. Wie sollte also der Herr Eisen …-dings nicht böse werden? Aber warum ging er nicht einfach dazwischen? Scheute er den Wettbewerb mit Schön Harald? Weil der breitere Schultern hatte? Wenn meine Frau so auf Teufelkommraus mit solch einem Knaben so turteln würde – was täte ich da? Würde ich mit finsterem Gesicht von weitem zuschauen? Ginge ich hin und böte Ohrfeigen an? Wem? Beiden? – Und wenn mich der Bursche dann verhaute, vor den Augen meiner Frau vertrimmte – was war dann gewonnen?
Ein kompliziertes Problem …
Vorläufig berührte es mich ja mehr aus der Sicht des Zuschauers, denn mein Ehehafen war noch nicht gebaggert. Ich segelte noch auf offenem Meer, auf Freibeuterei sozusagen. Außerdem bildete ich mir ein, so was von Problemen würde sich mir nie stellen.
Vielleicht lag es ja am Doktor Reizenstein – oder Eisenbart, verflixt, ich konnte den Namen nicht behalten – selber, daß er hier auf Fernsicht saß! Konnte doch sein, er versäumte über seinen Büchern hie und da mal im Buch seiner Ehe zu blättern! – Dann wäre es ja nicht verwunderlich, wenn die Teilhaberin infolge zu geringer Dividende ihr Kapital woanders anlegte. Und sie hatte ja allerlei Kapital. Ihre unverschleierten Bilanzen wiesen das deutlich aus.