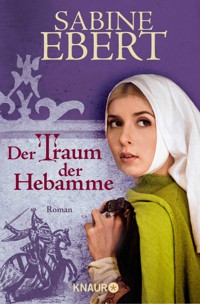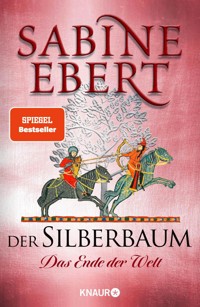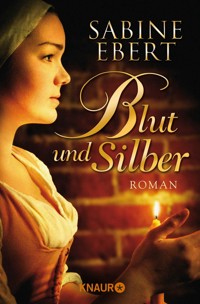
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Darf man sich seinem König widersetzen? In ihrem historischen Roman »Blut und Silber« lässt Bestseller-Autorin Sabine Ebert das Mittelalter in Freiberg lebendig werden Deutschland im Hoch-Mittelalter 1296: König Adolf von Nassau setzt eine gewaltige Streitmacht gegen Freiberg in Bewegung, um die reiche Silberstadt in die Knie zu zwingen. Unter den Bürgern entbrennt ein heftiger Streit: Dürfen sie sich ihrem König widersetzen? Oder sollen sie die gewalttätigen Horden einlassen? Zu denen, die die Stadt verteidigen wollen, gehört auch die junge Änne, eine Nachfahrin der Hebamme Marthe und des Ritters Christian. Entsetzt muss sie miterleben, wie Freiberg blutig erobert wird – durch Verrat! Unter großen Opfern schaffen es die Verteidiger Freibergs, die Burg der Stadt als letzte Bastion zu halten. Aufopferungsvoll kümmert Änne sich um die Verwundeten und kommt dabei auch Markus näher, dem jungen Hauptmann der Wache. Doch schließlich bleibt den Belagerten keine Wahl, als sich dem Heer König Adolfs zu ergeben. Markus muss fliehen und Änne im besetzten Freiberg zurücklassen … Sabine Ebert, Bestseller-Autorin der Hebammen-Saga, ist eine Garantin für akribisch recherchierte und hochspannend erzählte historische Romane. Der Kampf um Freiberg im Mittelalter war nicht nur schicksalhaft für die Bürger der Silberstadt, sondern auch für die Mark Meißen, das Haus Wettin und letztlich die politische Ordnung im künftigen Deutschland. Wer gerne Mittelalter-Romane liest, wird auch von Sabine Eberts historischen Romanen um die Hebamme Marthe und von der Bestseller-Serie »Schwert und Krone« über den Staufer-Kaiser Friedrich Barbarossa begeistert sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Sabine Ebert
Blut und Silber
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neue große historische Bestseller der Autorin der »Hebammen-Romane«!
Deutschland 1296: König Adolf von Nassau setzt eine gewaltige Streitmacht gegen Freiberg in Bewegung, um die reiche Silberstadt in die Knie zu zwingen. Unter den Bürgern entbrennt ein heftiger Streit: Dürfen sie sich ihrem König widersetzen? Zu den Freibergern, die die belagerte Stadt mutig verteidigen, gehören auch Änne, eine Nachfahrin der Hebamme Marthe, und die Gauklerin Sibylla. Entsetzt müssen sie miterleben, wie Freiberg blutig erobert wird – durch Verrat!
Inhaltsübersicht
DRAMATIS PERSONAE
PROLOG
ERSTER TEIL
Altenburg, Dezember 1295
Freiberg, Januar 1296
Im Dunkel der Nacht
Verstärkung
Das Ultimatum des Königs
Die Feuernacht
Geständnisse
Der zweite Angriff
Streit
Dunkles Omen
Der Durchschlupf
Der Sturm
Die geheime Order
Die Befehle des Königs
Sechs Tage
Die sechzig
Die Entscheidung
Die Flucht
ZWEITER TEIL
1. Juni 1297, einige Meilen vor Prag
Pfingsten 1297 in Prag
Der rechtmäßige Markgraf von Meißen
Das Treffen
Die Rückkehr
Das Wiedersehen
Im Verborgenen
Vorbereitungen
Begegnungen
Christians Pfad
Gewagtes Spiel
Verhängnis
In der Höhle des Löwen
Rettungspläne
Tage und Nächte
Hoher Einsatz
April 1298 in Finsterwalde
Handstreich in Rochlitz
Unerwartete Wendung
Die Entscheidung des Königs
DRITTER TEIL
Juli 1306 auf der Wartburg
Kriegsvorbereitungen
Die befriedete Stadt
November 1306 auf der Wartburg
In einer Schlucht südlich von Eisenach
Die Rückkehr
Zurück zur Frauenburg
Der alte Landgraf
Ritt durch die Dunkelheit
Mai 1307 in Freiberg
Vertrieben und verstoßen
Leipzig, 30. Mai 1307
Vor der Schlacht
31. Mai 1307, Ebene bei Lucka südlich von Leipzig
Im Ungewissen
Bitterer Sieg
Zehn Schritte
Der Morgen danach
Warten
Wo alles begann
Epilog
Nachbemerkungen
Danksagung
Glossar
Zeittafel
DRAMATIS PERSONAE
Aufstellung der wichtigsten handelnden Personen. Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet.
Freiberg
Ulrich von Maltitz*, Ritter des Meißner Markgrafen Friedrich von Wettin und Kommandant der Burg
Niklas von Haubitz*, Anführer des Heeres zur Verteidigung der Stadt
Markus, Hauptmann der Wachen von Burg Freiheitsstein
Jan, sein Bruder
Sibylla, eine Gauklerin
Christian, ein Gassenjunge
Nikol Weighart*, Bürgermeister, Silberschmied
Katharina, seine Frau
Jenzin*, Ratsherr und Apotheker
Änne, sein Mündel
Beata, Jenzins Frau
Hans Lobetanz*, ihr Neffe und Geselle
Wilhelm, Jenzins Großknecht
Hannemann Lotzke*, Ratsherr und Gewandschneider
Johannes Lotzke*, ihr Sohn
Conrad Marsilius*, Ratsherr und Stadtphysicus
Clementia, seine Magd
Dittrich Beschorne*, Ratsherr und Rechtsgelehrter
Berlewin*, Ratsherr und Zunftmeister der Freiberger Kramerinnung
Heinrich von Frauenstein*, Ratsherr und Waffenschmied
Dittrich von Schocher*, Ratsherr und Weinhändler
Conrad von Rabenstein*, Ratsherr und Tuchhändler
Gottfried von der Bobritzsch*, Ratsherr und Kürschner
Jenzin Burner*, Ratsherr und Schmelzmeister
Conrad Stoian*, Ratsherr und Grubeneigner
Veit Haberberger, Besitzer einer Schmelzhütte
Menachim ben Jakub, Rabbi der jüdischen Gemeinde
Friedemar, Bergmeister
Eberhard von Isenberg, königlicher Burgkommandant in Freiberg unter Adolf von Nassau
Reinold von Bebenburg, einer seiner Nachfolger unter Albrecht von Habsburg
Hildegard, Witwe des früheren Burgvogtes
Jakob und Gerald, ihre Söhne
Roland, Ulrichs Knappe
Clemens, Pater der Marienkirche
Hartmann, ein Blaufärber
Herrmann und Claus, Wachen vom Petritor
Gero und Otto, Freiberger Stadtwachen
Hochadel und Geistlichkeit
König Adolf von Nassau*
Friedrich von Wettin*, genannt der Freidige, Markgraf von Meißen
Diezmann*, sein jüngerer Bruder, Markgraf der Lausitz
Albrecht von Habsburg*, nach Adolfs Abwahl und Tod zum König gewählt
Wenzel II*, König von Böhmen
Jutta von Habsburg*, seine Frau
Herzog Heinrich von Braunschweig-Grubenhagen*, Schwager Friedrichs
Heinrich von Görz-Tirol*, Herzog von Kärnten, weiterer Schwager Friedrichs
Eisenach
Albrecht von Wettin*, Landgraf von Thüringen und Vater Friedrichs
Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk*, seine Frau und Mutter der gleichnamigen Frau Friedrichs
Elisabeth von Lobdeburg-Arnshaugk* (die Jüngere), ihre Tochter und spätere Gemahlin Friedrichs
Rudolf von Vargula*, Truchsess des Landgrafen Albrecht
Herrmann von Goldacker*, Marschall des Landgrafen
Gunther von Schlotheim*, Schenk des Landgrafen
Albrecht von Sättelstedt*, Verwalter der Landgrafen
Lena, eine Magd
Franz, ihr Sohn
weitere handelnde Personen
Reinhard von Hersfeld*, Tylich* und Theodor von Honsberg*, Hertwig von Hörselgau*, Reinhard von Seweschin*, Ritter von Markgraf Friedrich
Meinhard*, Bischof von Meißen
Heinrich von Nortenberg*, Befehlshaber des königlichen Heeres vor Lucka
Friedrich von Schönburg*, Anführer der Pleißnischen Reichsstädte in der Schlacht bei Lucka
PROLOG
Häuser brannten lichterloh, Menschen rannten schreiend davon, während sich eine nicht enden wollende Schar Bewaffneter wie ein schwarzer, todbringender Strom in die Stadt ergoss …
Schweißgebadet schreckte Änne aus dem Schlaf und krachte mit dem Kopf gegen den schweren Apothekertisch, unter dem sie wie jede Nacht auf einem Strohsack schlief. Doch den Schmerz nahm das Mädchen kaum wahr. Zu verstörend war das Traumbild gewesen – und zu wirklich.
Es geschah oft, dass sie nachts schlecht träumte: von dem unbarmherzigen Vormund, bei dem sie lebte, seit ihre Eltern tot waren, von seiner keifenden Frau, der sie es nie recht machen konnte, und seinem bösartigem Neffen. Aber dieser Traum war unglaublich schlimmer gewesen.
Hastig schlug Änne ein Kreuz. Ihr Herz klopfte wild, als wollte es aus der Brust springen. Fröstelnd zog sie sich die zerschlissene Decke enger um die Schultern. Es hatte schon lange mehr keinen so strengen Winter gegeben. An den Wänden der Kammer glitzerten Eiskristalle, auch wenn sie das in der Dunkelheit kaum erkennen konnte.
Angestrengt lauschte sie, ob irgendjemand ihren Schreckensschrei gehört hatte und aufgewacht war. Wenn sie das Haus aus dem Schlaf weckte, würde der Vormund sie gnadenlos verprügeln. Und er war stark, der Meister Jenzin. Von seinen Schlägen würde ihr Gesicht wieder eine ganze Woche geschwollen und verfärbt sein.
Aber es blieb still im Haus des Apothekers. Also blieb ihr nur, sich wieder unter der Decke zu verkriechen und zu beten, dass sie sich irrte.
Wenn ihr der Alptraum in dieser Klarheit schon zum dritten Mal erschienen war, konnte das nur eines bedeuten: Es stimmte, was der Oheim ihr Tag für Tag vorhielt.
Sie stammte tatsächlich aus einem verfluchten Geschlecht. Verflucht, weil sich die Männer durch ihren Mut immer wieder zu viele gefährliche Feinde machten und die Frauen mit der Gabe des zweiten Gesichts gezeichnet waren – was den einen wie den anderen den vorzeitigen Tod einbrachte.
Doch wenn das stimmte, bedeutete dies auch, dass sich die Schreckensbilder aus ihrem Traum erfüllen würden!
Jene, die sie gerade noch vor Augen hatte, und auch die anderen: drei Köpfe vor den Toren der Stadt aufgespießt … und der Obere Markt voller Blut, das den frisch gefallenen Schnee rot färbte, umsäumt von Verwundeten und Gefangenen, die fassungslos auf die enthaupteten Leichname ihrer Gefährten starrten …
Würde tatsächlich noch diesen Winter ein sengendes, mordendes Heer in Freiberg wüten? Vielleicht sogar schon morgen oder übermorgen?
Je länger Änne zitternd dalag und in die Finsternis starrte, viel zu aufgewühlt und verängstigt, um wieder einschlafen zu können, umso stärker wuchs in ihr die Gewissheit. Noch ehe der Schnee schmolz, würde eine grausame Macht die Stadt erobern und Ströme von Blut vergießen. Blut von Menschen, die sie kannte. Und niemand konnte das Verhängnis abwenden.
ERSTER TEIL
Die belagerte Stadt
Altenburg, Dezember 1295
Ich habe ein ganz dummes Gefühl.«
Das hätte Ritter Ulrich von Maltitz nicht erst aussprechen müssen. Seine misstrauische Miene und die Unruhe, mit der er immer wieder zur Tür blickte, die schief in den Angeln hing und bei jeder Bewegung laut knarrte, sagten genug.
Er hatte noch nicht einmal den schneebedeckten Umhang abgelegt. Die schmelzenden Flocken ließen sein schulterlanges Haar schwarz wirken.
»Meint Ihr das Essen, das uns dieser schmierige Wirt bringt, sofern er es je fertigbekommt?«, antwortete der Markgraf von Meißen mit verhaltenem Spott, während er es sich auf einer Bank bequem machte und die langen Beine ausstreckte, die vom anstrengenden Ritt durch die strenge Kälte des Winters steif geworden waren.
Der König hatte Friedrich von Wettin hierher in die Reichsstadt Altenburg beordert, und wenn es nach ihm ginge, dürfte dieser den Markgrafentitel gar nicht mehr führen. Denn Adolf von Nassau, vor dreieinhalb Jahren zum Regenten gewählter Niemand unter den Reichsfürsten, erhob Anspruch auf die Mark Meißen. Obwohl das Fürstengericht noch nicht die Acht über den Meißner gesprochen hatte, galt Friedrich schon so gut wie geächtet, als Rebell, der sich dem König mit dem Schwert entgegenstellte, um seinen Besitz zu wahren. Oder das, was davon übrig war, nachdem sein verschwenderischer Vater auf leichtsinnige Weise den größten Teil seiner Ländereien verschleudert hatte. Dabei war es keine zehn Jahre her, dass dessen Vater über fünf Fürstentümer herrschte!
»Ihr wisst genau, was ich meine«, antwortete Ulrich von Maltitz ungestüm und vergaß dabei für einen Augenblick den respektvollen Ton, den er seinem Lehnsherrn schuldete. »Wenn Ihr auf meinen Rat hörtet, wären wir nie hierhergekommen. Das riecht nach einem Hinterhalt, nach Verrat!«
Der dunkelhaarige Ritter Anfang dreißig legte den Umhang ab und ließ ihn achtlos auf die Bank sinken, ohne die Tür aus den Augen zu lassen. Dann trat er sogar einen Schritt in den Gang hinaus, um hinunter in die Schankstube des Wirtshauses zu spähen, in dem sie Quartier genommen hatten. Rauchschwaden vom Herdfeuer und der Lärm der Zecher drangen in die größte der oberen Kammern, wo ein paar Schankmägde die Tafel für die hohen Gäste aufgestellt hatten. Doch niemand schien sich die altersschwache Holztreppe hinaufzuwagen.
Krachend ließ Ulrich die Tür wieder hinter sich zufallen und blieb stehen, die Hand am Schwert.
»Wollt Ihr etwa dem König so viel Unehrenhaftigkeit unterstellen?«, ermahnte ihn der Markgraf mit hochgezogenen Augenbrauen, immer noch eher spöttisch als streng.
Friedrich war achtunddreißig Jahre alt und weder der dichtende Schöngeist wie sein Großvater, den man »den Erlauchten« nannte, noch der verlebte Verschwender wie sein Vater. Er war nüchtern, zupackend und entschlossen. Und er teilte das Misstrauen des Maltitzers, eines seiner engsten Vertrauten, was die Möglichkeit betraf, der König habe sie nur hierherbeordert, um den Gegner beiseiteschaffen zu lassen, auch wenn er es sich nicht anmerken ließ. Es gab keinen Verhandlungsstoff. Adolf von Nassau wollte die Mark Meißen, und Friedrich war nicht bereit, sie herzugeben. So war der Stand der Dinge.
Doch der König hatte sein Heer gen Meißen in Bewegung gesetzt und auf dem Weg dorthin bereits zum zweiten Mal binnen kurzem Thüringen verwüsten lassen. Friedrich wollte nicht, dass die Angst und Schrecken verbreitende Streitmacht des Nassauers nun auch noch Meißen und Freiberg, seine reiche Silberstadt, in Schutt und Asche legte. Deshalb war er nach Altenburg geritten, so groß die Gefahr eines Hinterhaltes auch sein mochte. Er durfte nichts unversucht lassen, um seinem Land den Krieg zu ersparen.
Ulrich schnaubte verächtlich. »Der König! Was für ein König ist das schon? Ein Schwächling, einer, der sich die Stimmen der Fürsten bei der Wahl gegen den Habsburger mit leeren Versprechungen erkauft hat, weil er weder Land noch Geld besitzt. Und deshalb stiehlt er es – von Euch und Euerm Bruder!«
Friedrich hätte König sein sollen, dachte Ulrich wütend. Sein Großvater gleichen Namens war der letzte große Stauferkaiser, und schon als Zwölfjährigem hatte man ihm die Kaiserwürde angetragen, ohne dass er sie je erringen konnte. Friedrich III., König von Jerusalem und Sizilien, Herzog von Schwaben, Landgraf zu Thüringen und Pfalzgraf zu Sachsen – das sollten seine Titel sein, von der Herrschaft über die Mark Meißen ganz zu schweigen! Und die wollte ihm Adolf von Nassau nun auch noch nehmen.
Der Markgraf beugte sich leicht vor, nun mit strengem Gesichtsausdruck. »Es grenzt an Hochverrat, was Ihr da von Euch gebt!«, ermahnte er seinen Ritter mit gesenkter, gefährlich anmutender Stimme. »Hütet Eure Zunge! Und zur Übung beginnt Ihr damit besser sofort, noch bevor wir morgen auf die Männer des Königs treffen!«
Die Gesichtszüge des Maltitzers verschlossen sich, er sank auf ein Knie. »Vergebt mir, mein Fürst«, murmelte er und verbiss sich die Bemerkung, sie könnten sich glücklich preisen, wenn sie erst am nächsten Tag und nicht schon heute Nacht auf die Männer des Königs treffen würden.
»Nun steht schon auf und setzt Euch zu uns«, lenkte der Markgraf ein. Mit knapper Geste wies er auf den Platz zwischen sich und den anderen Rittern, die sich bereits an die Tafel gesetzt hatten und ebenfalls zur Tür blickten – allerdings eher in Erwartung des Wirtes mit Braten und Wein statt eines Kommandos gedungener Meuchelmörder.
Ulrich von Maltitz zögerte. Der lange Ritt bei scheußlichem Schneegestöber hatte auch ihm die letzten Kräfte abverlangt, seine Beinmuskeln zitterten immer noch vor Anspannung, und die Aussicht, sich setzen zu können, war mehr als verlockend, zumal einer der Knechte ein Kohlebecken aufgestellt hatte, das wenigstens im Umkreis von zwei, drei Schritten wohlige Wärme verbreitete. Doch er konnte sich nicht setzen, ohne das lange Schwert abzulegen, und ebenso wenig wollte er – eingeklemmt zwischen den Kampfgefährten – mit dem Rücken zur Tür hocken.
»Wenn Ihr erlaubt, bleibe ich stehen und behalte den Gang im Auge.«
Friedrich seufzte schicksalsergeben. »Ihr seid übervorsichtig. Aber tut, was Ihr nicht lassen könnt!«
Der kurze Blick, den er mit Ulrich wechselte, sagte allerdings etwas anderes: Wie erleichtert der Markgraf über die Vorsicht seines Vertrauten war, zu der es hinreichend Anlass gab.
Es klopfte, erst zaghaft, dann stärker. Ulrich riss die Tür auf. Erschrocken fuhr die mit zwei schweren Krügen beladene Schankmagd zurück, als sie sich plötzlich dem blanken Schwert eines Ritters gegenübersah. Von Maltitz fragte sich, wie sie wohl angeklopft hatte – mit dem Ellbogen oder mit der Fußspitze?
Etwas von dem Wein war durch ihre hastige Bewegung auf ihr grobgewebtes Kleid geschwappt, doch das schien sie gar nicht wahrzunehmen. Ihre schreckensweiten Augen waren von der scharfen Waffe wie gebannt. Ulrich ließ das Schwert sinken und trat einen Schritt zurück.
Die Frau, deren Gesicht vor Hitze gerötet war und kleine Schweißperlen auf der Stirn und über den zusammengekniffenen Lippen aufwies, knickste rasch erst vor ihm, dann tief vor dem Markgrafen. »Ich bringe Wein. Wenn es den edlen Herren beliebt?«
Auf Friedrichs Zeichen hin goss sie erst ihm den Becher voll, dann seinen Rittern: nach Ulrich von Maltitz auch Reinhard von Hersfeld, den Brüdern Tylich und Theodor von Honsberg, Rudolf von Falkenstein, Reinhard von Seweschin und dem Jüngsten, Hertwig von Hörselgau. Die anderen Männer hatte Ulrich bei den Pferden und um das Wirtshaus herum postiert. Friedrichs Gefolge war klein, aber sorgfältig ausgewählt unter den besten seiner kampferprobten Ritter.
»Ihr gestattet!« Nach der wortlosen Zustimmung des Markgrafen nahm Ulrich dessen Becher und kostete vor.
Wein, wirklich.
»Ziemlich sauer, aber nicht vergiftet, wie es scheint.«
Ulrich reichte den Becher zurück.
Die Magd warf ihm heimlich einen beleidigten Blick zu und stellte den Wein vor dem Markgrafen ab. Dann schenkte sie aus dem zweiten Krug Bier an die niederen Gefolgsleute aus.
Als sie damit fertig war, knickste sie erneut und ging.
Friedrich hob seinen Becher. »Möge Gott uns morgen beistehen!«
»Amen!« Die anderen tranken ihm stehend zu.
Und möge Gott uns auch diese Nacht beistehen, dachte Ulrich bei sich, während er einen kräftigen Schluck nahm.
Wieder klopfte es, und eine weitere Schankmagd brachte ein großes Brett mit Brot, Käse, Schinken und Speck. »Der Braten ist gleich fertig, lässt der Wirt ausrichten«, erklärte sie.
Niemand antwortete ihr. Die Ritter, hungrig und durchgefroren, brachen auf Friedrichs einladende Geste Stücke von dem noch warmen Brotlaib, zogen ihre Essmesser und schnitten dicke Scheiben von Käse, Schinken und Speck ab. Mit Erlaubnis ihres Fürsten durften sie heute die Regel für höfische Mahle vernachlässigen, nach der als maßlos betrachtet wurde, wer das Brot aß, bevor die Hauptspeisen aufgetragen waren. Die letzte Rast auf dem Weg hierher lag lange zurück.
Wenn auch die Herberge am Markt verräuchert war und Aussehen und Kleidung des Wirtes wenig vertrauenerweckend wirkten – das noch dampfende Brot schmeckte köstlich, der Schinken war gut geräuchert, der Käse würzig.
Die Männer begannen, sich zu entspannen und lautstark zu unterhalten.
Feuchte Schwaden stiegen von ihren Kleidern auf, die der Schnee durchnässt hatte. Doch allmählich wurde es warm im Raum, und ihre Kleider und Haare begannen zu trocknen.
»Wenn Ihr erlaubt, Hoheit!«
Johannes Lotzke, ein junger Freiberger, bot sich an, für Friedrich und seine Ritter Wein nachzuschenken, denn die Knappen waren zur Wache bei den Pferden eingeteilt worden.
Aufmunternd nickte Friedrich dem jungen Mann mit dem rötlichen Haar zu, den er erst kürzlich in sein Gefolge aufgenommen hatte und der ihm durch seinen Diensteifer und seine Klugheit aufgefallen war. Sein Vater, ein Gewandschneider und einer der Freiberger Ratsherren, hatte ihn geschickt, damit er dem Markgrafen diene, höfisches Benehmen lerne und bis zu seiner Verheiratung etwas von der Welt sehe.
»Sag, junger Lotzke, wann soll die Hochzeit sein?«, fragte breit grinsend Rudolf von Falkenstein, ein älterer Ritter mit derbem Humor, der offensichtlich einen Spaß mit dem Freiberger Burschen plante.
»Nach Pfingsten, Herr«, antwortete Johannes, während seine Ohren in verräterischem Rot aufleuchteten. Er kannte die Ritter inzwischen gut genug, um zu ahnen, dass sich der Falkensteiner einen Scherz auf seine Kosten erlauben wollte.
»Und, ist sie hübsch, deine Braut?«
»Ich denke schon«, murmelte Johannes mit gesenktem Kopf, scheinbar ganz darin vertieft, die Becher der Ritter nachzufüllen.
»Er denkt es!« Rudolf schlug sich auf die Schenkel und sah grinsend zu seinen Tischnachbarn. »Aber sicher scheint er nicht zu sein. Hast sie wohl noch nicht näher in Augenschein genommen?«
Johannes erwiderte nichts. Wenn er die Wahrheit sagte, nämlich dass er bis über beide Ohren in seine Zukünftige verliebt war, die jüngere Tochter des Tuchers, es aber um nichts in der Welt wagen würde, sich ihr vor der Brautnacht auch nur auf fünf Schritte zu nähern, würde der Falkensteiner nicht nur Späße auf seine, sondern auch auf ihre Kosten treiben. Und das wollte er verhindern.
Überhaupt – die Hochzeitsnacht … Der Gedanke daran ließ ihn noch verlegener werden.
Das schien der stets zu Späßen aufgelegte Falkensteiner zu erraten. »Mir scheint, unser junger Freiberger ist recht schüchtern, was Frauen betrifft. Er braucht wohl noch ein bisschen Anleitung, bevor er vor die Kirchentür tritt, damit er seine hübsche Braut vollends zufriedenstellen kann. Was meint ihr?«
Wieder wandte er sich an die anwesenden Ritter. »Lassen wir dem Wirt ausrichten, er möge unserem Freund hier Gesellschaft für die Nacht besorgen? Aber keine Jungfrau, sondern eine mit Erfahrung. Am besten einen richtig alten Drachen. Dann lernt er schon einmal, was ihn in der Ehe erwartet, wenn er nicht von Anfang an aufpasst …«
Die anderen lachten schallend. Es war ein gutmütiger Spott, dennoch war Johannes mittlerweile vom Hals bis zu den Haarwurzeln rot angelaufen. Vergeblich suchte er nach einer Entgegnung, aber ihm fiel nichts Passendes ein. Außerdem hätte er sowieso nichts sagen dürfen, ohne dazu aufgefordert zu werden. Also betete er stumm, dass der Falkensteiner seine Ankündigung nicht wahr machte.
Der Markgraf wollte etwas Beschwichtigendes sagen, um den jungen Mann aus seiner Verlegenheit zu erlösen, doch er kam nicht dazu.
Ulrich von Maltitz’ energisches »Still!« dröhnte dazwischen. Mit erhobenem Arm, leicht vorgebeugt, sah der misstrauische Ritter aus der schmalen Fensterluke, dann stürzte er zur Tür und riss sie auf. »Bewaffnete! Sie kommen hierher!«, brüllte er nach einem kurzen Blick hinab. »Zieht die Schwerter!«
Noch während seiner Worte sprangen die Männer auf, griffen nach den Waffen und gruppierten sich um ihren Fürsten.
Aus den ebenerdigen Räumen drangen erschrockene Rufe, gebrüllte Befehle, das Krachen umstürzender Bänke. Während die Ziege, die der Wirt gleich neben der Schankstube hielt, angstvoll meckerte, polterten schwere Tritte die Treppe herauf.
»Ihr müsst nach oben fliehen!«, rief der Maltitzer dem Markgrafen zu und wies auf die Luke zum Dach, bevor er den schweren Riegel vorschob. »Es sind mehr als zwei Dutzend. Wir können Euch nicht gegen sie alle verteidigen.«
Auch Friedrich zog sein Schwert und blickte auf seine Männer. »Nein. Wir erwarten sie hier. Gott steh uns bei.«
Schon zerbarst die marode Tür unter einen wuchtigen Hieb oder Tritt von draußen. Bewaffnete drängten durch die Öffnung, um sofort von vier Meißner Rittern mit dem Schwert in Empfang genommen zu werden.
Der Raum war so klein und vor allem so niedrig, dass sie kaum ausholen konnten.
Den ersten Angreifer enthauptete Ulrich mit einem einzigen Hieb, einen weiteren streckte Reinhard von Hersfeld nieder. Doch über die Leichname ihrer gefallenen Kumpane hinweg drängten immer mehr Angreifer in die Kammer. Die Männer an der Tür mussten ein paar Schritte in das Innere zurückweichen. Nun bildeten die sieben Ritter einen schützenden Halbkreis um ihren Fürsten. Wohl ein Dutzend Angreifer – allesamt mit dem königlichen Adler auf dem Wappenrock – stürmten auf sie ein. Doch die Meißner hielten stand, auch wenn ihr Halbkreis immer enger wurde.
Bald sah Ulrich nur noch Blut um sich, erkannte, dass der Falkensteiner tödlich getroffen zu Boden ging und zwei ihrer bewaffneten Reitknechte seinen Platz einnahmen. Der junge Hertwig schrie neben ihm auf und sackte zusammen, die Rechte über eine heftig blutende Wunde am linken Oberarm pressend. Ulrich schob ihn rasch hinter sich und trat vor, um den nächsten Angreifer niederzustrecken.
Seitlich von ihm krachte und prasselte es – ein paar Angreifer hatten die Fachen aus Lehm und Stroh durchgetreten und zwängten sich nun aus dem Nebenraum durch das Ständerwerk, um von der Seite anzugreifen.
Fast im gleichen Augenblick drängten vier ihrer eigenen Leute, die er unten als Wache postiert hatte, durch die Tür.
Ulrich blieb weder Zeit noch ausreichend Sicht, um die Gegner zu zählen, die deutlich in der Überzahl waren. Das änderte sich bald. Die Reisigen hatten inzwischen mehrere Gegner in einen Kampf nahe der Tür verwickelt. Die anderen standen den mittlerweile nur noch fünf Meißner Rittern und dem Markgrafen gegenüber, der längst selbst mitkämpfte, Schwert und Surkot voller Blut, mit schnellen, geschickten Hieben auf die Gegner einschlagend.
Allmählich ließ der Kampflärm nach. Von den Gegnern waren nur noch drei übrig, mit denen sich Ulrich, Tylich und Reinhard erbitterte Zweikämpfe lieferten.
Ulrichs Gegner war ein Bulle von einem Kerl, mit Oberarmen wie Schenkeln. Er focht einen plumpen Stil und verließ sich ganz auf seine Kraft. Mit aller Macht drückte er seine Klinge auf die des Kontrahenten, doch Ulrich entzog sich ihm mit einer geschickten Bewegung und strich ihm im nächsten Augenblick das Schwert über die Kehle. Wie ein gefällter Baum stürzte der Bulle zu Boden und riss im Fallen das Kohlebecken um.
Geistesgegenwärtig griff Ulrich nach dem Krug und goss das Bier über die glühenden Stücke, wo es zischend verdampfte. Die restliche Glut trat er hastig aus. Das trockene Gebälk würde brennen wie Zunder, so dass nicht nur sie selbst Gefahr liefen, in den Flammen umzukommen, sondern halb Altenburg in Brand geraten konnte, sollte in der Kammer ein Feuer ausbrechen.
Ulrich vergewisserte sich mit einem Blick, dass seine Gefährten zurechtkamen, und wollte sich zu Friedrich umdrehen. In diesem Augenblick gellte ein markerschütternder Schrei.
Der Maltitzer fuhr herum und erstarrte. Unter den totgeglaubten Gegnern hatte sich einer aufgerappelt und stürzte mit gezogenem Schwert von hinten auf den Markgrafen. Friedrich bemerkte ihn zu spät, erst als der junge Lotzke warnend aufschrie. Die todbringende Klinge fuhr direkt auf ihn zu; keiner seiner Ritter war nahe genug, um einzugreifen. Immer noch schreiend, warf sich der Freiberger zwischen die Waffe und den Fürsten.
Verblüfft starrte der Angreifer auf den zusammensackenden Körper, während der Markgraf unversehrt vor ihm stand. Sein Zögern wurde ihm zum Verhängnis: Im nächsten Augenblick war Ulrich von Maltitz heran und trieb dem Attentäter das Schwert tief in die Brust. Dann zog er seine Waffe wieder heraus und stieß den Leichnam mit einem Fußtritt beiseite, der vor ihm zu Boden plumpste. »Seid Ihr unversehrt, mein Fürst?«, fragte er atemlos und voller Sorge.
»Ja, dank dieses Jungen«, antwortete Friedrich düster. Vorsichtig ließ er den durchbohrten Körper des Freibergers zu Boden sinken, aus dessen Wunde ein Schwall Blut geströmt war.
Ulrich atmete tief durch und sah sich in der Kammer um.
Der Kampf war beendet, der Boden mit Leichnamen übersät, seine Gefährten voller Blut. Hertwig versuchte, mit einem abgerissenen Ärmel seine Wunde abzubinden, Tylich blutete heftig am Oberschenkel, und der alte Falkensteiner lag mit gespaltenem Schädel nahe der Tür. Ihn hatten sie ganz verloren, ihn und den jungen Freiberger, auf den sein Vater und seine Braut nun vergeblich warten würden.
Von Maltitz schlug ein Kreuz. »Gott erbarme sich ihrer armen Seelen.«
Dann stand er auf. »Wir müssen weg, sofort. Ich weiß nicht, ob wir alle erwischt haben oder ob jemand entkommen ist, der Verstärkung holt.«
Niemand widersprach. Er befahl den Reisigen, die Leichen der beiden Gefallenen mitzunehmen, damit ihnen ein christliches Begräbnis zuteilwerden konnte, und ließ Tylichs Wunde in aller Eile notdürftig verbinden.
Dann stürmten sie hinaus, immer noch die blanken Schwerter in der Hand. Niemand stellte sich ihnen in den Weg. Angesichts des Kampfgetümmels waren die Gäste des Wirtshauses längst davongerannt.
Die Knappen hatten bereits die Pferde für eine rasche Flucht gesattelt.
Roland, Ulrichs Knappe, trat auf seinen Herrn zu. »Drei von den Wachen haben sie erschlagen. Die anderen sind hochgerannt, um Euch zu helfen«, berichtete er. Selbst in dem trüben Licht konnte Ulrich erkennen, dass der Sechzehnjährige kreidebleich war.
Die Reisigen holten nun auch die Leichname der gefallenen Wachen und banden sie auf die Packpferde. Dann saßen alle auf und ritten, so schnell sie konnten, durch die Dämmerung.
Bald würden die Stadttore geschlossen, und sie säßen in Altenburg fest, den Mordgesellen des Königs ausgeliefert. Doch sie hatten Glück. Das Tor in der Nähe des Wirtshauses war noch nicht geschlossen.
Erschrocken drückten sich die Menschen in die Mauernischen oder flüchteten in die Häuser, als sie den wilden Reitertrupp kommen sahen und hörten. Im Galopp sprengten die Meißnischen aus der Stadt und in die einbrechende Nacht hinaus.
Sie mochten wohl zehn oder zwölf Meilen weit gekommen sein, als Friedrich Befehl gab zu halten. Sie rasteten am Rande eines Waldes, allerdings nur kurz und ohne ein Feuer zu entzünden, denn sie konnten nicht sicher sein, etwaige Verfolger abgehängt zu haben. Der Mond, der den Schnee leuchten ließ, sorgte für ausreichend Helligkeit.
»Ich schätze, die Verhandlungen sind damit beendet«, knurrte Ulrich mit finsterer Miene und griff in den verharschten Schnee, um das verkrustete Blut der Attentäter von seinen Händen zu wischen.
»Das war eine offene Kriegserklärung!«, sagte Reinhard von Seweschin schroff, der Älteste unter Friedrichs Rittern. »Adolf hat einen Präzedenzfall geschaffen – einen Fürsten, den er unter Zusage freien Geleits zu sich beorderte, überfallen zu lassen. Vielleicht bringt das endlich auch die anderen Fürsten gegen ihn auf.«
»Vielleicht«, meinte Ulrich mit Blick auf Friedrich nachdenklich. »Werden die Fürsten zusehen, wie der von ihnen gewählte König die Waffen gegen die eigenen Vasallen, das eigene Volk richtet? Wenn er Euch Titel, Land und Leben nehmen will, könnte er das ebenso mit jedem von ihnen tun.«
Der Markgraf schüttelte kaum erkennbar den Kopf. »In einem habt Ihr beide recht: Jetzt ist der Krieg unausweichlich. Adolf wird sein Heer von Plünderern und Brandstiftern in die Mark Meißen schicken. Und als Erstes werden sie versuchen, Freiberg zu erobern. Der König will das Silber, damit wäre er viele Sorgen los.«
Friedrich sah nun direkt zu Ulrich. »Aber es besteht keine Hoffnung auf Hilfe. Mag auch Albrecht von Habsburg Anspruch auf den Thron erheben – er wird unter den Fürsten keinen offenen Verbündeten für eine neue Königswahl finden. Noch nicht.«
Dann wandte sich Friedrich dem Hersfelder zu. »Reinhard, reitet los zu Niklas von Haubitz; er soll seine Truppen, so schnell es geht, nach Freiberg führen, um die Stadt zu verteidigen. Ulrich, Ihr reitet dorthin und warnt sie. Ich vertraue Euch das Kommando über Burg Freiheitsstein an. Wir brauchen das Silber, um Truppen aufzustellen, mit denen wir gegen das königliche Heer antreten. Sonst werden viele Menschen sterben. Das wäre das Ende des Hauses Wettin und das Ende der Hoffnung auf Frieden in der Mark.«
Freiberg, Januar 1296
Verzweifelt kämpfte sich die schmale Gestalt durch den Schnee, stemmte sich mit letzter Kraft gegen den eisigen Wind, der durch die Überreste des zerrissenen Kleides fuhr, die Fetzen flattern ließ und Eiskörner gegen die nackte Haut peitschte.
Noch ein Schritt. Und noch einer. Wie viele mochten es sein bis zum rettenden Stadttor? Hundert? Zweihundert? Schon waren in der Dämmerung die dunklen Konturen der Wehrtürme zu sehen, zeichnete sich vage durch das Schneetreiben die starke Stadtmauer ab, der schützende Wall um Freiberg.
Etwas rann ihr die Beine hinab. Sie war zu schwach, um nachzusehen, ob es Blut war. Ihr Körper verwehrte jede andere Bewegung als das dumpfe Vorwärtsgehen. Und ihr Bewusstsein weigerte sich, durch den Anblick noch einmal die schrecklichen Erinnerungen heraufzubeschwören, die Todesschreie und die rohe Gewalt.
Ich muss weiter, dachte sie verzweifelt. Denn nach dem Sterben wird es keine Erlösung für mich geben, nur die schlimmsten Qualen der Hölle. Auch wenn ich mich gewehrt habe und Todesangst statt Wollust empfand – es war Sünde, und kein Priester wird mich davon freisprechen.
Noch ein Schritt. Und noch einer.
Als hätten sich die Elemente gegen ihr letztes bisschen Lebenswillen verschworen, heulte der Wind stärker auf, fegte Wehen wie feine Schleier über das freie Feld vor ihr, ließ Wirbel kreiseln, nahm ihr den Atem und die Sicht auf die rettenden Mauern.
Sie wusste, wenn sie jetzt der Schwäche nachgab und sich in den Schnee sinken ließ, würde sie nie wieder aufstehen.
Also setzte sie trotzig einen Fuß vor den anderen, eine tiefe Spur durch den Schnee furchend, die der Sturm schon nach ein paar Schritten wieder verwehte und zu einer kaum sichtbaren Mulde verharmloste.
Sie wollte leben. Sie musste die anderen warnen.
Für einen Augenblick verharrte sie mitten in der Bewegung und lauschte. Täuschte sie der heulende Wind, oder waren das wirklich schon die Glocken, die ankündigten, dass die Tore zur Stadt geschlossen würden?
Der Verstand sagte ihr: Du kommst zu spät. Sie werden die Stadt schließen, und du wirst vor dem Tor im Schnee erfrieren. Aber schneller gehen konnte sie nicht. Also setzte sie weiter einen Schritt vor den anderen in der irrsinnigen Hoffnung, man würde sie doch erhören und einlassen.
Sorgfältig verschloss Jan, einer der jungen Burschen von Freibergs Wachmannschaft, den seine Kameraden manchmal Waghals und manchmal Sturkopf riefen, das Peterstor. Gleich würde einer der Ratsherren kommen, heute wohl Conrad Marsilius, der Stadtphysicus, und den großen Schlüssel an sich nehmen. Kein Störenfried sollte die Bürger aus ihrem wohlverdienten Schlaf aufwecken, kein Gesindel sie des Nachts belästigen. Und morgen, nach Tagesanbruch, würde man bei Licht besehen können, wer Einlass begehrte.
»Gott sei gepriesen, wieder ein Tag, ohne dass die Truppen des Königs hier angerückt sind«, meinte neben ihm Hartmann, ein Blaufärber, der für diese Nacht zum Wachdienst am Peterstor eingeteilt war und dessen Name in krassem Widerspruch zu der schmächtigen Gestalt mit dem ängstlichen Wesen stand.
Der Handwerker rieb sich vor Kälte oder aus Erleichterung die von der Arbeit verfärbten Hände. »Wer weiß, ob sie überhaupt hierherkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesem strengen Winter jemand in den Krieg zieht.«
Darauf würde ich nicht wetten, dachte Jan und fuhr sich mit der Rechten durch den hellen Lockenschopf, wie er es meistens unbewusst tat, wenn ihn etwas beschäftigte. Doch er schwieg, um den Blaufärber, der sich vor seinem eigenen Schatten zu fürchten schien, nicht noch mehr zu verängstigen.
»Bei dem Wetter jagt man doch keinen Hund vor die Tür«, plapperte der Schmächtige weiter. »Schnell, zurück ins Wachhaus, ans Feuer!«
Wortlos ging Jan voran. Der Blaufärber hätte ja nicht mitkommen müssen; das Tor hätte er auch allein verschließen können. Aber er hatte förmlich darauf bestanden, mit stolzgeschwellter Brust, so etwas Bedeutendes tun zu können oder zumindest dabei zu sein. Drinnen im Wachhaus würden ihn seine Kameraden hoffentlich vom Geschwätz des Färbers befreien, damit er sich seinen eigenen Gedanken hingeben konnte.
Die Königlichen waren auch heute nicht gekommen. Aber ebenso wenig die Verstärkung, die jener Ritter von Maltitz versprochen hatte, der im Auftrag des Markgrafen das Kommando über die Burg übernommen hatte. Wo, um alles in der Welt, blieb nur Niklas von Haubitz mit seinem sehnlich erwarteten Heer? Oder waren beide Streitmächte schon aufeinandergestoßen, so dass der Stadt Belagerung und Krieg erspart blieben? Zumindest, falls Niklas gesiegt hatte. Sonst wären sie ohne Rettung der rheinischen Söldnerschar des Königs ausgeliefert, über die die Leute die wildesten Geschichten erzählten, von Sengen und Morden, Plündern und Brandschatzen.
Die Männer in der Wachstube – je zur Hälfte ausgebildete Wachen und Stadtbürger, die reihum zu nächtlichen Diensten eingeteilt waren – sahen kaum auf, als die beiden den Raum wieder betraten. Angesichts der Kriegsgefahr waren die Wachmannschaften verstärkt und alle neununddreißig Türme bemannt worden.
»Man möchte wirklich keinen Hund vor die Tür jagen bei dem Wetter«, meinte nun auch Herrmann, der älteste und erfahrenste unter den Wachleuten am Peterstor.
Jan trat ans Feuer und hielt die klammen Hände über die Flammen. Gleich würde er wieder in die Kälte müssen, den Turm hinauf, um Ausschau zu halten. Bei dem Schneetreiben und in der einsetzenden Nacht würde zwar nicht viel zu sehen sein, aber die Ankunft eines starken Heeres konnte ihm nicht entgehen. Wer weiß, ob der König seine Truppen nicht sogar in der Dunkelheit gegen die Stadt schickte, deren Silberreichtum ihn locken musste wie Honig den Bären.
Er sandte noch einen bedauernden Blick auf das Feuer, dann ging er zur Treppe, die im Innern des Turmes hinaufführte.
»Ich komme mit«, verkündete der Blaufärber seufzend und kam damit Herrmanns Weisung zuvor.
Oben angekommen, ignorierte Jan die Litanei des mageren Männleins, lehnte sich weit vor, um durch den schmalen Mauerspalt zu blicken, und kniff die Augen zu Schlitzen zusammen.
Täuschte ihn das Schneetreiben, oder kam da tatsächlich ein dunkler Schatten auf das Tor zu?
Wer, um alles in der Welt, würde sich nachts bei diesem Frost und eisigen Wind über die Ebene wagen, wo doch das Tor verschlossen war und niemand mehr Einlass fand? Die Regel war unumstößlich, zur Sicherheit der Stadt und ihrer Bewohner. Kein Bettler und keine Hure würden bei solcher Kälte nachts vor dem Eingang zur Stadt lagern, statt sich im Wald, in einem verlassenen Gehöft oder sonst wo einen Unterschlupf zu suchen, um nicht zu erfrieren. Und wer Geld besaß, nahm sowieso in einer der Herbergen vor der Stadt für die Nacht Quartier.
Die Sache kam ihm merkwürdig vor.
Inzwischen war der Schemen an die Pforte heran und hämmerte dagegen.
»Das Tor ist verschlossen«, rief Jan hinunter. Der Wind trug seine Worte fort, aber ein paar Fetzen mussten angekommen sein. Die Gestalt hob den Kopf und rief etwas zu ihm hinauf. Für einen Moment ließ das Heulen des Sturms nach und beruhigte sich das wilde Schneetreiben. Nun konnte Jan erkennen, dass dort unten eine Frau stand, ohne Umhang, nur mit einem Schaffell über den Schultern, mit unbedecktem Haar, das zerrissene Kleid krampfhaft über der Brust zusammenhaltend.
»…önigs Truppen … morgen hier …«, wehte ihre ersterbende Stimme zu ihm herauf.
Auch Hartmann, der aus dem nächsten Mauerspalt geblickt hatte, musste das mitbekommen haben. »Eine Hure. Die will sich bloß interessant machen, damit wir sie doch noch reinlassen«, meinte er abfällig.
Dann entblößte ein Windstoß ihre Beine. Er sah das weiße Fleisch und leckte sich nervös die Lippen. Vielleicht würde sich die Hure gefällig erweisen, wenn sie sie einließen. Sein eigenes Weib war alt, mürrisch und im Bett nicht zu gebrauchen. Schon stellte er sich vor, wie er mit seinen blauen Händen die Brüste der Hure umklammern würde, die bestimmt so weiß waren wie das, was er gerade von ihrem Körper zu sehen bekommen hatte. Der Blaufärber wurde ganz aufgeregt bei diesem Gedanken, sein Mund war mit einem Mal ganz trocken. Ob er wohl den anderen dazu bringen konnte, entgegen den Regeln noch einmal das Tor zu öffnen?
Als Hartmann sich umdrehte, merkte er, dass Jan schon auf dem Weg nach unten war. Hat also auch Appetit auf das Täubchen, der Bursche, dachte er und lachte meckernd vor sich hin.
Zu seiner Enttäuschung ging Jan nicht gleich zum Tor, sondern blieb in der Wachstube stehen. »Herrmann, du musst entscheiden, ob wir noch einmal jemanden einlassen«, forderte er den Älteren auf und unterrichtete ihn mit wenigen Worten.
Zu dritt gingen sie hinaus zum Tor.
»Wer da?«, rief Herrmann der Unbekannten zu, laut genug, damit seine tiefe Stimme durch das Gebälk dringen konnte. »Und was weißt du vom Heer des Königs?«
»… nah …«, war alles, was sie von der kraftlosen Antwort hören konnten.
Jan und Herrmann sahen einander an. »Sie kommt aus der Richtung, aus der wir das feindliche Heer erwarten. Sie könnte denen in die Hände gefallen und entflohen sein«, gab der Jüngere zu bedenken. »Vielleicht bringt sie wichtige Neuigkeiten. Wenn wir sie nicht hereinlassen, ist sie morgen früh erfroren.«
Herrmann nickte zustimmend. »Ratsherr Conrad hat den Schlüssel schon geholt. Lauf ihm nach!«
Dann rief er laut durch das dicke Holz: »Weib, geh zum Erlwinschen Tor! Dort wird man dich einlassen, ausnahmsweise, trotz der späten Stunde.«
Von draußen kam keine Bestätigung.
Es kostete Jan einige Mühe, den graubärtigen Stadtphysicus zu überzeugen, das Erlwinsche Tor noch einmal zu öffnen.
»Keiner kommt mehr in die Stadt nach dem Abendläuten«, schnappte der für seine Schroffheit bekannte Arzt und wandte sich schon ab, um weiterzugehen.
»Uns droht Krieg! Wir müssen wissen, wie weit das königliche Heer an die Stadt herangekommen ist. Oder soll ich zum Kommandanten der Burg gehen, damit er Euch Order erteilt?«, beharrte Jan dreist und stellte unter Beweis, dass er den Spottnamen »Sturkopf« nicht umsonst trug.
Es war zwar fraglich, ob man ihn zum Burgkommandanten vorlassen würde, aber sein älterer Bruder war der Hauptmann der Wache und würde ihn schon anhören.
Conrad Marsilius musterte den vorwitzigen Burschen wortlos. Dann wies er mit einem stummen Seufzer Richtung Erlwinsches Tor. »Gehen wir. Aber schnell! Ich werde dringend bei einem Kranken erwartet.«
Am Haupttor, dem einzigen, das in besonderen Fällen auch nachts noch einmal geöffnet wurde, unterrichteten sie die dortigen Wachen, dann zog der Ratsherr sein schweres Schlüsselbund hervor und öffnete die Ausfallpforte neben dem Tor einen Spaltbreit.
Hastig spähte Jan hinaus. Niemand war zu sehen.
Hatte es die Unbekannte nicht mehr bis hierher geschafft, oder war es doch ein Hinterhalt?
»Ich gehe sie suchen«, sagte er und vergewisserte sich, dass sein Dolch griffbereit unter dem Umhang steckte. Dann stemmte er sich gegen die Tür, hinter der sich eine Wehe türmte, und zwängte sich hinaus.
Der Wind blies immer noch unbarmherzig eisige Böen über die Ebene; dichte Schneewehen schränkten die Sicht auf ein paar Schritte ein.
Das ist ein Winter, der uns sogar die Wölfe bis an die Stadtmauer treiben könnte, dachte Jan, zog seinen Umhang enger um sich und blickte suchend nach links und rechts. Niemand zu sehen. Also blieb ihm nichts anderes, als über die Brücke und am Graben entlang der hohen Mauer zum Peterstor zu stapfen. Normalerweise kein allzu weiter Weg, nicht einmal eine halbe Meile, aber diesmal angesichts des Wetters und der Unmengen Schnees eine kraftraubende Strecke.
Er entdeckte sie erst, als er schon bis auf wenige Schritte vor dem anderen Tor war: zusammengebrochen im Schnee liegend, den halbnackten Arm der rettenden Pforte entgegengestreckt. Der Wind ließ ihr offenes Haar wehen, doch nichts verriet, ob die reglose Gestalt noch lebte oder inzwischen erfroren war.
Jan vergeudete keine Zeit damit, das mitten im Schneetreiben ergründen zu wollen. Rasch lud er sich den eiskalten Körper über die Schulter und bedeckte den schmalen Leib mit seinem Umhang. Er hoffte, seine eigene Körperwärme würde helfen, die Frau am Leben zu halten.
Zurück am Erlwinschen Tor, pochte er kräftig gegen die Ausfallpforte und rief das Losungswort. Die Tür wurde erneut einen Spaltbreit geöffnet. Erst nachdem sich jemand mit ängstlichem Blick vergewissert hatte, dass da draußen wirklich Jan Waghals stand, wurde er hastig eingelassen.
Mit seiner Last über der Schulter ging er ins Wachhaus, ohne auf Hartmanns ungeduldige Fragen zu antworten, und bettete die ohnmächtige oder tote Fremde – eine junge Frau, wie sich nun zeigte, vielleicht sogar noch unverheiratet angesichts der unbedeckten dunklen Locken – vorsichtig auf den Lehmboden, nahe am Feuer.
»Sie sieht aus wie eine Eisfee, so weiß …«, wisperte andächtig Claus, der Jüngste unter den Torwachen. »Sogar ihre Wimpern und Augenbrauen sind voller Eis. Erinnert ihr euch noch an die Geschichten, die im letzten Sommer dieser reisende Händler erzählte? Von dem Reich weit oben im Norden, wo das Land ewig von Schnee bedeckt ist, die Bären weißes Fell haben, und wo Riesen und andere Ungetüme ihr Unwesen treiben?«
»Unsinn«, knurrte Herrmann. »Es gibt keine weißen Bären. Und Feen haben keine Würgemale.«
»Vielleicht musste sie mit den nordländischen Ungeheuern kämpfen, um zu uns zu gelangen?«, beharrte Claus.
Herrmann ignorierte den Einwand. »Lebt sie noch?«, fragte er Jan. Der Arzt war längst fort, er musste zu seinem Kranken gegangen sein.
Als Jan zu keinem klaren Ergebnis kam, überwand er seine Scheu und legte seine Hand zwischen ihre Brüste, um nach dem Herzschlag zu suchen. Er spürte, wie sich der Brustkorb schwach hob und senkte, und sah erleichtert auf. »Sie lebt.«
Die Eiskristalle an ihren Wimpern waren geschmolzen und rannen die Schläfen hinab, so dass es aussah, als ob die Fremde weinte.
Schon holte ihn die Ratlosigkeit wieder ein. Was tat man mit halberfrorenen Weibern, noch dazu, wenn ihre Kleider zerrissen waren und mehr als genug Haut entblößten, um die Gedanken der Männer auf Abwege zu bringen? Zumal ihm von den Älteren ständig vorgeworfen wurde, nichts anderes als Mädchen im Kopf zu haben.
Als hätte die Unbekannte sein stummes Flehen erraten, schlug sie plötzlich die Augen auf. Sie blickte verwirrt um sich, öffnete den Mund, als ob sie etwas sagen oder fragen wollte, doch plötzlich verzerrte sie das Gesicht vor Schmerz und begann, krampfartig Hände und Füße zu schütteln.
»Meine Hände! Meine Hände!«, schrie sie. »Es tut so weh! Helft mir!«
»Sie ist doch eine Eisfee – und nun schmilzt sie. Nehmt sie weg vom Feuer!«, rief Claus und bekreuzigte sich.
Jan zog sie von der Feuerstelle, aber nicht, weil er dem Jüngeren glaubte, sondern weil er sich erinnerte, wie sehr es schmerzte, wenn er seine nach einer Wache halberfrorenen Gliedmaßen zu nah über dem Feuer erwärmte. Warum hatte er nicht gleich daran gedacht?
Und wo blieb nur der Stadtphysicus?
Er versuchte, der Fremden Hände und Arme zu reiben, doch das schien alles noch schlimmer zu machen. Schließlich nahm er ihre krampfhaft zuckenden Hände zwischen seine. »Ruhig, nur ruhig. Es wird gleich besser.«
Erst als der Schmerz anscheinend nachließ und die hektisch flatternden Bewegungen aufhörten, wagte er, ihr etwas zu trinken einzuflößen.
Herrmann allerdings fand, nun sei es genug der Rücksichtnahme. »Wer bist du, und was treibt dich bei diesem Wetter in die Nacht?«, fragte er ungeduldig. »Weißt du etwas vom Heer des Königs?«
Die Fremde blickte erneut irritiert um sich, dann hakte sich ihr Blick an Herrmann fest. Erst allmählich schien sie zu begreifen, wo sie war und was der Fragesteller von ihr wollte.
Voller Scham über ihr Äußeres raffte sie den Umhang fester um sich, den Jan über sie gelegt hatte, zog die Beine an und kauerte sich unter dem wärmenden Filz zusammen.
»Ich heiße Sibylla«, begann sie, um sofort wieder zu stocken.
Sibylla war nicht ihr wirklicher Name, den hatte sie längst vergessen, doch diesen Namen hatten ihr die Fahrensleute gegeben, mit denen sie durchs Land gezogen war. Aber die Gaukler – für sie ihre Familie – waren alle tot, erschlagen von den Männern des Königs.
Sie konnte die Bilder nicht verscheuchen, sah jeden Einzelnen noch einmal vor ihren Augen sterben.
Samson, den Riesen, hatten die Bewaffneten als Ersten niedergemacht, damit er ihnen nicht gefährlich werden konnte. Dann ließen sie Andres so lange mit seinen bunten Bällen jonglieren, bis der erste Ball zu Boden fiel, um ihm zur Strafe und zu ihrem Spaß einen Arm abzuschlagen. Höhnisch hatten sie den Verblutenden aufgefordert, mit einer Hand zu jonglieren, und als er das nicht tat, schlugen sie ihm auch den anderen Arm ab. Als Andres tot war, schnitten sie den Kindern die Kehlen durch, die sonst immer die Pfennige der Zuschauer einsammelten und nun angesichts des Mordens nicht aufhören wollten zu schreien. Die alte Delia, die Sibylla das Lesen aus der Hand beigebracht hatte, erstachen sie, als sie sich schützend vor die Kleinen werfen wollte. Und dann waren nur noch Honza, der Spielmann, und sie übrig.
»Los, sing uns was vor«, hatte ihn unter dem Grölen seiner Kumpane einer aufgefordert. »Wir lassen dich leben, solange du uns nicht langweilst.«
Und Honza, ihr Liebster, hatte um sein und ihr Leben gesungen. Reim um Reim, grobe Possen, deftige Späße, während die verrohten Kerle ums Lagerfeuer saßen und soffen und die wiederkehrenden Verse mitgrölten. Sibylla sah an seinen Augen, dass er verzweifelt versuchte, die Männer davon abzuhalten, über sie herzufallen. Doch sie wussten beide, dass ihr Schicksal besiegelt war wie das ihrer toten Gefährten. Selbst mit den derbsten Späßen würde Honza die Bewaffneten nicht mehr lange aufhalten können.
»Jetzt gib mir mal die Melodie vor«, hatte bald einer von ihnen gerufen und war auf sie zugegangen, während er zur Belustigung seiner Kumpane anstößig das Becken vor- und zurückbewegte.
»Komm, sei nett zu mir, Schätzchen, dann tu ich deinem Spielmann nichts.«
Es musste wohl der Anführer des Trupps sein, der da breitbeinig auf sie zukam, stiernackig, einen Wolfspelz über der Schulter, mit übelriechendem Atem und bösem Grinsen, während seine Kumpane grölten und ihn anfeuerten.
Sibylla warf ihrem Liebsten einen letzten verzweifelten Blick zu, mit dem sie ihn beschwor, sich nicht einzumischen. Lieber wollte sie erdulden, was ihr bevorstand, als ihn auch noch sterben zu sehen.
Doch während ihr der Anführer mit einem Ruck das Kleid herunterriss, war Honza schreiend auf ihn zugestürmt, die Laute wie eine Keule schwingend. Er kam nicht weit, jemand stieß ihm einen Dolch in die Brust. Noch während der Spielmann zu Boden sackte, war ein Zweiter aufgesprungen und schlug ihm den Kopf ab. Als der enthauptete Leichnam den schmutzig getrampelten Schnee rot färbte, trat der Mörder an ihn heran und hieb dem Toten auch noch die Hände ab.
»Jetzt versuch mal, in der Hölle zu spielen«, knurrte er, während die Männer um ihn herum lachten.
Der Mann packte Sibylla brutal an den Haaren und drehte ihren Kopf so, dass sie den verstümmelten Leichnam ihres Liebsten sehen musste.
»Jetzt zu dir!«, fuhr er sie an und stieß sie zu Boden.
Sibylla wusste nicht mehr, wie viele Männer über sie hergefallen waren; irgendwann war sie ohnmächtig geworden. Dass die anderen sie für tot hielten, rettete ihr das Leben. Als die Bewaffneten, müde und berauscht vom Bier und ihren Untaten, eingeschlafen waren, kam sie vor Kälte schlotternd zu sich, stahl ein verfilztes Schaffell und kroch davon, mühsam, obwohl ihr jeder Zoll ihres Körpers schmerzte.
Sie wusste nicht, wie sie es geschafft hatte, dem Heerlager zu entkommen, und schon gar nicht, wie sie noch so weit hatte laufen können, bis hierher, bis nach Freiberg, ohne zu erfrieren. Die Bewohner der Dörfer, durch die sie unterwegs gekommen war, hatten sie vertrieben, manchmal sogar mit Knüppeln oder Heugabeln.
»Huren und Lumpenpack können wir hier nicht brauchen!«, hatten sie ihr mehr als einmal nachgeschrien.
Vielleicht wäre ihr zu anderer Jahreszeit mehr Mitleid entgegengebracht worden. Aber in diesem harten Winter mussten die Dörfler befürchten, selbst Hungers zu sterben.
Die ungeduldige Stimme Herrmanns riss Sibylla aus der Schreckensstarre, in die sie die Erinnerungen versetzt hatten.
Sie fuhr zusammen und räusperte sich.
»Ich heiße Sibylla«, wiederholte sie mit heiserer Stimme. »Die Truppen des Königs haben mich und meine Gefährten gefangen genommen. Wir sind … waren … Spielleute und fielen ihnen in die Hände, als uns ein Gastgeber an sie auslieferte, um selbst in Ruhe gelassen zu werden.«
Was ihm aber nicht viel genützt hatte, denn auch sein Besitz war rücksichtslos geplündert worden.
»Eine Gauklerin, eine unehrlich Geborene!« Hartmann stöhnte auf. »Und dafür solch ein Aufruhr mitten in der Nacht?«
»Mir ist es gleichgültig, ob sie eine Gauklerin ist oder die Königin von Saba, wenn sie uns Auskunft geben kann, wo das Heer des Nassauers steht«, wies Herrmann ihn unwirsch zurecht und richtete seinen Blick auffordernd auf Sibylla.
»Sie müssen jetzt keine zehn Meilen von hier Richtung Chemnitz sein. Morgen sind sie hier«, sagte sie.
Herrmann ließ sich berichten, was Sibylla noch wusste.
»Es tut mir leid, aber bevor du dich ausruhen kannst, musst du mit mir auf die Burg, zum Kommandanten. Kannst du aufstehen?«
»Darüber entscheide ich«, hörten sie hinter sich eine knurrige Stimme. Sie fuhren herum, um finster von Conrad Marsilius angestarrt zu werden, den niemand von seinem Krankenbesuch hatte zurückkehren hören. Der Tasselmantel und der Bart des Arztes waren voller Schnee, sein graues Haar vom Sturm zerzaust. »Und dreht euch gefälligst weg, während ich sie untersuche!«
Die Wachen gehorchten.
Bedächtig ging der Stadtphysicus auf Sibylla zu, griff beruhigend nach ihren Händen, musterte sie mit unbewegter Miene, dann schlug er den Umhang auseinander und sah, womit er gerechnet hatte.
Nachdem er sie mit sanften Händen untersucht hatte, zog er ein Wachstäfelchen aus seiner Pilgertasche, ritzte mit einem dünnen Stab etwas hinein und gab es Jan.
»Das soll der Apotheker für sie zubereiten.«
Dem Ratsherrn und Arzt war klar, dass diese Patientin ihn nicht bezahlen konnte. Aber niemand würde ihm nachsagen können, er helfe ihr nur aus Mitleid, einer durch und durch weiblichen und somit schwächenden Eigenschaft. Die Apothekenverordnung, die der letzte Stauferkaiser, der Großvater des Meißner Markgrafen, erlassen hatte, schrieb vor, die Armen unentgeltlich zu behandeln. Und wenn sie so wichtige Informationen für den Burgkommandanten hatte, dann sollte der sich darum kümmern, dass der Apotheker bezahlt wurde.
Jan steckte das Wachstäfelchen ein, half der Geschundenen, die bei seiner Berührung zurückzuckte, vorsichtig auf und überließ ihr seinen Umhang. Sie hatten keine Zeit, ein Kleid zu besorgen.
Ulrich von Maltitz war trotz der späten Stunde noch nicht zu Bett gegangen. Er hatte aus alter Gewohnheit Rüstkammer und Proviantlager der Freiberger Burg Freiheitsstein überprüft, darauf geachtet, dass die Burgbesatzung beim Bier nicht über die Stränge schlug, die Wehrgänge abgeschritten und mit den Männern dieses oder jene Wort gewechselt, um sich von ihrer Kampfbereitschaft zu überzeugen.
Den Burgvogt hatte er bei seiner Ankunft auf dem Sterbelager vorgefunden. Nicht einmal Aderlässe konnten dessen Fieber senken, so dass Ulrich sofort das alleinige Kommando übernehmen musste. Am nächsten Morgen konnte er nur noch der trauernden Witwe und ihren Söhnen, zwei jungen Rittern, sein Beileid aussprechen.
Doch er hatte eine gute Mannschaft auf Freiheitsstein vorgefunden: fünf Dutzend Ritter, die teils auf der Burg, teils mit ihren Familien im vorgelagerten Stadtviertel wohnten, dem Burglehn, und noch einmal so viele Wachen unter dem Kommando eines überraschend jungen, aber tüchtigen Hauptmanns namens Markus.
Nun herrschte Stille innerhalb der Mauern, die gelegentlich vom Wiehern eines Pferdes oder Kläffen eines Hundes unterbrochen wurde. Nur wenn man genau hinhörte, war dann und wann ein leises Geräusch zu hören, wenn die Wachen einander trafen und ein paar Worte miteinander wechselten.
Ulrich hielt es nicht auf seinem Platz. Mit dem Becher in der Hand ging er zur Fensterluke und starrte hinaus in die Dunkelheit.
Wo blieb nur Niklas von Haubitz mit seinen Truppen?
Und warum war seit Tagen nicht einer ihrer Kundschafter zurückgekehrt? Sie konnten doch nicht alle dem Gegner in die Hände gefallen sein. Nicht einmal ein paar Bauern, die vor dem feindlichen Heer geflohen waren, brachten Nachricht.
War keiner von ihnen durch den Schnee gekommen? Hatten die Männer des Königs niemanden am Leben gelassen?
Oder war am Ende gar kein Heer gen Freiberg in Marsch? Es gab nicht wenige in der Stadt, die das glaubten oder zumindest hofften. Ulrich gehörte nicht dazu. Diesem König konnte und wollte er nicht trauen. Mochten dessen Anhänger ihn auch als gewandt, liebenswürdig und tapfer bezeichnen – in seinen Augen verkörperte Adolf von Nassau alles, was ein König nicht sein sollte: Er war ehrlos, gierig und gnadenlos gegenüber seinen Vasallen, seinem eigenen Volk.
Und da er im Meißner Markgrafen unter allen Wettinern denjenigen sah, der ihm am ehesten gefährlich werden konnte, war er entschlossen, ihn völlig zu entmachten. Der Schlüssel dazu war Freiberg – die Silberstadt, deren Reichtum legendär war; so unermesslich, dass die Freiberger sogar das Portal ihrer größten Kirche vergolden ließen.
Doch so stark befestigt Freiberg auch sein mochte – die eisige Jahreszeit machte es verwundbar. Die zugeschneiten Gräben um die Mauer konnten nicht geflutet werden, die neun Teiche, die wie eine Kette vor dem Teil der Stadtmauer angelegt worden waren, hinter dem sich die Burg befand, waren zugefroren, so dass die Angreifer jetzt nur noch den Graben und die Mauer zu überwinden hatten.
Gerüchten zufolge sollte der König zehntausend Männer hierherführen, die von allen gefürchteten Söldner vom Rhein. Das waren doppelt so viele, wie Freiberg Bewohner zählte, selbst wenn man die Bergleute und die Juden hinzurechnete, die vor den Stadtmauern lebten.
Sollten es wirklich zehntausend sein, war er nicht sicher, wie lange er Freiberg gegen diese Übermacht verteidigen konnte. Schon die Überzahl der Gegner könnte die Standhaftigkeit der Stadtbürger ins Wanken bringen.
Sie würden jeden Mann zur Verteidigung brauchen, sonst waren sie verloren, selbst wenn Niklas von Haubitz noch vor dem feindlichen Heer auftauchte.
Ulrich hörte Schritte die Treppe heraufpoltern, dann klopfte jemand heftig an seine Tür. Noch bevor er wusste, wer Einlass begehrte, war dem Ritter klar, dass er eine wichtige Nachricht bringen würde.
Statt der bisherigen Ruhelosigkeit verspürte er auf einmal Gelassenheit. Sie hatten getan, was sie konnten, um sich vorzubereiten: die Vorräte aufgestockt, die Wachen verstärkt, die Waffen geschärft und Steine zurechtgelegt, um die Stadttore zumauern zu können.
Er war bereit für den Kampf. Das Warten konnte er nicht länger ertragen. Er wollte Rache für den schändlichen Überfall in Altenburg, Rache für seinen Kampfgefährten Rudolf von Falkenstein und jenen jungen Freiberger, der sich zwischen den Markgrafen und das todbringende Schwert geworfen hatte, Rache dafür, dass der König den Meißner Markgrafen zum Gesetzlosen machen wollte, obwohl das Haus Wettin seit Generationen treu zur Krone stand.
Markus, der junge Hauptmann der Wache, trat auf seinen Ruf hin ein. Auch er schien noch nicht geschlafen zu haben. Sein hellbraunes Haar war mit einem Lederstreifen zusammengebunden wie am Tag, Kleidung und Ausrüstung waren vollständig und wirkten nicht so, als seien sie gerade in aller Eile wieder angelegt worden.
»Zwei Wachen vom Peterstor haben jemanden aufgelesen, der behauptet, geradewegs den Königlichen entkommen zu sein«, erklärte er ohne Umschweife.
Herrmann und Jan wollten vor Ulrich niederknien, doch er wies sie mit einer Handbewegung an, gleich zur Sache zu kommen. Wenn er ihre Gesichter richtig deutete, hatten sie keine Zeit zu verlieren.
Mit unbewegter Miene hörte er zu, was die Männer berichteten.
Dann befahl er Sibylla herein, die auf Anweisung von Markus draußen gewartet hatte. Krampfhaft den geliehenen Umhang zusammenklammernd, versuchte sie eine Verbeugung. Doch dabei wäre sie vor Schwäche beinahe umgefallen, hätte Markus sie nicht aufgefangen und am Arm gestützt.
»Weißt du, wie weit das Heer des Königs entfernt ist und wie viele Männer der König hierherführt?«, fragte Ulrich, während er Sibylla aufmerksam musterte.
Der Anblick der zu Tode erschöpften jungen Frau, die vor ihm kniete, mit Würgespuren am Hals, von Schlägen geschwollenem Gesicht, zerrissenem Kleid und zerkratzten Händen, zeigte überdeutlich, was die Freiberger von den gefürchteten Truppen des Nassauers zu erwarten hatten.
Wären die Spuren des Leides nicht gewesen, hätte sie als Frau sein Interesse wecken können. Sie war unverkennbar eine Schönheit gewesen, bevor die Königlichen ihr das angetan hatten, feingliedrig, mit fast durchscheinender Haut, üppigen schwarzen Locken und dunklen Augen. Doch nun würde sie wohl auf lange Zeit die Nähe eines Mannes nicht ertragen können, dachte er bedauernd. Dabei musste sie einen bemerkenswerten Überlebenswillen besitzen, wenn sie es geschafft hatte, sich in diesem Zustand und durch das Schneetreiben allein nach Freiberg durchzuschlagen.
»Sie werden morgen hier sein, Herr«, sagte Sibylla mit brüchiger Stimme.
Dann zögerte sie, und ihr Blick schweifte ab. »Ich kann Euch keine genaue Zahl sagen. Aber es sind viele, wohl etliche Tausend, mehr, als ich je auf einmal gesehen habe.«
»Hast du etwas darüber gehört, was sie vorhaben?«
»Ja, Herr.« Wieder stockte Sibylla und senkte den Blick. »Sie prahlten mit den Schandtaten, die sie vorhaben, wenn sie Freiberg erst eingenommen haben, und wie sie sich das Silber aus den Truhen der Kaufleute holen. Einer wollte wetten, es würde keine drei Tage dauern, bis das Ultimatum des Königs angenommen sei. Dafür« – sie wirkte auf einmal verunsichert und wankte leicht – »würden Krebs und Katze schon sorgen. Hab’s nicht verstanden. Aber niemand wollte dagegensetzen.«
Ulrich runzelte die Stirn. Natürlich wurde vor der Schlacht immer viel geprahlt unter Männern. Es war wichtig, sie glauben zu lassen, dass sie siegreich aus dem Kampf hervorgehen würden. Aber Freiberg in nur drei Tagen bezwingen? Das konnte bloß zweierlei bedeuten.
Entweder war Adolfs Streitmacht noch größer als befürchtet und hatte neuartige Belagerungsmaschinen, wie gemunkelt wurde. Das könnten »Krebs« und »Katze« sein.
Oder der König wollte den Ratsherren anbieten, ihre Stadt für reichsfrei zu erklären. Dann wäre Freiberg direkt dem König unterstellt. Das passte damit zusammen, dass Adolf die Markgrafschaft sowieso als erledigtes Lehen einziehen wollte.
Wie treu standen die Freiberger Ratsherren zu ihrem Fürsten?
Nicht ohne Mitgefühl musterte Ulrich Sibylla, die nun die Hände über dem zusammengekrümmten Leib verkrampft hielt und deren Augen fiebrig zu glänzen schienen.
Dann wandte er sich an Markus, von dem er wusste, dass er auch ein hervorragender Reiter war. »Reite nach Osten, jetzt gleich, Niklas von Haubitz entgegen. Seine Streitmacht kann nicht mehr weit sein. Sie müssen die Nacht durchmarschieren, damit sie noch vor dem König die Stadt erreichen. Nimm dir zwei deiner besten Männer und Pferde zum Wechseln mit.«
Markus nickte knapp und wollte gehen, um sofort aufzubrechen, doch Ulrich hielt ihn zurück.
»Sag den Wachen Bescheid, damit sie ihre Aufmerksamkeit verdoppeln! Aber niemandem sonst«, befahl er noch. »Ich will, dass die anderen morgen ausgeruht sind. Und jemand soll jetzt gleich den Bürgermeister, den Bergmeister und den Anführer der Leute vom Judenberg zu mir bringen.«
Markus nickte erneut und ging zur Tür, nachdem er Herrmann ein Zeichen gegeben hatte, ihn zu begleiten.
Als Jan ihm folgen wollte, hielt Ulrich ihn zurück.
»Wie ist dein Name?«
»Jan, Herr.«
»Ein Böhme?«, fragte Ulrich mit leicht zusammengekniffenen Augen. Bei den Böhmen war es üblich, aus dem Namen »Johannes« einen »Jan« zu machen.
»Meine Mutter stammt aus Böhmen«, gab Jan Auskunft und strich sich verlegen durch den Lockenschopf. »Aber mein Vater war ein Freiberger Bürger, ein Zimmerer. Sie leben beide nicht mehr.«
»Und da hast du beschlossen, statt der Axt lieber das Schwert zu schwingen?«, meinte Ulrich nicht ohne Sympathie für den jungen Mann.
»Es lag nahe«, antwortete der junge Mann mit verlegenem Grinsen. »Mein Bruder ist der Hauptmann der Wache.«
Erst bei diesen Worten wurde Ulrich die Ähnlichkeit zwischen den beiden bewusst. Sie war ihm nur im schwachen Kerzenlicht nicht aufgefallen. Vielleicht hatte er sich auch davon ablenken lassen, dass dieser Bursche hier wohl erst Mannesalter erreicht hatte und blondes Haar trug, sein wohl fünf Jahre älterer Bruder hingegen braunes.
»Sprichst du die Sprache der Böhmen?«
»Ja, Herr. Mutter hat sie uns beigebracht.«
Dann sollte ich ihn mit zum Markgrafen nehmen, falls er die Belagerung überlebt, dachte Ulrich. Wir müssen bald mit dem böhmischen König verhandeln, der ebenfalls ein Auge auf die Mark Meißen geworfen hat, und da kann es nicht schaden, jemanden dabeizuhaben, der sich unbemerkt ein bisschen unter dessen Leuten umhört.
Vorausgesetzt, dass ich selbst die Belagerung überlebe, fügte er in Gedanken an.
»Gut gemacht, Jan Böhme, sich in der Dunkelheit noch einmal vor das Tor zu wagen«, lobte er den jungen Mann.
»Bevor du zurück zum Peterstor gehst, begleite die Frau zum Apotheker. Wir wollen doch nicht, dass sie zum Dank für die Warnung am Fieber eingeht. Dann bring sie zurück auf die Burg. Eine Schlafstatt wird sich für sie finden.«
Jan zögerte. »Wenn Ihr erlaubt, Herr … ein Vorschlag.«
Ungeduldig forderte Ulrich von Maltitz den jungen Burschen auf zu sprechen.
»Zum Haushalt des Apothekers Jenzin, des Ratsherren, gehört ein Mädchen … sein Mündel …«
Erschrocken sah er, dass der Gesichtsausdruck des Burgkommandanten abweisend wurde. Hastig sprach er weiter, um nicht in Verdacht zu geraten, den Ritter mit Weibergeschichten zu belästigen.
»Sie kennt sich sehr gut damit aus, Salben und Tinkturen zu mischen und Verbände anzulegen. Vielleicht wäre es gut, wenn ich sie gleich auf die Burg mitbringe. Dann kann sie dem Feldscher zur Hand gehen, wenn wir angegriffen werden und es Verletzte gibt.«
Mit der zynischen Abgeklärtheit durch jahrelange Kampferfahrung dachte Ulrich: Wenn wir angegriffen werden, lassen Kräuter abgeschlagene Gliedmaßen nicht nachwachsen. Sofern wir überhaupt Zeit haben, uns um die Verletzten zu kümmern. Und dann müssen wir uns sorgen, wie wir den Gefallenen ein christliches Begräbnis zuteilwerden lassen, wo doch das Erdreich drei Ellen tief gefroren ist. Das einzig Gute an dieser Jahreszeit: Es ist zu kalt, um Seuchen fürchten zu müssen. Doch diese düsteren Gedanken behielt er für sich. Wer weiß, vielleicht konnte ihnen das Mädchen ja wirklich von Nutzen sein.
»Gut. Ich bespreche das morgen selbst mit dem Ratsherrn.«