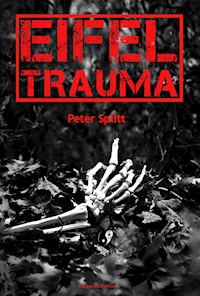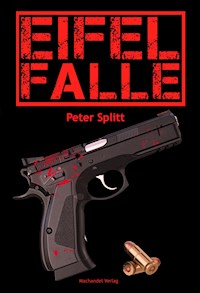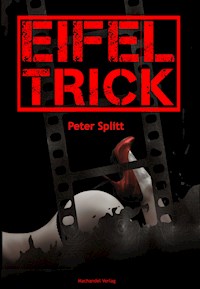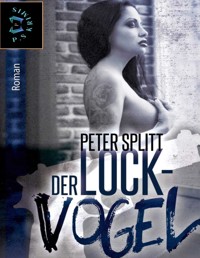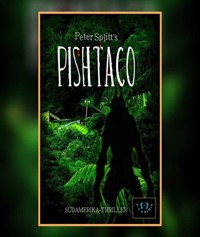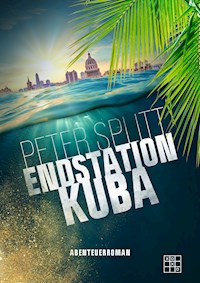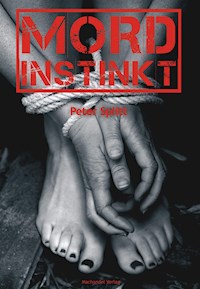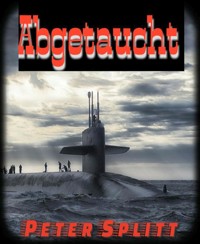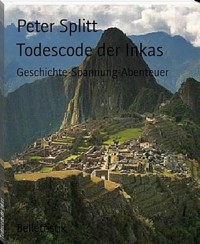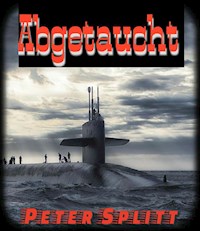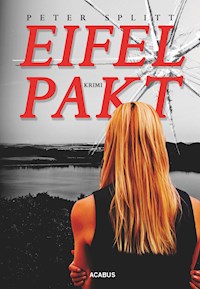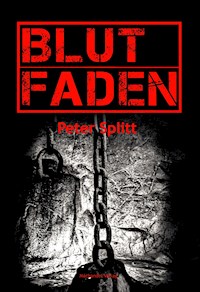
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der erste Fall der Kommissarin Julia Brück In kurzen Abständen werden in Köln drei perfide verunstaltete Männerköpfe gefunden. Weder die junge Kriminalkommissarin Julia Brück noch ihr Chef Gereon habe jemals zuvor derart zugerichtete Opfer gesehen. Und es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt für das Motiv dieser Morde. Entgegen der Anweisungen ihres Chefs verfolgt Julia eine eigene Fährte und versucht, einen Jahrzehnte zurückliegenden Fall in einem ganz anderen Ort mit den drei Morden zu verknüpfen. Sie ahnt nicht, dass sie damit die Büchse der Pandora öffnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Blutfaden
Prolog
Der Mann zog einen Schlüsselbund aus seiner Jackentasche, fingerte nach einem ganz bestimmten Schlüssel, steckte ihn, nachdem er ihn gefunden hatte, in das Sicherheitsschloss und schloss die Tür auf. Sie öffnete sich leicht, wie er zufrieden feststellte. Schließlich musste es jetzt schnell gehen.
Er stieg die ausgetretene Steintreppe hinunter und betrat einen schmalen Gang, der ihn zu einer zweiten Tür führte. Diese hatte er, wie einige andere auch, aus besonders hartem Stahl anfertigen lassen. Er musste grinsen, als er an den Schmied dachte, dem er den Schwachsinn von Türen für Pferdeboxen erzählt hatte, die er komplett erneuern wollte. Die Leute glaubten einfach alles. Die Sicherheitsschlösser hatte er in mühevoller Kleinarbeit selbst eingebaut, das hätte ihm nicht einmal der Schmied abgenommen, dass er die für Pferdeboxen brauchte. Der Mann schloss die zweite Tür auf und stand vor dem schlauchförmigen Eingang des eigentlichen Hauptgebäudes, einer alten Wehranlage. Er liebte dieses alte Gemäuer mit seinen dunklen Gängen und dem Geruch nach Feuchtigkeit und Fäulnis, in dem er schon als Kind gespielt hatte. Wie viele Soldaten mochten seinerzeit hier Unterschlupf gefunden haben?, fragte er sich nicht zum ersten Mal. Beim Umbau hatte er Patronenhülsen, Kartuschen, sowie alte Militärhelme gefunden. Die hütete er seitdem als seinen geheimen Schatz. Es lebten nicht mehr viele von damals, vermutlich war die Anlage inzwischen völlig in Vergessenheit geraten. Dazu befand sie sich auf seinem eigenen Grund und Boden, denn er hatte das Waldgrundstück vor ein paar Jahren zu einem Spottpreis gekauft. Freigegeben zur Nutzung als Freizeit-und Erholungsgrundstück. So stand es jedenfalls im Kaufvertrag. Und genau aus diesem Grund war er jetzt hier – um seiner Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Er hatte den alten Bunker nach und nach mit sehr viel Fantasie zu seinem, wie er es nannte, Labyrinth umgebaut. Im Einzelnen bestand sein System aus verschiedenen Zellen, die durch Türen und Gänge miteinander verbunden waren, wovon die meisten Türen auf Flure leiteten, die im Nichts endeten beziehungsweise wieder zurück in den Hauptgang führten, scheinbar ohne jemals einen Ausgang zu haben. Der befand sich ja auch ganz woanders. Die eigentlichen Zellen hatte er im untersten Stockwerk, möglicherweise im ältesten Teil des Bunkers, angelegt. Von jeder Zelle führte eine kleine Leiter hinauf in den zweiten Stock und durch eine Stahltür in die unterschiedlichen Flure und Gänge. Eine geniale Konstruktion, denn befand man sich in der Zelle und blickte nach oben, sah es so aus, als würde die Tür direkt in die Freiheit führen. Diese kleine Täuschung hatte er bewusst eingebaut. Das Herz der Anlage war ein Überwachungsraum, von dem aus er die Zellen mittels Videokamera überwachen konnte. Der Raum war so etwas wie eine kleine Asservatenkammer, vollgestopft mit Gerätschaften, die er hier und da benötigte. Unter anderem gab es hier einen gut gefüllten Kühlschrank, ein Notstromaggregat, sowie eine Schlafcouch, für den Fall, dass er hier einmal übernachten musste. Er hatte wirklich an alles gedacht. Auch an eine raffinierte Falltür, durch die man direkt in den Zellentrakt gelangte. Er vergewisserte sich, dass alle Kameras einwandfrei liefen, dann zog er sich einen schwarzen Umhang über und setzte die Maske auf.
Für seinen männlichen Gast war es an der Zeit, die Prüfung zu absolvieren. Die notwendigen Vorbereitungen hatte er bereits getroffen. Gleich zu Anfang hatte er dem Kerl ein präpariertes Stachelhalsband um den Hals gelegt und ihn mit einer grobgliedrigen Verlängerung an die Wand gekettet. Der Gefangene hatte laut geschrien und Gift und Galle gespuckt, als er aus seiner Betäubung erwacht war. Genützt hatte es ihm nichts.
Er hatte ihm ganz nüchtern und sachlich die Besonderheit des Halsbandes erklärt. Dass es an einen Zeitmesser gekoppelt war und über eine spezielle Vorrichtung per Funk ausgelöst werden konnte. Dafür hatte er sich extra ein entsprechendes Schaltsystem mit einem leistungsfähigen Sender besorgt. Ansonsten konnte sich sein männliches Opfer in einem gewissen Radius frei bewegen, soweit das in einer kleinen Zelle eben möglich war. Er hatte ihn jedoch ausdrücklich davor gewarnt, den Mechanismus zu manipulieren, da dieser das Halsband ansonsten automatisch zuziehen und ihm die scharfen Spitzen in die Kehle rammen würde. Aus Erfahrung wusste er, sein Gefangener würde alles versuchen, um aus seiner Zelle herauszukommen, und genau darauf hatte er sein Spiel ausgelegt. Er knipste das Licht an und stieg die Treppe hinab. Der Raum, in dem er sein Opfer gefangen hielt, war jetzt hell erleuchtet und kalt.
Der Gefangene hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Angekettet wie ein wildes Tier zerrte er an der Kette, mit der er an der Wand befestigt war. Dann wurde es plötzlich hell. Er sackte zurück, blinzelte nach oben und sah die verkleidete Silhouette auf sich zu kommen.
„Durst“, schrie er laut. Doch es kam nur ein Krächzen aus seiner trockenen Kehle. Er bekam etwas Wasser in einer Art Hundeschüssel hingestellt. Vorsichtig beugte er sich, so gut es die Konstruktion an seinem Hals eben zuließ, vor und trank. Wie lange er hier schon gefangen war, wusste er nicht, es gab hier nichts, das die Zeit gliederte. Er vermutete, dass er sich in einem Kellerraum befand, und dass auch nur, weil er seinen Peiniger von oben hatte herunterkommen sehen. Zudem herrschte eine modrig penetrante Luftfeuchtigkeit, die er einatmen musste.
„Was hast du mit mir vor? Lass mich gefälligst raus! Was soll dieses Scheißhalsband hier?“
Seine Fragen kamen rasch, keuchend, kaum, dass er sich Zeit zum Luft holen dazwischen ließ.
Die Stimme, die ihm antwortete, klang eiskalt.
„Dieses schöne Halsband ist ein wesentlicher Bestandteil deiner Prüfung. Du stehst jetzt vor deinem wahren Richter. Wie viel bedeutet dir dein Leben? Und was bist du bereit, dafür zu tun, um es zu verlängern? Du siehst das kleine Vorhängeschloss am Anfang deines Halsbandes? Der passende Schlüssel dazu steckt in einem Bund mit 50 weiteren Schlüsseln.“
Ein dicker Schlüsselbund fiel scheppernd vor ihm auf den Boden.
„Du hast genau 60 Sekunden Zeit, um ihn zu finden, das Schloss aufzuschließen und das Halsband abzustreifen. Nach Ablauf dieser Zeit lasse ich den Sicherungsmechanismus automatisch zuschnappen und die Spitzen dieses schönen Spielzeugs bohren sich in deinen Hals. Danach kannst du noch einen kurzen Augenblick lang deinen eigenen Tod mitverfolgen.“
Der Gefangene riss die Augen auf, bis das Weiße hervor trat. Er zitterte am ganzen Leib, riss und zerrte noch einmal vergeblich an der Fußfessel. Alle möglichen Gedanken schossen ihm durch den Kopf. 60 Sekunden blieben ihm noch. Nur 60 Sekunden. Welcher dieser verdammten Schlüssel ist der richtige?
Er sah, wie sein Peiniger zynisch grinste und eine Sanduhr auf die Treppe stellte. Es war soweit, die menschliche Uhr tickte …
Der Gefangene bestand die Prüfung nicht. Vielleicht hätte er noch eine Überlebenschance gehabt, wäre er nicht hypernervös gewesen, als er mit zittrigen Händen verzweifelt versuchte, genau den einen Schlüssel zu finden, auf den es ankam. So schnappte die Falle nach 60 Sekunden zu und verrichtete ihre tödliche Arbeit. Die Augen des Mannes traten aus ihren Höhlen, als die Metallzähne seinen Hals zermalmten. Die wenigen Sekunden, die er noch lebte, wurden zu einer nicht enden wollenden Qual, genauso wie es sein Entführer geplant hatte. Der genoss den Anblick ein weiteres Mal, als er sich die Aufzeichnung der Kameras in seinem Überwachungsraum anschaute. Es war ein ganz besonderer Kick, ganze 60 Sekunden lang mit ansehen zu können, wie der Gefangene um sein erbärmliches Leben kämpfte und verlor.
Danach hakte er dessen Namen in Gedanken von seiner Liste ab, ging wieder hinab und räumte die Sauerei auf. Er schmiss den blutigen Körper in eine Schubkarre und brachte ihn in einen anderen Raum. Seine Nasszelle!
Hier hatte er aus Gründen der Sauberkeit auch die Kreissäge aufgestellt. Blutspritzer versauen die unmittelbare Umgebung in Sekunden, wie er aus Erfahrung wusste, deshalb war der geflieste Boden mit einem Ablauf direkt in die Sickergrube eine durchaus lohnende Investition gewesen. Er spürte erneut freudige Erregung in sich aufsteigen, als er die Säge anwarf. Sie fraß sich durch Fleisch und Knochen, mitten durch sein Opfer. Den Kopf trennte er sauber vom Torso ab. Damit hatte er noch etwas ganz Besonderes vor. Blut spritzte auf den gefliesten Boden. Auch die Säge war blutverschmiert, als er schließlich sein Werk vollendet hatte. Er blickte auf seine Armbanduhr und nickte mit Genugtuung. Er war immer noch pünktlich. Es war 21 Uhr. Zeit, nach Hause zu fahren. Seine Frau würde bestimmt schon auf ihn warten. Nur gut, dass sie die Geschichte mit den Überstunden und den Sonderschichten geschluckt hatte. So blieb ihm genügend Freiraum für seine Zeremonien, beziehungsweise für die Vorbereitungen darauf.
Bisher hatte sie nie Theater gemacht, wenn er erst spät am Abend heimkam. Ganz im Gegenteil, dann war sie besonders zugänglich und verwöhnte ihn umso mehr. Schließlich war die verdammte Arbeit an allem schuld!
Kapitel 1
Julia Brück, Kripo Köln. Fast feindselig starrte ich das kleine Namensschild auf meinem Schreibtisch an und fragte mich nicht zum ersten Mal, was zum Teufel ich hier überhaupt noch machte. Ich saß wieder an diesem Fall, der in der Öffentlichkeit so viel Aufsehen erregt hatte und der tagelang durch die einschlägige Presse gegangen war. Zwei dicke Aktenordner befanden sich in unserem Archiv und ein Teil der Festplatte meines Computers war gefüllt mit ekelhaften Fotos und Details über die grausame Tat eines Mannes, der nach Meinung aller Befragten als unscheinbar, farblos und zurückhaltend galt. Um so mehr waren die Menschen überrascht und schockiert gewesen, als sich herausstellte, dass Edgar Wiese, Anfang sechzig, mit obsessiver Triebhaftigkeit seine eigene zehnjährige Enkelin über mehrere Jahre hinweg missbraucht hatte. Ich zoomte sein Foto groß auf meinen Computerbildschirm und betrachtete sein blasses, nichtssagendes Gesicht. Das Besondere daran waren die Augen. Mir lief ein kalter Schauder den Rücken hinunter, glaubte ich doch eine eiskalte Grausamkeit darin zu erkennen. Oder war das einfach nur Einbildung, weil ich wusste, was der Mann getan hatte?
Wie dem auch sei, der Mann war menschlicher Abschaum. Leider brachte die Welt immer wieder seinesgleichen zum Vorschein. Und es war meine verdammte Pflicht als Polizistin, Menschen vor solchen Ungeheuern zu beschützen. Besonders deprimierend war es allerdings, wenn wir Kriminalbeamte nach langer Ermittlungsarbeit endlich solch ein menschliches Monster gefasst hatten, und irgendein weltfremder Richter strafte den Kerl dann mit einem viel zu milden Urteil ab. So geschehen im Fall Edgar Wiese, der sage und schreibe nach abgesessenen zweieinhalb Jahren Knast wieder das Licht der Freiheit genießen durfte. Die entsprechende Nachricht erschien heute Morgen auf Facebook und ich war einfach nur fassungslos, als ich sie las. Trotz meiner Erfahrung bei der Kripo bringt mich so etwas noch immer in Rage.
Nachdenklich drehte ich meinen Stuhl zum Fenster hin, blickte nach draußen, wo sich die Lichter der Großstadt in den Glasscheiben widerspiegelten, und ließ meinen Gedanken freien Lauf. Nach einer Spätdienstwoche fieberte ich dem kommenden Wochenende entgegen. Zusammen mit meiner besten Freundin Alex wollte ich nach Holland fahren. Zugegeben, konkrete Pläne hatte ich noch keine. Nur, dass ich ans Ijsselmeer wollte. Matjes essen, Fahrradfahren und relaxen – das volle Programm.
Obwohl ich jetzt seit mehreren Jahren in Köln wohnte und arbeitete, war ich noch nie am Ijsselmeer gewesen. Es wurde höchste Zeit, mir einen Ausflug in die erweiterte Umgebung zu gönnen. Außerdem sehnte ich mich danach, ein ungestörtes freies Wochenende mit Alex zu verbringen. Nur wir zwei. Keine Kriminalfälle und keine menschlichen Tragödien. Alex war Sozialarbeiterin von Beruf. Streetworkerin, wie man im Sprachgebrauch so schön sagte, und ihr Job hatte es genau so in sich wie meiner. Wahrscheinlich saß sie jetzt im Sozialkaffee Hoffnung und hörte sich traurige Geschichten von jungen Menschen an, die irgendwie auf die schiefe Bahn geraten waren.
Noch während ich das dachte, knallte es auf der gegenüberliegenden Seite des Schreibtisches laut. Dort saß mein Chef, Hauptkommissar Klaus Gereon, und es war ganz offensichtlich seine Faust, die gerade die Oberfläche seines Schreibtisches malträtiert hatte.
„Ich möchte mal gerne wissen, wann du endlich in die Gänge kommst, Julia!“, keifte er mit hochrotem Gesicht, das mich irgendwie an einen Wasserbüffel erinnerte. Gereon war Choleriker und hatte wahrscheinlich schon in seiner Jugend wesentlich älter ausgesehen als er war. Dazu kam, dass sich die Falten an Stirn und Wangen im Laufe der Jahre zu wahren Rinnen vertieft hatten. Sein einstmals dichtes und schwarzes Haar war inzwischen grau und schütter geworden. Sein tatsächliches Alter war schwer zu schätzen. Ich hatte nie danach gefragt, vermutete nur, dass es irgendwo zwischen Anfang und Mitte Fünfzig lag.
„Vor einer viertel Stunde ist die Meldung vom Fühlinger See eingegangen. Die Kollegen von der LAPO haben um Amtshilfe gebeten, weil sie gerade niemanden frei haben, der sich um die Angelegenheit kümmern kann. Und du bist noch nicht einmal aufgestanden“, meckerte er weiter. „Soll ich denn alles alleine machen? Auf dem See soll ein Kajak herrenlos im Wasser treiben. Tu endlich was! Und nimm den Walter mit!“
Ich kannte ihn und versuchte cool zu bleiben. Wenn Gereon einmal in Rage kam, dann ließ man ihn am besten toben. Er sah mich jetzt direkt an, wobei das Neonlicht schräg in sein Gesicht fiel und die Falten noch tiefer erscheinen ließ. Der Mann sah wie ein Schlaganfallkandidat aus und ich wollte ihn nicht noch weiter aus der Fassung bringen. Ich verkniff mir daher jeglichen Hinweis auf diverse Höflichkeitsfloskeln und nahm ihm den Wind aus den Segeln.
„Geht klar, Chef. Ich schnappe mir den Walter, und dann fahren wir hinaus nach Fühlingen und checken die Lage.“
„Ja, zeig mal, wie anständige Arbeit geht! Ich brauche jemanden, der sich an Ort und Stelle vergewissert, ob alles in Ordnung ist. Ansonsten steht morgen wieder in der Zeitung, dass die Polizei nichts unternimmt.“
Ich nickte, obwohl mir die Sache ganz und gar nicht schmeckte. Schließlich war ich von einem einigermaßen ruhigen Abend ausgegangen und befand mich im Geiste bereits bei den Vorbereitungen für das Wochenende. Ich wollte den Wagen waschen lassen und noch ein paar Dinge für die Fahrt besorgen. Außerdem wollte ich Mrs. Willieby gut versorgt wissen, wofür eigentlich nur meine Nachbarin Frau Engelshorn in Frage kam. Sie hatte mir bereits zugesagt, sich um meine Main Coon Katze zu kümmern.
„Wer hat denn den Unfall gemeldet?“, fragte ich vorsichtig. Gereon räusperte sich und reichte mir einen gelben Notizzettel.
„Ein gewisser Roy Dickmann. Von einem Unfall hat er allerdings nicht gesprochen. Das ist reine Spekulation. Der Mann hat ausgesagt, er sei mit seiner Freundin am See spazieren gegangen und habe dabei das Kajak entdeckt, das ist alles.“
Ich stand auf, nahm meine Lederjacke von der Stuhllehne und verließ das Büro. Draußen auf dem Flur atmete ich tief durch. Gereon konnte ein richtiges Ekelpaket sein. Vor allem, wenn er so schlecht drauf war wie heute. Ein leer herumdümpelndes Kanu war doch kein Kripo-Fall! Das hätte er jedem Dorfsheriff andrehen können. Scheiß Spätdienst, dachte ich und ging die Treppe hinunter in den ersten Stock. Hier hatten die Kollegen von der Bereitschaft ihren Arbeitsplatz. Ohne anzuklopfen öffnete ich die Tür des Zimmers mit der Nummer 18 und musste fast laut loslachen. Der Kollege Walter Behringer saß hinter seinem Schreibtisch und las Zeitung. Seine Füße lagen auf der Tischplatte, sein Stuhl wippte und neigte sich dabei gefährlich nach hinten. Seine ausgelatschten Turnschuhe ragten prominent in mein Blickfeld, schafften es aber nicht, seine verwaschene Jeans und ein zu großes Polohemd zu verdecken. Sein strähniges Haar war nach hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und auch sein verlebtes Gesicht konnte eine gewisse Lebenseinstellung nicht verbergen.
„Na, du Faulpelz! Hast du nichts zu tun, oder was?“
Walter blickte von seiner Zeitung auf und strahlte mich an.
„Ach du bist das, Julia. Sieht fast so aus, oder? Ich komme sogar dazu, die Zeitung zu lesen.“
Walter war erst vor einem Jahr zu uns gestoßen. Seitdem arbeitete er als Springer in den unterschiedlichen Dezernaten. Meistens wurde er dort eingesetzt, wo gerade Not am Mann war, was in diesem Augenblick allerdings nicht der Fall zu sein schien.
„Schluss mit lustig, Walter! Befehl vom obersten Häuptling. Du sollst mit mir hinaus zum Fühlinger See fahren. Es hat eine Meldung gegeben.“
Walter blickte auf seine Armbanduhr. „Um diese Zeit noch? Es ist bereits kurz nach neun. Ich meine, was soll denn da draußen schon los sein? Ja, wenn wir Sommer hätten, dann wäre das natürlich etwas anderes, aber so …“
Er hatte nicht ganz Unrecht. Im Sommer hatte der See Hochkonjunktur. Wassersportler, Radfahrer und Spaziergänger bevölkerten bis spät in die Nacht hinein die Gehwege am Ufer. Jetzt, mitten im Herbst, war dort nicht mehr viel los. Ich zuckte mit den Achseln. „Ein herrenloses Kanu. Hat vermutlich eine ganz harmlose Erklärung. Aber Gereon will´s so haben, also tun wir ihm den Gefallen und klären das. Lass uns kurz nach Fühlingen fahren und nach dem Rechten sehen. Kommst du? “
„Jaaaa“, kam es wenig begeistert zurück. Er blickte mich verstohlen von der Seite an, nahm seine langen Beine von der Schreibtischplatte und erhob sich.
Gemeinsam verließen wir das Polizeigebäude und gingen hinunter auf den Hof, um eines der Dienstfahrzeuge in Beschlag zu nehmen, welche die Fahrbereitschaft uns Beamten zur Verfügung stellte. Draußen blickte ich in das Lichtermeer der Kölner City, welches scheinbar nirgendwo enden wollte. Ich mochte diese Stadt, ihr besonderes Flair und die Lebensfreude der Menschen. Walter ging auf einen blitzblank geputzten Passat zu. Dabei fasste er sich unbewusst an den Bauch. Zu wenig Bewegung und unregelmäßige Mahlzeiten hatten ihm ein chronisches Magenleiden beschert. Dazu rauchte er auch noch wie ein Schlot. Auch jetzt, während die Fernbedienung das Auto entriegelte, zückte er bereits wieder die Zigarettenschachtel.
„Denk nicht mal dran!“, sagte ich bestimmt, weil ich meinen Pappenheimer kannte.
„Nur ein paar Züge, so viel Zeit muss sein“, bat er und griff nach seinem Feuerzeug. „Hast du schon von Wiese gehört?“, fuhr er fort, vermutlich, um vom Thema Rauchen abzulenken. Dabei zog er bereits an seiner Zigarette und blies den blauen Dunst gierig in den Himmel. Ich ließ ihm sein Ablenkungsmanöver durchgehen und bejahte.
„Der wird wieder auf freien Fuß gesetzt. Dabei steckt uns der Fall immer noch in den Knochen. Der Kerl hat sich an seiner eigenen Enkelin vergangen. Kannst du dir das vorstellen?“
Ich schüttelte den Kopf, wohl wissend um die Abgründe menschlicher Grausamkeit, und sah zu, wie Walter den Rauch seiner Zigarette inhalierte.
„Hat Gereon den Fall damals bearbeitet?“, fragte er.
„Höchst persönlich! Und jetzt speit er Gift und Galle, weil der Dreckskerl wieder frei kommt.“
„Das kann ich dem Boss gut nachfühlen. Lächerliche zweieinhalb Jahre Gefängnis hat Wiese nur gekriegt. Dabei hätte man ihm die Eier abschneiden sollen. Aber die Welt wird immer verrückter. Ich find´s echt zum Kotzen. Jede Rentnerin, die schwarz fährt, bekommt eine hohe Strafe aufgebrummt. Aber der? Sich an kleinen Kindern vergehen, das geht gar nicht!“
Ich atmete tief aus, spürte wie meine Wangen heiß wurden. „Leider hat der Richter das ganz anders gesehen. Was stimmt mit dem nicht? Bitte sag es mir. Ich frage mich, wie ein gesunder Menschenverstand solch ein Urteil fällen kann. Der hat sicher keine eigenen Kinder.“
Ich hatte mich wieder in Rage geredet, wie immer bei so einem emotionalen Thema.
Walter antwortete nicht, zog nur noch schneller an seiner Zigarette, und ich versuchte, wieder das Thema zu wechseln.
„Darüber könnte ich mich stundenlang aufregen, aber lassen wir das. Was war denn bei dir inzwischen los?“
Walter seufzte herzzerreißend.
„Nichts Besonderes“, antwortete er. „Bei Irene hat der Imbiss gebrannt. Du kennst doch Irene, oder nicht?“
„Meinst du die Krähe von der Bruzelbude unten am Rheinufer?“
„Genau die meine ich.“
„Na, der hätte man schon viel früher die Bude abfackeln sollen, so wenig, wie die das Frittenfett wechselt.“
„Aber Julia …“
„Hat es Verletzte gegeben?“
Walter zog weiter an seinem Glimmstängel.
„Nur Irenes Koch, und der war sturzbetrunken. Hat wahrscheinlich auch den Brand verursacht. Wir mussten ihn in Schutzhaft nehmen.“
Ich hob erstaunt die Augenbrauen. „Schutzhaft?“
„Na klar, Irene hat gedroht, ihn umzubringen.“
Ich musste lachen. „Sonst noch Fälle, die kein Mensch braucht?“
„Jau. Irgend so ein Dödel hatte unweit des Hauptbahnhofes einen Gullideckel auf die Bahngleise geworfen und damit ein ganz schönes Chaos verursacht. Und den Wasserrohrbruch in Inges Büdchen hast du ja sicher von deinem Fenster aus mitbekommen. Fahren wir?“
Ich nickte, worauf er seinen Zigarettenstummel in einen Gully warf und ich mahnend meinen Zeigefinger hob. Grinsend stieg er in den Dienstwagen und öffnete mir die Beifahrertür. Sobald ich saß, fuhren wir los. Zunächst ging es stadtauswärts in Richtung Chorweiler. Als wir uns der Trabantensiedlung näherten, musste ich unwillkürlich an all die Menschen denken, die wie Tiere in einem Käfig in den Hochhäusern des Vorstadtsilos hockten. Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie sie hinter ihren Fenstern saßen und sehnsüchtig in die Ferne starrten, auf der Suche nach etwas, das sie niemals erreichen konnten. Bei diesen Gedanken wurde mir leicht schwindelig und ich öffnete das Seitenfenster des Dienstwagens. Die frische Luft half sofort. Ich versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was vor uns lag. Eine lapidare Meldung, dachte ich. Damit bekamen wir Polizisten es immer wieder zu tun.
Der Verkehr auf der Straße entzerrte sich, je weiter wir uns von der Innenstadt entfernten. Der Fühlinger See bildete ein Dreieck zur Neusser Landstraße und zur Autobahn A1. Die Ford Werke rechts davon nahm ich kaum noch zur Kenntnis. Beim Tennisverband Mittelrhein bogen wir rechts in die Merianstraße ab. Im Vordergrund tat sich der See jetzt ruhig und dunkel vor uns auf. Von dem hektischen Nachtleben einer großen Stadt war hier nichts mehr zu spüren. Nur ab und zu tauchten die Scheinwerferlichter eines vorbeifahrenden PKWs auf. Wahrscheinlich handelte es sich um ein Liebespärchen, das nach einem einsamen Plätzchen suchte oder um einen Hundefreund, der noch mit seinem Vierbeiner eine Runde drehen wollte. Walter lenkte den Passat auf den Parkplatz in Höhe des Pavillons. Ein junger Mann stand dort vor einem aufgemotzten Japaner mit feuerroter Metallic-Lackierung und wedelte wild mit den Armen. Auf dem Beifahrersitz saß eine junge Frau mit wasserstoffblond getönten Haaren und rauchte. Walter hielt neben dem tiefer gelegten Flitzer auf dem Kiesufer und nahm in Kauf, dass die kleinen Steinchen gegen den Unterboden des Dienstwagens spritzten.
„Haben Sie angerufen?“, fragte er, nachdem er ausgestiegen war.
„Wurde auch langsam Zeit, dass endlich jemand kommt. Ist ja schon eine Ewigkeit her, seit ich bei euch angerufen habe“, begrüßte uns der junge Typ, dessen Hose in quadratisch, praktisch, gut die richtige Bezeichnung fand. Ich war inzwischen auch ausgestiegen und zeigte ihm meinen Dienstausweis, nannte ihm meinen Namen und versuchte ihn erst einmal ein wenig zu beruhigen.
„Immer schön mit der Ruhe, junger Mann. Wir sind ja jetzt da. Am besten Sie zeigen uns einfach die Stelle, wo das Kajak im Wasser treibt, und wir schauen nach dem Rechten. Walter, bringst du bitte die Taschenlampen mit …“
Er tat es und wir gingen los.
Das Gelände zum Ufer des Sees hin war stockdunkel. Wir leuchteten den Pfad mit unseren Taschenlampen aus, während der junge Mann unaufhörlich drauflos plapperte und uns mit seiner Entdeckung nervte. Es dauerte nur ein paar Minuten, da hatten wir das Ufer erreicht. Ein Stück weiter oben lag etwas Länglich-Gelbes im flachen Wasser. Der Wind musste das Kajak an den Rand des Ufers getrieben haben. Jetzt brauchten wir niemanden mehr, der uns den Weg wies. Ich bat den jungen Mann, zurückzubleiben, während Walter und ich uns dem Kajak näherten.
Stille. Auf den ersten Blick konnten wir nichts Ungewöhnliches feststellen. Bis auf die Tatsache natürlich, dass das Kajak führerlos war. Wir gingen näher heran. Walter leuchtete mit der Taschenlampe das Innere des Wasserfahrzeugs aus. Im Fußraum war etwas eingeklemmt. Er lenkte den Strahl seiner Taschenlampe genau auf die Stelle. Etwas Blaues leuchtete ihm entgegen. Ein Müllsack der Stadt Köln, oben zugeknotet.
„Können die Leute ihren verdammten Müll nicht …“, war der Anfang eines Satzes, den ich nicht mehr zu Ende bringen konnte, weil mein Kollege bereits die Handschuhe angezogen hatte und an dem Müllsack zerrte. Der schien einiges zu wiegen, denn er bewegte sich nicht. Also wickelte Walter die beiden Enden des Knotens um seine Finger und zog noch fester. Der Müllsack löste sich langsam und Walter befreite ihn endgültig mit einem letzten, kräftigen Ruck. Geschickt machte er sich daran, den Knoten zu lösen und ich bemerkte im gleichen Moment diesen penetranten Verwesungsgeruch, der von Sekunde zu Sekunde immer intensiver wurde. Mein Kollege zog die geöffnete Plastikfolie auseinander und taumelte erschrocken zurück. Ach du heilige Scheiße!
Ich wollte nachsehen, was los war, aber Walter hielt mich zurück.
„Vorsicht! Das ist kein schöner Anblick, Julia!“
Voller böser Vorahnung ging ich in die Hocke um besser sehen zu können. Der Schein meiner eigenen Taschenlampe fiel auf den geöffneten Müllsack, aus dem mir eine grausige menschliche Fratze entgegenstarrte. Ich schluckte und ließ mich auf den Boden fallen. Den Anblick musste ich erst einmal verdauen. Walter setzte sich neben mich und steckte sich mit zittrigen Händen eine Zigarette an. Dieses Mal beschwerte ich mich nicht. Ich nahm meine Taschenlampe in die Hand und leuchtete wieder in den Müllsack. Was ich gerade noch mit Entgegenstarren bezeichnet hatte, musste ich sofort revidieren. Die Fratze konnte mich gar nicht anstarren, denn die Augen waren auf groteske Weise verschlossen worden. Genauso wie die Nase, der Mund und die Ohren. Das eingefallene Gesicht glich dem einer alten ägyptischen Mumie. Beim zweiten Hinschauen realisierte ich die waren Ausmaße des Grauens. Jemand hatte dem männlichen Kopf mit schwarzen Fäden sämtliche Gesichtsöffnungen zugenäht.
Mir wurde kotzübel. Ich stand wieder auf, wollte dem entgehen, was ich gerade gesehen hatte, da hörte ich die Rufe des jungen Mannes, der jetzt langsam näher kam.
„Hey, was ist denn da? Dauert es noch lange oder kann ich jetzt gehen? Ich muss noch meine Kleine nach Hause fahren!“
Der hatte mir gerade noch gefehlt. Ich riss mich zusammen und agierte wie aus dem Lehrbuch.
„Bleiben Sie genau dort stehen, wo Sie sind“, befahl ich ihm, zog dabei mein Handy aus der Jackentasche und wählte Gereons Nummer. Irgendwo weiter weg auf der Merianstraße brummte ein Auto. Gereon meldete sich und ich erzählte ihm mit zittriger Stimme, aber so leise wie möglich, um unseren Zeugen nicht zu verschrecken, was wir entdeckt hatten. Einen Augenblick lang herrschte völlige Stille. Gereon sagte kein Wort. Meine Nachricht schien ihn vollkommen umzuhauen. Ich wiederholte meine Worte. Jetzt reagierte er, murmelte Ach du dicke Scheiße, genauso wie mein Kollege Walter vor ein paar Minuten, und legte einfach auf.
Da ich meinen Chef kannte, wusste ich genau, was jetzt kam. Gereon würde den üblichen Apparat in Bewegung setzen und bald schon würde es hier von Polizeitechnikern wimmeln. Mir taten die Kollegen von der Spurensuche jetzt schon leid, die nach weiteren Leichenteilen suchen mussten. Sicher hatten sie sich genauso wie ich, auf ein entspanntes Wochenende gefreut. Auch Walter machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, als ihm dämmerte, dass seine Freizeit immer mehr in weite Ferne rückte. Dazu kam das Gefühl des Grauens, der Ohnmacht und der Hilflosigkeit, die der verunstaltete Tote bei uns ausgelöst hatte.
Als wir lange nach Mitternacht zurück in die Stadt fuhren beschlich mich so eine bestimmte Ahnung, dass dieser Mord uns noch viele schlaflose Nächte bereiten würde. Das tatsächliche Ausmaß des Grauens, welches uns noch bevorstand, erahnte ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.
Stunden später, ein strahlender Oktobersamstag, saß ich in unserem muffigen Büro in Köln, anstatt am Ijsselmeer in Holland. Es war genauso gekommen, wie ich es vorausgesehen hatte. Gereon hatte beinahe eine ganze Zehnerschaft an Technikern plus eine Hundestaffel hinaus an den Fühlinger See beordert, die bis in die frühen Morgenstunden das weiträumig abgesperrte Ufer durchkämmten, absuchten und durchforsteten. Dabei wurde alles erfasst, was nur irgendwie analysiert und zugeordnet werden konnte. Bodenproben, Fußspuren, Fingerabdrücke, Haare, Fasern und dergleichen. Diese mutmaßlichen Spuren würde man zusammen mit dem Kajak akribisch unter die Lupe nehmen. Der so grausam verunstaltete männliche Kopf lag bereits auf einem stählernen Autopsietisch in der Gerichtsmedizin und wurde von Martin Kraut, unserem Chef-Forensiker, akribisch untersucht. Ich brannte darauf, die ersten Ergebnisse zu bekommen, hatte ich mich doch gestern noch selbst an der Suchaktion beteiligt. Allerdings, gefunden hatten wir nichts. Keine weiteren Leichenteile, keine Kleidungsstücke oder persönliche Dinge. Nichts, was auch nur im Entferntesten auf die Identität des Toten hinwies. Im Morgengrauen waren die Kollegen von der Spurensuche noch einmal hinaus nach Fühlingen gefahren, aber ich bezweifelte, dass sie noch etwas finden würden. Blieb die Aussage unseres Zeugen. Sie lag in schriftlicher Form auf meinem Schreibtisch und wartete darauf, dass ich den Inhalt in den Computer eingab.
Name: Roy Dickmann
Anschrift: Seelenstraße 4 in Köln
Alter: 29
Beruf: Gas und Wasserinstallateur.
Ich hatte Dickmann gestern noch einmal ausführlich befragt und dann nach Hause geschickt. Der einzige Widerspruch in seiner Aussage lag darin, dass er offenbar nicht mit seiner Freundin spazieren gegangen war, wie er zuerst am Telefon ausgesagt hatte. Das war zwar einigermaßen verwirrend, machte ihn aber nicht gleich zu einem Verdächtigen. Es gab schließlich viele andere Dinge, die ein junges Pärchen miteinander tun konnte. Ich checkte im Computer die Daten und Infos, die ich finden konnte. Doch Roy Dickmann besaß eine völlig reine Weste. Gegen ihn lag polizeilich nichts vor. Als ich für einen kurzen Augenblick von meinem Bildschirm aufblickte, sah ich, wie Gereon mich von der offenen Tür aus beobachtete. Seine Mundwinkel hingen nach unten, er sah völlig übermüdet aus.
„Haben wir schon was?“, fragte er leise. Ich verneinte und spielte nervös mit der Computermaus. „Kraut will sich nach der Mittagspause melden“, fügte ich schnell hinzu, um irgendetwas sagen zu können. Auf einmal merkte ich, dass mein Vormittagskaffee noch immer unberührt und kalt neben meinem Computer stand. Ich hatte das Getränk völlig vergessen.
„In Ordnung“, sagte Gereon, machte eine leichte Drehung und war schon wieder irgendwo draußen auf dem Gang verschwunden.
Kapitel 2
In der Mittagspause ging ich hinüber zu Inge. Ihr Verkaufsbüdchen lag direkt gegenüber von unserem Polizeipräsidium und war ein echtes Kleinod des Großstadtlebens. Hier bekam man ungefragt die richtige Zigarettenmarke auf den Tresen gelegt, und mit einer bunten Tüte Süßigkeiten konnte man sich zurück in die eigene Kindheit beamen. In ihren Regalen standen Dosenravioli direkt neben dem Klopapier. Es gab alles für den täglichen Bedarf, ohne dass man gleich den nächsten Supermarkt aufsuchen musste. Süßigkeiten wie Mäusespeck, doppelte Schnüre und fiese CenterShocks gehörten zu Inges Sortiment genauso dazu wie warme Bockwurst, Pommes Frites, Dosenfutter und Filterkaffee. Sie hatte sich einen Kittel übergezogen und sah darin aus wie die liebenswürdige Miss Marple aus dem Rheinland, eine leicht übergewichtige Frau, die man einfach mögen musste.
„Hallo Inge, wie geht’s dir?“, begrüßte ich sie freundlich. Sie unterbrach ihr Kreuzworträtsel und sah zu mir auf.
„Ach, du bist das, Julia. Um deine Frage zu beantworten, es geht so. Mein Büdchen und ich haben schon bessere Zeiten gesehen. Verfluchter Rohrbruch! Das war vielleicht eine Bescherung. Und meine Enkelin Ramona war mal wieder nicht zu erreichen, wenn man sie braucht. Mutterseelenallein durfte ich alle Regale ausräumen, sauber machen und dann wieder einräumen. Aber jetzt bin ich aus dem Gröbsten heraus. Was kann ich Gutes für dich tun?“
„Gibt es noch was Warmes? Ich möchte mich draußen auf die Bank setzen. Ist so schönes Wetter heute“, erklärte ich ihr.
„Nur Bockwurst und Kartoffelsalat. Heute ist Samstag, da gibt es keinen Eintopf.“
Ich nahm die Wurst mit dem Salat, Inge packte mir alles auf einen Pappteller und verschloss das Ganze mit Alufolie. Beim Herausgehen wäre ich beinahe mit Willi Matuschek zusammengestoßen. Der war auch so ein Unikum aus dieser Gegend und Stammgast in Inges Büdchen. Er war Mitte sechzig und hatte eine Stirnglatze, hinter der sich seine restlichen Härchen zu einem grauen Kranz kräuselten. Wie immer trug er einen blauen Arbeitsoverall, der geschickt seine dicke Wampe verdeckte. Matuschek war frühpensionierter Schreiner, verdiente sich aber als Hausmeister ein Zubrot.
„Mahlzeit, junge Dame“, neckte er mich und trat lachend zur Seite. Ich klopfte ihm auf die Schulter, trat hinaus auf die Straße und ging zurück zum Polizeipräsidium. Die nächsten 20 Minuten verbrachte ich auf der kleinen Bank in unserer Grünzone und um 13 Uhr war ich pünktlich wieder im Büro. Keine Minute später klingelte schon das Telefon. Ich hob ab, obwohl ich noch nicht einmal meine Jacke ausgezogen hatte.
„Kraut“, meldete sich eine männliche Stimme am anderen Ende. „Ich habe gerade den abgetrennten Schädel von gestern in der Mangel. Möchtest du die ersten Details hören?“
Ich war gespannt wie ein Flitzebogen. „Schieß los!“, forderte ich ihn auf.
„Okay. Er gehört zu einem Mann, ca. 40 bis 50 Jahre alt, weiße Hautfarbe. Wahrscheinlich ist er schon sechs Monate tot.“
„Dafür ist er aber noch verdammt gut erhalten“, entfuhr es mir spontan. Ich stellte mir vor, wie Kraut mir nickend zustimmte.
„Und genau da haben wir schon eine der Besonderheiten. Der Schädel muss kühl gelagert worden sein. Ansonsten wäre die Verwesung viel weiter fortgeschritten.“
„Du meinst, jemand hat ihn in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt?“
„Wenn ich das wüsste. Es wäre zumindest eine Möglichkeit.“
Ich musste unwillkürlich an BoFrost denken, auch wenn mir ganz und gar nicht zum Scherzen zumute war.
„Wie sieht es mit der Todesursache aus? Kannst du mir darüber etwas sagen?“, fragte ich schnell, um mich selbst von meinen kuriosen Gedanken abzulenken.
„Erst wenn ich die Röntgenaufnahmen habe. Steht dann alles in meinem Bericht, wenn ich fertig bin. Ist Gereon da?“
„Im Augenblick nicht.“
„Auch gut, dann komme ich später noch zu euch rüber.“
„Immer gern“, erwiderte ich, bedankte mich für die Info und legte auf. Insgeheim bewunderte ich, mit welcher Schnelligkeit Kraut bereits einige wichtige Informationen herausgefunden hatte. Männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, weiße Hautfarbe. Wahrscheinlicher Todeszeitpunkt: Innerhalb der vergangenen sechs Monate. Damit ließe sich vielleicht schon etwas anfangen. Ich dachte an die Liste der vermissten Personen und beschloss, den Computer nach den entsprechenden Kandidaten zu befragen. Endlich zog ich meine Jacke aus und hing sie über die Stuhllehne. Danach tippte ich die Angaben, die mir Kraut gerade durchgegeben hatte, in den Rechner und wartete. Die Seite baute sich auf.
Als erster erschien ein gewisser Werner Schmitz. Männlich, 48 Jahre alt, verschwunden am 09. Juni. Dann kam Michael Lang, 42 Jahre alt. Seine Frau hat ihn am 30. Mai als vermisst gemeldet. Willie Nippes, 45 Jahre alt. Männlich, weiß, am 16. Mai als vermisst gemeldet. Georg Gruner, 46 Jahre alt. Männlich, weiß, gilt seit dem 04. Mai als vermisst und Peter Schäng, 49 Jahre alt. Männlich, weiß, seit dem 30. März vermisst.
Das war´s. Der Computer hatte genau fünfzehn Personen gefunden, die im Großraum Köln seit ungefähr sechs Monaten vermisst wurden. Davon kamen aber nur diese fünf in die engere Wahl. An denen würde ich mich zunächst orientieren müssen, zumindest, bis Martin Kraut mir das genaue Alter des Toten nennen konnte. Kurz nach 15.00 Uhr kam er dann tatsächlich in unser Büro. Klein gewachsen, eher unscheinbar, leicht korpulent mit einer Stirnglatze, aber ein Profi vor dem Herrn. Kraut liebte seine Arbeit, die Tüfteleien, die Sicherheit. Darin war er gut. Und bestimmt wusste er, dass wir wussten, wie gut er war. Hinter den Mauern der Gerichtsmedizin vermochte er sich großartig zu entfalten. Dem Vernehmen nach konnte er stundenlang Fingerabdrücke analysieren, ballistische Proben nehmen, DNA Profile abgleichen, Textilfasern und Blut analysieren. Er war ein Pedant und immer dabei, wenn wir komplizierte und verworrene Fälle auf dem Schreibtisch hatten, so wie jetzt. Den Erfolg genoss er dann meistens für sich allein im stillen Kämmerlein. Ich bot ihm Gereons Stuhl an, da der Chef bisher immer noch nicht aufgetaucht war, und wartete mit Vollspannung auf Krauts Bericht. Er setzte sich und blickte mich über die Gläser seiner verrutschten Brille an.
„Schlimme Sache“, murmelte er. „Ich meine, ich habe ja schon vieles gesehen, aber das was da auf meinem Tisch liegt … als ob ein abgetrennter Kopf nicht schon brutal genug wäre. Nein, da muss dem armen Kerl auch noch das ganze Gesicht entstellt werden. Augen, Nase, Mund und Ohren, alles fein säuberlich zugenäht. Und mit was für einer Präzision! Ich habe die Nähte genauestens untersucht und fotografiert. Ein Kreuzstich sitzt sorgfältig neben dem anderen. Wahrscheinlich hat der Mörder eine Sattlernadel benutzt. Da muss ein echter Fachmann am Werk gewesen sein. Ich schicke dir die Fotos nachher rauf. Bei dem Nähmaterial handelt es sich höchstwahrscheinlich um schwarzen Zwirnfaden.“
Ich machte mir fleißig Notizen. „Zwirn“, wiederholte ich. „Das sind zusammengedrehte Garne mit einer hohen Reißfestigkeit, richtig?“
„Stimmt genau. Die Zusammensetzung richtet sich nach den gewünschten Optiken und den technischen Anforderungen, wie eben eine hohe Reißfestigkeit. Der Mörder wollte sicherstellen, dass die von ihm verschlossenen Körperöffnungen sich nicht so schnell wieder öffnen ließen.“
„Wie krank ist das denn?“, murmelte ich und spürte wieder den kalten Schauder auf meinem Rücken. Trotzdem schrieb ich diese Information auf einen Zettel.
„Weiter“, forderte ich Kraut auf. „Was kannst du mir über das Alter des Mannes sagen?“
„Anhand der Abnutzung der Halswirbel würde ich ziemlich genau auf Mitte Vierzig tippen. Plus/Minus ein Jahr vielleicht. Ich habe die Fäden von seinen Lippen gelöst und mir die Zähne angesehen. Die sehen verdammt gut aus. Er besitzt sogar noch alle vier Weisheitszähne. Im Übrigen werde ich schon bald ein ziemlich genaues 3D-Gesichtsprofil erstellen können. Das ist dann so etwas Ähnliches wie eine Skulptur. Damit solltet ihr ihn identifizieren können.“
Ich schrieb wieder alles auf. „Was ist mit der Todesursache?“, fragte ich weiter.
Kraut zögerte kurz. „Hm … das ist ziemlich schwer zu sagen. Der Kopf wurde mit etwas Scharfem abgetrennt. Den Knochenabsplitterungen und den groben Einkerbungen im Rumpf des Halses nach zu urteilen könnte es eine grobzahnige Kreissäge gewesen sein. Ein Messer war es jedenfalls nicht.“
„Also Präzisionsarbeit?“
„Könnte man so sagen. Genaueres werden die Röntgenaufnahmen ergeben.“
Ich traute mich kaum zu fragen, tat es aber dann doch. „Glaubst du der Mann hat noch gelebt, als er …?“
Kraut zuckte mit den Achseln. „Möglich wär´s, aber da der Rest des Körpers fehlt, kann ich das nicht hundertprozentig bestimmen.“
„Verstehe. Was denkst du, wie lange du brauchst, um ein Gesichtsprofil zu erstellen?“
„Ein, zwei Tage höchstens. Mehr nicht. Für die Oberflächendokumentation in 3D muss ich das Körperteil säubern und entsprechend vorbereiten. Zunächst bin ich aber noch auf Spurensuche.“
„Soll mir alles recht sein, solange ich das nicht machen muss. Was denkst du Martin, wer tut so etwas?“
Kraut kratze sich nachdenklich am Hinterkopf. „Da fragst du mich was, Julia. Ich bin Mediziner, kein Psychologe. Ich wundere mich ja selbst darüber, was sich ein krankes menschliches Hirn alles ausdenken kann.“
„Stimmt schon. Ich habe jedenfalls alles notiert und gebe den Zettel an Gereon weiter. Dann hat er was, worüber er nachdenken kann, wenn er wieder zurück ist.“
Kraut sah mich fragend an. „Apropos Gereon. Sieht nicht gut aus, dein Chef, was?“
„Stimmt leider, und genauso schlecht wie er aussieht, ist auch seine Laune. Er benimmt sich manchmal wie zum Davonlaufen.“
„Private Probleme?“
„Was man so munkelt. Angeblich soll seine Frau einen anderen haben.“
„Kein Wunder, was der hier auch für Überstunden schiebt.“
Ich dachte an Alex, die ihren freien Samstag allein verbringen musste und darüber sicher ganz und gar nicht glücklich war.
„Polizei und Privatleben passen leider nicht immer zusammen.“
„Aber du kommst klar mit deinem Freund, oder?“, fragte er.
Ich nickte vorsichtig. Anscheinend war hier noch nicht durchgesickert, dass ich im Moment solo war, und wenn es nach mir ging, dann konnte es auch getrost so bleiben. Kraut stand auf, lächelte mir zu und verließ das Zimmer. Ich dachte noch einmal darüber nach, was er mir erzählt hatte und hoffte, dass wir in ein bis zwei Tagen genügend Material zusammenbringen würden, um dem Toten einen Namen geben zu können. Den restlichen Nachmittag verbrachte ich damit, die Kandidaten auf meiner Vermisstenliste zu sortieren. Die beiden ältesten, Peter Schäng und Werner Schmitz, kamen schon mal nicht mehr infrage.
Bis ich das Präsidium verlassen konnte, war es beinahe vier Uhr. Auf dem Nachhauseweg überlegte ich, dass ich Alex zur Wiedergutmachung zum Essen einladen wollte. Zunächst aber stand ein verspäteter Mittagsimbiss an. Noch war das Wochenende nicht ganz im Eimer. In meiner Wohnung empfing mich eine gutgelaunte Mrs. Willieby Sie miaute laut und sprang mir erwartungsvoll vor die Füße. Ich stellte meinen kleinen Rucksack neben dem Schirmständer im Flur ab und kraulte ihren Kopf. Die uralte, graue Main Coon Katze war mir nach einem Einsatz in einem Messi-Haushalt einfach nicht mehr von der Seite gewichen und hatte mich quasi als neue Katzenmutter adoptiert. Unglücklicherweise hatte sie nur noch ein Auge, was aber meiner Zuneigung zu ihr keinen Abbruch tat. Nachdem sie genügend Streicheleinheiten bekommen hatte, trottete sie in Richtung des Katzenbaumes, der im Wohnzimmer vor dem Fenster stand, und ich ging wieder nach draußen und landete wie so oft in letzter Zeit in Francescos Pizzeria an der Ecke. Nachdem ich mir seine typisch italienischen Komplimente angehört hatte, nahm ich eine Pizza Quattro Formaggio und eine Flasche Rotwein mit nach Hause und verzehrte den Leckerbissen gemeinsam mit Mrs. Willieby auf der Couch und Jörg Pilawa im Fernsehen. Danach schlief Mrs. Willieby zusammengerollt in meinem Schoß ein und ich spülte die fade Quizsendung mit dem mitgebrachten roten Chianti hinunter. Die Abendstimmung war trügerisch, aber wenigstens sprach niemand über abgeschnittene Köpfe und zugenähte Gesichtsteile. Nach einer heißen Dusche fiel ich ins Bett und hoffte, dass mir die scheußliche Fratze vom Fühlinger See nicht im Schlaf begegnen würde. Die Hoffnung erfüllte sich nicht. In meinen Träumen drehte sich alles um Nadeln und Fäden voller Blut.
Kapitel 3
Alex war not amused. Ihre Stimme klang schrill und vorwurfsvoll. Das Brummen des Handys hatte mich quasi aus dem Schlaf gerissen. Und das an meinem heiligen Sonntag. Mit allen Mitteln versuchte ich nicht so erschlagen zu klingen, wie ich in Wirklichkeit war.
„Alex?“
„Mein Gott, Julia, wie siehst du denn aus? Habe ich dich etwa geweckt?“
Ich bejahte ihre Frage, denn mir fiel keine gescheite Antwort ein. Wie ich diese Videoanrufe hasste.
„Oh, das tut mir leid. Soll ich besser später noch einmal anrufen?“
„Nein, nein. Ist schon gut. Ich bin ja jetzt wach. Sag mal, wo bist du eigentlich?“
„Na bei mir zu Hause, wo sonst?“
Bei mir meldete sich das schlechte Gewissen. „Du, Alex, das mit gestern tut mir echt leid. Ich wäre so gerne mit dir nach Holland gefahren. Stattdessen … ach was, das erzähle ich dir später. Sehen wir uns heute?“
„Von mir aus gern, aber nicht so früh. Ich habe vorher noch etwas zu erledigen.“
„Geht klar“, erwiderte ich und spürte den Kaffeedurst. Mit einem Mal war ich völlig wach und nahm Alex via Handy mit in die Küche.
„Soll ich dich abholen?“, fragte sie.
„Kommt ganz darauf an, was du vorhast.“ Ich öffnete den Küchenschrank, griff nach der Dose mit dem gemahlenen Kaffee und gab drei Teelöffel davon in die italienische Espressokanne. Die stellte ich auf die Herdplatte und wartete. Alex schwieg zunächst. Ich sah, wie sie an ihrer Plastikkette spielte. Schließlich brachte sie doch einen Vorschlag hervor.
„Was hältst du vom Volksgarten? Bei diesem schönen Wetter sollten wir irgendwo ins Freie gehen, und Hellers hat doch diesen tollen Biergarten hinter dem Lokal.“
„Prima“, sagte ich. „Gute Idee, gutes Mädchen.“
Sie winkte und lachte kurz. „Okay, dann bin ich gegen 18.00 Uhr bei dir. Bis später.“
„Bis später“, äffte ich ihr nach, doch ihr Gesicht war bereits von meinem Display verschwunden. Na, das ging ja schnell. Ich war überrascht und erleichtert zugleich. Normalerweise konnte ich mit Alex stundenlang telefonieren und wir kamen dabei vom Höcksken aufs Stöcksken, aber heute war sie ziemlich kurz angebunden gewesen. Ich nahm die Espressokanne vom Herd und ließ das braune Gebräu in meine Lieblingskaffeetasse laufen. Damit setzte ich mich an die Küchenbar, spielte mit meinem Handy und schwelgte in Erinnerungen an unsere Jugendzeit. Alex und ich kannten uns vom Gymnasium her. Schon damals hatten wir uns sehr gut verstanden. Ich war ihr Trostpflaster, wenn es mit irgendeinem Typen nicht richtig klappen wollte. Am Anfang jeder neuen Beziehung war sie stets aufgekratzt und voller Hoffnungen gewesen, am Ende saß mir dann ein Häuflein Elend gegenüber, das ich wieder aufzubauen versuchte. Dadurch sind wir uns stetig ein Stückchen näher gekommen. Alex war Alex. Sie machte sich nichts aus der neusten Mode und entsprach keinem Schönheitsideal. Sicher hätte sie weitaus mehr aus ihrem Typ machen können, aber sie legte keinen Wert auf teure Kosmetik. Nach der Schule hatten wir uns kurz aus den Augen verloren. Alex studierte Psychologie und ich ging zur Polizeihochschule.
Irgendwann bekam ich überraschend eine Facebook-Nachricht von ihr und eines Abends stand sie mit einer Flasche Wein vor meiner Haustür. Wie immer wollte sie sich bei mir ihr Herz ausschütten. Es war genauso so wie früher, nur dass sie diesmal von Männern nichts mehr wissen wollte. Ich spürte, wie sehr sie mir in all der Zeit gefehlt hatte und war nur allzu gerne bereit, unsere alte Freundschaft wieder aufleben zu lassen.
Als ich so dasaß, vor mich hin sinnierte und auf mein Handy starrte, fiel mir auf, dass zwischenzeitlich ein Anruf eingegangen war, ohne das ich ein Brummen bemerkt hätte. Die Nummer, die das kleine Display anzeigte, kannte ich nicht. Ich drückte auf die Wahlwiederholungstaste und erhielt prompt die Nachricht, dass die von mir eingewählte Telefonnummer nicht existierte. Auch gut. Ich löschte die Nachricht, schlüpfte im Schlafzimmer in meine Kleidung und gab Mrs. Willieby etwas Nass- und Trockenfutter.
Am späten Nachmittag verschlechterte sich das strahlende Herbstwetter. Die Wolken, die sich während des Tages noch als feine Schleier präsentiert hatten, wurden langsam dunkler. Weit entfernt, so dass man die genaue Richtung nicht ausmachen konnte, war ein erstes Donnergrollen zu hören. Alex war überpünktlich. Sie hatte wohl sogar schon auf mich gewartet, denn als ich aus der Haustür trat, sah ich, wie sie die Seitenscheibe ihres Wagens in die Höhe fuhr. Ich öffnete die Beifahrertür, stieg in den Wagen und setzte mich auf den Beifahrersitz. Alex beugte sich zu mir hin und drückte mir einen Kuss auf die rechte Wange. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug, hohe Schuhe und eine glitzernde Kette. In solch einem Aufzug hatte ich sie noch nie vorher gesehen.
„Du siehst ja schnieke aus“, begrüßte ich sie bewundernd. Alex machte auf cool.
„Nun ja, man tut was man kann.“
„Deinem Aussehen nach zu urteilen scheint es dir ja richtig gut zu gehen.“
„Geht so“, erwiderte sie ausweichend und dann kam: „Ich wäre so gerne mit dir nach Holland gefahren.“
Das war es also. Daher wehte der Wind. Ich versuchte es mit der berühmten guten Miene zum bösen Spiel.
„Das holen wir nach, ja? Versprochen!“ Ich schenkte ihr ein strahlendes Lächeln. Alex strich sich eine ihrer schwarzen Locken aus dem Gesicht und fuhr los. Mir wurde sehr schnell klar, dass tatsächlich etwas nicht mit ihr stimmte. Während der Fahrt war sie sehr zurückhaltend und schien nur über Belanglosigkeiten sprechen zu wollen. Unsere Stimmung kam nicht so richtig in die Gänge und ich bemühte mich darum, jedes ernsthafte Thema zu vermeiden.
„Bleibt es beim Volksgarten?“, fragte ich vorsichtig. Diesmal antwortete sie mir sofort.
„Von mir aus gern. Bei Hellers gibt es heute mediterrane Küche. Darauf habe ich richtig Lust!“
Mir war alles recht. Außerdem kam mir sogleich eine Idee.
„Wenn du den Wagen bei der alten Festung parkst, können wir noch ein Stück zu Fuß durch den Park gehen …“
Alex zeigte auf den sich zuziehenden Himmel. „Ob das gutgeht?“
Ich lachte und zog sie auf. „Du bist doch nicht aus Zucker! Wir nehmen einen Schirm mit und gut ist.“
Sie stellte den Wagen auf dem Parkplatz vor dem Fort Paul ab. Wir stiegen aus, überquerten die Eifelstraße und betraten den Eingang des Volkgartens. Bislang hatten wir uns kaum gegenseitig auf den Arm genommen, was sehr merkwürdig war, denn normalerweise foppten wir uns, bis uns die Tränen über die Wangen liefen. Ob das nur an der vergeigten Hollandreise lag?
Während wir durch den Park gingen, beobachtete ich Alex aus den Augenwinkeln heraus. Ihr Blick war auf den Boden gerichtet. Nur ab und zu sah sie sich die Gesichter der entgegenkommenden Spaziergänger an. Allerdings kam mir das keineswegs wie zufällig vor. Irgendwie schien sie nach jemandem Ausschau zu halten. An diesem ungewöhnlich warmen Herbstabend wimmelte der Park trotz der Gewitterlage vor Menschen. Das Hellers hatte sämtliche Türen geöffnet und der Biergarten stand voller Tische und Stühle. Leger gekleidete Männer und Frauen saßen beisammen und genossen die abendliche Atmosphäre. Die Außenterrasse war gut besucht. Alex und ich sahen uns nach einem freien Tisch um, aber da war keiner. Gerade als ich mit ihr nach drinnen gehen wollte, erhob sich ein junges Pärchen von ihren Stühlen und wandte sich zum Gehen. Mit einem Satz war ich bei den freigewordenen Plätzen und gab Alex ein Zeichen, mir zu folgen. Wir warteten bis die beiden verschwunden waren, setzten uns und bestellten eine Flasche Weißwein sowie die Speisekarte. Alex war nicht sie selbst. Egal, ob sie es abstritt, ich wusste es einfach. Dafür kannte ich sie zu gut. Ohne abzuwarten goss sie ihr Glas voll und kippte den Inhalt hastig in sich hinein. Dadurch versuchte sie wohl ihre Anspannung zu lösen, was ihr aber nicht so richtig gelang. Ich war einigermaßen irritiert.
„Was ist los Alex? Sag es mir!“
Sie zuckte zusammen, fühlte sich ertappt und blickte mich mit ausdruckslosen Augen an.
„Was soll denn los sein?“
Ich wollte nicht weiter nachbohren. Sie würde mir schon erzählen, was sie bedrückte, wenn sie es für richtig hielt. Also lenkte ich das Gespräch auf das Essen.
„Heute gibt es frische Muscheln“, erklärte ich und hoffte, es würde sie auf andere Gedanken bringen. Alex studierte die Abendkarte und setzte ihr Pokerface auf.
„Tatsächlich? Ich würde ja gerne welche nehmen, aber beim letzten Mal, als ich Muscheln gegessen habe, ist mir davon schlecht geworden.“
Jetzt musste ich lachen.
„Na, wenn dir davon schlecht wird, dann lass doch die Finger davon.“
Das Pokerface wich einem Trotzgesicht. „Aber ich liebe Muscheln. Und jedes Mal, wenn sie irgendwo auf der Karte stehen, denke ich, heute wird mir davon bestimmt nicht schlecht. Was nimmst du?“
„Ich überlege noch. Gestern hatte ich Pizza, also werde ich heute Abend etwas anderes essen. Ich glaube, ich nehme die Gambas mit Nudeln.“
Wir gaben unsere Bestellung auf, prosteten uns zu und übten uns in Small Talk. Wenn die abgesagte Fahrt nicht der einzige Grund für ihr seltsames Verhalten war, dann lag es vielleicht an ihrer Arbeit? Ich versuchte sie vorsichtig aus der Reserve zu locken.
„Wo drückt der Schuh, Frau Psychologin? Ist es der Job?“, fragte ich und hoffte, es würde irgendwie witzig klingen.
Alex trank einen Schluck aus ihrem Glas. Ich beobachtete sie dabei.
„Ertappt. Du scheinst mich besser zu kennen, als ich mich selbst.“
„Ist es das neue Projekt?“
Sie schien mich nicht richtig zu verstehen. „Projekt?“, fragte sie nach. Ich nickte ihr zu, da schien bei ihr der Groschen zu fallen.
„Du meinst das Programm zur Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation von Prostituierten?“
Ich nickte bestätigend.
„Ich komme voran. Der Job ist anstrengend und mühsam, aber er lohnt sich. Mittlerweile haben die Mädchen Vertrauen zu mir aufgebaut und manche reden ganz offen mit mir. Wir treffen uns meistens im Kaffee Hoffnung am Bischhofsweg. Die haben dort einen extra Raum, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen können. Da spricht es sich leichter als in einem schnöden Büro.“
Das Cafe kannte ich, aber mir war nicht ganz klar was Alex dort tat. Also hakte ich nach.
„Alex, ich glaube ich habe irgendwie ein Brett vor meinem Kopf. Ich weiß noch immer nicht, wie du den Frauen hilfst.“
Sie musste nicht lange überlegen. Die Antwort lag ihr auf der Zunge.