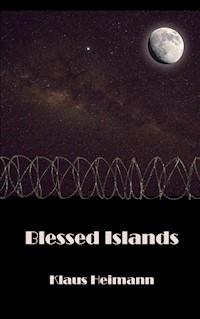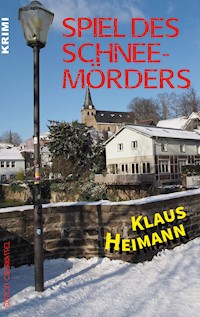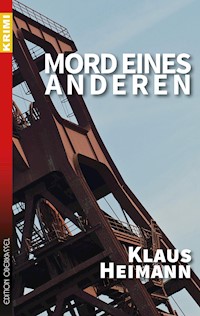Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Koffer mit fünf Millionen Euro in einem Taxi mit dem Ziel Nordkap. Unterwegs tauchen mehrere Männer auf, die ihn beanspruchen. Und verschwinden wieder. Hauptkommissar Sigi Siebert wittert ein Verbrechen. Lange rätselt er über die irrwitzige Fahrt, bis eine Spur nach Namibia auftaucht. Krimi und Roadstory zugleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
www.klausheimann.de
Schon als Jugendlicher liebte es Klaus Heimann, anderen Kindern Märchen oder aus dem Stegreif erfundene Geschichten zu erzählen. Die Lust am Erzählen begleitete ihn ins Erwachsenenalter und er begann mit dem Schreiben. Bisher verfasste er Kurzprosa, Lieder, ein Kindermusical und mehrere Romane. Neben seiner Heimatstadt Essen und dem Ruhrgebiet liefern Klaus Heimann Reiseerlebnisse Inspiration für sein schriftstellerisches Schaffen.
Dieses Buch entstand als Neubearbeitung der Titel
„Taxi zum Nordkap“, ISBN 978-3943121926, Düsseldorf 2015
„Spur nach Namibia“, ISBN 978-3958130432, Düsseldorf 2016
Das Cover wurde gestaltet durch © 2022 Klaus Heimann mittels Adobe
Photoshop unter Verwendung von eigenem Bildmaterial
Das Werk ist inklusive aller Abbildungen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsschutzgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar.
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Der Bericht
Von Essen nach Halmstad
Von Halmstad nach Dombås
Von Dombås nach Mosjøen
Von Mosjøen nach Narvik
Von Narvik nach Alta
Von Alta nach Honningsvåg
Zum Nordkap und zurück
Teil II: Das Geständnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Intermezzo
Kapitel 3
Teil III: Die Ermittlung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil IV: Die Schuld
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Intermezzo
Kapitel 4
Kapitel 5
Schlussbemerkungen
Teil I
Der Bericht
Von Essen nach Halmstad
Wenn ich die Ereignisse und Bilder dieser unglaublichen Reise vor meinem inneren Auge vorbeispazieren lasse, grenzt es für mich heute an ein Wunder, dass ich nicht verrückt geworden bin. Tagelang war ich mit meinem Taxi unterwegs, erst quer durch Norddeutschland, Dänemark und Schweden und dann durch die Weite Norwegens. Gleich zu Anfang gab mir die Reise Rätsel auf, die sich schnell zu einem Labyrinth aus Täuschungen, Irrwegen und Misstrauen verklumpten. Trolle sind mir begegnet während meiner Reise, wenn auch in Menschengestalt. Sie haben ihr dreckiges Spiel mit mir getrieben, Possen auf meine Kosten gerissen. Dann sind sie einfach wieder verschwunden.
Mein Name ist Rainer Meldorf. Freunde nennen mich „Taxi-Rainer“. Siebenundfünfzig Jahre bin ich alt. Ich lebe allein in Essen im Ruhrgebiet. Hinter mir liegen zwei gescheiterte Ehen, Kinder habe ich keine. Wenn ich nicht arbeite, hänge ich vor dem Fernseher ab oder treffe mich mit einem Kumpel auf ein paar Bier in der Kneipe. Nein, ich interessiere mich nicht für Fußball und man wird es kaum glauben, mich hat noch nie ein Fußballstadion von innen gesehen. Mein Wissen über Sport reicht gerade mal für zwei Bierlängen. Eher zieht es mich ins Theater oder ins Kino. Dafür wiederum kann ich leider kaum einen meiner Freunde begeistern. Mein Privatleben darf also in Summe als ereignisarm bis langweilig bezeichnet werden.
Mit der Taxifahrerei habe ich anfangs nur mein karges Studentenbudget aufpeppen wollen. Als die Blütenträume vom Erwerb eines Abschlusses mangels Interesse und wegen einer gewissen Unfähigkeit, mich selbst zu quälen, geplatzt waren, lag es nahe, den Nebenjob zum Beruf zu machen. Ich bin daran kleben geblieben – fünfunddreißig Jahre, hunderttausend Zigaretten und Millionen Kilometer lang.
Heute rauche ich nicht mehr. Der Arzt hat mir dazu geraten und dieses eine Mal halte ich schweren Herzens Disziplin. Ich mag solche Beeinflussungen nicht, die über das Gewissen laufen.
Was mich ans Taxifahren gebunden hat, ist die Freiheit, die der Beruf mitbringt. Deinen Boss kriegst du nur selten zu Gesicht, du treibst dich den ganzen Tag herum, natürlich nur in dem Rahmen, den die Fahrgäste zulassen. Gemessen an anderen Jobs ist das viel. Und ich fahre gerne Auto. Immer noch, auch wenn Verkehr im Ruhrgebiet eher gegenseitiges Schieben als Fortkommen bedeutet.
Ein besonderes Erlebnis der Freiheit versprach anfangs diese eine Tour zu werden, eine Fahrt, für die du als Taxifahrer höchstens einmal im Leben angeheuert wirst. Davon will ich hier berichten.
Ich stand mit meiner Droschke vor dem Hotel Handelshof und wartete auf Fahrgäste. Der schmucke Kasten liegt direkt gegenüber dem Hauptbahnhof in Essen. Hier gibt es immer Leute, die irgendwohin wollen.
Ein schöner Junitag kündigte sich an. Schon jetzt, um halb neun, zeigte der Himmel ein makelloses Blau. Dazu blies eine leichte, angenehme Brise. Nun ja, ein Taxifahrer hat nicht viel vom Wetter. Aber dem Auge und dem Gemüt tut so etwas gut.
Er kam von nirgendwo. Plötzlich wurde meine Tür aufgerissen und da stand er, der Mann, mit dem ich in meine wahnwitzige Reise starten sollte. Ich sah nur den knittrigen, nach meinem modischen Empfinden mindestens zwei Nummern zu großen, kittfarbigen Trenchcoat, einen breitkrempigen, hellbraunen Hut und einen unscheinbaren Koffer. Seltsamerweise trug der Mensch bei diesem herrlichen Wetter schwarze Lederhandschuhe.
„Können Sie mich zum Nordkap bringen?“, fragte mich der Typ mit einer sonoren Bassstimme.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass man am Hauptbahnhof in Essen einen Fahrgast aufnimmt, der zum Nordkap will, das ist mal klar. Und so war ich im ersten Moment leicht begriffsstutzig und bat den Mann, seine Frage zu wiederholen.
„Zum Nordkap möchte ich. Fahren Sie mich hin?“
Ich witterte ein großes Geschäft, denn solche Exoten sind selten. Und: Die sollte man melken. Blitzschnell ging ich im Kopf den Taxitarif durch. „Bei Fahrten, deren Ziel außerhalb des Pflichtfahrgebietes liegt, hat der/die Taxifahrer/in den Fahrgast vor Fahrtbeginn darauf hinzuweisen, dass das Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke frei zu vereinbaren wäre“, steht dort irgendwo zu lesen. Die Strecke zum Nordkap lag bildlich vor mir, denn in den vielen Wartestunden durchstöberte ich begeistert Reiseführer über alle möglichen Länder. In Gedanken war ich mindestens ein dutzend Mal zum Nordkap gefahren. Es ist ein typisch menschliches Bedürfnis, irgendwo an ein Ende zu gelangen, etwa die Schule abzuschließen, beim Marathon das Ziel zu erreichen oder eben am nördlichsten Punkt Europas anzukommen. Ich rechnete die Kilometer hoch. Zwischen drei- und viertausend, schätzte ich. Ich fahre gerne Auto.
„Hin und zurück?“, fragte ich den ominösen Kerl, um mehr Zeit zum Überlegen zu gewinnen.
„Nur hin“, antwortete der und wurde ungeduldig, „fahren Sie nun oder nicht?“
„Das wird Sie neuntausend Euro kosten“, beendete ich meine Kalkulation und schaute ihn, während ich ihm den Preis nannte, aufmerksam an, um seine Solvenz zu taxieren.
„Dann los. Aber ich stelle eine Bedingung: Wir fahren ausschließlich über Land und benutzen keine Fähre.“
„Elftausend“, wurde ich leichtsinnig, „plus Spesen.“
„Einverstanden. Ich steige hinten ein.“
Der Mann ging ums Auto herum, riss die Tür hinter dem Beifahrersitz auf und ließ sich ächzend auf das Polster der Rückbank fallen. Das ging mir zu schnell.
„Haben Sie denn so viel Geld dabei?“, fragte ich ungläubig über die Schulter.
„Na klar. Würde ich Sie sonst anheuern?“, kam es sehr überzeugend zurück. Ich hörte, wie der Reißverschluss des Koffers aufgezogen wurde.
Ein Blick nach hinten nahm mir den Atem. Im Koffer lagen, wie die Sardinen in der Büchse, lauter Geldscheine, sauber mit Banderolen zu kleinen Päckchen gebündelt. Wie viel Zaster mochte das sein?
„Sind die echt?“, zweifelte ich an dem, was ich nicht glauben wollte.
„Sicher sind die echt. Und jetzt fahren Sie bitte los.“
„Wie viel ist das?“ Ich ließ nicht locker.
„Fünf Millionen Euro. Reicht das?“, blaffte der Kerl zurück.
„Haben Sie eine Bank ausgeraubt?“, wurde ich ängstlich.
„Ich versichere Ihnen, da steckt nichts Kriminelles dahinter.“
„Na gut.“ Ich gab mich dem Mann und dem Anblick des Geldes geschlagen und meldete meine Fahrt bei der Zentrale an: „Wagen einhundertfünf. Habe einen Fahrgast zum Nordkap aufgenommen. Werde ein paar Tage unterwegs sein.“
„Bist du bekloppt“, meldete sich eine blecherne Frauenstimme aus dem Lautsprecher, „solche Fahrten will der Chef erst genehmigen.“
Unser Chef, den wir hinter vorgehaltener Hand „Blechnapf“ nennen, hat gerne den Überblick. „Blechnapf“ haben wir ihn getauft, weil er mal eingesessen hat. Verknackt haben sie ihn wegen schwerer Körperverletzung. Danach sieht er übrigens auch aus mit seinem kräftigen Körperbau, der stark ins Bullenhafte spielt, und mit den blutunterlaufenen Augen. Ich mag ihn nicht, meinen Boss. Er hat mir bereits drei Mal gekündigt und sieben Mal den Lohn gekürzt aus nichtigen Gründen. Ich habe mir geschworen, dass Blechnapf irgendwann auf meiner Wiese Gras fressen wird.
„Bestell dem Chef einen schönen Gruß von mir. Er wird verstehen, dass ich dieser Fahrt nicht widerstehen kann“, fertigte ich die Frauenstimme ab, knipste den Funk aus, küsste die Christophorus-Medaille, die an einer Kette vom Armaturenbrett herunterbaumelt, und startete den Motor.
Nur wenige Ampeln und wir gelangten auf die Autobahn A40, wo sich die Fahrzeugkolonne einigermaßen zügig fortbewegte. Ungewöhnlich für den Berufsverkehr. Minuten später erreichten wir den Abzweig zur Autobahn A43, die in nördlicher Richtung bis Münster führt. Nach zwei, drei Abschnitten auf der A43 mit etwas dichterem Verkehrsaufkommen ließen wir eine gute halbe Stunde später das Ruhrgebiet endgültig hinter uns.
Mein Passagier hatte bis dahin kein weiteres Wort verloren. Er saß starr auf dem Sitz rechts hinter mir und blickte ausdruckslos aus dem Fenster. Erst auf der Höhe von Dülmen gab er etwas von sich: „Können wir vielleicht kurz anhalten? Ich habe ein menschliches Bedürfnis.“
Bei nächster Gelegenheit scherte ich auf einen Rastplatz aus. Ich stellte den Wagen in einer Parkbucht ab, die dem WC-Häuschen gegenüber lag. Irgendetwas hinter mir klickte und ich verstand: Mein Fahrgast schloss seinen Koffer ab.
„Schaffen Sie mein Gepäck bitte in den Kofferraum. Und unterstehen Sie sich, damit zu verschwinden. Ihre Nummer habe ich mir notiert und ich habe viele wichtige Freunde. Überall!“ Der Mann stieg aus und ließ den Koffer auf der Rückbank stehen. Dann stiefelte er in einem merkwürdigen Schritt, der mich auf O-Beine schließen ließ, mit wehenden Mantelschößen zum stillen Örtchen.
Ich verließ das Taxi ebenfalls, ging um den Kühler herum und öffnete die hintere Tür auf der Beifahrerseite. Da stand es, das wertvolle Stück. Ich hob den Koffer heraus und schätzte sein Gewicht. So schwer wogen also fünf Millionen Euro. Eigentlich erstaunlich wenig, wenn man das Eigengewicht des Gepäckstücks bedachte. Mit einem Seufzer schlug ich die Tür zu und beförderte den Koffer ins Gepäckabteil. Dann setzte ich mich wieder hinters Lenkrad.
Mein Fahrgast kam kurz darauf zurück. Er legte weder Mantel noch Hut ab, entledigte sich aber seiner Handschuhe und bezog erneut Stellung im Fond. Dann griff er in die Innentasche seines Trenchcoats und zerrte ein paar Notenbündel mir unbekannten Aussehens hervor.
„Das sind dänische, schwedische und norwegische Kronen. Damit bezahlen Sie bitte alles, was wir im Norden an Ausgaben haben. Organisieren Sie die Reise, wie Sie es für richtig halten, und verwenden Sie das Geld nach Ihrem Gutdünken. Ich werde jetzt versuchen zu schlafen“, raunte mir der Typ gähnend zu, drückte mir die Devisen in die Hand und sich selbst den Hut ins Gesicht. Bereits beim Beschleunigen auf der Autobahnauffahrt fiel er in ein hörbar schläfriges Atmen. Ein komischer Kauz!
Ich fahre zwar gerne Auto, mag aber keine Langweilerstrecken wie das platte Land zwischen Dülmen und Hamburg, unterbrochen nur von einem kleinen Jubelschrei der Landschaft kurz hinter Münster, wo Tecklenburger Land und Wiehengebirge ein paar Höhenzüge gegen die Monotonie setzen. Natürlich gerieten wir in den obligatorischen Stau bei Lotte/Osnabrück und ich schob mich Stoßstange an Stoßstange gemeinsam mit den Brummis an der rechten Leitplanke entlang. Den nervösen Spurwechsel dieser Hektiker, die ständig meinen, auf der anderen Spur ginge es zügiger voran, vermeide ich strikt. Ich weiß aus Erfahrung, dass das alles im Stau nichts bringt. So blieb ich brav, eingekeilt zwischen zwei Sattelzügen, auf der rechten Seite und ergab mich den Verkehrsverhältnissen. Dabei konnte ich wenigstens ohne Stress meinen Gedanken nachhängen. Und davon gab es, im Vergleich zu meinem sonstigen Füllstand im Hauptspeicher, momentan viele.
Was war das für ein merkwürdiger Typ, der da auf meiner Rückbank den Schlaf des Gerechten schlief und den es anscheinend wenig juckte, allein mit mir und seinen Millionen auf Spazierfahrt zu gehen? Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass er nichts auf dem Kerbholz hatte. Warum sollte er sonst das Land verlassen? Um sich einen Lebenstraum zu erfüllen, was ja viele zum Nordkap treibt? Um Sehnsüchte nach Einsamkeit und Natur zu stillen? Um seinen Milliönchen im Köfferchen ein wenig raue Luft um die Banderolen wehen zu lassen? Hallo, was dachte ich da gerade für einen Stuss?
Das Reiseziel fand ich okay – ich freute mich auf die Fahrt. Endlich die Enge der Städte und das Geschiebe auf den Straßen verlassen. Endlich tagelang von dem Kommando der blechernen Frauenstimme befreit sein. Das klang fast wie Urlaub. Wie man sich leicht ausmalen kann, wird das Nordkap eher selten von Essen aus mit dem Taxi angesteuert. Es durfte genau genommen, jedenfalls nach meinen Informationen, das erste Mal sein. Aber ich war lange genug Taxifahrer und ich hatte mir oft genug das Warten auf den Stellplätzen durch einen Plausch mit den Kollegen verkürzt. Solche Fernfahrten kamen immer mal wieder vor.
Nur das Geld, das viele Geld störte im Vergleich mit allen jemals gehörten Taxifahrergeschichten enorm. Man fährt nicht mit seiner Knete einfach so durch die Weltgeschichte. Und wenn, dann wohl kaum in einem Taxi. Sollte man es doch tun, aus Übermut oder aus sonst was für Gründen, zeigt man seine Scheinchen nicht vor, weil man sein Geheimnis für sich behalten will. Der Chauffeur könnte ja ein schräger Vogel sein und auf dumme Ideen kommen.
Ging ich etwa ein persönliches Risiko ein?
Zum Nordkap fahren mit einem spleenigen Abgedrehten im Taxi war das eine, dass der Kerl aber einen gewaltigen Haufen Moos bei sich führte, war das andere. Das roch nach einem fürchterlichen Span im Kopf, was bedrohlich genug klang, oder nach etwas Illegalem, was die Sache für mich eher noch gefährlicher machte. Wieder blieben meine Gedanken an der Erwägung hängen, ob ich hinter mir einen Kriminellen herumkutschierte. Dann hätte mich der Typ schlicht angelogen. Würde dem bestimmt nichts ausmachen.
Eine verflixt undurchsichtige Situation.
Und wenn man uns aufgriff und das Geld im Gepäckabteil fand?, schoss es mir durch den Sinn, als der Verkehr langsam wieder Fahrt aufnahm. Eigentlich nicht schlimm. Niemand würde mir nachweisen können, dass ich gewusst hatte, was der Mann da hinter mir im Köfferchen mit sich schleppte. Hatte er mich hineinsehen lassen? Selbstverständlich nicht!
Im Rückspiegel konnte ich nur einen Zipfel vom Mantelärmel meines Passagiers sehen, denn er hatte sich tief in den Polstern verkrochen. Auch vorhin hatte ich nicht viel von ihm erkennen können unter seinem flatternden Mantel und der Hutkrempe. Eine Personenbeschreibung wäre mir unmöglich gewesen. Weder hätte ich ihn als gepflegt noch als heruntergekommen bezeichnet. Mein Gefühl sagte mir, dass von ihm keine Bedrohung ausging, sein Auftreten war nicht aggressiv gewesen, höchstens bestimmend. Jemand, der gewohnt ist, dass nach seiner Pfeife getanzt wird. Es war dieser Geldkoffer, der das Ganze zu einem undurchdringlichen Dickicht machte. Einen Risikozuschlag hätte ich von ihm verlangen sollen. Aber was hatte man davon, wenn man irgendwo im skandinavischen Outback einen Scheitel gezogen kriegte und im Straßengraben landete?
Nein, so etwas durfte ich auf keinen Fall denken. Das war absurd.
Ich erwischte mich dabei, dass ich im Kreis dachte, im ersten der vielen Kreise, die folgen sollten. Auf dieser Startetappe unserer gemeinsamen Reise waren die Gedanken unter meiner Schädeldecke noch nüchtern und abgeklärt. Als ich kurz vor Hamburg die Autobahn wechselte, versagte ich mir jedes weitere Grübeln, weil ich erkannte, dass ich des Pudels Kern nicht auf die Spur kam. Wollte ich das alles verstehen, musste ich den Knilch auf meiner Rückbank in ein Gespräch verwickeln und ihn vorsichtig ausquetschen. Darin war ich geschickt. Nur so würde es mir möglich sein, die wahren Hintergründe seiner Wahnsinnsfahrt herauszufinden. Wir würden Tage gemeinsam im Taxi zubringen und es würden sich reichlich Gelegenheiten ergeben, dem Kerl auf den Geldzahn zu fühlen. Solange ich fuhr, lief ich keine Gefahr, dass er mir eins über die Birne haute, denn dadurch brächte er sich selber in Not. Für den Augenblick war ich sicher hinter meinem Steuerrad, aber ich nahm mir vor, auf der Hut zu sein.
Links und rechts der Autobahn erblickte ich die Kräne des Hamburger Hafens, die ihre Arme wie mächtige stählerne Tentakel in die Luft streckten. Die Hochbrücke, auf kühne Betonstelzen gesetzt, verlieh der Szenerie etwas von Science-Fiction. Die Autos, die hinüberfuhren, wirkten wie Fliegen auf einer Wäscheleine. Bald darauf verschluckte der Elbtunnel die Aussicht und der zähe Mittagsverkehr drängelte unterirdisch weiter vorwärts. Als uns das Tageslicht wieder empfing, sah die Hansestadt aus wie jede andere Stadt, durch die man auf einer Autobahn fährt.
Nachdem wir Hamburg passiert hatten, bekam ich Durst. Wie üblich lag die Thermoskanne mit Kaffee unter dem Beifahrersitz und im Kofferraum stand wie immer eine Kiste mit Sprudelwasser bereit. Einen Moment überlegte ich, den nächsten Parkplatz anzusteuern, aber dann fiel mir ein, dass es wohl besser wäre, vor der dänischen Grenze noch einmal vollzutanken und meinen Durst bis zu dieser Zwangspause zu zügeln. Also suchte ich im Navi eine möglichst grenznahe Tankstelle und fuhr noch eine reichliche Stunde weiter, um die Piste bei Tarp zu verlassen. Von dort war es nicht mehr weit bis zur Grenze und der Ort lag günstig in der Nähe der Autobahn.
Wenig später stand ich an der Zapfsäule und steckte den Dieselrüssel in den Tankstutzen. Während der Treibstoff in meinen Wagen hineinrieselte, goss ich mir einen Becher Kaffee ein, spülte das lauwarme Gesöff mit mächtigen Schlucken hinunter und angelte mir eine Flasche Mineralwasser aus dem Kofferraum. Dabei blieb mein Blick kurz am Geldkoffer hängen. So viele Mäuse! Damit hätte man vermutlich ausgesorgt.
Bleib sauber, Junge! Wer weiß, was an diesem Geld klebt. Das könnte dir das Genick brechen. Lass es!
Die Zapfsäule riegelte ab und ich ging zur Kasse. Mein Spezi auf der Rückbank gab die ganze Zeit über keinen Mucks von sich. Er schlief und schlief und schnarchte und schlief. War der kaputt! Wovon nur?
Neben der Kasse entdeckte ich eine Theke mit belegten Brötchen und Kuchen. Das passte mir ganz gut. Ich kaufte ein Käse- und ein Schinkenbaguette und zwei Plunderteilchen zum Nachtisch. Mein zahlender Freund konnte gerne davon abhaben. Irgendwann würde er ja mal wach und dann hätte er bestimmt Hunger. Dann nutzte ich die Gelegenheit noch zu einem Toilettengang.
Mit dem Nötigsten versorgt und im Unterleib druckentlastet, fuhr ich zurück auf die Autobahn. Keine dreißig Kilometer weiter passierten wir die dänische Grenze. Hier gab es zum Glück keine Kontrollen mehr. Hätte dort ein Zöllner gestanden, hätte der mich bestimmt herausgewunken, denn ein wenig Angst hatte ich doch und wahrscheinlich sah mir das ein Profi an.
Aber das waren ja nicht meine Milliönchen da hinten im Stufenheck und wenn es auch unangenehm geworden wäre, der Polente die ganze Sache zu erklären, mich traf schließlich keine Schuld. Sollte doch Bolle, wie ich meinen Fahrgast, da er mir seinen richtigen Namen bislang nicht verraten hatte, in Anlehnung an einen Gassenhauer taufte, den Uniformträgern alles erklären. Mir war maximal die Schnapsidee vorzuwerfen, mich auf diese blödsinnige Tour eingelassen zu haben. Nordkap, wir kommen!
Direkt hinter der Grenze tauchte links eine Tannenpflanzung, rechts ein kleines Industriegebiet auf. Dann wurde es, wie zuletzt in Schleswig-Holstein, ausgesprochen ländlich. Äcker und Wiesen, ein wenig Wald dazwischen, eher Gebüsche. Der weite Himmel, eben noch komplett in sommerliches Blau eingekleidet, war plötzlich übersät mit Wattebausch-ähnlichen Schönwetterwolken. Doch das bisschen Wasserdampf und die paar Meter Straße konnten es nicht sein, die mir das Gefühl gaben, mich im Ausland zu bewegen. Es blieb alles vertraut und wirkte doch anders. Lag es vielleicht an den scheinbar flacher geneigten Dächern der Bauernhöfe oder an den gemütlicher wirkenden Häusern, dass ich den Grenzübertritt innerlich spürte? Jedenfalls rührte das Gefühl, in der Fremde zu sein, nicht ausschließlich von der dänischen Variante der Beschilderung und den ungewohnt klingenden Ortsnamen her.
Etwas fiel besonders auf. War der Verkehr auf der deutschen Seite noch sprunghaft und gehetzt erschienen, entspannte er sich auf der dänischen Seite sofort. Brav wurde die Spur gehalten, alle hielten ausreichend Abstand, niemand drängelte, die Höchstgeschwindigkeit wurde um höchstens zehn Stundenkilometer überschritten. So glitt ich mit meinem Taxi als ein Glied in der Kette der flüssig dahinrollenden Blechkarawane durch Südjütland dahin, ja, ich möchte sagen: in Ferienlaune.
Bei Fredericia ließen wir das Festland hinter uns. Eine Autobahnbrücke führt hier über den Kleinen Belt hinüber auf die Insel Fünen, die gelegentlich als „Garten Dänemarks“ bezeichnet wird. In der Höhe von Odense, dem Geburtsort von Hans Christian Andersen und Hauptort auf Fünen, raschelte ich in der Brötchentüte herum und zog das Schinkenbaguette hervor. Es war mittlerweile etwas weich geworden. Als ich Bolle ansprach, er könne auch etwas essen, gab der nur einen langgezogenen Schnarcher zur Antwort. Warum sollte ich also warten, bis sich der Käse unappetitlich nach oben bog? Gewohnt, meinen Eingebungen zu folgen, wanderte die Käsesemmel dem Schinken hinterher und in meinem Magen stellte sich ein herrliches Schweregefühl ein.
Am anderen Ende von Fünen erreichten wir die Brücke über den Großen Belt. Es ist ein imposantes Bauwerk, das an dieser Stelle die Verbindung zwischen Fünen und Seeland, dem nächsten Eiland, das die dänische Hauptstadt Kopenhagen trägt, hält. Zunächst fährt man über kleinere Inseln hinweg flach am Boden entlang, aber schon von Ferne sieht man die beiden gewaltigen Pylone aufragen, an denen die Brücke aufgehängt ist. Zwischen ihnen erreicht die Fahrbahn eine Höhe, dass die größten hier verkehrenden Schiffe darunter passieren können.
Ich freute mich schon auf die Überquerung, denn ich mag solche markanten Beispiele für die Kunst der Bauingenieure. Ich spielte sogar einen Augenblick mit dem Gedanken, Bolle dafür zu wecken. Aber dann ließ ich das mit dem Wecken und blieb mit meinem Reiseeindruck lieber allein. War doch Bolles Problem, wenn er nichts auf seiner teuren Fahrt sehen wollte.
Als wir den flachen Auftakt der Belt-Querung hinter uns gelassen hatten und die Steigung erreichten, die zum Zenit der Fahrbahn hinaufführt, entstand für mich der Eindruck, in ein Himmelstor hineinzufahren, das durch die Brückenpfeiler gebildet wurde. Einzig die Tragseilkonstruktion und die kräftigen Leitplanken kanalisierten den Blick, erinnerten daran, dass man immer noch erdverbunden unterwegs war. Dann flachte die Steigung ab und es ging wieder abwärts. Ich schaute von oben auf den Großen Belt hinab, auf dem die Schiffe neben dem gewaltigen Bauwerk und vor der Weite aus Meer und Landschaft wie Spielzeuge erschienen. Gerne hätte ich meine Geschwindigkeit gedrosselt oder gar angehalten, so erhaben wirkte dieser Ausblick auf mich, aber der Verstand verbot es mir, zum Verkehrshindernis zu werden, denn immerhin befand ich mich auf einer Autobahn. Also fuhr ich mit unverminderter Geschwindigkeit weiter und bedauerte, dass der Höhepunkt der Eindrücke hinter mir lag.
Am Kassenhäuschen auf der seeländischen Seite holte mich die Realität rasch wieder ein und ich entrichtete ein saftiges Entgelt für diese kurzen Augenblicke Höhenluft über dem Meer. Ich bezahlte die Maut von den Devisen, die mir Bolle in Dülmen zugesteckt hatte. Dann ging es weiter zum nächsten Wunderbauwerk, der Öresund-Brücke.
Die Öresund-Brücke bot einen ähnlichen Anblick wie ihre Vorgängerin. Allerdings ist sie, wie ich wusste, etwas niedriger als ihre Schwester über den Großen Belt. Nach ihrer Überquerung kamen wir bereits in Schweden an und auch dort lauerte uns eine Mautstelle auf. Dafür ersparte man uns zum Glück erneut die Grenzkontrolle.
Auf schwedischer Seite umkreiste ich Malmö und orientierte mich dabei an der Kennzeichnung „Europastraße 6“, auf der Karte und auf Schildern abgekürzt „E6“. Diese Straße würde von hier aus meinen Weg durch Schweden und Norwegen bis fast zum Nordkap bilden. Dort, wo ich auf die E6 auffuhr, hat sie bereits einige Kilometer von Trelleborg im äußersten Süden Schwedens hinter sich gebracht. Sie würde mich an der Westküste entlang nach Norwegen bringen, wo sie zunächst der Ostküste des Oslofjords folgt. Dann tangiert sie Oslo, die norwegische Hauptstadt, erreicht später Trondheim und führt anschließend in die nördlichen Provinzen, wo ich sie ein Stück hinter Alta endgültig in Richtung Nordkap verlassen würde. Insgesamt eine Strecke von 2600 Kilometern. Die E6 aber endet an diesem Abzweig noch nicht, sondern vollzieht eine Kehre nach Süden, weil ihr ein Fjord den Weg versperrt, nimmt auf ihrem letzten Stück eine Wendung in östliche Richtung und findet ihren Endpunkt in Kirkenes, unmittelbar an der russischen Grenze.
Bolle schlief unterdessen immer noch, wenn auch mittlerweile etwas unruhiger als zu Beginn der Fahrt. Seinen Rücken wollte ich nicht spüren, nach einem ganzen Tag zusammengekauert auf der Rückbank eines Taxis. Der musste doch langsam wachwerden! Oder hatte er was genommen? Das war dann aber eine ziemliche Dröhnung, denn auch nach drei Tagen ohne jeden Schlaf hielt ich es für unmöglich, in dieser Haltung stundenlang durchzupennen. Ein Rätsel mehr, das mir mein Begleiter aufgab.
Ich ließ Bolle Bolle sein und genoss lieber die Fahrt. Das Landschaftsbild aus Dänemark setzte sich auf schwedischer Seite fort. Die ganze Zeit über blieb die Gegend leicht gewellt, Felder und Wiesen wirkten wie ein Flickenteppich, kleine Wäldchen, bescheidene Flüsse und beschauliche Seen. Eine entspannte, eine entspannende Gegend, wie geschaffen, um dem Sommer eine Heimat zu geben. Der Baustil der Häuser verriet, anders als beim Passieren der deutsch-dänischen Grenze, nicht den Übergang in ein anderes Land. Das blieb noch etliche Zeit so. Auf die skandinavische Holzarchitektur musste ich noch etwas warten.
Der größte Teil der E6 in Schweden ist Autobahn und wir kamen weiter zügig voran. Es war tüchtig spät geworden und ich nahm mir vor, noch etwa zwei Stunden zu fahren. Tausend Kilometer, schätzte ich, würden dann hinter uns liegen. Mit Sicherheit die schnellsten Kilometer der ganzen Route – über das entschleunigte Fortbewegen auf norwegischer Seite hatte ich bereits in meinen Reiseführern gelesen.
Schließlich erreichten wir Halmstad. Ich verließ die E6 und fuhr einem Schild nach, das zu einem Hotel wies. Es entpuppte sich als moderner Hochhausturm, eine Art Unterkunft, die ich normalerweise nicht schätze. Aber für eine Nacht und müde, wie ich war, spielte das keine Rolle.
Ich parkte den Wagen auf einem Parkplatz nebenan und stieg aus. Meine Wirbelsäule verlangte nach einer Einheit Dehnübungen, die ich ihr gleich hier neben dem Auto bewilligte. Dann öffnete ich Bolles Verschlag und sprach ihn zunächst behutsam, dann in Zimmerlautstärke und schließlich im Kasernenton an. Er reagierte nicht. Was war mit diesem Knaben bloß los?
Ich kam einfach nicht dahinter und beschloss, mich zuerst um mich selbst zu kümmern. Ich fuhr die vorderen Seitenscheiben herunter, wie man es macht, wenn man seinen Hund alleine im Auto zurücklässt, verriegelte dann das Taxi per Fernbedienung und schlenderte ins Hotel.
Mich empfing ein glattes Interieur, Holzboden und Ledersofas. Hinter dem Empfang stand niemand und ich betätigte die Glocke. Eine stämmige blonde Frau mittleren Alters schoss aus einer Tür hinter dem Tresen und sprach mich auf Schwedisch an. Daran hatte ich bis jetzt gar nicht gedacht, dass mein Schulenglisch gefragt war. Es gelang mir unter Zuhilfenahme von Händen und Gesichtsmuskeln, zwei Einzelzimmer zu ordern und die Stämmige händigte mir die Schlüssel aus. Ich fragte sie, wo ich etwas zu essen haben könnte, und sie zeigte mir auf einem Plan des Hotels einen Raum, in dem sich das Restaurant befand.
Zufrieden, das alles geklärt zu haben, nahm ich den Aufzug in meine Etage und inspizierte mein Zimmer. Der glatte Einrichtungsstil setzte sich hier fort. Ich verriegelte die Tür hinter mir und befreite meine Hände vom Fahrschweiß, indem ich sie ausgiebig wusch. Dann warf ich mir zur Abkühlung ein paar Spritzer Wasser ins Gesicht. Genug der Hygiene. Ich schmiss mich aufs Bett und blieb ein paar Minuten einfach liegen.
Als ich aufstand, zeigte meine Armbanduhr kurz nach neun. Einen halben Tag war ich also schon von zuhause weg. Sollte ich nochmal nach Bolle sehen?
Ach was, sollte der doch meinetwegen im Taxi übernachten. Hunger hatte ich.
Ich sprang vom Bett auf und begab mich zum Restaurant. An den sauber aufgereihten Tischen saßen nur wenige Gäste. Die Atmosphäre, die hier herrschte, wirkte auf mich ziemlich clean, kühl möchte ich beinahe sagen, positiv ausgedrückt: zweckmäßig. Ich hatte kaum an dem Ecktisch, den ich gewählt hatte, Platz genommen, als schon ein junges Mädchen, das ich mir wegen einer gewissen Ähnlichkeit mit der Stämmigen vom Empfang als deren Tochter vorstellte, mit einer Speisekarte vor mir stand. Zu meiner Verblüffung war die Karte dreisprachig abgefasst, neben Schwedisch und Englisch auch in Deutsch. Obwohl mir das hohe Preisniveau für Alkoholika in Skandinavien bekannt war, orderte ich ein Bier und suchte mir, während das Mädchen verschwand, um das Getränk zu holen, Köttbullar, also Fleischklößchen, mit Stampfkartoffeln aus.
Nachdem mir die Bedienung eine kleine, immerhin gekühlte Bierflasche und ein Glas auf den Tisch gestellt hatte, bestellte ich das gewählte Essen durch Zeigen auf der Speisekarte. Dann schenkte ich mir die Gerstenkaltschale ein und nahm einen kräftigen Schluck. Schmeckte gar nicht übel.
Gerade setzte ich das Glas mit einem verhaltenen Seufzer ab, als Bolle in das Lokal hereinstürmte. Ein wenig wirr sah mein Fahrgast aus, als wäre er gerade eben erst aufgewacht. Trenchcoat und Kopfbedeckung trug er immer noch, was seinem Auftritt im Lokal eine gewisse Aufmerksamkeit bescherte. Er sah sich prüfend um und entdeckte mich dann in meiner Ecke. Sein Gesicht, jedenfalls das, was man unter seiner Hutkrempe erkennen konnte, zeigte große Erleichterung. O-beinig kam er auf mich zu.
„Wie gut, Sie hier anzutreffen. Ich habe so tief geschlafen, dass mich das Erwachen in Ihrem Taxi vollkommen verstört hat, denn ich hatte die ganze Fahrt für einen Moment verdrängt. Wo sind wir hier?“
Bolle blieb in Hut und Mantel vor mir stehen. Ein seltsamer Vogel war das.
„Wir sind in Schweden, in Halmstad, um genau zu sein. Ich habe auch schon ein Zimmer für Sie geordert. Setzen Sie sich doch. Es gibt hier ein ganz anständiges Bier, wenn auch nur aus der Flasche.“
„Ach ja. Gerne. Verzeihen Sie, ich muss ja einen Eindruck auf Sie hinterlassen … “, stammelte Bolle. Er nahm den Hut ab, hängte seinen Mantel, unter dem eine helle Hose und ein gepflegtes dunkelblaues Clubjackett hervorkamen, an einen Haken in der Nähe des Tischs und rutschte auf den mir gegenüber stehenden Stuhl.
Ich studierte Bolles enthülltes Gesicht. Er mochte Ende fünfzig sein, also in meinem Alter. Gertenschlank war er, weniger sportlich, ich hätte aufgrund der tiefen Falten auf den Wangen eher gesagt, ausgezehrt. Sein Teint war gebräunt, die Bräune war jedoch mit Grau unterlegt, irgendwie ungesund. Ja, einen kranken Eindruck machte er auf mich. Seine auffällig stahlblauen Augen glänzten leicht fiebrig. Was war sein Problem?
„Möchten Sie etwas essen? Ich habe gerade bestellt“, lud ich meinen entschleierten Fahrgast großzügig von seinem eigenen Geld ein.
„Wasser, nur Wasser. Ich werde es gleich selber bei der Kellnerin bestellen.“
„Sind Sie denn jetzt ausgeschlafen?“, fragte ich Bolle.
„Ich muss wirklich einen sonderbaren Eindruck auf Sie machen. Wie kann ich das nur korrigieren?“
„Erzählen Sie mir einfach, was Sie zu dieser Fahrt veranlasst hat. Da steckt doch eine Geschichte dahinter, oder nicht? Nur zu“, forderte ich Bolle mit meinem gewinnendsten Lächeln auf, sich zu erklären. Hinter diesem Sonntagsgesicht versuchte ich, meine extreme Neugier zu verbergen. Schließlich wollte ich endlich wissen, mit wem und was ich zu schaffen hatte.
Das Mädchen brachte – erstaunlich rasch – meine Köttbullar. Die hatten kaum zu tun in der Küche. Und sie besaßen unter Garantie eine Mikrowelle.
Bolle bestellte bei der Bedienung in lupenreinem Englisch ein Ramlösa, ein schwedisches Mineralwasser. Sein charmanterer Umgang mit ihr zeigte, dass er offensichtlich ein Mann von Welt war.
„Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt“, wandte sich Bolle wieder mir zu, „König mein Name. Ludger König. Wie heißen Sie?“
„Nennen Sie mich einfach Rainer. Das tun alle.“
„Na gut, dann rede ich Sie aber mit Herr an, wenn ich darf, Herr Rainer.“
„Ganz wie Sie wollen, Sie sind der zahlende Kunde. Und Sie heißen auch noch König.“
Bolle schmunzelte leicht verlegen über mein humorloses Witzchen. Ehrlich gesagt war es mir egal, wie er mich anquatschte.
Die Kellnerin brachte das Wasser und Bolle studierte eine Weile die Perlen in seinem Glas. „Tja, wir haben ja Zeit, nehme ich an“, sagte er dann. „Wenn es Ihnen nicht zu langweilig wird, hole ich etwas weiter aus mit meiner Geschichte. Darf ich?“
„Nur zu. Ich bin in der Regel ein guter Zuhörer“, antwortete ich, gespannt auf seine Story wie ein Trageseil an den Ostseebrücken. Das ließ ich Bolle aber lieber nicht merken.
Mein mysteriöser Passagier fiel in einen gepflegten Plauderton. Ich muss gestehen: Seine Art zu erzählen fesselte mich bereits nach den ersten paar Sätzen. Ein Mann, dem man gerne zuhörte. Ein geübter Geschichtenerzähler, dessen sonore Bassstimme das Erzählte trug.
Irgendwie war die Situation trotzdem etwas seltsam. Da waren wir zwölf Stunden lang gemeinsam im Taxi bis nach Schweden gefahren und hatten bislang kaum ein Wort miteinander gewechselt. Normalerweise hätten wir jetzt die Eindrücke unserer Reise miteinander ausgetauscht, unsere Pläne und Ziele für die nächsten Tage besprochen. Stattdessen erzählte mir dieser Mann seine Familiengeschichte.
Den Zusammenhang begriff ich erst später.
***
Man kennt uns im Ruhrgebiet. „König – Ihre Sicherheit unter Tage“, so lautet unser Firmenslogan. Mit diesem Motto ist meine Familie einmal bedeutend und reich geworden. Und ich habe das alles vorgestern liquidiert: Aus ist es mit Firma König und ihrer Sicherheit.
Doch ich will vorne anfangen, wir haben ja Zeit.
Meine Familie stammt aus dem Bergischen, aus irgendeinem unbedeutenden bergischen Kaff. Dort besaß sie seit dem achtzehnten Jahrhundert eine kleine Dorfschmiede, von der sie wahrscheinlich bescheiden gelebt hat. Pferde beschlagen, kleine Reparaturen an Kutschen, ab und zu einen schmerzenden Zahn ziehen: Davon lebte so ein Dorfschmied wohl damals. Und davon lebten die Königs, bis mein Großvater die Schmiede übernahm.
Meinem Großvater – Wilhelm hieß er, wie der Kaiser – reichte dieses Leben nicht. Er war besessen von der Idee, mehr aus dem alten Familienbetrieb zu machen. Zu Hilfe kam ihm dabei der Umstand, dass seine Eltern früh verstarben und er keine Geschwister besaß. Somit war er frei von Verpflichtungen, musste Vater und Mutter im Alter nicht finanziell unterstützen und es gab niemanden, der ihm in die Führung der Schmiede hineinredete.
Zu Wilhelms Zeit war das Ruhrgebiet die Heimat der Eisen- und Stahlindustrie. Namen wie Krupp, Stinnes oder Thyssen leuchteten ins Bergische Land hinüber. Dorthin wollte Großvater mit aller Macht. Dort wurde das Material bearbeitet, das zu seinem Lebensinhalt geworden war, dort loderten die Feuer, in denen das Eisen schmolz, am hellsten.
Ich habe ihn als kleiner Junge noch erlebt. Mit den Augen eines Kindes ist er mir immer komisch vorgekommen, wie er dastand, den linken Arm auf einen Gehstock gestützt – den rechten Unterarm hatte er im Dienst des Vaterlandes vor Verdun verloren –, mit Vollglatze und weißem, brustlangem Vollbart. Beinahe eine Märchenfigur. Allerdings bin ich ihm nie zu nahe gekommen, habe mich auf Distanz zu ihm gehalten, wahrscheinlich, weil wenig menschliche Wärme von ihm ausging.
Mit den Augen eines Erwachsenen wäre ich vermutlich zu einer anderen Einschätzung gelangt. Ich sehe Großvater Wilhelm noch am Tisch sitzen und energisch, ja herrisch, mit dem linken Arm herumfuchteln, um seine Worte oder Anliegen zu bestärken. Im Stehen benutzte er zusätzlich seinen Gehstock, den er, wie ein ekstatischer Dirigent seinen Taktstock, durch die Luft zischen ließ. Ich glaube, mein Vater besaß riesigen Respekt vor seinem alten Herrn, der in Wirklichkeit keineswegs die Märchenfigur war, die ich als Kind in ihm gesehen habe. Sechzig Jahre zuvor hatte irgendein Banker diesem Dorfschmied immerhin den Kredit gewährt, um seine Vision von einer Werkzeugfabrik zu verwirklichen.
Dieses Geld bildete den Grundstock für Großvaters Unternehmen, das er folgerichtig in Essen errichtete. Kaum dort angekommen, machte er sich gleich daran, gemeinsam mit einem Gesellen eine neue Art Lager für Pumpenwellen zu entwickeln. Nach monatelanger Anstrengung war es soweit: Wilhelm König erhielt auf seine Erfindung ein Patent.
Es ist nicht überliefert, welche Neuerungen dieses Patent beinhaltete, denn das war lange Zeit das bestgehütete Betriebsgeheimnis der Firma König. Die Unterlagen dazu gingen im Zweiten Weltkrieg bei einem Brand verloren. Es müssen aber Optimierungen des Härtungs- und Schleifverfahrens gewesen sein, die Großvater stolz dem Patentamt präsentiert hat. Für ihn war es gewiss ein feierlicher Moment, als er die frische Patenturkunde zum ersten Mal in seinen groben Schmied-Händen hielt!
Die Bodenhaftung verbat es Wilhelm, nun selbst vom Pumpenbau zu träumen. Nein, er stellte es gescheiter an. Er fertigte mit seinem Gesellen ganz besonders sorgfältig zwei Pumpenlager im neuen Verfahren und bot sie den etablierten Pumpenfabrikanten zum Probelauf an, unter der Bedingung, dass er sie bei erfolgreichem Test zuliefern würde. Geschickt öffnete er sich so ein Türchen zur Ruhrindustrie, denn darauf zielten seine Anstrengungen letztendlich ab. Die Erprobung der Lager muss sehr überzeugend ausgefallen sein, denn binnen Jahresfrist belieferte Großvater alle führenden Pumpenhersteller. Der kleine Dorfschmied war dort angekommen, wohin er sich vom Schmiedefeuer seiner bergischen Heimat geträumt hatte.
Erst als gesetzter Geschäftsmann fand Wilhelm es an der Zeit, eine Familie zu gründen. Ein Jahr vor Ausbruch des Kriegs heiratete er in gutbürgerliche Kreise ein, was ihm manchen Vorteil für das Geschäftliche verschaffte. Leider ließ er sich von Glanz und Gloria des Kaiserreiches so weit blenden, dass er sich trotz der großen Verantwortung für den Betrieb als einer der Ersten zum Kriegsdienst verpflichtete. Ein Mann seiner Stellung und mit seinen Verbindungen wäre garantiert bis zum Ende der Weltenschlacht nicht eingezogen worden, hätte er es nicht selbst darauf angelegt. Nun, wie schon berichtet, bezahlte er für diesen Enthusiasmus mit einem Unterarm und außerdem mit einem gehörigen Knacks, was seine Deutschtümelei anging. In dieser Beziehung war er ein Hinterwäldler geblieben. Hitler stand er später angeblich von Anfang an kritisch gegenüber.
Während Großvater im Dienste des Kaisers gegen Frankreich aufmarschierte, wurde noch im ersten Kriegsjahr mein Vater, Heinz König, geboren. Nach seiner Verletzung kam Wilhelm heim und hatte die Nase voll vom Soldatentum. Andererseits war es gut, dass er sich nun wieder um seine Firma kümmern konnte, denn der Krieg hatte ihn nicht nur den Unterarm, sondern mangels Aufträgen auch beinahe das Geschäft gekostet. In den folgenden Jahren mit den Gründungswirren der Weimarer Republik, der Ruhrbesetzung und der Inflation wurde die wirtschaftliche Situation nur unwesentlich besser.
Richtig in Fahrt kamen Wilhelms Geschäfte erst wieder im Dritten Reich.
Inzwischen war Familie König auf sieben Köpfe angewachsen: Heinz hatte drei Brüder und zuletzt noch eine Schwester bekommen. Wilhelm setzte durch, dass keiner seiner vier Söhne aufs Schlachtfeld geschickt wurde. Da mag einiges an Schmiergeld und manche geduldete Vorteilsnahme im Spiel gewesen sein. Doch mein Vater Heinz ist seinem Vater immer dankbar dafür gewesen, dass er ihm den Dienst an der Waffe erspart hat. Für vieles andere war er ihm nicht dankbar, besonders nicht für die ihm zugewiesene Rolle im elterlichen Betrieb.
Heinz war als Erstgeborener natürlich der Kronprinz der Firma König. Meine Großmutter soll ihn sehr verwöhnt haben. Nach dem Gymnasium wurde er – unter Einflussnahme der Familie seiner Mutter übrigens und gegen den Willen Wilhelms, der eher dem praktischen Ausbildungszweig zuneigte – nach Köln auf die Universität geschickt. Dort hat er wohl, wenn ich seine Erzählungen über jene Zeit richtig deute, ein recht flottes Studentenleben geführt. In den ersten Semestern versuchte er es mit den verschiedensten Studienzweigen – aus stillem Protest gegen seinen Vater, der die ganze Studiererei argwöhnisch beäugte –, bis er letztendlich im Kaufmännischen hängenblieb. Kurz vor Kriegsende brachte er einen Abschluss zustande.
Der Eintritt meines Vaters in den elterlichen Betrieb fällt tatsächlich in den Mai 1945. Wilhelm hatte seinem Sohn vorsorglich ein kleines Büro direkt neben einer der zerbombten Werkshallen einrichten lassen. Er soll ihn dort mit den Worten empfangen haben: „So, mein Junge, genug der geistigen Höhenflüge. Die Halle da, die baust du mir als Erstes wieder auf!“ Auch wenn diese Worte so nicht gefallen sein mögen, bezeichnen sie doch das Verhältnis der beiden, wie es später auf Familienfeiern in meinem Beisein immer wieder beschrieben wurde: Der groß gewordene Dorfschmied nimmt den studierten Sohnemann unter seine Knute. Trotz dieses permanenten Schwelbrandes hat Heinz nie mit dem Gedanken gespielt, die Firma König zu verlassen. Er war zu stolz, den Familienbesitz aufzugeben, und wusste, dass die Uhr für ihn tickte, denn sein Vater hatte die Sechzig lange überschritten.
Nach schweren Nachkriegsjahren des Aufbaus und der Entbehrungen zündete das deutsche Wirtschaftswunder. Kohle und Stahl wurden wieder zum Motor der Ruhrwirtschaft. Firma König lieferte jetzt komplette Pumpen, Bremsanlagen für Loren, Beleuchtungseinrichtungen und alles andere, was man im weitesten Sinne unter dem Schlagwort „Sicherheit“ subsumieren kann, direkt an die Zechen. Besonders dieser unmittelbare Kontakt zu den Endkunden wurde wertvoll, als gegen Ende der fünfziger Jahre das Zechensterben einsetzte.
Zu diesem Zeitpunkt gab Wilhelm die Firmenleitung endgültig an Heinz ab, weil er merkte, dass seine Kräfte schwanden und er den Anforderungen der neuen Zeit nicht mehr gewachsen war. Nun ging Heinz’ Stern erst auf. Mein Vater war im Grunde gar kein Schöngeist, was ihm Großvater angedichtet hatte. Er lebte halt gerne und war den Genüssen des Lebens zugetan.
Wenn man sich heute die Familienalben von damals ansieht, dann verkörpert Heinz König auf den Fotos das Klischee vom erfolgreichen Unternehmer aus dem Wirtschaftswunderdeutschland der Nachkriegszeit. Im Anzug, mit weißem Hemd und Krawatte, lächelt er in die Kamera. Die Neigung zur Glatze, sein Erbteil von Wilhelm, hatte seinen Schopf Mitte dreißig bereits reichlich ausgedünnt. Sein freundliches, ovales Gesicht stützt er auf ein ansehnliches Doppelkinn und er trägt einen stattlichen Unternehmerbauch vor sich her. Ein regelrechter Buddha von der Ruhr!
Sonntags war unser Haus immer mit dem Duft seiner teuren Zigarren erfüllt und noch heute verbinde ich Erfolg und Zufriedenheit mit diesem Geruch. Später hat mein Vater wegen gesundheitlichen Problemen einigen Genüssen abschwören müssen, Zigarren hat er sich jedoch nie abgewöhnt.
Anfang 1951 hat mein Vater seine Sekretärin, meine Mutter Ursula, geheiratet. Es waren mehr die praktischen Dinge, die Heinz und Ursula miteinander verbanden. Ich bin nicht sicher, ob mein Vater seiner Frau immer treu war – wenn nicht, haben die beiden in meiner Gegenwart wenigstens keine Szene daraus gemacht. Vier Jahre nach der Hochzeit kam ich zur Welt und blieb das einzige Kind aus dieser Verbindung.
Das Ehepaar König ergänzte sich gegenseitig prima. Ursula hielt ihrem Heinz den Rücken frei, schob Innendienst bis in die Nacht hinein, während ihr Mann seine Sausen zur Förderung der Geschäfte unternahm. Mutter hat nie über die vielen Arbeitsstunden geklagt und war rund um die Uhr für die Firma da. Aber leider nicht für mich.
Ich wuchs in den Händen von Hausmädchen und Erziehern auf. Darüber möchte ich mich nicht beklagen, das erklärt aber vielleicht einiges. Ich lebte in einem Kokon, unserer Villa am Stadtrand, fern der Realität. Nie war ich gezwungen, mich gegen andere durchzusetzen. Unser Personal hütete sich, dass ich einen Grund haben könnte, mich über jemanden zu beklagen: Sie wussten alle nur zu genau, würde ich meiner Mutter etwas Derartiges erzählen, hätten sie leicht ihre gutbezahlte Stelle verlieren können. Das entsprach wahrscheinlich wiederum dem schlechten Gewissen meiner Mutter, dass sie mich fremden Menschen anvertraute. Also begegnete mir mein gesamtes Umfeld mit Vorsicht und unangemessener Nachsicht. Auf je weniger Widerstand ich traf, desto größeren Gefallen fand ich daran, meine Grenzen auszudehnen.
Kurz gesagt: Ich wurde zu einem kleinen Monster erzogen.
Das ging natürlich fürchterlich schief, als ich eingeschult wurde. Stillsitzen, mich in die Schülergemeinschaft einfügen, Auseinandersetzungen standhalten: Das waren neue Erfahrungen, die meine Mitschüler weitaus besser meisterten als ein verzogener kleiner Egozentriker. Es dauerte nicht lange, bis sich meine Lehrerin bei meinen Eltern meldete.
Und wie reagierten die?
Was zuvor ein schrankenloses Zuhause gewesen war, schlug nun um in ein Heim der Strenge. Das Personal wurde angewiesen, mir nichts mehr durchgehen zu lassen, und wenn ich mich jetzt über einen unserer Hausgeister bei meiner Mutter beschwerte, wurde immer deren Verhalten bestätigt, das genaue Gegenteil dessen, was ich bisher kennengelernt hatte. Aus dem kleinen Monster wurde so ein schüchternes, ängstliches Kind, ein Außenseiter, gedrillt, um zu funktionieren. Aber tief in mir drin wurzelte der Drang, mich auszuleben, wie ich es aus meiner frühen Kindheit kannte, tief in mir drin schlummerte die Sehnsucht, wieder ein Leben ohne Grenzen zu führen, setzte sich ein unterdrückter, aber deshalb nicht vergessener Freiheitsdrang fest – bis heute!
Die Grundschule schloss ich in der Versetzungsklasse mit einem mittelprächtigen Zeugnis ab. Auf Anraten meiner Lehrerin steckten mich meine Eltern in ein konservatives Internat. Zucht und Ordnung als Ideale vergangener Zeiten hatten dort überlebt und bestimmten nun als verlängerter Arm meines Zuhauses die Tage. Der einzige Weg, ein bisschen Anerkennung von meinem Elternhaus zu bekommen, wonach meine wunde Seele regelrecht lechzte, war Fleiß.
Ich zwang mich dazu, mehr Stunden als meine Mitschüler hinter den Büchern zu hocken, und lernte, was das Zeug hielt. Nur die guten Noten, die sich bald als Lohn für die ganze Plackerei einstellten, brachten mir Lob vonseiten meiner Eltern ein – eine andere Art von Zuneigung blieb mir verwehrt. Zu sehr waren die beiden mit dem Wohlergehen der Firma König beschäftigt; ihr Sohn war und blieb eine Randnotiz in ihrem Leben.
Mein Vater diktierte, dass ich nach der Schule Bergbau zu studieren hätte. Auf irgendeinem Fortbildungsseminar hatte er die Marketinglehre aufgeschnappt und fühlte sich bestätigt darin, dass ein Unternehmen vom Markt her zu führen sei. Jene Betriebe würden den größten unternehmerischen Erfolg haben, die am besten auf die Wünsche der Kundschaft eingingen. Für ihn lag ein gewisses Kalkül darin, der geneigten Kundschaft irgendwann einen Nachfolger präsentieren zu können, der ihre Branche verstand.
Ich will zugeben, dass die Wahl des Studienfachs meinen Interessen und Neigungen ziemlich gut entsprach. Die Technikbegeisterung Wilhelms, die ihn zu seiner Zeit groß gemacht hatte, hatte eindeutig eine Generation übersprungen.
So, wie ich ein eifriger Schüler war, so wurde ich auch ein eifriger Student. Ich schloss innerhalb der Regelstudienzeit mit einer Eins ab und setzte meine Universitätslaufbahn sogleich mit einer Promotion fort. Ja, Ihnen sitzt Dr. Ludger König gegenüber. Darauf waren meine Eltern besonders stolz.
Wie es unterdessen unserer Firma ging?
Nun ja, die Kundschaft starb sozusagen aus. Eine Zeche nach der anderen schloss ihre Pforten. Nur ein gestiegenes Sicherheitsbewusstsein erhielt uns eine Marktnische, in der die Firma König überleben konnte. Die Öffnung gegenüber den Weltmärkten hatte die Importkohle nach Deutschland gebracht und nur im internationalen Denken steckte für unsere Produktpalette eine Chance für eine einträgliche Zukunft.
Diese Einsicht hatte mein Vater längst gewonnen, als er mich nach meiner Promotion ins Unternehmen holte und ich zum ersten Mal Einblick in das Geschäft erhielt. Die achtziger Jahre waren gerade angebrochen, Wirtschaftskrisen für Deutschland kein Fremdwort mehr. Hohe Lohnabschlüsse im Jahrzehnt zuvor hatten die Produktionskosten in die Höhe schnellen lassen. Und ich als Theoretiker, als Youngster, war zum Garant des Fortbestandes der Firma König erkoren und sollte aus dem Handgelenk heraus eine Neuausrichtung anstoßen. Lieber Vater Heinz, das war einfach unfair!
Drei Jahre blieb mein Vater noch der Berater an meiner Seite. Dann erlitt er plötzlich einen Schlaganfall und bezahlte für seinen ausschweifenden Lebenswandel. Mutter zog sich zeitgleich mit ihm ins Private zurück. Die Verantwortung für die Firma blieb an mir hängen. Und meine Antwort darauf war wieder: Fleiß.
Ich schaltete ein namhaftes Beratungsunternehmen ein, das für mich einen Masterplan für den Fortbestand unseres Unternehmens entwickelte. Fremdes Kapital hereinzulassen, das schloss ich von vorneherein aus. Die Firma König sollte unter allen Umständen im alleinigen Besitz der Familie bleiben – das war ich Wilhelm und Heinz schuldig.
Die überlegen dreinschauenden Berater verstanden solche Sentimentalitäten nicht, bestätigten mir aber in allen anderen Punkten das, was ich längst ahnte: Die Produktionskosten mussten herunter, neue, internationale Märkte mussten erschlossen werden. Das Strategiepapier der Herren zeigte auch die Wege auf: Verlagerung der Produktion technisch anspruchsloser Artikel ins Ausland, vermehrter Zukauf von Standardmaterialien, Platzierung des Themas „Sicherheit im Bergbau“ auf den Märkten in Südamerika und Fernost, Aufbau eines internationalen Handelsnetzwerks mit Partnern vor Ort. Eine Herkulesaufgabe lag vor mir. Ich habe mich ihr gestellt, ihr mein Leben geopfert.
Meine wenigen Beziehungen sind alle wegen Zeitmangel den Bach runtergegangen. Geheiratet habe ich nie. Ich ackerte und ackerte, flog rund um die Erdkugel, führte Gespräche in verschiedenen Sprachen und soff mich, wenn es erforderlich war, mit irgendwelchen chinesischen Provinzfürsten halb zu Tode. Ich habe in diesen Jahren alles für die Firma König gegeben, da darf mir niemand einen Vorwurf machen. Und – das bewerte ich anders als unser Betriebsrat – ich habe dabei immer an die Leute gedacht, auch wenn die Belegschaft in unserem Stammwerk während meiner Zeit auf ein Drittel geschrumpft ist.
Weder Wilhelm noch Heinz hätten es besser gemanagt. Ich habe ihren Betrieb bis vorgestern unter Einsatz aller Kräfte, die im mir stecken, und darüber hinaus erhalten und bin ihrer Sache treu geblieben. Trotzdem bin ich gescheitert, denn in mir sind Widersprüche aufgebrochen, denen gegenüber ich machtlos bin.
Wieder einmal war ich nach Fernost gereist. Ich wohnte in einem dieser Fünf-Sterne-Hotels, die überall auf der Welt vorgeben, landestypisch und authentisch zu sein, aber stets nur ein Abklatsch der Wirklichkeit und eine Kunstwelt bleiben. Es zog mich hinaus in diese Wirklichkeit, hinaus aus dieser Legebatterie für Wirtschaftskapitäne, hinaus auf die Straße, in den Schmutz hinein, in den Lärm hinein, ins Leben hinein. Ein Taxi brachte mich in ein Viertel, das überlief von diesem Leben. Wimmelnde Betriebsamkeit herrschte dort, plötzlich roch das Leben nach scharfen Gewürzen und Auspuffgasen, kroch das Leben aus allen Winkeln, bestürmte mich im schweißnassen Oberhemd, nahm mich in sich auf und spie mich am Ende wieder aus, denn dies war nicht mein Leben.
Hier war ich so fern der Heimat!
Die Freizügigkeit meiner frühen Kindheit kam mir in den Sinn, während ich einer Schar kleiner Asiaten beim Spielen zusah. So frei, so unbeschwert, so gedankenlos sollte man wieder einmal sein dürfen! Warum trieb ich mich hier herum und trug den Asiaten Produkte hinterher, die in der Heimat niemand mehr nachfragte? Sollte ich mich wirklich mit einem Unternehmen herumquälen, das nur noch durch Export fortbestand?
Dieses Gespinst aus Gefühlen und Fragen drang auf mich ein, scheinbar ohne Zusammenhang. Und trotzdem gab es diesen Zusammenhang: Die Sinnfrage meines Schaffens und die Sehnsucht nach Freiheit. Ohne die Verneinung der Sinnfrage hätte ich dem Freiheitsdrang nie nachgegeben, denn dabei hätte die mir eingetrichterte Disziplin im Wege gestanden. Während meines Fußmarschs zurück ins Hotel knabberte ich gewaltig an diesem Konflikt.
Wieder in meinem Quartier angekommen, stand die Antwort auf meine Krise fest. Ich ließ alle Termine sausen, packte meine Sachen und bestieg den nächsten Flieger nach Düsseldorf. Direkt vom Flughafen aus fuhr ich in die Kanzlei unserer langjährigen Anwaltssozietät und wartete auf den nächsten freien Notar. In einer Nachtschicht besprach ich mit ihm die Gründung der König-Stiftung. Außerdem bat ich ihn, den Verkauf der Firma vorzubereiten.
Durch einen meiner Geschäftspartner fand ich überraschend schnell einen Interessenten, einen Chinesen. Die fünf Millionen im Koffer, die zweigte ich zur Sicherung meines Lebensabends ab. Der Rest ging in die König-Stiftung ein, die zum Ziel hat, das industrielle Ruhrgebiet in Museen, Ausstellungen, Forschung, bildender Kunst und Literatur für die Nachwelt zu bewahren. Vielleicht erhielten Wilhelm und Heinz durch die Stiftung den Platz in der Geschichte, der ihnen gebührt.
Die Abwicklung der Firma König wurde vorgestern besiegelt. Eine schwere Last ist dadurch von meinen Schultern genommen. Die ganze Verantwortung die Jahre über, das Wachsamsein gegenüber der Konkurrenz, die vielen schlaflosen Nächte, die schwierigste Entscheidungen hervorbrachten. Es war niemand da, der mir diese Last erleichtert, geschweige denn abgenommen hätte. Meine Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen wollten immer nur Geld sehen. Wenn es einem von ihnen dreckig ging, kam er angekrochen. Ansonsten hieß es immer: „Der Ludger hat doch den Betrieb geerbt. Der hat doch das ganze Geld. Worüber soll der sich beklagen?“ Von meiner Bürde hat niemand Notiz genommen.
In die ganze Erleichterung mischt sich heute, nachdem die erste Euphorie hinter mir liegt, ein Wermutstropfen. Ich habe ein Unternehmen aus der Hand gegeben, das mein Großvater aufgebaut, mein Vater geprägt und ich … zu Grabe getragen habe. Natürlich schmerzt mich das. Aber ist das nicht nur eine Vorwegnahme des Endes einer ganzen Ära des Ruhrbergbaus? Ist die Firma König nicht ein Teil dieser verblichenen Ära? Hätte ich den Geschäftszweck umformulieren und beispielsweise einen Anlagenbauer für die Lebensmittelindustrie aus der Firma formen sollen? Es gab solche Vorschläge. Aber: Wäre das nicht erst recht einem Verrat an Wilhelm und Heinz gleichgekommen?
Seit die Tinte unter dem Vertragswerk getrocknet ist, plagen mich diese Gedanken. Nachdem ich mit meinem Geldkoffer zwei Tage und Nächte durch die Straßen gezogen war, ohne zu essen, ohne zu schlafen, wusste ich nur eine Antwort: Ich musste irgendwohin, wo Ruhe herrscht, wo die Natur erhaben ist, wo ich eine andere Macht spüren kann als die der Wirtschaft und der wirtschaftlichen Interessen, etwas sehen und erleben kann, das größer ist als wir Menschen. Deshalb habe ich heute Morgen Ihr Taxi bestiegen und es fiel mir auf die Schnelle kein magischeres Ziel ein als das Nordkap. Was ich dort oben will, weiß ich noch nicht. Aber dass es eine neue Erfahrung für mich birgt, da bin ich sicher.
Diese Andersartigkeit brauche ich jetzt, um meine neue Freiheit zu begreifen, um meinen lebenslangen Käfig zu sprengen. Am Nordkap, das spüre ich ganz genau, wird ein neues Leben für mich beginnen, ein lasten- und sorgenfreies Leben, ein befreites Leben, ein Leben fernab von den Verpflichtungen einer Firma König und ihren Gründern gegenüber.
Ich freue mich darauf!
Von Halmstad nach Dombås
Ich war lange mit dem Essen fertig und hatte zwischenzeitlich noch zwei weitere Biere getrunken, als Ludger König zum Schluss kam. Kerzengerade saß er vor mir, strahlte tatsächlich eine Art königlicher Würde aus. Ein Mensch, der etwas darstellte in seinem Clubjackett und mit seiner angenehmen Stimme, ein wunderbarer Erzähler.
In diesem Augenblick war ich zufrieden mit Ludger Königs Erklärungen, war fest davon überzeugt, alles verstanden zu haben. Was er mir in seiner Erzählung auseinandergelegt hatte, die Familiengeschichte, die Familientradition, wie er aufwuchs in diesem großbürgerlichen Umfeld, wie er daran verzweifelte und letztendlich scheiterte, beides fortzuführen, das fand ich absolut nachvollziehbar. Seinen Entschluss zu dieser Flucht vor den Gespenstern seiner Vergangenheit, zu der wir gemeinsam aufgebrochen waren, ja selbst die Wahl des Ziels, des Nordkaps, passten für mich ins Bild. War die Fahrt für mich eine Chance, eine kleine Auszeit von der Routine zu nehmen, bedeutete sie für ihn einen Befreiungsschlag. Ich möchte sogar sagen, dass ich Ludger König an diesem Abend regelrecht bedauerte für sein Leben am Leben vorbei und ich gönnte ihm die erkämpfte Freiheit von Herzen. Ich gehe so weit, zu behaupten, an diesem Abend besaß er meine ganze Sympathie.
Und noch etwas war für mich enorm wichtig: Das Geld, das ich chauffierte, entstammte keinen kriminellen Machenschaften! Ich wusste zwar nicht, ob man Barschaften dieser Größenordnung über die Grenzen Europas hinweg befördern durfte, an Zoll und Fiskus vorbei. Moralisch befand ich mich aber ganz auf Ludger Königs Seite. Es war sein Geld und nachdem er jahrzehntelang dieses Geld nur als Saldo auf irgendwelchen Konten gekannt hatte, verstand ich seine Handlungsweise, den Erfolg seines Lebenswerks physisch bei sich zu tragen, nur zu gut. Die Erklärungen meines Fahrgastes befreiten mich von meinen Skrupeln und Verdächtigungen. Ich konnte ja nicht ahnen, was noch folgen würde.
„Danke für diese Erklärung“, rief ich meinem Gegenüber zu, einen kleinen Klops der Rührung im Hals. Wirklich nur einen kleinen.
„Ich dachte, ich müsste Sie so weit Einblick nehmen lassen in meine Herkunft und meine Motive für diese Reise. Damit Sie mich verstehen, meine ich. Verstehen Sie mich?“
„Voll und ganz“, versicherte ich.
Ludger König war durch seinen Erzählmarathon sichtlich erschöpft, so dass er wieder sehr müde wirkte. Das Grau unter seiner Haut trat noch deutlicher hervor und ich machte mir neue Sorgen. Wenn er wirklich krank war: Wie ernst war diese Krankheit?
„Fehlt Ihnen etwas? Ich will ehrlich sein: Sie sehen nicht ganz gesund aus“, sprach ich das Thema offen an.
„Nein, nein. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich bin nur völlig fertig. Es ist beinahe so, als käme der ganze Stress der Jahre jetzt auf einmal hervor. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich mich hinlege. Darf ich Sie um meinen Schlüssel bitten?“
„Ja, natürlich. Moment. Hier ist er. Es ist Zimmer siebenhundertneun. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Herr König.“
„Gute Nacht, Herr Rainer.“
Bolle – ich bleibe ab jetzt wieder bei Bolle und habe, wie man später sehen wird, meine Gründe dafür – nippte den ersten winzigen Schluck von seinem Ramlösa, erhob sich, griff nach Schlüssel, Hut und Mantel und verschwand durch die Restauranttür. Ich blickte ihm nachdenklich hinterher.
Die Geschichte, die mir gerade serviert worden war, klang zwar durch und durch glaubwürdig und mein Mitreisender schien mir ein aufrechter Mensch zu sein. Doch mein Instinkt, mein Jahre lang geschulter Taxifahrerinstinkt, der antrainierte Argwohn den Fahrgästen gegenüber, flüsterte mir zu, dass Wissen vor Glauben steht.
Ich winkte die junge Frau herbei und beglich die Rechnung. Die drei kleinen Biere kamen genauso teuer wie das Essen. Dann ging ich ins Foyer des Hotels.
Vorne an der Rezeption gab es einen Computer, der Gästen kostenlos zur Verfügung stand. Bildschirm und Tastatur waren etwas erhöht auf einem Bord platziert, so dass man das Gerät im Stehen oder auf einem Barhocker sitzend bedienen konnte. Ich schob das Sitzmöbel, das die Vorbenutzer zur Seite gestellt hatten, heran und rief eine Suchmaschine auf. Als Erstes tippte ich „König Bergbau“ ein. Das Einzige, was ich dazu finden konnte, war „Bergbau AG Ewald-König Ludwig“ und hatte definitiv nichts mit der Firma König zu tun, von der Bolle gesprochen hatte.
Ich versuchte es mit den Namen Ludger, Heinz und zuletzt mit Wilhelm König. Alles, was der Computer ausspuckte, wollte nicht zu Bolles Story passen. Im Essener Telefonbuch wurde kein Ludger König geführt. Als selbst der Slogan „König – Ihre Sicherheit unter Tage“, der ja angeblich überall bekannt sein sollte, keine brauchbaren Treffer lieferte, gab ich auf. Nach der Stiftung, die gemäß Bolles Auskunft angeblich erst wenige Tage existierte, brauchte ich erst gar nicht zu suchen.
Das Imperium König – eine einzige große Lüge? Nur dazu erfunden, mich zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen?
Die ergebnislose Sucherei ernüchterte meinen Glauben an Bolle und seine Erzählung ziemlich. Eben noch war ich gewillt gewesen, ihm seine Familiensaga abzukaufen. Er hatte so überzeugend gesprochen, flüssig und wortgewandt. Es hatte absolut seriös geklungen. Anscheinend war ich ihm auf den Leim gegangen. Ich hatte ihn ehrlich bemitleidet und nun blieb nichts als Enttäuschung übrig.
Dieser Mann hieß definitiv nicht Ludger König. Das Schlimmste war für mich: Ich kutschierte weiterhin einen Namenlosen durch die Gegend, vielleicht sogar einen kranken Namenlosen oder gar einen ansteckend kranken Namenlosen mit einem Haufen Geld aus unbekannter Quelle. Und dass er mir so schamlos einen Bären aufgebunden hatte, machte ihn in meinen Augen gefährlich.
Was verbarg Bolle vor mir? Betrug? Oder Schlimmeres?
Ich blätterte die Online-Meldungen von verschiedenen deutschen Nachrichtendiensten durch nach Informationen über ein Verbrechen, bei dem es um stattliche Summen ging. Als ich bei den Meldungen, die zwei Wochen alt waren, ankam und immer noch nicht fündig geworden war, gab ich auf. Auch diese Recherche führte ins Leere.
Was sollte ich tun?