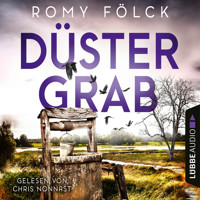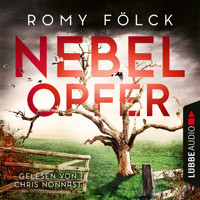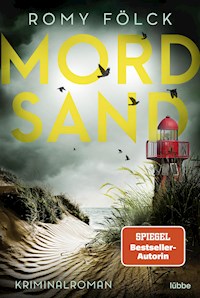9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Elbmarsch-Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach ihrem letzten Fall erholt sich Frida Paulsen in der Elbmarsch, als sie der Hilferuf ihrer alten Freundin Jo erreicht. Vergangene Nacht fand diese in der Marsch die Leiche einer Frau und ist nun überzeugt, dass man sie des Mordes verdächtigt. Kurz darauf verschwindet Jo spurlos. Besorgt begibt sich Frida auf die Suche nach ihrer Freundin. Die Spur führt auf die Halbinsel Holnis zu einem einsam gelegenen Haus, das die Inselbewohner nur das Bluthus nennen. Vor vielen Jahren wurde dort eine Familie grausam hingerichtet - den Täter hat man nie gefunden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungOstseeküste, Herbst 199712345678910111213141516171819202122232425DankÜber dieses Buch
Ein einsam gelegenes Reetdachhaus an der Ostsee. Die Inselbewohner nennen es das Bluthus, seit dort vor vielen Jahren eine Familie grausam ermordet wurde. Der Täter wurde nie gefunden.
Zwanzig Jahre später verschwindet eine alte Freundin von Frida Paulsen spurlos. Die junge Polizistin ist zutiefst beunruhigt. In der Wohnung der Vermissten findet sie ein Foto – es zeigt ein einsam gelegenes Reetdachhaus am Meer. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Bjarne Haverkorn begibt sich Frida auf die Spur dieses rätselhaften Hauses, dessen unheilvolle Vergangenheit für sie alle zur tödlichen Bedrohung wird …
Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn ermitteln in ihrem zweiten Fall – der neue Roman der SPIEGEL-Bestsellerautorin
Über die Autorin
ROMY FÖLCK wurde 1974 in Meißen geboren. Sie studierte Jura, ging in die Wirtschaft und arbeitete zehn Jahre für ein großes Unternehmen in Leipzig. Heute lebt sie als freie Schriftstellerin in der Elbmarsch bei Hamburg. TOTENWEG, der erste Band ihrer Krimiserie um das Ermittlerduo Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn, wurde zu einem sensationellen Erfolg und stand wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Mit BLUTHAUS legt die Autorin den zweiten Band der Serie vor.
ROMY FÖLCK
BLUTHAUS
KRIMINALROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2020/2025 by Bastei Lübbe AG,
Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de unter Verwendung von Motiven von © www.buerosued.de und © Plainpicture: Stephen Sheperd
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6323-4
luebbe.de
lesejury.de
Für meine SchwesterKatrin Fölck
Ostseeküste, Herbst 1997
Der Verrat fühlt sich so eisig an wie das Wasser, das um ihre Beine spült. Wellen schlagen hart am Ostseestrand auf. Sie hat Mühe, in der aufschäumenden Brandung das Gleichgewicht zu halten, aber sie bleibt stehen. Der Wind ist kalt und peitscht ihr die nassen Haare ins Gesicht. Sie wischt sich Meerwasser und Tränen von den Wangen, dreht sich um und läuft los. Auf dem sandigen Untergrund rutscht sie weg, fängt sich wieder und läuft weiter. Sie sieht kaum etwas, stolpert über Geröll und angewehte Zweige. In der Dunkelheit wird sie den Weg zum Haus nicht finden. Sie nimmt den Rucksack von ihren Schultern. Der Wind reißt ihn ihr beinahe aus der Hand. Sie findet die Taschenlampe, schaltet sie ein und läuft weiter. Das schwache Licht leuchtet ein paar Meter den menschenleeren Strand aus. Bald erkennt sie die Stelle, die sie sucht, klettert einen Trampelpfad an der Düne hinauf und erreicht eine Treppe, die zu einem Reetdachhaus führt. Flackerndes Licht erhellt die Fenster in der unteren Etage.
Wahrscheinlich haben ihre Eltern die halbe Nacht auf sie gewartet, obwohl sie sich beim Abendessen so heftig mit ihnen gestritten hat wie noch nie. Harte Worte hat sie ihnen an den Kopf geworfen. Ich hasse euch! Ihr macht mein Leben kaputt! Ich will euch nie wieder sehen! Mama hat geweint. Papa hat sie mit traurigen Augen angeschaut und auf ihr Zimmer geschickt. Einen Moment hat sie gedacht, er habe sie verstanden. Dennoch hat sie ihren Rucksack gepackt und ist aus dem Fenster gestiegen. Sie wollte nie mehr zurückkommen.
Welche Sorgen und Vorwürfe ihre Eltern sich gemacht hätten, wenn sie heute Nacht mit Kelly abgehauen wäre, will sie sich nicht vorstellen.
Alles ist anders gekommen. Sie ist wieder hier.
Geräuschvoll öffnet sie die Tür und wirft den nassen Rucksack vor sich auf den Boden. Sollen sie doch kommen! Sollen sie sie anschreien und bestrafen. Es ist ihr egal. Nichts kann sie mehr verletzen, keine Ohrfeige, kein Walkman-Entzug, kein Hausarrest. Die schlimmste Strafe ist, dass Kelly nicht am Treffpunkt erschienen ist. Dass sie gekniffen hat, obwohl sie es war, die vorgeschlagen hat abzuhauen. Weg von ihren streitenden Eltern und von deren Vorhaltungen, weg von ihrem nervigen kleinen Bruder, weg von diesem schrecklich dunklen Haus, das sie von der Stunde an gehasst hat, als sie hier angekommen sind.
Nichts rührt sich in den Räumen. Niemand kommt zur Tür und schreit sie an. Sie will hinaufgehen in ihr Zimmer, will nur schlafen und vergessen. Aber sie bleibt stehen. Etwas stimmt nicht. Warum ist es so still?
Sie geht zum Wohnzimmer, in dem der Fernseher tonlos flimmert. Nur das Quietschen ihrer nassen Turnschuhe ist zu hören. Ihre Jeans hinterlassen Wasserlachen auf dem alten Eichenparkett.
Papa sitzt im Sessel. Er muss eingenickt sein, während er auf sie gewartet hat, sein Kopf liegt auf der Lehne. Mama ist nicht zu sehen. Wahrscheinlich ist sie schon schlafen gegangen.
»Paps?« Sie geht einen Schritt auf ihn zu. Warum wacht er nicht auf? »Paps?«
Er rührt sich nicht.
Sie zittert plötzlich, aber nicht vor Kälte. Ihr Herz schlägt laut. Schritt für Schritt tastet sie sich vor.
Sie steht vor ihm, sieht das Loch in der Stirn ihres Vaters, seinen starren Blick, all das Blut auf Gesicht und Sessel.
Sie will schreien, aber kein Ton kommt über ihre Lippen. Ihr Blick fliegt zur Couch. Darauf liegt Mama wie hingestürzt auf dem Bauch. Die blonden Haare und ihr T-Shirt sind dunkel verklebt. Aber das Schlimmste ist die kleine Hand, die unter ihrem Körper hervorragt.
Sie greift danach, will sie hervorziehen, dem Tod entreißen. Aber die Hand ihres Bruders ist leblos und kalt.
1
Frida kuppelte aus und gab Gas. Die Räder des Treckers drehten im Schlamm durch, der Deutz bewegte sich nicht. Sie sah ihren Vater ein Zeichen mit der Hand geben. Sein Daumen zeigte nach unten. Sie stellte den Motor ab und kletterte aus dem Fahrerhaus. »Mist!«
»Das hat keinen Sinn. Du fährst ihn nur weiter fest«, sagte er und wischte sich ein paar Schlammspritzer aus dem Gesicht.
»Was machen wir jetzt?«
Fridtjof, ihr Vater, schwieg und sah nachdenklich auf den Trecker, der mit den Rädern im Morast eingesunken war. Einer der polnischen Arbeiter, die auf seinem Obsthof arbeiteten, war am Morgen in dieses Schlammloch gefahren. Er hatte sich die Drainage ansehen sollen, da der Apfelhof durch den anhaltenden Regen der letzten Wochen an einigen Stellen unter Wasser stand, und war zu weit in den verschlammten Bereich hineingefahren, wo der Trecker schnell versackt war.
»Ich hole eine Fuhre Mutterboden. Wir müssen ihn auf festen Untergrund bekommen, sonst sinkt er noch mehr ein.«
Sie nickte. »Okay, ich warte hier.«
Fridtjof Paulsen ging zu seinem Pick-up, stieg ein und fuhr weg. Frida sah auf ihre Uhr. Die Bergung des Treckers würde mehr Zeit brauchen, als sie eingerechnet hatte. Vor Mittag würden sie hier nicht fertig werden. Dabei hatte sie nach Hamburg fahren wollen, um die letzten persönliche Dinge aus ihrer Wohnung zu holen, die sie ab nächster Woche untervermietet hatte.
Frida hatte entschieden, einige Monate in der Marsch auf dem Hof ihrer Eltern zu bleiben und in ihr altes Kinderzimmer zu ziehen. Sie hatte sich einige Zeit vom Polizeidienst beurlauben lassen. In den ersten Wochen, nachdem sie von einem Gewaltverbrecher verschleppt und beinahe mit ihrer eigenen Dienstwaffe erschossen worden war, hatte sie die posttraumatische Belastungsstörung nicht wahrhaben wollen. Aber schon bald hatte sie die Symptome nicht mehr ignorieren können: Nervosität, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit und Albträume. Sie fühlte sich in großen Menschenansammlungen nicht wohl, konnte nicht mehr mit dem Rücken zu einer Tür sitzen, reagierte bei Knallgeräuschen schreckhaft, ja fast panisch. Trotzdem stellte sie sich immer wieder die Frage, wie es in Zukunft mit ihr weitergehen würde. Wollte sie irgendwann in den Polizeidienst zurückkehren? Die Abschlussprüfung der Polizeiakademie hatte sie mit guten Noten bestanden. Das hieß, sie könnte endlich die kriminalistische Laufbahn einschlagen, die sie lange Zeit angestrebt hatte, und irgendwann zur Mordkommission gehen, was immer ihr Traum gewesen war.
Frida spürte einen Tropfen im Gesicht. Sie zog sich die Kapuze der Regenjacke über den Kopf, ging zu ihrem Jeep und öffnete die Tür. Vom Beifahrersitz nahm sie eine verschrammte Thermoskanne, goss sich Tee in einen Metallbecher und lehnte sich an die Motorhaube. Es regnete stärker, und ein leichter Dunst stieg zwischen den Apfelbäumen hoch. Die Luft war feucht. Es roch nach Erde und Moder.
Das Frühjahr war vollkommen verregnet gewesen. Ihr Vater sprach es nicht aus, aber das Wetter bereitete ihm Sorgen. Tag für Tag hoffte er darauf, dass es endlich trocken blieb und das Ausschwärmen der Hummeln zur Baumblüte nicht durch weitere Regenfälle gefährdet wurde. Wenn das passierte und dieses Jahr ein Großteil der Apfelernte ausfiele, würde sein Obsthof, der sich in den letzten Monaten von der drohenden Insolvenz erholt hatte, das nicht überleben.
Frida trank einen Schluck Tee. Hier draußen im Apfelhof fühlte sie sich frei. Und diese Freiheit war es, die sie in ihrer derzeitigen Situation am meisten brauchte. Sie trank aus, setzte sich hinter das Steuer und zog die Tür zu, um den Wolkenbruch abzuwarten, der immer heftiger wurde. Sie stützte sich mit den Unterarmen auf dem Lenkrad auf, während der Regen seinen monotonen Beat auf das Jeepdach trommelte.
Mordkommission. Sie fragte sich, ob sie das überhaupt noch wollte. Ihre Leidenschaft für den Beruf war in Gleichgültigkeit umgeschlagen. In jenem Moment, als sie in die Mündung ihrer Waffe und dem Tod ins Auge geblickt hatte, hatte sich alles verändert. Ihr altes Leben gab es nicht mehr.
Die Frau stand plötzlich vor ihr im Regen, starrte sie einen Moment durch die Windschutzscheibe an. Sie trug eine enge Motorradjacke und eine Hose aus Leder, die ihre schlanke Figur betonte. Die Füße steckten in schweren Bikerstiefeln. Sie ging zur Seite, öffnete die Tür zum Jeep und schwang sich neben Frida auf den Beifahrersitz. Erst hier nahm sie ihren Motorradhelm ab, auf dem der Regen abperlte.
»Jo?«, fragte Frida ungläubig. Sie wusste nicht, was sie zu diesem Überraschungsbesuch sagen sollte.
Johanna Arndt war auf dem Internat in Süddeutschland ihre Mitbewohnerin gewesen. Sie hatten sich mit dreizehn kennengelernt und jahrelang in einem winzigen Zimmer zusammenrücken müssen.
»Wie hast du mich gefunden?«, fragte Frida.
»Deine Mutter hat mir gesagt, wo du bist.« Jo schüttelte ihre dunklen Haare auf und legte den Helm in den Fußraum. »Hier draußen hast du dich also verkrochen.«
»Verkrochen?« Frida trank den Tee aus und stellte den Becher auf die Ablage hinter dem Lenkrad.
Jo überhörte den Sarkasmus in ihrer Stimme. Denn sie war es gewesen, die sich nach ihrer letzten Begegnung im Herbst nicht mehr gemeldet hatte. »Mistwetter!« Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke auf.
»Trotzdem bist du mit der Harley unterwegs?«
Jo zuckte die Schultern. »Gute Regenkleidung. Da kommt nichts durch.«
»Und heute hast du dir gedacht, du machst einen kleinen Ausflug in die Marsch und besuchst mich mal?«
Jo sah sie an. Ein sanfter Zug um ihren Mund, ihre Lippe zuckte, aber sie lächelte nicht. »So ähnlich.«
Frida fühlte sich schon wieder unsicher unter ihrem Blick. Die toughe und schöne Jo, die alles im Griff hatte. Die sich ihren Erfolg in der Detektei, deren Inhaberin sie war, hart erarbeitet hatte. Und sie, Frida, die Polizistin, die mit psychischen Problemen hier auf dem Land in Wartestellung gegangen war, die sich vor der Entscheidung, wie es weitergehen sollte in ihrem Leben, drückte.
»Geht es dir gut?«, fragte Jo, und Frida hörte ehrliche Sorge darin. »Ich hab’s in der Presse verfolgt, was dir passiert ist. Sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet habe.«
Frida musste diese Entschuldigung erst einmal verdauen. Sie hätte damals im Herbst gern mit Jo gesprochen, aber sie hatte nie auf ihre Anrufe reagiert. Die Freude, die Freundin wiederzusehen, war stärker als Fridas Enttäuschung.
»Ja, hier draußen geht es mir gut. Hamburg war mir zu eng. Ich habe keine Luft mehr bekommen.«
»Kann ich verstehen. Gemütlich hier …« Jo wies nach draußen. »Im Schlamm.«
Sie blickten einen Moment schweigend hinaus auf die Apfelbaumreihen. Der Regen trommelte seine beruhigende Melodie aufs Dach.
Frida sah Jo an. Ihre Haare waren länger als bei ihrem letzten Treffen. Diese Frisur machte sie weicher, auch wenn Jo immer ein Hauch von etwas Dunklem umwehte. Es war das Geheimnisvolle, das sie ausstrahlte, was die Menschen in ihrer Umgebung anzog, obwohl sie die Gefahr spürten. Wer sich mit Jo einließ, musste auf der Hut sein. Aber Frida mochte diese aufgeladene Stimmung zwischen ihnen beiden. Die kleinen Rangeleien, ihr unterschwelliges Kräftemessen, das nie nachgelassen hatte, auch wenn sie heute befreundet waren.
Frida fragte sich plötzlich, warum sie sich nach dem Internat fast ganz aus den Augen verloren hatten. »Warum bist du hier?«
Ein langer Blick, der mit einer Gegenfrage endete. »Hast du einen Kaffee für mich?«
»Nein, nur Tee.« Frida füllte ihren zerbeulten Becher und reichte ihn ihr.
Jo trank nachdenklich. »Du hast mir gefehlt«, sagte sie schließlich.
Frida stieß langsam die Luft aus. Ein warmes Gefühl brach sich in ihr Bahn und ließ den Ärger, der sich wochenlang bei dem Gedanken an Jo aufgestaut hatte, zerplatzen wie eine Seifenblase. »Dafür kommst du hier raus? Das hättest du mir auch am Telefon sagen können.«
»Wollte ich aber nicht.« Sie hielt den alten Metallbecher mit beiden Händen, trank noch einen Schluck Tee. »Ich wollte dich sehen. Wollte wissen, wie es dir wirklich geht. Ein Telefon kann Lügen nicht filtern.«
Ja, sie hatte recht. Natürlich hätte Frida behauptet, alles sei in Ordnung, wenn Jo angerufen hätte. Sie wusste, dass Jo ihr ansah, dass nichts in Ordnung war. Dass diese Nacht in der Marsch, in der der Tod nur einen Flügelschlag entfernt gewesen war, alles verändert hatte.
»Du bist ein hartes Mädchen, aber nicht hart genug, um mich anzulügen. Ich merke doch, dass es dir nicht gut geht«, sagte Jo.
Frida schluckte. Jo schaffte es immer, tief zu ihren Zweifeln durchzudringen und sie an die Oberfläche zu befördern. »Ich weiß nicht, ob ich das noch kann«, sagte sie schließlich. »Polizistin sein, meine ich. Irgendwas ist in mir zerbrochen. Ich spüre nichts mehr von der Leidenschaft, die ich mal für den Job hatte.«
Jo stellte die Tasse ab und kreuzte die Arme. »Dem Tod so nahe zu kommen, verändert Menschen.«
Frida sah sie an. »Du meinst, ich habe Angst, in meinen Beruf zurückzugehen?«
»Natürlich hast du Angst. Aber das ist völlig normal! Frida, du bist eine Kämpferin. Du hast es drei Jahre mit mir in einem Zimmer ausgehalten. Und ich habe dich hart rangenommen, ich weiß.«
»Du warst ein richtiges Miststück. Ich hab dich gehasst.«
Jo lachte, ein dunkles Glucksen, das Frida viel zu selten bei ihr hörte. »Du aber auch. Du hast Juckpulver in meine Schlafanzughose gekippt. Ich habe mich tagelang zwischen den Beinen gekratzt.«
»So was hätte ich nie getan!« Frida fiel in ihr Lachen ein. Die Tüte Juckpulver. Die hatte sie schon wieder vergessen gehabt. »Dafür hast du ein gebrauchtes Kondom in meinem Bett versteckt. Ich habe mich draufgelegt, habe eine Ekelblase an der Lippe bekommen.«
»Sah echt aus, oder?« Jo gluckste vor Schadenfreude. »Dabei war das nur gequirltes Eiweiß aus der Küche. Aber du warst noch grün hinter den Ohren und hast es nicht gecheckt.«
»Ich habe mich so davor geekelt, in meinem Bett zu schlafen. Und die Bettwäsche durfte ich erst eine Woche später wechseln.«
Sie lachten, bis ihnen die Tränen kamen, und dieses Lachen radierte alles aus, was zwischen ihnen im letzten halben Jahr in Schieflage geraten war.
Frida wischte sich die Augen. Es war eine harte, aber auch wichtige Zeit in ihrem Leben gewesen. Sie hatten beide tiefe Verluste verarbeiten müssen, als man sie in diesem kleinen Kabuff zusammengesteckt hatte.
»Woran denkst du?«, fragte Jo.
»An damals.«
»Wir waren keine Kinder mehr und trotzdem nicht erwachsen. Und wir waren allein mit unserem Schmerz zwischen all den Menschen. Vielleicht sind wir deshalb heute bindungsunfähig.«
»Sind wir das?«
Ihre Blicke trafen sich.
Jo zuckte die Schultern. »Hast du etwa jemanden?«
Frida schwieg. Sie hatte recht. Sie waren beide nicht für die Liebe geschaffen, tiefe Gefühle machten ihnen Angst. Aus diesem Grund hielten sie jeden auf Abstand, der ihnen zu nahe kam. Vielleicht war Jo deshalb im Herbst abgetaucht. Weil selbst ihre Freundschaft zu eng geworden war und sie überfordert hatte.
Der Regen hatte aufgehört. Das Schweigen zwischen ihnen war wohlig wie eine warme Decke. Und jetzt?, dachte Frida. Wie würde es weitergehen? Würde Jo wieder wegfahren und sich erneut monatelang nicht melden?
»Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen. Ich komme klar.«
»Ich weiß. Du bist zäh.«
»Hm.« Da war sich Frida nicht so sicher.
Jo wirkte angespannt. Ihr Kommen hatte einen ganz anderen Grund. Sie wollte etwas von ihr. Frida kannte sie lange genug, um zu wissen, was für einen Kraftakt es für sie bedeutete, jemanden um etwas zu bitten. Sie schwieg und wartete.
»Du hast also momentan keinen Kontakt zu deiner Dienststelle und zu deinen Kollegen?«
Frida war überrascht, dass sie ausgerechnet auf ihren alten Job zu sprechen kam. »Nein, ich bin seit Monaten raus.«
Jo schien unzufrieden. Warum war ihr das so wichtig?
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Frida. »Steckst du in Schwierigkeiten?«
»Nein, lass mal. Unwichtig.«
»Ich kann Jan Hansen anrufen. Er ist ein Hamburger Kollege, ich vertraue ihm. Das kannst du auch!«
Jo schwieg einen Moment, schien das Angebot abzuwägen. »Nein, ist okay. Komm du erst mal wieder auf die Beine. Und melde dich, wenn du reden willst.«
»Okay.«
Jo zog den Reißverschluss ihrer Lederjacke zu und nahm ihren Helm. »Pass auf dich auf, Frida.« Sie sah sie lange an, aber für eine Umarmung war sie zu stolz. Sie stieg aus und setzte den Helm auf.
Frida beobachtete sie im Rückspiegel. Die Harley-Davidson stand in der Einfahrt am Tor. Jo stieg auf und fuhr los. Das Bollern der schweren Maschine war noch einige Sekunden zu hören. Dann war es wieder still im Apfelhof. Nur die Leere blieb, die Jo immer in ihr hinterließ, wenn sie fort war.
Am Mittag hatten Frida und ihr Vater den Trecker endlich auf festen Untergrund gebracht. Durch den feinen Regen klebten Fridas Haare an ihrem Kopf. Sie wollte raus aus ihren durchgeschwitzten Klamotten, wollte sich den Schlamm von den Stiefeln spülen.
»Fahr schon vor!«, sagte ihr Vater. »Ich komme bald nach. Mutter soll das Essen warm halten.«
Sie stieg in ihren Jeep und verließ die Apfelanlage. Nach ein paar Minuten erreichte sie Deichgraben, das Dorf, in dem sie aufgewachsen war. Wenige hundert Meter hinter dem Ortsschild bog sie in den Obsthof ihrer Familie ein. Der Regen hatte die Schlaglöcher auf dem Hof mit Wasser gefüllt. Sie parkte den Wagen vor dem großen Reetdachhaus.
Nichts wünschte sie sich so sehr, als zu Geld zu kommen und in dieses alte Gebäude investieren zu können, das seit Generationen ihrer Familie gehörte. Im Herbst war das Reetdach notdürftig repariert worden, aber in absehbarer Zeit musste es komplett saniert werden, wenn es die nächsten Stürme überstehen sollte. Bröckelnde Fugen und Salpeterausblühungen im Backstein zeigten, dass auch das Mauerwerk angegriffen war. Das Haus verfiel, und Frida konnte nichts dagegen tun. Der Innenhof musste neu gepflastert werden, und auch die anderen Hallen und Gebäude hielt nur noch Fridtjofs Flickschusterei zusammen.
Dieser Obsthof war ihr Erbe. Und sie wollte es erhalten. Aber wie? Wenn sie wieder den Polizeidienst anträte, würde sie sicherlich ein Darlehen bekommen. Das wäre ein Anfang. Aber was, wenn sie sich dagegen entschied?
Sie dachte an Jos Worte, dass ihre Angst vor der Rückkehr in den Dienst ganz normal war, aber dass sie zäh genug wäre, es zu schaffen. Jammern war etwas für Schwächlinge. Das war ihre unterschwellige Botschaft gewesen.
Frida stieg aus dem Wagen und lief zum Haus, sprang über ein paar Pfützen. Der ungarische Hütehund Arthur stand schwanzwedelnd an der Tür. Sie kraulte ihn hinter den Ohren und zog Regenjacke sowie Gummistiefel in der Diele aus.
»Schlepp mir den Dreck nicht in die Küche!«, hörte sie Marta, ihre Mutter, schimpfen. »Dein Vater war schon hier, um einen Schlüssel zu holen. Die Diele sah danach aus, als wäre das ganze Dorf hier durchgetrampelt.«
»Ich habe die Stiefel ausgezogen. Papa braucht noch ein paar Minuten, warten wir mit dem Essen?«
»Wat mut, dat mut«, brummte ihre Mutter.
Frida ging zur Küche und blieb in der Tür stehen. Sie mochte diesen gemütlichen Raum. Backsteinwände, dunkle Holzbalken unter der Decke, weiße Fensterrahmen mit Holzkreuzen, ein Gasherd, über dem gusseiserne Töpfe hingen. Und an der Wand der Tisch mit der rustikalen Sitzbank, auf der sie schon als Kind gesessen hatte. Was aus der Zeit fiel, waren zwei IKEA-Stühle, die Frida aus ihrer Hamburger Wohnung mitgebracht hatte. Die wackeligen Küchenstühle hatte sie auf den Speicher geräumt, wo niemand sie vermisste.
In diesem Raum saß ihre Familie seit Generationen zum Essen, Feiern, Streiten, Aussöhnen. Hier wurde die Arbeit besprochen und der Schnaps ausgeteilt. »An diesem Tisch spuckt niemand ins Glas«, pflegte ihr Vater oft zu sagen, was hieß, dass nur Freunde hier mit ihnen tranken. Die Narben im Holz des Tisches waren wie sichtbare Marken ihrer Kindheit. Die Küche war ein Raum voller Erinnerungen, guten wie schlechten, der jedem offen stand, der mit den Paulsens zusammensitzen wollte.
»Es riecht gut, Mama! Was gibt es?« Sie stellte sich an den Herd und hob einen Topfdeckel an. Kartoffelstampf. Frida schob einen Löffel hinein und kostete. Der mit Karotten, Milch und Butter gestampfte Kartoffelbrei schmeckte wie in ihrer Kindheit. So kochte ihn nur ihre Mutter.
»Frische Stinte gibt’s dazu«, sagte Marta und schob ihre Tochter vom Herd weg, die den Pfannendeckel über den kleinen gebratenen Elbfischen angehoben hatte. »Du kannst im Keller was zu trinken holen. Wir essen jetzt. Wenn Fridtjof zu spät kommt, hat er Pech. Dann sind die Stinte kalt.«
Frida lief in den Keller und kam mit Apfelsaft und Wasser zurück in die Küche. Sie warf Arthur einen Kauknochen zu.
»Du sollst den Hund nicht so verwöhnen. Er läuft nicht mehr so viel in seinem Alter. Wenn er fett wird, bist du schuld.«
Frida seufzte, sagte jedoch nichts. Arthur verzog sich unter den Tisch und fing an, an dem Knochen zu nagen.
Auf dem Hof war Traktorenlärm zu hören. Fridtjof stellte den Deutz vor die Ruine der Technikhalle, die nach einem Brand im Herbst nicht wieder aufgebaut worden war. Kurz darauf stand er mit seinen schmutzigen Stiefeln in der Küche. »So, ich bin da.«
Marta wurde blass vor Wut. »Nicht schon wieder …!«
Fridtjof sah ihren Blick und lief hinaus, hinterließ noch mehr Schlammreste auf dem Boden.
Frida lächelte. Dass ihr Vater auch in jeden Fettnapf trat, der für ihn bereitstand. Manche Dinge änderten sich nie.
2
Bjarne Haverkorn stöhnte, als das Klingeln seines Diensttelefons ihn aus dem Schlaf riss. Schlaftrunken setzte er sich auf und schaltete die Nachttischlampe an. Er war früh ins Bett gegangen, weil er sich schon seit Wochen müde und abgeschlagen fühlte. Dies war der zweite nächtliche Einsatz, obwohl er erst vor wenigen Tagen zur Mordkommission zurückgekehrt war. Er griff nach dem Handy. »Klaus, was haben wir?«, fragte er verschlafen.
»Eine Leichensache in einem unbewohnten Gehöft nahe Seester. Die Mannschaft ist schon unterwegs.« Sein Kollege Klaus Behrens nannte ihm die Adresse.
»Gut, bis gleich.« Haverkorn sah auf die Uhr. Es war kurz nach Mitternacht. Ihm war klar, dass er in dieser Nacht keinen Schlaf mehr bekommen würde.
Er zog sich an, trank durstig ein paar Schlucke aus einer Wasserflasche, nahm seine Regenjacke vom Haken und verließ die Wohnung. Gut, dass Ursula noch immer in der Klinik war. Seine Frau hatte diese nächtlichen Einsätze in all den Jahren nie verkraftet. Anfangs hatte sie ihm offene, schließlich stumme Vorwürfe gemacht, wenn er in der Nacht aus dem Bett geholt worden war. Das Alleinleben hatte auch seine Vorteile.
Es regnete in Strömen, als er hinaus in die Marsch fuhr. Die Scheinwerfer seines Wagens leuchteten die Wasserfäden aus, die ihn blendeten, und er musste die Augen zusammenkneifen, weil die Müdigkeit ihn immer wieder zu übermannen drohte. Er fluchte leise. Zu Hause hätte er sich wenigstens noch die Zeit nehmen sollen, einen Kaffee zu kochen.
Welche menschliche Tragödie würde ihn auf diesem abgelegenen Gehöft erwarten? Sein Kollege hatte ihn am Telefon nur informiert, dass es eine Leichensache gab. Für Einzelheiten war keine Zeit gewesen. Weitere Details würde Haverkorn erst vor Ort erfahren.
Er bremste plötzlich und schlitterte ein Stück über die nasse Fahrbahn. Kurz vor dem Straßengraben kam der Wagen zum Stehen. Beinahe hatte er die Abzweigung nach Seester verpasst. Der Schreck machte ihn hellwach. Er setzte zurück und bog ab.
Haverkorn fand das Gehöft zwischen ein paar überschwemmten Feldern. Auf der anderen Straßenseite reihten sich in einer Anlage Apfelbäume wie eine stumme Armee aneinander. Der Hof schien seit vielen Jahren verlassen, war der Natur und dem Verfall preisgegeben worden. Haverkorn fragte sich, was geschehen war, dass sein Besitzer ihn aufgegeben hatte. War der Bauer verstorben? Hatten seine Kinder den Betrieb nicht weiterführen können oder wollen, weil sie längst einen anderen Lebensweg eingeschlagen hatten? Denn wer wollte schon hier rausziehen in diese Einöde, wollte abseits der Ortschaft wohnen und Landwirtschaft betreiben?
Er parkte hinter dem Transporter der KTU und stieg aus. Sein Kollege Klaus Behrens kam ihm in Gummistiefeln entgegen. Er sah übernächtigt aus. »Moin, Bjarne.«
»Moin, Klaus. Wie ist der Stand?«
»Eine tote Frau um die fünfzig. Laut einer Zeugin hat sie noch gelebt, als sie sie gefunden hat. Schwere Stichverletzungen in Brust- und Bauchbereich. Dadrinnen …«, er wies auf das Haus, »… sieht es aus wie in einem Schlachthaus.«
Haverkorn war überrascht. »Sie ist lebend gefunden worden? Hier draußen?«
»Ja, von einer Motorradfahrerin. Die war am Abend hier unterwegs.«
»Hm«, brummte er. »Hinweise auf den Täter?«
Behrens schüttelte den Kopf. »Bisher nichts. Henning und Udo suchen nach der Tatwaffe. Aber der Hof ist groß, und bei diesem Sauwetter können sie heute Nacht nicht viel ausrichten.«
»Und die Zeugin? Könnte sie was mit der Tat zu tun haben?«
»Eher unwahrscheinlich. Sie hat den Notarzt gerufen und das Opfer versorgt, bis es verstarb. Sie steht unter Schock. Der Notarzt hat ihr was zur Beruhigung gegeben.«
»Gut, gehen wir rein.« Haverkorn folgte Klaus Behrens. Seine Kollegen begrüßten ihn kurz oder nickten ihm einfach zu. Haverkorn blieb an der offenen Haustür stehen und ließ das Bild im Inneren auf sich wirken.
Die Diele war ein langer Gang. Feuchte, teilweise abgerissene Tapete zeugte vom einsamen Verfall dieses Wohnhauses. Das grelle Licht eines mobilen Scheinwerfers leuchtete den Raum aus. Auf den braunen Relieffliesen, einem Relikt der Siebzigerjahre, lag rücklings die Tote. Ihr Kopf war zur Seite gekippt. Jemand hatte ihre Augen geschlossen. Die Kleidung war geöffnet, der Oberkörper umwickelt von zahlreichen durchgebluteten Verbänden und Stofffetzen. Unter der Leiche hatte sich eine dunkle Lache gebildet. Haverkorn schluckte trocken. Sein Magen meldete sich mit einem dumpfen Unwohlsein. Klaus hatte recht, hier sah es aus wie in einem Schlachthaus. Unzählige blutige Schuhabdrücke waren wie bizarre Tanzschritte um die Leiche auf den Boden gestempelt und begannen bereits zu trocknen. Wahrscheinlich die Abdrücke der Frau, die sie gefunden hatte, und die der Rettungssanitäter, dachte Haverkorn.
An der Wand sah er die typischen Spritzmuster, die bei einer brutalen Messerattacke entstanden. Auf dem lackierten Türrahmen klebte der einzelne Abdruck einer Hand. Wie der letzte Hilferuf der Toten.
Übelkeit stieg seine Speiseröhre hoch. Er schluckte erneut, um sie zu unterdrücken. Der metallische Geruch von Blut ließ ihn würgen. Oder war es der kaum merkliche Geruch von Schimmel in diesem Raum? Ihm wurde schwindelig, und er hielt sich am Türrahmen fest.
Klaus Behrens stellte sich neben ihn. »Pass auf, dass du nicht ausrutschst, wenn du zu ihr willst. Die Sanitäter haben alles breitgetreten. Lauf über die Trittplatten. Ich habe noch ein paar Überzieher im Wagen.«
»Lass gut sein …« Haverkorn drängte sich an ihm vorbei nach draußen und atmete tief durch.
Sein Kollege war ihm gefolgt und warf ihm einen fragenden Blick zu. »Alles okay mit dir?«
»Ja, danke. Ich hab alles gesehen.« An der frischen Luft verflüchtigte sich der Schwindel. Aber die Übelkeit blieb. »Wo ist die Zeugin?«, fragte er gepresst.
»Sitzt bei Anja im Transporter. Komm, ich bringe dich zu ihr.«
Haverkorn atmete tief durch, als er Klaus Behrens folgte. Was war nur mit ihm los? In den dreißig Jahren bei der Mordkommission hatte er eine Menge Tote gesehen: aufgedunsene Wasserleichen, unkenntliche Brandopfer, strangulierte Selbstmörder, ermordete Kinder. Routine war es nie gewesen, neben einer Leiche zu stehen, aber nach seinem ersten Jahr im Morddezernat hatte er gelernt, diesem Anblick mit dem nötigen emotionalen Abstand zu begegnen. Nun kehrte er nach einem halben Jahr zur Mordkommission zurück, und sein Körper reagierte wie der eines blutigen Anfängers?
Natürlich hatte er, nachdem er im Dienst einen Mann erschossen hatte, viele schlaflose Nächte und Albträume gehabt. Aber er hatte schnell Kontakt mit dem Psychologischen Dienst aufgenommen, um das Erlebte zu verarbeiten. Die Gespräche mit der Psychologin hatten gut angeschlagen, und die Versetzung zum Betrugsdezernat hatte ihr Übriges beigetragen. Inzwischen hatte er verinnerlichen können, dass es die einzige Möglichkeit gewesen war, das Leben seiner Kollegin zu retten. Was also war los mit ihm? War er zu früh zurückgekommen? Haverkorn ging zu seinem Wagen, nahm eine Flasche Wasser heraus und trank sie halb leer.
Neben einem Polizeitransporter, der in der Auffahrt stand, wartete Behrens ungeduldig auf ihn. Er ging zu ihm hinüber. Den Kollegen von der Streife, die rauchend unter einem Vordach standen, nickte er zu. Das war heute kein normaler Einsatz gewesen. Er sah ihre angespannte Haltung. Den Anblick von da drin mussten sie sicherlich erst einmal verarbeiten.
»Ihr könnt gleich Schluss machen, meldet euch in der Wache, und schickt uns morgen den Bericht rüber«, sagte er im Vorbeigehen.
»Machen wir!« Der junge Beamte warf die Zigarette weg und trat sie im Schlamm aus.
»Heb die mal lieber wieder auf«, warnte ihn Haverkorn. »Sonst besucht dich morgen die KTU und fragt dich, warum du einen Tatort verunreinigst.«
Der junge Polizist sah ihn erschrocken an und klaubte die Zigarettenkippe vom Boden auf.
»Bjarne!« Eine seiner Kolleginnen stieg aus dem Bus. »Sie sagt nichts«, flüsterte sie und warf einen Blick ins Wageninnere. Dort saß eine dunkelhaarige Frau in einem übergroßen Sweatshirt und hatte die Arme um sich geschlungen. Sie starrte auf die Tischplatte, auf der ein leerer Block lag. »Der Notarzt hat sie stabilisiert. Er nimmt sie gleich noch mit ins Krankenhaus und behält sie eine Nacht dort. Morgen früh können wir sie befragen.«
»Hat sie sich ausgewiesen?«
»Nein, sie hatte keine Papiere bei sich. Ich habe das Kennzeichen ihres Motorrades abgefragt. Wenn sie die Halterin ist, haben wir ihren Namen: Johanna Arndt, Wohnsitz Hamburg. Aber das ist auch schon alles. Als wir hier ankamen, trug sie nur ihren BH und die Lederhose. Mit ihrem Pullover hatte sie versucht, die Blutung der Frau zu stoppen.« Sie warf Haverkorn einen langen Blick zu. »Sie braucht schnellstens eine Dusche, wenn die KTU mit ihr durch ist.«
»Dann sollen die sich beeilen.«
»Ihre Kleidung haben wir sichergestellt. Jens hat ihr ein Kapuzenshirt gegeben, das er im Wagen hatte.« Sie seufzte. »Hoffen wir, dass sie uns morgen erzählen kann, was passiert ist.«
Haverkorn stieg in den Bus und setzte sich der Zeugin gegenüber. Sie blickte nicht auf.
»Frau Arndt, ich bin Kriminalhauptkommissar Bjarne Haverkorn.«
Dunkle Strähnen fielen ihr ins blasse Gesicht. Sie sah ihn an, hielt seinem Blick einen Moment stand, bevor sie sich wieder auf das Notizbuch konzentrierte.
»Der Notarzt wird Sie ins Krankenhaus bringen. Dort bleiben Sie heute Nacht. Morgen sehen wir weiter.«
Sie schwieg.
Haverkorn lehnte sich zurück und betrachtete sie. War sie wirklich nur eine Zeugin, die zufällig in dieser Nacht hier draußen vorbeigekommen war? Schwer vorstellbar an diesem abgelegenen Ort in der Marsch. Aber wenn sie selbst die Täterin war, warum hätte sie den Notarzt verständigen und auf die Polizei warten sollen? Das machte ebenfalls keinen Sinn.
Die Frau blickte wieder auf. Dunkle Augen musterten ihn. Sie mochte Anfang bis Mitte dreißig sein. Blutspritzer trockneten auf ihrer Wange. Die Lippen formten ein paar Worte, die Haverkorn nicht verstand. Er lehnte sich zu ihr nach vorn. »Wie bitte?«
»Ich hab alles versucht«, sagte sie, »aber ich konnte sie nicht retten.«
†
Sie rennt durch die Dunkelheit. Jemand ist vor ihr, aber sie hört nur seine schnellen Schritte. Ihre Schusswaffe hält sie fest in der Hand. Lichter flackern hinter ihr auf. Sie wendet sich um. Die Kollegen sind hinter ihr. Weiter! Sie blickt nach vorn und stolpert, stürzt zu Boden. Ihre Waffe hat sie beim Fallen verloren. Panik kommt in ihr auf. Sie will aufstehen, weiterlaufen. Aber als sie in die Mündung der Waffe blickt, weiß sie, dass sie sterben wird.
Frida wachte auf. Wie jedes Mal, wenn sie im Traum mit einer Waffe bedroht wurde. Schweißnass lag sie im Bett und versuchte, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. Der Traum war nur ein Traum. Aber die Todesangst war echt. Sie griff nach der Wasserflasche neben ihrem Bett und trank mit großen Schlucken. Ihr Herzschlag beruhigte sich. Sie stellte die Flasche ab, lehnte sich zurück und blieb einige Minuten mit geschlossenen Augen im Bett liegen. Wie lange sollte das so weitergehen? Wann würde sie endlich wieder durchschlafen können?
Irgendwann stand sie auf, öffnete das Fenster und sah, dass es schon wieder regnete. Die Blätter der Kastanie auf dem Hof troffen vor Nässe. Sie nahm ihr Smartphone vom Schreibtisch. Drei Anrufe in Abwesenheit und eine Mailboxnachricht wurden angezeigt. Sie wischte über das Display und sah, wer sie angerufen hatte: Jo.
Frida war überrascht. Nicht nur, dass Jo versucht hatte, sie kurz nach sieben Uhr anzurufen, sondern auch, dass sie es innerhalb von wenigen Minuten dreimal probiert hatte.
Frida hörte ihre Mailbox ab, aber mehr als ein kurzes Seufzen von Jo war darauf nicht zu hören.
Frida wählte Jos Nummer. Es klingelte mehrfach, aber sie ging nicht an ihr Handy. Frida beendete den Anruf und setzte sich aufs Bett.
Frida tippte nochmals auf Jos Nummer und ließ es länger klingeln. Was wollte sie von ihr? Sicherlich keinen Small Talk. Das war nicht ihre Art.
»Frida!« Jo klang erleichtert.
»Entschuldige! Ich habe mein Telefon nicht gehört …«
»Du musst etwas für mich tun!«
»Okay.«
»Fahr in die Detektei, und komm dann nach Itzehoe.« Jos Stimme ließ keine Widerrede zu.
»Was ist los?«
»Eine Frau ist tot. Ich glaube, die wollen mir was anhängen!« Jo räusperte sich. »Hol bitte in der Detektei meine Papiere. In meiner Geldbörse im Schreibtisch. Ausweis und Führerschein!«
»Wo bist du jetzt?«
»In diesem Polizeihochhaus, zehnte Etage. Sie verhören mich gleich.«
»In der Bezirkskriminalinspektion?«
»Genau.«
»Was ist passiert?«
Jo schwieg einige Sekunden, schien zu überlegen, wo sie beginnen sollte. »Ich kann jetzt nicht reden. Hol meine Papiere und komm her, ja? Ich muss rein.«
»Klar, ich …« Sie sah auf dem Display, dass Jo sie schon weggedrückt hatte.
Frida hatte die Freundin noch nie so aufgelöst erlebt. Zehnte Etage in der BKI, hatte sie gesagt. Dort befand sich die Mordkommission. In was war Jo da hineingeraten?
Frida stand auf, zog sich an und lief hinunter in die Küche, wo ihre Mutter Karotten putzte. »Kaffee ist noch in der Kanne!«
»Keine Zeit, ich muss los.«
»Ohne Frühstück? Was ist denn so eilig?«
»Erkläre ich dir später!« Frida lief in die Diele, nahm sich den Jeepschlüssel vom Brett und stolperte beinahe über Arthur, der sie hatte begrüßen wollen. Sie lief hinaus. Hoffentlich hatte Jo keinen Mist gebaut. Sie wollen mir was anhängen, hatte sie gesagt. Mit einem unguten Gefühl fuhr Frida vom Hof.
3
Bjarne Haverkorn blickte müde aus seinem Bürofenster im zehnten Stock der Bezirkskriminalinspektion auf die Stadtkirche St. Laurentii, die hinter den Schlieren der Regenfront verschwand. Er drückte eine Kopfschmerztablette aus dem Blister und schluckte sie mit etwas Wasser hinunter. Er war gegen fünf Uhr morgens zu Hause gewesen, hatte geduscht und sich umgezogen. Gleich würde er Johanna Arndt befragen, die er im Krankenhaus abgeholt und mit zur Mordkommission gebracht hatte.
Er setzte sich an seinen Schreibtisch, wo er sich völlig fehl am Platze vorkam. Das war sein Büro, und doch fühlte er sich noch immer wie ein Fremder. Er schlug die Ermittlungsakte auf. Darin lagen einige handschriftliche Notizen, der Spurenbericht und der Bericht der Schutzpolizisten, die in der Nacht vor Ort gewesen waren. Haverkorn trank einen Schluck Kaffee und las aufmerksam, welche Spuren und Erkenntnisse sie bisher hatten.
Um 22.23 Uhr war von Johanna Arndt per Handy ein Notruf an die Rettungsstelle abgesetzt worden. Sie meldete, dass sie auf einem unbewohnten Gehöft eine schwer verletzte Frau gefunden habe. Als der Rettungswagen dort eintraf, war die Verletzte bereits an den schweren Verletzungen verstorben. Der Notarzt hatte daraufhin die Polizei verständigt, denn augenscheinlich war das Opfer von einer unbekannten Person mit mehreren Messerstichen in Bauch und Brustbereich lebensgefährlich verletzt worden und laut der Zeugin innerhalb weniger Minuten verblutet. Die Schutzpolizisten hatten das Gelände durchsucht, jedoch keine weitere Person ausfindig gemacht. Sie hatten den Hof gesichert und auf die Kollegen der Mordkommission gewartet.
Die Tatwaffe war, trotz intensiver Suche, bisher nicht im Gehöft gefunden worden. Die Suche wurde heute Morgen fortgesetzt.
Auch der Bericht der erkennungsdienstlichen Behandlung der Toten war der Akte bisher nicht beigefügt, sodass die Identität der toten Frau weiterhin ungeklärt blieb. Nach der Befragung der Zeugin würde er bei den Kollegen beim Erkennungsdienst nachhaken, beschloss Haverkorn.
Auf einem gelben Klebezettel stand in der Schrift von Klaus Behrens: »Auf dem Gehöft ist von Beamten der Schutzpolizei ein Fahrrad entdeckt worden. Die KTU hat es mitgenommen. Könnte sein, dass das Opfer am Abend damit dorthin gekommen ist. Kläre ich ab.«
Haverkorn atmete tief durch. Noch war die Akte löchrig wie ein Schweizer Käse. Die Obduktion war auf vierzehn Uhr festgesetzt worden. Vielleicht brachte diese einige Erkenntnisse zum Tathergang. Er nahm den Telefonhörer und wählte eine Nummer in Hamburg. »Moin, Torben, Bjarne hier.«
»Bjarne! Das ist ja eine Überraschung! Lange nichts von dir gehört. Wie geht’s dir?«
Haverkorn seufzte leise. »Bin seit Montag wieder hier. Muss ja weitergehen. Und bei dir?«
»Immer der gleiche Wahnsinn. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht den falschen Job habe.«
»Das frage ich mich seit dreißig Jahren«, brummte Haverkorn. »Weshalb ich anrufe: Ich habe die Leichensache von diesem Gehöft in der Marsch auf dem Tisch. Ich komme zur Obduktion, nicht Klaus. Er musste zum Zahnarzt. Wurzelbehandlung.«
Dr. Torben Kielmann lachte ins Telefon. »Seinen Zahn hätte ich vor der Obduktion auch hier erledigen können. Eine kleine Abwechslung kann ich immer gebrauchen.«
Haverkorn schmunzelte. Er mochte den schwarzen Humor des jungen Rechtsmediziners. »Vierzehn Uhr, bleibt es dabei?«, fragte er nach.
»Ich denke schon. Komm ein paar Minuten früher, und wir trinken noch einen Kaffee zusammen.«
»Klingt gut. Aber besorg einen richtigen, nicht diesen flüssigen Asphalt, den ihr so trinkt.«
»Halb zwei in meinem Büro?«
»Wenn ich es noch finde.«
»Folge einfach dem Geruch nach gemahlenen Bohnen«, sagte Dr. Kielmann lachend.
»Gut, Torben. Ich muss Schluss machen, die Zeugin wartet.«
»Du befragst die Frau, die heute Nacht versucht hat, die Blutung zu stoppen?«
»Genau.«
Der Rechtsmediziner seufzte leise. »Es war aussichtslos. Sechs Stiche im Abdomen. Wir werden es gleich sehen, wenn ich sie öffne, aber ganz sicher wurden wichtige Organe perforiert, vielleicht sogar die Lunge. Der Täter wollte, dass sein Opfer stirbt.«
†
Der Regen ließ nach, als Frida über die Brooksbrücke in die Speicherstadt fuhr. Sie mochte dieses historische Areal. Der Freihafen und die Speicherstadt zeugten noch immer vom unbändigen Freiheitswillen der Hamburger Kaufleute, die 1881 nach dem Zollanschlussabkommen mit dem Deutschen Reich diese kleine Enklave auf den Brookinseln errichtet hatten, um weiterhin zollfrei Waren lagern und verarbeiten zu können. Auch wenn die Lagerräume längst in Büros, Wohnungen, Restaurants und sogar Museen umgewandelt worden waren, spürte man hier noch den Hauch der Geschichte. Jos Detektei befand sich in einem der alten Speicher am Brooksfleet, einem Baudenkmal neugotischer Backsteinarchitektur.
Frida parkte den Jeep und lief am Sandtorkai entlang zur Adresse der Detektei. Sie öffnete die schwere Holztür und betrat das ehemalige Lagerhaus, dachte an Teppiche, Gewürze, Tee, Tabak und Kaffeebohnen, die hier in großen Säcken hineingetragen oder an den teils noch immer vorhandenen Seilzügen hochgezogen worden waren, um sie einzulagern.
Frida lief die ausgetretenen Stufen zum dritten »Boden« hinauf und klingelte an der Tür. Nichts passierte.
Warum hatte sie nicht vorher bei Jos Assistentin angerufen? Sie klingelte nochmals. Länger. Was, wenn sie nicht da war?
Im gegenüberliegenden Büro ging eine Tür auf. Eine Frau in Jeans und Blazer warf Frida einen ärgerlichen Blick zu. »Macht Nova wieder nicht auf?«
»Ist sie denn da?«
»Klar ist sie da. Aber wenn sie keine Lust hat, lässt sie die Leute Sturm klingeln.« Sie kam herüber und schlug mehrfach mit der flachen Hand auf die Metalltür der Detektei. »Nova, mach die Tür auf! Kundschaft!«
Ein blasses Gesicht erschien in der Tür. Jos Assistentin hatte raspelkurzes blondes Haar, Smokey Eyes und ein Lippenpiercing. Sie war kleiner, als Frida sie in Erinnerung hatte, und strahlte die drahtige Wendigkeit eines Wiesels aus. Aber auch dessen Verschlagenheit. »Was willst du, Gitta?«, fragte sie ruhig.
Die Frau ließ sie einfach stehen. Laut fiel die Bürotür auf der anderen Seite des Ganges zu.
»Und?«, fragte Nova und lehnte sich mit verschränkten Armen in den Türrahmen.
»Hallo, ich bin Frida Paulsen! Ich war letzten Herbst schon mal hier. Jo hat mich gebeten, ihre Geldbörse abzuholen.«
Novas graublaue Augen musterten sie und unterzogen sie einer genauen Kontrolle. »Kommen Sie rein!«, sagte sie schließlich. »Sie sind doch die Polizistin, mit der meine Chefin auf dem Internat war.«
Frida nickte und folgte ihr in die Räume der Detektei.
»Nova von Lübitz.« Sie reichte ihr die Hand und fing Fridas überraschten Blick auf. »Verarmter Landadel aus Vorpommern. Aber manchmal hilft der Titel bei einer Recherche.« Novas Händedruck war bemerkenswert fest.
Sie setzte sich auf den Stuhl hinter den Empfang, wo zwei überdimensionale Monitore standen, und zündete sich eine Zigarette an. Ihr Schreibtisch sah chaotisch aus, wilde Stapel von geöffneten Akten und Computerausdrucken lagen herum, umringt von schmutzigen Kaffeetassen und einer Fischdose, die als Aschenbecher herhielt. »Hat Jo gesagt, wo sie ist? Sie hat sich seit gestern Nachmittag nicht mehr gemeldet. Ich ersticke in Arbeit, und sie geht nicht mal ans Handy.«
»Sie steckt in Schwierigkeiten, hat mich heute Morgen aus Itzehoe angerufen.«
»Itzehoe? Was macht sie denn in dem Kaff?« Nova nahm einen tiefen Zug ihrer Zigarette.
»Sagen Sie es mir! Sie war kurz angebunden. Hat mir nur gesagt, dass sie ihre Papiere nicht dabeihat und ich sie hier abholen soll.«
Nova nickte. »Das ist wieder typisch. Wo liegen sie?«
»In ihrem Schreibtisch.«
Sie legte die brennende Zigarette in der Heringsdose ab. »Kommen Sie!«
Frida folgte Nova in Jos Büro, das sich seit dem Herbst nicht verändert hatte. Ein heller Raum mit Blick auf den Brooksfleet, Backsteinwände, ein aufgeräumter Schreibtisch, keine überflüssigen Accessoires. Der kühle Chic, den Jo mochte und ausstrahlte.
Nova ging zum Schreibtisch und zog ein Schubfach auf. Sie kramte darin herum. »Hier sind die Papiere nicht.«
Frida zog ein anderes Schubfach heraus. Die Geldbörse lag obenauf. Schwarzes Leder. Sie nahm sie heraus.
Nova griff nach einer Akte im Schreibtisch und blätterte darin herum. »Was soll das denn?«, flüsterte sie.
Frida horchte auf. »Stimmt was nicht?«
»Diesen Fall kenne ich nicht. Dabei lege ich alle unsere Akten an.« Sie hielt ein Foto hoch und betrachtete es wortlos. Frida erkannte ein altes Reetdachhaus, bevor Nova es wieder in die Akte legte, die sie sich unter den Arm klemmte. »Haben Sie alles?«
»Ja, klar. Ich fahre nach Itzehoe und bringe Jo die Papiere. Warum hat sie nicht Sie angerufen?«
Nova zuckte die Schultern. »Ich kann hier nicht weg. Hab keinen Führerschein.«
»In diesem Job? Müssen Sie nicht mal raus aus dem Büro?«
»Den Außendienst erledigt normalerweise Jo. Wir haben auch ein paar Freie für alle Fälle. Ich bin die Frau für … sagen wir, spezielle Recherchen.« Sie hielt die Hände hoch und bewegte die Finger.
Frida dachte an die beiden Monitore auf ihrem Schreibtisch und verstand. Die schnellste Recherche lief heute über das Internet.
Frida öffnete Jos Geldbörse und vergewisserte sich, dass Personalausweis und Führerschein darin waren.
Nova lehnte am Schreibtisch und knabberte an ihrem Lippenpiercing.
»Ich mache mir Sorgen um Jo. Sie hat sich verändert in den letzten Wochen.«
»Verändert?«
»Ja, sie hat sich zurückgezogen, redet kaum noch mit mir. Früher haben wir oft in der Küche zusammengesessen und über den Job gequatscht. Auch ab und an über was Privates. Aber seit einigen Wochen sehe ich sie kaum noch. Und wenn sie mal hier ist, spricht sie nicht mehr als drei Worte mit mir.«
»Vielleicht ist es nur eine Phase.«
»Ich kenne Jo schon seit ein paar Jahren. Sie hat ihre Launen, zieht sich auch mal zurück. Sie braucht ihren Freiraum, ich weiß. Aber sie hat noch nie ihr Geschäft schleifen lassen. Ich schiebe hier Nachtschichten, damit wir die Kunden nicht verprellen, und Jo tut so, als ginge sie das alles nichts an. Gestern war sie kurz hier und ist dann gleich wieder weg, um jetzt in Itzehoe aufzutauchen. Was macht sie da?«
»Ich weiß nichts Genaues. Aber sie muss eine Aussage bei der Mordkommission machen.«
Nova schüttelte langsam den Kopf. »Mordkommission?« Sie seufzte und verließ Jos Büro.
Frida folgte ihr. Die Zigarette qualmte noch immer in der Fischdose. Nova nahm sie, klopfte die Asche ab und inhalierte tief. Sie warf die blaue Akte auf den Stapel auf ihrem Schreibtisch.
»Sagen Sie Jo, wenn Sie sie sehen, dass sie mich hier hängen lässt und hinter meinem Rücken an einem Fall arbeitet, schmeckt mir überhaupt nicht!«
4
Die Zeugin war schon im Vernehmungsraum, als Haverkorn eintrat. Johanna Arndt saß bewegungslos da und blickte aus dem Fenster. Sie trug noch immer das viel zu große Kapuzenshirt, das ihr einer seiner Kollegen in der Nacht gegeben hatte. Haverkorn hatte eine gewisse Vorstellung davon, wie ihre Kleidung ausgesehen hatte, nachdem sie die stark blutende Frau medizinisch versorgt und bis zu ihrem Tod im Arm gehalten hatte.
Er setzte sich ihr gegenüber an den Tisch. »Können wir?«
Sie reagierte nicht, sah aus dem Fenster den ziehenden Wolken zu.
»Können wir mit der Befragung beginnen, Frau Arndt?« Er wartete einen Moment. »Möchten Sie etwas trinken? Wasser, Tee, Kaffee?«
Johanna Arndt schüttelte fast unmerklich den Kopf. Eine erste Reaktion. Haverkorn öffnete die Akte und schaltete das Diktiergerät ein, das auf dem Tisch lag. »Frau Arndt, ich fange mit ganz einfachen Fragen an. Können Sie mir bitte Ihre Personalien diktieren? Ausweisen konnten Sie sich ja bisher nicht.«
»Eine Freundin …« Sie räusperte sich. »Eine Freundin bringt meine Papiere her.«