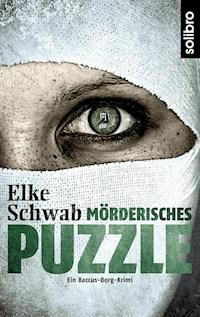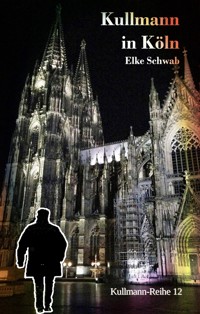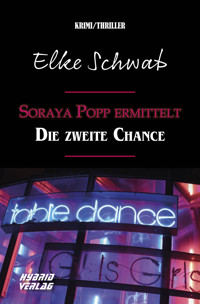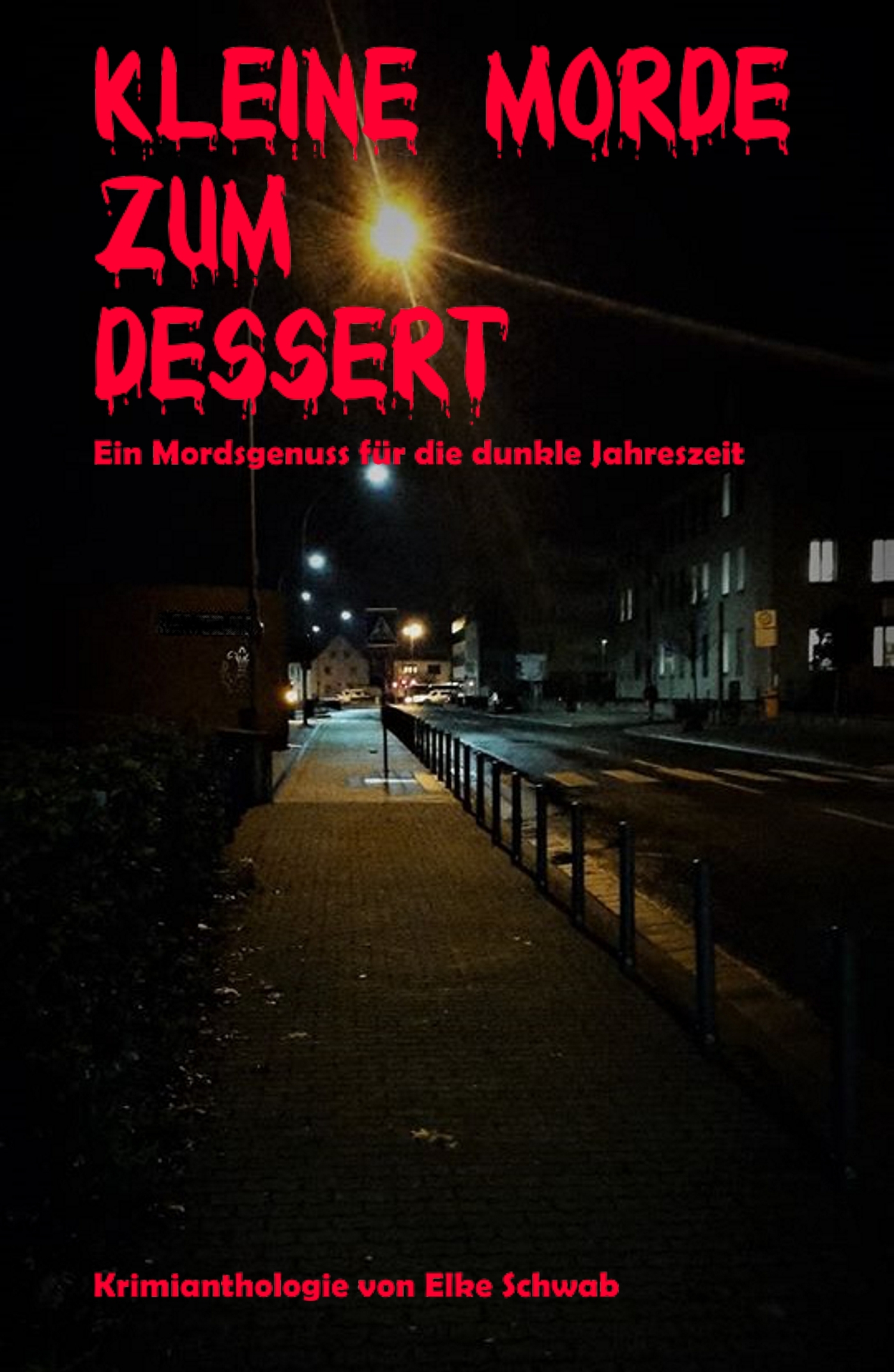Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Solibro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Subkutan
- Sprache: Deutsch
Er war Phönix. Von nun an zählten Stärke, Klugheit und Mut zu seinen Eigenschaften. Und er hatte eine Aufgabe. Ihm oblag es, über Leben und Tod zu bestimmen. Eine Aufgabe, die er sich selbst auferlegt hatte, weil nur er dazu in der Lage war, über die Schicksale derer zu bestimmen, die es verdienten. Mit langsamen Schritten schlenderte er die von Gräbern gesäumte Allee entlang und suchte nach einem geeigneten Platz. Denn er wusste genau, welche immensen Emotionen die Musik hervorrufen konnte, die er beabsichtigte, durch die Finsternis schallen zu lassen. Begleiten sollte ihn ein Werk, das nicht nur seine Fantasie zu beflügeln vermochte, sondern auch die Einbildungskräfte seiner Auserwählten! Es sollte das Letzte sein, was sie in ihrem Leben zu hören bekam: Die Mondscheinsonate. Eine tote Frau im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken sorgt für Aufsehen. Weitere Morde an jungen Frauen lassen auf einen äußerst raffinierten Ritualmörder schließen, der die Kommissare Baccus und Borg bei ihren verdeckten Ermittlungen in Atem hält, denn der Täter scheint auf alles vorbereitet zu sein ... Von mittlerweile insgesamt neunzehn Krimis der Saarländerin Elke Schwab ist "Blutige Mondscheinsonate" der vierte Teil der bislang sechsbändigen Krimireihe mit Lukas Baccus und Theo Borg (Prequel "Gewagter Einsatz", "Mörderisches Puzzle", "Eisige Rache", "Blutige Mondscheinsonate", "Tödliche Besessenheit", "Tickende Zeitbombe"). Die beiden übermütigen Kriminalkommissare klären mit lockeren Sprüchen spektakuläre Fälle auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Blutige Mondscheinsonate
Im Nordosten von Frankreich in einem alten elsässischen Bauernhaus entstehen die spannenden Krimis der gebürtigen Saarländerin Elke Schwab. In der Nähe zur saarländischen Grenze schreibt und lebt sie zusammen mit ihrem Mann samt Pferden, Esel und Katzen. Sie wurde 1964 in Saarbrücken geboren und ist im Saarland aufgewachsen. Nach dem Gymnasium in Saarlouis arbeitete sie über zwanzig Jahre im Saarländischen Sozialministerium, Abteilung Altenpolitik. Schon als Kind schrieb sie über Abenteuer, als Jugendliche natürlich über Romanzen. Später entschied sie sich für Kriminalromane. 2001 brachte sie ihr erstes Buch auf den Markt. Seitdem sind dreizehn Krimis und sechs Kurzgeschichten von ihr veröffentlicht worden. Ihre Krimis sind Polizeiromane in bester »Whodunit«-Tradition. 2013 erhielt sie den Saarländischen Autorenpreis der „HomBuch“ in der Kategorie „Krimi“. Im selben Jahr folgte der Kulturpreis des Landkreises Saarlouis für literarische Arbeit mit regionalem Bezug.
Bisher erschienen:
• Blutige Mondscheinsonate – Solibro Verlag, 2014
• Urlaub mit Kullmann – Ub-Verlag, 2013
• Eisige Rache – Solibro Verlag, 2013
• Blutige Seilfahrt im Warndt – Conte Verlag, 2012
• Mörderisches Puzzle – Solibro Verlag, 2011
• Galgentod auf dem Teufelsberg – Conte Verlag, 2011
• Das Skelett vom Bliesgau – Conte Verlag, 2010
• Hetzjagd am Grünen See – Conte Verlag, 2009
• Tod am Litermont – Conte Verlag, 2008
• Angstfalle – Gmeiner Verlag, 2006
• Grosseinsatz – Gmeiner Verlag, 2005
• Kullmanns letzter Fall – Conte Verlag, 2004
• Ein ganz klarer Fall – Eigenverlag, 2001
Elke Schwab
BLUTIGEMONDSCHEINSONATE
Ein Baccus-Borg-Krimi
1. Sprado, Hans-Hermann: Risse im Ruhm.
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2005ISBN 978-3-932927-26-5 • eISBN 978-3-932927-67-6 (E-Book)
2. Sprado, Hans-Hermann: Tod auf der Fashion Week
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2007ISBN 978-3-932927-39-3 • eISBN 978-3-932927-68-3 (E-Book)
3. Elke Schwab: Mörderisches Puzzle
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2011ISBN 978-3-932927-37-9 • eISBN 978-3-932927-64-5 (E-Book)
4. Elke Schwab: Eisige Rache
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2013ISBN 978-3-932927-54-6 (TB) • eISBN 978-3-932927-72-0 (E-Book)
5. Elke Schwab: Blutige Mondscheinsonate
Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2014ISBN 978-3-932927-85-0 (TB) • eISBN 978-3-932927-86-7 (E-Book)
ISBN 978-3-932927-86-7
1. Auflage 2014 / Originalausgabe
© SOLIBRO® Verlag, Münster 2014
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nils. A. Werner, www.nils-a-werner.de
Coverfotos: Vasilchenko Nikita/bigstock.com; Roverto/bigstock.com (Noten)
Foto des Autors: Alida Scharf, Köln
Bestellen Sie unseren Newsletter unter www.solibro.de/newsletter •
Infos vom Solibro Verlag gibt es auch bei Facebook und Twitter.
www.solibro.de
verlegt. gefunden. gelesen.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Epilog
Anzeigenseiten
Prolog
Er war Phönix!
Aus der Asche seines bisherigen Lebens neu erstanden, war er heute ein anderer. Von nun an zählten Stärke, Klugheit und Mut zu seinen Eigenschaften. Und er hatte eine Aufgabe. Ihm oblag es, über Leben und Tod zu bestimmen. Eine Aufgabe, die er sich selbst auferlegt hatte, weil nur er dazu in der Lage war, über die Schicksale derer zu bestimmen, die es verdienten.
Er hielt inne und schaute sich um.
Der Vollmond leuchtete am nachtschwarzen Himmel und tauchte die Erde in ein geheimnisvolles Licht. Leise knirschten die Schottersteine unter seinen Schuhen. Ein schwacher Wind wehte – setzte die Bäume und Sträucher in Bewegung, womit ein leises Rauschen erzeugt wurde – einem Seufzen gleich.
Wie Stalagmiten ragten die Grabsteine aus dem Boden hervor. Finster hoben sie sich vom silbrig grauen Hintergrund ab.
Es war eine warme Sommernacht. Fledermäuse flatterten dicht an seinem Kopf vorbei – machten dabei knackende Geräusche, die er zum ersten Mal wahrnahm. Sie klangen so lebendig.
Mit langsamen Schritten schlenderte er die schmale, von Gräbern gesäumte Allee entlang und schaute sich um. Nichts sollte diese faszinierende Atmosphäre stören. Dieser Augenblick war nicht zufällig gewählt. Er wusste genau, welche Auswirkung der Vollmond auf seine Wirkungsstätte haben würde. Seine Augen erfassten ein großes, steinernes Kreuz am Scheitelpunkt des Schotterweges. Auf dem Sockel stand eine Widmung an die gefallenen Soldaten aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 in französischer und lateinischer Sprache.
Er lächelte. Dieser Ort war besser, als er es sich in seiner Fantasie hätte vorstellen können. Er schaute sich um und erkannte, dass der Gedenkstein alles bot, was er für sein perfektes Szenario brauchte, auch wenn der dichte Wuchs der Bäume und Sträucher die Sicht ein wenig versperrte. Aber das schmälerte die Bedeutung seiner Arbeit keineswegs. Im Gegenteil: So hatte er noch den Vorteil der Überraschung auf seiner Seite, weil der Blick erst auf den letzten Metern frei wurde.
Nun galt es nur noch, die richtige Anordnung für sein Arrangement zu finden. Denn er wusste genau, welche immensen Emotionen die Musik hervorrufen konnte, die er beabsichtigte, durch die Finsternis schallen zu lassen. Leise summte er die Töne, die ihm inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen waren. Es war die Musik, die er einst für seine Bestimmung gehalten hatte, die ihm jedoch verwehrt geblieben war. Heute hatte er dafür eine andere Verwendung – eine viel bessere. Für diesen besonderen Anlass hatte er das große iPad mitgenommen, weil die Akustik dieses Gerätes deutlich besser war als auf allen anderen Geräten – wenn auch nicht perfekt. Das war der einzige Kritikpunkt an seiner Planung. Nichts, aber auch gar nichts hatte er finden können, was seinen Vorstellungen von guter Klangqualität gerecht geworden wäre. Alle transportablen Geräte neigten dazu, die hohen Töne zu verzerren. Damit zerstörten sie den Musikgenuss – seinen Musikgenuss, den er heute mit einem besonderen Ereignis paaren wollte. Begleiten sollte ihn ein »Nachtstück, voll dunkler Stimmungen« – ein Werk, das nicht nur seine Fantasie zu beflügeln vermochte, sondern auch die Einbildungskräfte seiner Auserwählten!
Es sollte das Letzte sein, was sie in ihrem Leben zu hören bekam: Die Mondscheinsonate!
Er schaltete das Gerät ein – Klaviertöne erklangen.
Diese Musik erzeugte mit ihrer radikalen Formsprache eine hohe emotionale Spannung, die ihn mitriss, ihn gefangen nahm, ihn faszinierte. Die Melodie, die stets wie hinter einem Schleier halb verborgen blieb, nährte seine Entschlossenheit, ließ seine Fantasie die wildesten Blüten treiben. Ließ ihn sich ausmalen, was nun auf ihn zukommen würde. Ernste Stimmung breitete sich in ihm aus, bedeutete ihm, wie wichtig seine Mission war.
Ausgerechnet als der Song »Hangover« von Taio Cruz losschmetterte, kam für Delia Sommer der Moment, das »Nachtwerk« zu verlassen. Aber ihr Date ließ sie alles andere vergessen. Diese Verabredung war so geheimnisvoll und mysteriös – anders als alles, was sie bisher erlebt hatte. Da konnte sie sogar diesen tollen Sound ohne Zögern zurücklassen. Als sie sich dem Ausgang der Discothek näherte, spürte sie eine Hand an der Schulter. Ihre Anspannung war so groß, dass sie erschrocken zusammenzuckte. Doch als sie die Stimme ihrer Freundin Lilli Drombusch hinter sich hörte, musste sie über sich selbst lachen. Sie war so nervös vor diesem heimlichen Rendezvous, als sei es das erste Mal, dass sie sich mit einem Mann traf.
»Gehst du schon?«
Delia nickte und wollte weitergehen, doch Lilli hielt sie zurück.
»Mensch, Delia! Gib mir doch wenigstens einen Hinweis, wo ihr euch trefft!«
»Das würde dir so passen!« Delia schmunzelte. »Dann lauerst du uns am Ende noch auf und verdirbst uns die romantische Nacht.«
»Das traust du mir zu?«
»Nein!« Delia gab schnell nach, als sie sah, dass Lillis hübsches Gesicht ganz traurig wurde. »Es gehört einfach zu unserem Ritual, dass ich nichts verrate. Und daran halte ich mich.«
»Du bist echt gemein! Als deine beste Freundin habe ich doch wohl ein Recht darauf, alles zu erfahren.«
»Keine Sorge! Morgen steht alles auf Facebook. Mit Fotos!« Triumphierend hielt Delia ihr Handy in die Höhe. »Das habe ich schließlich immer dabei.«
»Mir könntest du ruhig vorher schon Bescheid sagen, wie dein geheimnisvolles Date gelaufen ist. Oder gehöre ich schon zu der Masse deiner Freunde?«
Delia nahm Lilli in die Arme und drückte sie zum Abschied fest an sich. »Nein!«, murmelte sie in ihr Ohr, »du bist die beste und neugierigste Freundin, die ich habe.«
»Vielleicht mache ich mir ja auch Sorgen um dich!«
»Jetzt ist es aber gut! Du bist nicht meine Mutter!«
»Hab’ verstanden. Also mache ich mir keine Sorgen und lasse dich einfach ins Ungewisse fahren.«
»Was heißt hier ungewiss? Ich weiß doch, mit wem ich mich treffe.«
»Das wüsste ich auch gern!« Lilli schmollte. »Du kannst mir ruhig sagen, wenn es dieser Gärtner ist. Der Typ ist ja schon an sich ein Abenteuer.«
»Es ist jemand, den du nicht kennst.«
»Wer sagt dir, dass dieser Typ in Ordnung ist?«
»Alles an ihm! Wenn du die Fotos siehst, wirst du mich verstehen.«
Damit ließ Delia ihre Freundin im Eingangsbereich der Disco stehen und trat hinaus in die Sommernacht.
Der Mond stand hell und rund am Himmel. Sie warf einen Blick darauf und war sich sicher, dass ihre Verabredung nicht zufällig heute standfinden sollte. Ein nervöses Kribbeln breitete sich in ihr aus. Sie konnte es kaum noch erwarten, die Überraschung zu erleben, die er ihr versprochen hatte. Nur mit wirklich abenteuerlustigen und mutigen Frauen konnte er etwas anfangen, hatte er zu ihr gesagt. Und genau das war sie. Sie war die Richtige für ihn. Das spürte sie.
Sie steuerte die gelbe Vespa an, die direkt vor dem Eingang abgestellt war und wollte starten. Doch in ihrer Aufregung würgte sie den Motor ab. Erschrocken wartete sie einen Augenblick, bevor sie einen neuen Versuch startete. Auf dem Kickstarter herumzuspringen, kam überhaupt nicht in Frage. Dabei könnte sie in Schweiß ausbrechen, weil sie damit nicht gut zurechtkam. Verschwitzt wollte sie auf keinen Fall ankommen.
Der zweite Versuch gelang. Sie atmete erleichtert durch, setzte ihren Helm auf und fuhr los. Sie bog auf die zu später Stunde wenig befahrene Straße ab und beschleunigte. Das Visier ihres Helms klappte sie hoch und genoss die angenehm kühle Nachtluft auf ihrem Gesicht.
Jeden Meter maß Phönix genau ab und arrangierte den Ort in absoluter Perfektion. Es sollte ein Fest der Sinne werden. Nichts durfte stören, nichts diese göttliche Harmonie verzerren, nichts seinen Plan durchkreuzen. Ihre Wahrnehmung sollte getäuscht werden. Sie sollte sich in Sicherheit wiegen – in dem Glauben, eine berauschende Nacht zu erleben, während sie ihrem unausweichlichen Tod entgegenging.
Der Schock des Verstehens würde umso eindrucksvoller sein, würde ihre Verzweiflung, ihre Ohnmacht und ihre Todesangst zu seinem ganz persönlichen Schauerstück machen.
Er rieb sich die Hände. Das war diese Mühe wert.
Im Einklang mit der Musik, die sanft und leise die Stille der Nacht durchdrang, legte er Meter um Meter zurück und dekorierte seinen Festplatz ganz nach seinen Anforderungen, damit der Liebesakt des Todes genau nach seinen Vorstellungen ablaufen konnte.
Er näherte sich dem Zentrum seines Wirkungskreises, dem Ehrenfriedhof. Schon von weitem konnte er die Silhouette des Steinkreuzes sehen. Ein Anblick, der ihn verzauberte. Einen besseren Opfertisch gab es nicht. An dieser Stelle schallte die Musik in einer angenehmen Lautstärke, sodass er sich dazu verleitet fühlte, im Rhythmus der Klaviertöne seine restliche Dekoration anzubringen. Die Champagnerflasche stellte er dekorativ auf dem Betonsockel des Kreuzes ab. Dieser Anblick entlockte ihm erneut ein zufriedenes Lächeln. Anschließend spazierte er langsam zwischen den Gräberreihen hindurch, um sein Werk zu bestaunen. Durch die vielen Kerzen entstand auf dem Ehrenfriedhof ein beklemmendes Zwielicht. Die Schatten der Grabsteine wiegten sich im Takt mit dem Wind, beugten sich über ihn und deckten ihn mit Finsternis zu. Die Schwingen des steinernen Adlers auf einer hohen Grabsäule schienen sich langsam auf ihn zu zu bewegen. Das leise Rauschen in den Blättern betonte den Surrealismus der Szenerie noch zusätzlich, indem er diese »Insel der Toten« lebendig erscheinen ließ.
Sein Adrenalinspiegel stieg an. Der Zeitpunkt war gekommen. Er wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis sie kam. Bis dahin musste er mental vorbereitet sein – musste ihr in allem, was auf sie zukam, einen Schritt voraus sein. Sie lenken, ohne dass sie es merkte und sie so ihrem Schicksal entgegenführen. Er warf noch einen letzten Blick über den Friedhof und war zufrieden mit dem, was er dort sah.
Delia parkte ihre Vespa am vereinbarten Ort, stieg ab und zog den Helm aus. Mit der kleinen Taschenlampe am Handy hatte sie genügend Licht, um sich ihre langen, blonden Haare im Rückspiegel frisieren zu können. Der lästige Helm drückte die Frisur immer platt, was ihr auf die Nerven ging. Aber ohne Helm durfte sie nicht fahren. Und ohne diese Vespa wäre sie verloren. Also nahm sie dieses Übel in Kauf. Anschließend frischte sie ihr Make-up auf. Als sie mit ihrem Outfit zufrieden war, zupfte sie an ihrem Minirock. Sie zog ihn noch ein bisschen höher, damit er sehen konnte, was sie alles zu bieten hatte. Auch das Top verbarg noch viel zu viel. Sie schob ihre Brüste hoch, sodass der Push-up-BH alles besser betonte. Den Netzstoff drapierte sie elegant über das neckische Outfit, als wollte sie damit etwas verhüllen.
So gefiel sie sich. Mit ihren hochhackigen Schuhen ging sie los. Auf dem Asphalt schallten ihre Schritte laut und deutlich. Doch kaum betrat sie unbefestigten Boden, wurden ihre Schritte leiser, dafür aber auch unsicherer. Schwankend und stolpernd setzte sie ihren Weg fort – mit der ständigen Angst, sich einen Absatz abzubrechen.
Doch schnell wurde sie von ihren Sorgen abgelenkt. Kleine Lichter in Reih und Glied fielen ihr ins Auge. Sie durchbrachen die Dunkelheit. Delia stolperte weiter, immer näher darauf zu, bis sie sich sicher war, was sie dort sah. Sie konnte es nicht glauben. Ihr erster Gedanke galt ihrer Freundin: Wenn sie das wüsste ...
»I’m gone live my life«, plärrte es plötzlich in die Stille hinein. Dann folgte ein lauter Bass und der Song »Live my life« von Justin Bieber dröhnte aus ihrem Handy. Hastig drückte sie auf den grünen Knopf und die Musik verstummte. Am anderen Ende der Leitung höre sie Lilli fragen: »Wo bist du jetzt?«
»Mensch Lilli! Hast du mich erschreckt«, schimpfte Delia.
»Sag schon! Was ist los bei dir? Ich platze vor Neugier!«, drängte Lilli weiter.
»Ich bin noch gar nicht angekommen, schon plärrst du mir ins Handy«, murrte Delia. »Ich werde das Gerät jetzt abschalten.«
Während sie in das Mobiltelefon sprach, stolperte sie weiter auf diese geheimnisvollen Lichter zu.
»Bitte nicht! Wie soll ich dich dann noch erreichen?«
»Gar nicht!«
»Aber ich muss doch wissen, was mit dir los ist! Wo bist du jetzt?«
»Ich bin bald da! Wenn die Verbindung abbricht, kannst du dir denken, dass ich etwas Besseres zu tun habe, als mit dir zu diskutieren.«
»Du bist ja wirklich verdammt scharf auf den Typ! Was hat der nur an sich? So warst du noch nie.«
Doch Delia hörte nicht mehr zu. Vor ihren Augen offenbarte sich eine Lichterreihe, die sie an Halluzinationen glauben ließ. Lediglich der gewöhnliche Maschendrahtzaun, der sie noch davon trennte, machte ihr klar, dass dieses Arrangement echt war. In Kniehöhe sah sie ein großes Loch, durch das sie problemlos hindurchkriechen konnte. Leise Klaviertöne vernahm sie im Hintergrund. Die Melodie war so langsam, als würde etwas Bedrohliches mitschwingen.
Das sah wirklich nach Abenteuer aus. Und gefährlich dazu. Alles, was Delia liebte. Der Reiz des Verbotenen. Sie wusste, wo sie war. Und sie wusste auch, dass hier kein Zutritt war. Und dazu diese rätselhafte Musik. Ihr Herz schlug vor Freude schneller.
»Geil!«, hauchte sie nur in den Hörer.
»Was?«
»Alles! Lilli! Einfach alles!«
»Mensch! Spann mich nicht so auf die Folter. Mach ein Foto und schick es mir zu!«, bat Lilli.
»Das filme ich besser! Sonst würdest du mir niemals glauben«, versprach Delia.
»Ja! Super! Mach das«, jubelte Lilli.
Delia ging in die Hocke und streckte das Handy durch das Loch im Zaun, um mit der Aufnahme zu beginnen.
Plötzlich tauchte eine Hand von der rechten Seite auf, ergriff das kleine Mobiltelefon und verschwand damit in der Dunkelheit.
Leise schallten die Töne des ersten Satzes der Mondscheinsonate durch die Nacht. Mit jedem Meter, den Phönix sich vom Ehrenfriedhof entfernte, wurden sie leiser und leiser, zarter; überirdischer. Seine Schritte hinterließen ein gedämpftes Rascheln auf dem vertrockneten Rasen, der bis zum Maschendrahtzaun reichte, durch den sie kommen musste.
Sie! Die Frau, die er für seinen Plan auserwählt hatte.
Die Frau, die nicht nur sein Leben von Grund auf verändern sollte, sondern auch das vieler anderer.
Die Frau, deren Leben hier ein Ende finden würde.
Feierliche Stimmung breitete sich in ihm aus.
Er positionierte sich hinter einer dichten Hecke, von der aus er das Gelände jenseits des Zauns überblicken konnte ohne selbst gesehen zu werden. Von nun an hieß es warten.
Seine Anspannung wuchs. Geduld war nicht seine Stärke. Aber das hätte er mit einkalkulieren müssen. Diese jungen Mädchen waren abenteuerlustig und risikofreudig – alles, was für seinen Plan große Bedeutung hatte. Aber pünktlich waren sie nicht. Warum auch? Welche Verpflichtungen hatten sie? Sie verbrachten mehr Zeit in Discos als in der Schule und genossen ihr Leben auf Kosten der Eltern.
Er schüttelte den Kopf, schüttelte diesen Gedanken ab. Damit erreichte er nur, dass er sich vom Wesentlichen ablenkte, nämlich von dem, was ihm bevorstand. Dafür benötigte er volle Konzentration.
Er schaute über die Kerzenlichter, die er so platziert hatte, dass sie exakt den Weg zum Friedhof beleuchteten. Der Wind rüttelte an den Flammen, sodass sie flackerten und dabei unstete Schatten warfen. Dazu das leise Rauschen in den Bäumen, begleitet durch die sanften Klänge des ersten Satzes der Klaviersonate – damit entwickelte sich sein Szenario zu einem wahren Kunstwerk.
Ein Anblick, der seine Ungeduld in Vorfreude verwandelte.
Plötzlich mischten sich jaulende Töne zwischen die Mondscheinsonate. Erschrocken horchte er auf. Er kannte den Song. Es war der neueste Hit von diesem Kinderstar Justin Bieber. Das verriet ihm, dass seine Verabredung gekommen war. Wer sonst hörte sich diese poppige Musik an?
Abrupt endete der Lärm und eine Frauenstimme ertönte.
Vorsicht lugte er zwischen den Ästen hindurch. Da sah er sie.
Der Rock so kurz, dass er kaum ihren hübschen Hintern verdecken konnte. Das enganliegende Top so knapp, dass es nur dürftig die Brüste verbarg. Darüber ein Netzshirt, das alles noch frivoler aussehen ließ. Die blonden Haare zur wilden Löwenmähne frisiert. Das junge Mädchengesicht stark geschminkt.
Hübsch, leichtsinnig und verdorben. Genau so, wie er sie eingeschätzt hatte. Aber es war kein Zufall, dass er mit ihr das perfekte Mädchen ausgesucht hatte. Schließlich hatte er sich vorbereitet. Und diese schöne Knospe ließ sich auf das Unbekannte ein – ohne zu zögern, ohne nachzufragen – einfach nur aus der Laune heraus, etwas zu erleben.
Er schmunzelte.
Doch das verging ihm schnell, als er hörte, was sie in ihr Handy hinein plapperte.
»Geil!«
Damit wollte sie wohl Begeisterung ausdrücken, da sie sein Arrangement entdeckt hatte. Ihn aber störte dieses Geschwätz. Es könnte seine Vorfreude trüben. Es wurde höchste Zeit, diesen Mund zum Schweigen zu bringen.
»Alles! Lilli! Einfach alles!«, meinte sie jetzt in einem Tonfall, der ihn in seinem Entschluss nur bestärkte.
»Das filme ich besser! Sonst würdest du mir niemals glauben«, sagte sie nun und hielt das Handy durch das Loch im Zaun.
Damit hatte sie den Bogen überspannt. Jetzt war Schluss.
Er streckte seine Hand danach aus und nahm das Gerät an sich.
Vorbei die Gefahr.
Nun gehörte sie ganz ihm.
Delia zuckte zusammen und stieß einen leisen Schrei aus. Sie zog die Hand zurück. Das Handy war weg. Schon tauchte es vor der Öffnung im Zaun auf und jemand sagte: »Fang mich!«
»Mensch, hast du mich erschreckt«, stieß sie erleichtert aus, als sie die Stimme erkannte. Schnell schlüpfte sie durch das Loch und sah endlich das ganze Ausmaß seines Arrangements.
»Wow! Ist das alles für mich?«, fragte sie mit einem Leuchten in den Augen.
»Siehst du hier noch jemanden?«, stellte er eine Gegenfrage. Er stand genau im Licht, sodass sie nur seine Silhouette erkennen konnte.
Obwohl sie wusste, dass sie allein waren, schaute sie sich um. Außerhalb der Kerzenreihe lag alles in Finsternis. Niemand zu sehen. Und außer den fernen Klaviertönen nichts zu hören.
»Was ist das für eine Musik?«, fragte sie.
»Erkennst du sie nicht?«
»Nein! Mit klassischer Musik kenne ich mich nicht aus.«
»Das ist die Mondscheinsonate von Beethoven.«
»Oh, wie romantisch! Die Mondscheinsonate im Mondschein!« Vor Begeisterung warf sie sich ihm an den Hals und umarmte ihn so stürmisch, dass er Mühe hatte, nicht nach hinten zu kippen.
Dann schlenderten sie los, folgten Arm in Arm den Lichtern, bis die ersten Grabsteine in Sicht kamen.
»Wohin entführst du mich?«
»Schau dich um, dann erkennst du es!«, antwortete er, während er die Champagnerflasche öffnete und in die mitgebrachten Gläser einschenkte.
Ihr Blick fiel auf das steinerne Kreuz. Sie las die Inschrift auf dem Sockel laut vor: A la Mémoire des Soldats francais décédes en 1870-71 ... Erigé par leurs Compatriotes.«
»Weißt du auch, was das heißt?« Er reichte ihr ein Glas mit der prickelnden Flüssigkeit.
»Machen wir hier Französischunterricht oder Französisch?«, fragte sie aufreizend zurück, nahm das Sektglas, das er ihr entgegenhielt und trank viel zu hastig.
Mit einem zufriedenen Lächeln zog er ihr die Kleider aus, während sie sich an seinen Körper schmiegte und seine Berührungen auf ihrer Haut genoss.
Plötzlich steigerte die Musik ihr Tempo. Aus den sanften Tönen wurden energische Klänge, die so gar nicht zu dem passen wollten, was Delia noch vor wenigen Sekunden gehört hatte. Immer lauter und aufdringlicher wurde die Musik, als wollte sie gewaltsam die romantische Stimmung zerstören.
»Was ist mit der Musik los? Eben war sie viel romantischer!«
»Das war der erste Satz«, erklärte er. »Aber, was ich will, ist keine Romantik, sondern Leidenschaft.«
»Dann sind wir schon zwei!«
Als Delia ganz nackt war, setzte der dritte Satz der Klaviersonate ein. Harte Hammerschläge ertönten, die in wilder Abfolge einen gebrochenen Akkord schmetterten. Der abrupte Tempowechsel ließ Delia erschrocken die Augen aufreißen. Doch was sie sah, erregte sie noch mehr. Sein Gesicht drückte eine unbezähmbare Entschlossenheit aus, sie zu erobern. Genau das, was sie wollte. Ungestüm drückte er sie auf die Erde nieder und nahm sie mit einer Geschicklichkeit, die aus einem Balanceakt zwischen Gewalt und Zärtlichkeit bestand. Weder wurde er zu schonungslos, noch zu behutsam – er fand immer den richtigen Dreh, um sie an die Grenzen der Ekstase zu führen. Delia stöhnte unter ihm, gab sich ihm willenlos hin, spürte, wie er sich entzog, um sie mit erneuter Kraft zu erobern. Sie gelangte an einen Höhepunkt, der sie kraftlos zusammensinken ließ. Noch nie hatte sie sich so ausgepowert gefühlt. Sie schloss die Augen und wartete darauf, dass er neben ihr niedersank und sie zärtlich in die Arme nahm.
Doch das geschah nicht.
Verwundert schaute sie auf und erschrak, als sie sah, wie er breitbeinig vor ihr stand. Wieder konnte sie nur seine Umrisse sehen, weil er mit dem Rücken zum Kerzenlicht stand. Hinzu kam, dass die Umrisse begannen, sich zu bewegen. Was war mit ihren Augen?
»War es nicht gut?«, fragte sie fassungslos.
»War?«
»Ist es noch nicht vorbei?« Delia wusste nicht, ob sie wirklich noch mehr wollte. Ihr Körper fühlte sich entkräftet an. Da war kein Funken mehr von Lust zu spüren. Außerdem überkam sie eine lähmende Müdigkeit, als sei ihr der Alkohol zu Kopfe gestiegen. Doch er nahm ihr Zögern nicht wahr, sondern flüsterte in einem Tonfall, der ihr Angst machte: »Mein Part fängt erst an.«
Er beugte sich herab, strich über ihren rechten Arm, bis sie plötzlich einen Schmerz spürte. Sie erschrak, bewegte sich aber nicht, sondern schaute ihm zu, wie seine Aufmerksamkeit sich auf den linken Arm konzentrierte, bis es auch dort schmerzte. Etwas Warmes breitete sich auf beiden Armen aus.
»Was ist das für ein Spiel?«, fragte sie verunsichert. Ihre Stimme lallte schon.
»Ich dachte, du bist zu jedem Abenteuer bereit?«, hakte er leise nach.
Delia war sich nicht mehr so sicher, ob sie beide darunter dasselbe verstanden. Sie fühlte sich benommen und unkonzentriert. Etwas lief hier aus dem Ruder – genauer gesagt, an ihren Armen herunter. Sie wollte nicht wissen, was es war. Allein ihre Vermutung ließ sie schon innerlich erschauern. Eisige Kälte kroch schlagartig durch ihren Körper, der vor wenigen Sekunden noch heiß glühend war.
Dann sah sie es: das Messer! Es war klein, fast unscheinbar. Das Blut, das im Kerzenschein an der Klinge schimmerte, war ihr eigenes. Sie brach in Panik aus.
Sie wollte schreien, doch seine große Hand legte sich über ihren Mund.
»Pssssssssst!«, flüsterte er in ihr Ohr.
Verzweifelt versuchte sie sich zu wehren, doch sie schaffte es nicht. Sie spürte nur, wie sie immer kraftloser wurde. Ein letzter Gedanke schoss ihr durch den Kopf: Das ist kein Abenteuer! Das ist eine Falle!
Dann fiel sie in eine erlösende Ohnmacht.
Der erste Satz der Mondscheinsonate setzte wieder ein. Aus dem cis-Moll entwickelte sich allmählich eine zarte Melodie, die leise umgeformt wurde, in andere Tonarten entwich, bis sich die Triolen verselbstständigten. Es war die freie Fantasie, die den Schöpfer einst dazu beflügelt hatte – eine vom Geist der Improvisation inspirierte – in ihrer Form nicht festgelegte Gattung! Damit sprach ihm Beethoven aus der Seele, denn ursprünglich lautete der Name dieser Sonate »Sonata quasi una Fantasia« – Sonate wie eine Fantasie. Phönix identifizierte sich nur zu gern mit dieser tiefgründigen Bedeutung. Auch er passte in keine Norm. Er hatte erkannt, dass er nur durch Andersdenken und –handeln weiterkommen konnte. Deshalb war er an diesem denkwürdigen Ort und lauschte den Klängen, die beschaulich und kühl zwischen den Grabstätten hindurch zu seinen Ohren drangen.
Dabei liebkoste er Delias zarte Haut. In ihrer Bewusstlosigkeit gefiel sie ihm ganz besonders, denn ihre Gesichtszüge wirken unschuldig und entspannt. Die Augenlider blieben geschlossen, als er ihren nackten Körper anhob. Sie war federleicht und fiel sanft gegen seinen Oberkörper. Es kostete ihn keine Mühe, mit ihr im Arm auf den Sockel zu klettern, um sie dort in die richtige Position zu bringen.
Ihre Schönheit betörte ihn. Ständig überkam ihn der Drang, sie wieder zu berühren. Die Erinnerung an ihren wilden Sex erregte ihn zu einem unpassenden Moment. Vorsichtig balancierte er sich und den schlafenden Körper der jungen Frau auf dem schmalen Fundament dicht vor dem steinernen Kreuz aus. Jetzt durfte er sich nicht durch dumme Gedanken ablenken lassen.
Sein Blick fiel auf ihr Gesicht, das bleich im Mondschein schimmerte. Ihre Augenlider begannen leicht zu flattern, was bedeutete, dass sie bald wieder aufwachen würde. Also musste er zusehen, dass das genau im richtigen Augenblick geschah.
Rasch begann er mit der Arbeit.
Es dauerte nicht lange, schon sah er den ersten schwachen Lichtstreifen am Horizont.
Der neue Tag erwachte.
Und Delia ebenso.
Delia öffnete die Augen.
Sie wusste nicht wo sie war. Auch nicht, wie sie an diesen Ort gelangt war, an dem sie sich aufhielt. Sie hob den Kopf und schaute sich um. Ihr Blick war verschwommen, grauer Dunst umgab sie. Sie schüttelte leicht den Kopf, doch damit löste sie nur Schwindel aus. Sofort hielt sie mit der Bewegung inne. Seufzend senkte sie den Kopf wieder auf ihre Schulter.
Ein Geräusch ließ sie aufhorchen.
Sie schaute auf und versuchte, etwas zu erkennen. Nach und nach wurden die Bilder klarer. Doch was sie sah, gefiel ihr nicht. Es waren Grabsteine, viele unterschiedliche Grabsteine.
Endlich fiel es ihr wieder ein. Ihr geheimnisvolles Rendezvous! Mit dem Mann ihrer Träume.
Sollte das Teil ihres mysteriösen Spiels sein?
Dann sah sie ihn.
Ihre Blicke trafen sich.
Erschrocken sah sie in seinen Augen einen tiefen Abgrund aufblitzen. Panik breitete sich in ihr aus. Das gehörte nicht zu ihrem Plan. Hier lief etwas verdammt schief. Sie wollte schreien, aber es kam kein Ton heraus. Sie wollte sich zurücklehnen, aber auch das gelang ihr nicht. Sie fühlte sich wie fixiert. Was war geschehen? Sie konnte sich nicht bewegen. Ihre Beine trugen sie nicht mehr. Sie hatte keine Kontrolle mehr über ihren Körper.
Alles fühlte sich an wie in einem ihrer Albträume. Ja, bestimmt! Sie befand sich mitten in einem Albtraum. Darin kam sie auch nie vom Fleck, egal wie sehr sie sich anstrengte zu laufen. So war es hier auch. Ihre Beine waren taub, ebenso ihre Arme. Diese Taubheit zog höher und höher – sie spürte ihren ganzen Körper nicht mehr. War das der Schlaf, der sie nun übermannte?
Etwas in ihr sträubte sich jedoch, sich in diesen Schlaf sinken zu lassen. Also strengte sie sich an, ihre Augen offen zu halten – selbst das gelang ihr nur unter größter Mühe. Doch was sie sah, ließ sie allmählich daran zweifeln, dass sie träumte. Er stand immer noch vor ihr und beobachtete sie. Warum half er ihr nicht? Warum grinste er so dämonisch? Was war mit ihm geschehen, nachdem sie miteinander geschlafen hatten?
Sie wollte ihn danach fragen, aber sie schaffte es nicht, sich zu überwinden. Alles an ihr war bleischwer. Sie brachte keinen Ton heraus. Ihre Willenskraft gab nach, ihre Augenlider fielen wieder zu.
Nein! Das durfte nicht sein!
Hastig riss sie die Augen wieder auf.
Immer noch stand er reglos vor ihr.
Sie spürte, dass er ein Spiel mit ihr spielte, das jegliche Grenzen überschritt.
Aber nicht mit ihr. Dazu war sie nicht bereit.
Sie wollte sich dagegen wehren, wollte sich vor seinen Augen nicht einfach gehen lassen. Diesen Triumph gönnte sie ihm nicht. Stattdessen wollte sie ihm so viel an den Kopf werfen. Ihm sagen, dass er nichts Besonderes beim Sex war. Dass sie schon Bessere hatte. Ihn verletzen – wie er sie verletzt hatte. Immerhin war sie am Gymnasium heiß begehrt. Viele ihrer Mitschüler zeigten großes Interesse an ihr. Sie hatte noch so viel vor – wollte noch so viel erleben – noch so viel von der Welt sehen.
Doch die Müdigkeit besiegte ihren Stolz.
Unumkehrbar legte sich Schwärze über ihre Augen.
1
Schon früh am Sonntagmorgen herrschten sommerlich warme Temperaturen. Die Sonne schien vom azurblauen Himmel, kein Wölkchen in Sicht. Die angekündigte Rekordtemperatur konnte nichts mehr aufhalten. Eigentlich liebte Susanne Kleber dieses Wetter. Doch heute musste sie arbeiten. In ihrem Job als Reporterin für die einzige saarländische Tageszeitung blieb es ihr nicht erspart, auch die Sonntage zu opfern, wenn etwas Wichtiges auf dem Programm stand. Genau das war heute der Fall.
Kritisch schaute sie auf ihren Nebenmann, Dimitri Wagner. Seit einigen Wochen war er als Kameramann bei ihrer Zeitung beschäftigt und begleitete sie zu allen wichtigen Außenterminen. Anfangs war Susanne skeptisch, doch inzwischen hatte er sie mit seinen pfiffigen Schnappschüssen überzeugt.
Seine Haare zu einem Irokesenschnitt verunstaltet – mit schwarzen Seiten und weißen Spitzen – war er ein echter Hingucker. Mit ihm konnte sie unauffälliges Recherchieren schon mal vergessen. Doch hier waren sie offiziell in ihrer Funktion als Reporterin und ihr Fotograf im Einsatz. Hier war es Susanne egal, wie er aussah. Ansonsten hatte sie immer eine Mütze für Notfälle in der Tasche, mit der sie Dimitri besser tarnen konnte.
Der Parkplatz, der sich immer mehr mit Menschen füllte, war ein Behindertenparkplatz. Vermutlich war er genau deshalb als Treffpunkt für die Touristenführung durch den Deutsch-Französischen Garten (DFG) gewählt worden, weil dort sowieso kein Auto parkte. Bisher hatte Susanne jedenfalls noch nie einen Schwerbehinderten dort parken sehen. Höchstens mal Franzosen, die es mit den Vorschriften nicht so genau nahmen.
Auch heute stand hier kein einziges Auto. Sonst hätten die vielen Menschen nicht mehr auf diesen Platz gepasst. Susanne staunte über das große Interesse an der Führung durch den Deutsch-Französischen Garten. Vermutlich hatte das neue Projekt, das hier gebaut werden sollte, diese Neugier geweckt. Der Vergnügungspark Gullivers Welt, der die bekanntesten Gebäude der Welt im Miniaturformat ausgestellt hatte, war nach 35 Jahren geschlossen worden. Nun sollten große Veränderungen vorgenommen werden, um mehr Aufmerksamkeit auf den Park zu lenken. Das Versprechen, für deutsche und französische Kinder einen Wasserspielplatz zu bauen, war dabei auf großen Anklang gestoßen. Bei den Saarbrücker Bürgern ebenso wie bei den Politikern.
Ein Räuspern riss Susanne aus ihren Gedanken. Vor dem Eingangstor stand eine Frau, deren leuchtender Rotschopf alle Gäste überragte.
»Passt acht, liebes Publikum«, begann sie mit schriller Stimme zu sprechen. Schlagartig waren alle still und schauten in ihre Richtung. »Mein Name ist Anna Bechtel. Ich bin die Leiterin des Amtes für Grünanlagen der Stadt Saarbrücken und somit auch für den Deutsch-Französischen Garten zuständig.«
Susanne arbeitete sich nach vorne, gefolgt von Dimitri, der sie keine Sekunde aus den Augen ließ. Sie könnte etwas sehen, was er nicht vor die Linse bekam. Dieser Gedanke stachelte den Kameramann zu Höchstleistungen an. Als sie in der ersten Reihe ankam, sah sie, dass die Frau, die diese Gruppe anführte, die reinste Bohnenstange war. Lang und dünn stand sie in einen Wickelrock und ein T-Shirt gehüllt, auf dem sich jede Menge Knochen abdrückten. Mit den leuchtend roten Haaren war sie der Inbegriff einer Gruppenführerin. Niemand konnte diese Frau übersehen.
»Wie wir alle wissen, wird der Park Gullivers Welt geschlossen. Dem Besitzer haben wir gekündigt und er hat den Park bereits leer geräumt.«
Alle nickten.
»Genau an diese Stelle werden wir einen Wasserspielplatz bauen!«
Applaus ertönte.
Anna Bechtel lachte, verneigte sich leicht und sprach weiter: »Dafür benötigen wir viel Geld. Das erlangen wir nur durch Fördergelder der EU, wenn wir den Deutsch-Französischen Garten als lohnendes Tourismusprojekt verkaufen können.«
Zustimmendes Nicken unter dem Publikum war zu sehen.
»Vor fünfzig Jahren, am 22. Januar 1963, wurde die deutsch-französische Freundschaft durch den Elysee-Vertrag besiegelt. Dieses Jubiläum wurde im letzten Jahr gebührend gefeiert. Doch wir wollen mit unserem Projekt zeigen, dass wir auch über diese obligatorischen Fälligkeitstage hinaus stets dazu bereit sind, diese länderübergreifende Freundschaft mit innovativen Projekten einer stetigen Verbesserung zu unterziehen. Aber das kostet Geld, das die Stadt Saarbrücken nicht hat. Deshalb werden wir regelmäßige Führungen anbieten, um den Menschen unsere Ziele näherzubringen. Extra dafür haben wir ein Tourismusbüro eröffnet. Das liegt genau am entgegengesetzten Ende des Parks, am Nordeingang. Dort wollen wir nachher den Abschluss machen, damit Sie sich in aller Ruhe umsehen können, welches Informationsmaterial wir dort ausliegen haben. Bei einer Tasse Kaffee vom Kiosk direkt nebenan können Sie sich in aller Ruhe über alles informieren, was die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft unseres Deutsch-Französischen Gartens betrifft.«
Wieder erntete die große, rothaarige Frau Applaus.
»Nun, passt acht, liebe Gäste. Wir wollen mit der heutigen Führung beginnen. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Ehrenfriedhof.«
Sie wollte sich gerade umdrehen und losgehen, als sie innehielt und fragte: »Ist jemand von der Presse hier?«
Zusammen mit Dimitri meldete sich Susanne auf die Frage und nannte die Zeitung, für die sie arbeitete.
»Das ist gut!«, honorierte Anna und entblößte dabei viel zu lange Zähne. »Öffentlichkeitsarbeit ist das A und O unseres Tourismuskonzeptes. Dann wollen wir mit der Führung beginnen.«
Sie durchschritt mit den vielen Besuchern im Schlepptau das Eingangstor und blieb schon gleich an einer hohen Steinmauer stehen.
»Das ist der Schulze-Kathrin-Bunker«, erklärte sie, »benannt nach Katharina Weißgerber. Sie hat sich bei der Schlacht auf der Spicherer Höhe am 6. August 1870 inmitten der Kämpfe um verwundete Soldaten beider Nationen gekümmert, ihnen Wasser gereicht und dabei geholfen, die Verwundeten aus den Gefechtslinien zu schaffen. Dieser Einsatz wurde dem preußischen König Wilhelm gemeldet und sie erhielt das Verdienstkreuz für Frauen.« Nickende Köpfe bewiesen ihr, dass alle wussten von wem sie sprach. »Leider gehört dieser Bunker nicht der Stadt Saarbrücken, sondern einer Fremdfirma, die ihn uns gerne verkaufen möchte. Aber das Geld können wir uns sparen, denn dieser Bunker funktioniert als Begrenzungsmauer unseres Deutsch-Französischen Gartens – ist also so oder so Bestandteil unseres Gartens. Außerdem kann ihn niemand wegschleppen.«
Die Zuschauer lachten.
Einer fragte: »Wie sieht es in dem Bunker aus?«
»Heute kann man nur noch die vorderen Räume betreten, die als Lagerräume genutzt werden«, antwortete Anna. »Die hinteren sind wegen Einsturzgefahr gesperrt. Aber wie es dort zu Kriegszeiten ausgesehen hat, kann man auf einer Fotoausstellung im Museum bewundern.«
Weiter ging es zu den Rosengärten. Der deutsche Rosengarten lag Frankreich zugewandt, der französische Deutschland – ein Symbol für die Deutsch-Französische Freundschaft, auf die Anna Bechtel mit besonderer Betonung hinwies. Im französischen Rosengarten stand ein Mann, der mit lauter Stimme sprach und dabei wild gestikulierte. Worte wie »France Libre« und »Paul Cézanne«, die besondere Fürsorge benötigten, schallten laut über den Platz.
Anna erklärte den staunenden Gesichtern: »Das ist François Miguel, unser französischer Gärtner! Er unterhält jeden mit seinem Fachwissen über Rosen, ob man nun will oder nicht.«
Sie sahen den Franzosen mit einem Mann sprechen, der Mühe hatte, den hektischen Armbewegungen des Gärtners auszuweichen. Ein Anblick, der die Besucher amüsierte.
»Aber als Gärtner ist er wirklich gut«, fügte Anna an. »Schauen Sie sich mal zum Vergleich den deutschen Rosengarten an. Dafür haben wir bis jetzt noch keinen geeigneten Gärtner finden können.« Tatsächlich! Der deutsche Rosengarten sah vernachlässigt aus.
Um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken, klatschte Anna Bechtel in die Hände und rief: »Passt acht, liebes Publikum. Es geht weiter, wir haben noch viel vor uns. Unser nächstes Ziel ist der Ehrenfriedhof.«
Ehrenfriedhof!
Phönix lachte in sich hinein.
Seine Geduld wurde nicht lange auf die Probe gestellt. Er wusste, dass eine Führung durch den Deutsch-Französischen Garten vom Eingang der Metzer Straße aus immer zu Anfang am Ehrenfriedhof vorbeiführte.
Das war ihm wichtig, weil er keine Lust hatte, sich lange hier aufzuhalten. Aber das Wissen, dass diese Führung nur wenige Minuten dauerte, hatte ihn zu diesem Spielchen getrieben, einfach daran teilzunehmen. Teilnehmerlisten wurden keine geführt, das war Grundvoraussetzung für ihn gewesen.
Er schaute in die ahnungslosen Gesichter der Besucher und spürte seinen Adrenalinspiegel ansteigen. Er wusste etwas, was sonst keiner ahnen konnte. Auch genoss er seine Vorfreude darauf, wie sie wohl reagierten. Die Neugier dieser Menschen spielte ihm in die Hände. Es würde alle umso härter treffen. Denn sie müssten ganz nah herangehen und hinstarren, weil sie zu dieser Führung gegangen waren mit dem Vorsatz, jedes Detail genau zu betrachten.
Genau das war Teil seines Planes!
Er unterdrückte ein Grinsen. Damit könnte er auffallen. Und auffallen war das Letzte, was er sich erlauben durfte.
Die Gruppe ging zielstrebig auf den verheißungsvollen Ort zu.
Er ignorierte das Geplapper von Anna Bechtel, weil es ihn nicht interessierte. Viel mehr suchte er unter den vielen Leuten einen möglichen Gefahrenpunkt – jemanden, der seinen Plan durchkreuzen könnte. Jemanden, der ihn kannte. Jemanden, der besonderes Interesse an ihm zeigte. Aber da war niemand. Egal, wie oft er sich die Gesichter ansah – niemand kam ihm bekannt vor, also bestand keine Gefahr für ihn.
Zum Glück.
Sie betraten bereits den unteren Teil des Friedhofs. Der dichte Baumbestand verhinderte die freie Sicht. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als ganz nah heranzugehen.
Und genau das taten sie in diesem Augenblick.
Sein Puls beschleunigte sich.
Sie steuerten einen Wald an, der von außen undurchdringlich wirkte, während Anna Bechtel berichtete: »Dieser Ehrenfriedhof wurde zu Ehren der deutschen und französischen Soldaten des Deutsch-Französischen Krieges in der Schlacht von Spichern im Jahre 1870 errichtet. Viele Tote waren auf beiden Seiten zu beklagen. Daher werden Sie auch schnell erkennen, dass Deutsche wie auch Franzosen hier Seite an Seite liegen.«
Man kam den Bäumen immer näher, doch es war immer noch kein einziges Grab zu sehen.
»Dieser Platz wurde nicht zufällig ausgewählt. Bis 1870 hieß das Ehrental In der Galgendelle, weil sich dort eine Hinrichtungsstätte für die Bürger der Grafschaft Saarbrücken befand.«
»Gruselig«, grummelte Susanne bei diesen Worten. Doch der Anblick, der sich ihr bot, bezeugte nichts von dieser schaurigen Vergangenheit. Sie sah nur Natur.
Erst als sie dicht davor standen, konnten sie Grabsteine zwischen den hohen Zypressen erkennen. Der Boden war überwuchert mit Efeu. Vereinzelt fielen Sonnenstrahlen auf den Boden und streuten ein diffuses Licht. Auch schienen schlagartig die sommerlichen Temperaturen um einige Grade zu sinken. Das einzige Geräusch, das die Besucher begleitete, war das leise Rauschen des Windes in den Blättern.
Eine Stelle stach durch bunte Blumen in dem eintönigen Grün hervor. Es war das Grab der legendären »Katharina Weißgerber«. Eine Zeitlang verweilten sie dort.
Je weiter sie durch die schmalen Pfade zwischen den Gräbern einhergingen, umso deutlicher gesellte sich ein weiteres Geräusch zu dem Rauschen. Es klang wie ein Summen.
Zunächst nahm es niemand wahr. Alle glaubten, es gehöre hierher. Doch plötzlich hob Anna Bechtel den Kopf und meinte mit erhobenem Zeigefinger: »Passt acht, liebes Publikum! Dieses Brummen gehört nicht hierher.«
Alle konzentrierten sich, bis sie das Geräusch vernahmen.
»Es gibt hier weit und breit keinen Motor«, sprach Anna weiter.
»Vielleicht hat jemand sein Auto abgestellt und den Motor laufen lassen«, spekulierte ein kräftiger Mann mit rotem Gesicht.
Anna nickte resigniert und meinte: »Es wird Zeit, dass wir den Park für die Autofahrer sperren können. Es reicht schon, dass überall auf der Welt Autos fahren.«
Die Besucher stimmten ihr zu.
Sie gingen weiter.
Plötzlich sahen sie, dass kein Auto dieses Summen verursachte.
An einem hohen, steinernen Kreuz flogen schwarze Fliegen in dichten Schwärmen hektisch kleine Kreise, sodass die Sicht auf das Kreuz größtenteils verwehrt blieb. Das Einzige, was ihnen eine Vorahnung von dem gab, was dort sein könnte, war der Geruch.
Plötzlich sprang Dimitri aus der Menge vor. Susanne lief hinter ihm her und wollte ihn zurückhalten, doch ohne Erfolg. Dimitri wedelte wild mit seinen Armen, bis alle deutlich sehen konnten, was sich unter dem Fliegenschwarm verbarg.
Am Kreuz hing eine tote Frau.
Sie war mit Stricken an den äußeren Schenkeln des Kreuzes festgebunden worden, sodass es aussah, als sei sie gekreuzigt worden. Außerdem war sie nackt. So konnte das ganze Ausmaß ihrer Verletzungen gesehen werden. Die Augen waren geschlossen. Die Lippen blau verfärbt. Ihr Körper war übersät mit bräunlich verfärbten Wunden. Ausgetretenes Blut klebte an ihrem Körper. Der Rest hatte sich unter ihr zu einer großen getrockneten Lache auf dem Sockel des Kreuzes gesammelt. Die Haut war großflächig übersät mit roten Flecken, lediglich der Unterleib schimmerte grün.
Susanne, die dicht davor stand, bekam eine Salve von ekelerregendem Gestank in die Nase. Dazu dieser Anblick, schon wurde ihr schwarz vor Augen und sie fiel um.
Phönix fühlte sich selbst vom Anblick der Toten überrumpelt. Das übertraf seine Vorstellungen. Gestern noch war sie strahlend schön und heute ...
Bei dem Gedanken, dass er mit dieser Person noch in der letzten Nacht geschlafen hatte, wurde ihm übel. Er spürte, wie ihm Galle hochkam. Während er sich umschaute, sah er, dass es anderen genauso erging – nur aus einem anderen Grund.
Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie die hübsche Journalistin einige Schritte rückwärts stolperte, bevor sie umfiel und genau vor seinen Füßen landete.
Das fehlte noch. Er wollte ihr auf keinen Fall auf die Beine helfen, weil er damit Aufmerksamkeit auf sich zog. Aber wenn er es nicht tat, geschah dasselbe. Diese Situation hatte er nicht vorhersehen können. Ebenso wenig das Chaos, das um ihn herum herrschte. Von allen Seiten strömten Leute herbei. Wie kam es, dass an einem heißen Sommertag so viele Menschen im Deutsch-Französischen Garten herumliefen? Wäre da ein Besuch im Schwimmbad nicht sinnvoller?
Er schaute auf die Daliegende und stellte fest, dass sich bereits der Fotograf mit ihr befasste. Also war seine Hilfe nicht nötig.
Unauffällig drehte er sich um und machte sich daran, dieses Spektakel zu verlassen.
Plötzlich rief jemand: »Niemand verlässt den Ehrenfriedhof!«
Das wurde ja immer schöner. Wollte sich dieser Fettwanst als Polizist aufspielen?
Er starrte ihn an und entgegnete würgend: »Wenn ich Ihnen auf die Füße kotzen soll, bitte.«
»Um Gottes Willen! Sie auch noch«, stöhnte der Dicke. »Die Menschen von heute vertragen wirklich nichts mehr.«
Phönix vergrößerte seinen Abstand zum Ehrenfriedhof. Erst als er sich ganz sicher war, dass ihn niemand beobachtete, drehte er sich um und schaute sich das Schauspiel aus der Ferne an.
Sein Schauspiel! Es hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Jetzt hieß es für ihn nur noch abzuwarten, bis genau das eintrat, was er sich davon versprach. Dieses Aufgebot an Schaulustigen gab ihm neue Zuversicht.
Es dauerte nicht lange, schon hörte er Polizeisirenen. Das war sein Zeichen, endgültig von diesem Ort zu verschwinden.
Susannes Wange schmerzte. Sie spürte Schläge. Entsetzt überlegte sie, ob sie wieder Streit mit ihrem Freund Lukas Baccus hatte. Aber er schlug sie doch nicht.
Platsch, der nächste Hieb.
Oder doch?
Schon wieder ein Schlag, dieses Mal noch fester.
Tatsächlich! Sie konnte es nicht fassen. Ein Beamter bei der Kriminalpolizei, der seine Freundin schlug? Zwar hatten sie in letzter Zeit häufiger Spannungen in ihrer Beziehung, gestand sie sich ein. Doch das ging zu weit.
Sie wollte zum Gegenschlag ausholen, da wurde ihr Arm festgehalten. Jetzt wurde es ihr zu bunt. Wütend öffnete sie die Augen und wollte gerade einen Urschrei ausstoßen! Aber was war das?
Sie lag auf dem Boden und viele fremde Gesichter schauten auf sie herab – nur nicht das von Lukas. Stattdessen war ihr Dimitris Gesicht mit den schwarz-weißen Stoppelhaaren auf dem Kopf am nächsten.
»Was ist passiert? Wo bin ich?«, fragte sie. »Warum liege ich auf dem Boden?« Sie schämte sich insgeheim für ihre bösen Gedanken über ihren Freund.
»Sag nur, du kannst dich nicht erinnern?«, fragte Dimitri zurück und lachte. »Hier geht voll was ab – genau das, was Reporter brauchen und du legst dich schlafen.«
Nun fiel es Susanne wieder ein: die Leiche am Kreuz und der Gestank, der ihr in die Nase gestiegen war. Peinlich berührt von ihrem Schwächeanfall stand sie auf, schüttelte den Schmutz von ihrem Sommerkleid und tat so, als sei nichts passiert.
Die Menschen um sie herum, die eben noch besorgt um sie schienen, eilten alle mit einem Tempo davon, als sei ihre Ohnmacht ansteckend.
Sie zuckte die Schultern und fragte geschäftsmäßig: »Was haben wir?«
»Jede Menge Fotos und eine am Boden liegende ...«
»Ich will Fakten und keine Sticheleien«, fiel ihm Susanne ins Wort.
»Die Polizei ist auf dem Weg«, erklärte Dimitri nun sachlicher. »Das bedeutet, dass die uns bald wegjagen.«
»O. k. Du verschwindest sofort, damit sie deinen Fotoapparat nicht sehen können. Ich warte mal, ob Lukas dabei ist.«
»Du meinst deinen Superhelden?«
»Genau den!« Susanne rollte entnervt die Augen.
»Der hat so rote Haare, dass er wie ein Warnschild in der Sonne herumläuft. Aber so ein Warnschild habe ich nicht gesehen.«
»Das musst du mit deinem Idioten-Haarschnitt gerade sagen«, fauchte Susanne.
»Hey! Voll verliebt in unseren Superbullen!« Dimitri kreischte vor Begeisterung. Er sah, wie Susanne zu einem Tritt ausholte. Schleunigst machte er sich davon.
Sie wartete ab, wer von der Abteilung für Tötungsdelikte diesen Fall übernehmen würde. Doch als sie sah, wie die Kriminalkommissarinnen Andrea Peperding und Monika Blech zusammen mit der Tatortgruppe, der Spurensicherung, dem Gerichtsmediziner und der Staatsanwaltschaft anrückten, ahnte sie, dass sie keine Informationen bekommen würde. Mit Andrea Peperding konnte sie nicht sprechen, da ihre Spannungen von Fall zu Fall größer wurden. Und Monika Blech sprach niemals in Gegenwart ihrer Kollegin. Staatsanwalt Helmut Renske wirkte äußerst grießgrämig, während er auf den Tatort zusteuerte. Vermutlich passte es ihm nicht, an einem Sonntag zu einem Fall gerufen zu werden und dazu noch mit diesen beiden Frauen. Also konnte sie in die Redaktion zurückkehren und das aufschreiben, was sie schon wusste. Und das war schon eine ganze Menge.
Die Terrasse des Victor’s Hotels lachte Helmut Renkse schon von weitem an. Sie lag im Schatten, womit sie eine Flucht aus der heißen Sonne bot. Hinzu kam der knurrende Magen, weil er an diesem Sonntagmorgen noch nicht einmal dazu gekommen war zu frühstücken. Auf nüchternen Magen ein Mordopfer zu ertragen war anstrengend. Aber gleichzeitig mit der Polizeibeamtin Andrea Peperding konfrontiert zu werden, gehörte nicht mehr zu seiner Gehaltsklasse. Seine Laune war an diesem sonnigen Sonntag in den Keller gesunken und daran musste er etwas ändern. Sofort war sein Entschluss gefasst. Er steuerte die Terrasse an, auf der zum Glück noch ein Tisch frei war und wählte gleichzeitig Hugo Ehrlings Nummer, um ihn zu einem Kaffee einzuladen. Zufällig wusste er, dass der Kriminalrat ganz in der Nähe wohnte, nämlich Am Triller. Also hatte dieser keinen weiten Weg und somit keine Ausrede parat, die Renske akzeptieren müsste.
Kaum hatte er sich an dem freien Tisch niedergelassen, kam ein Kellner und fragte ihn, ob er am Sonntagsbrunch teilhaben wolle. Renske lief das Wasser im Mund zusammen. Er wollte noch auf seinen Gast warten, den er telefonisch erreicht hatte. Zum Glück dauerte es nicht lange, schon stand Hugo Ehrling vor seinem Tisch.
»Kann es sein, dass Sie mit Ihrer Arbeit überfordert sind?«, fragte der Kriminalrat mit sichtlich unterdrücktem Ärger.
Doch Renskes Aussicht auf einen ausgiebigen Brunch ließ jede Anspielung an ihm abperlen. Freundlich meinte er dazu: »Ich lade Sie zu einem Sonntagsbrunch ein und schlage vor, dass uns der neue Fall nicht die Laune verdirbt.«
Ehrling trug trotz der unverhofften Bitte des Staatsanwalts, sich an einem Sonntagmorgen auf der Terrasse des Victor’s Hotels im Deutsch-Französischen Garten einzufinden, einen makellos sitzenden dreiteiligen Anzug. Das ließ in Renske die Frage reifen, ob der Amtsleiter sogar zuhause in seinem privaten Umfeld diese Garderobe trägt. Dass er selbst angemessen gekleidet war, lag daran, dass er an diesem Wochenende Bereitschaftsdienst hatte und sich deshalb hatte vorbereiten können.
Ehrling gab nach, setzte sich an den Tisch und beschloss, Renskes Einladung anzunehmen. Dazu entschieden sie sich neben Kaffee auch für einen Riesling. Sie steuerten das Büffet an, das im Inneren des Hotels auf einem langen Tisch angeordnet war. Das Angebot war vielseitig und reichte von süßen Speisen, Pasteten, Terrinen und gebratenem Roastbeef mit Karotten-Orangen-Creme über Fischvariationen mit Nudelauflauf und Gemüse der Saison bis hin zum Dessertbüffet mit Süßspeisen, bei denen schon der Anblick eine hohe Kalorienanzahl und zusätzlich auch keinen geringen Alkoholanteil verriet. Renske rieb sich über seinen Bauch, der wahrhaftig keine Mastkur benötigte. Doch bei diesem Angebot konnte er nicht widerstehen. Gedanken an Diät verschob er auf später.
Wieder am Tisch angekommen sprach er endlich aus, was ihn beschäftigte: »Ich bitte Sie, die beiden Kommissare Lukas Baccus und Theo Borg wieder in den Außendienst zu schicken.«
Ehrling trank von seinem Kaffee, grinste und meinte: »Also ist diese Einladung nicht ganz so uneigennützig, wie es den Anschein haben sollte.«
Dazu erwiderte Renske nichts.
»Zu dieser Maßnahme habe ich mich aus gutem Grund entschlossen. Lukas Baccus und Theo Borg haben es nämlich geschafft, den Fokus des öffentlichen Interesses auf unsere Arbeit zu lenken und somit gleichzeitig auf die Fehler aufmerksam zu machen, die den beiden Kommissaren selbst unterlaufen sind. Dem musste ich öffentlich Einhalt gebieten, um keine personellen Einmischungen des Innenministeriums zu riskieren. Sie wissen genau, welchen Einfluss diese Behörde auf unsere Personalsituation hat.«
»Kann es sein, dass wir dem Innenministerium diese Andrea Peperding verdanken?«, hakte Renkse nach.
Ehrlings Schweigen war Antwort genug.
»Was bedeutet das für mich?«
»Dass ich Ihnen nicht den Gefallen tun kann, um den Sie mich bitten. Es sei denn, die Beamtin Peperding macht wieder einen entscheidenden Fehler. Wie wir alle wissen, bewegt sie sich auf dünnem Eis.«
Renske hob sein Weinglas und meinte grinsend: »Auf einen guten alten Spruch!«
Ehrling griff ebenfalls nach seinem Glas und hakte nach: »An welchen Spruch denken Sie?«
»Fehler sind dafür da, dass sie gemacht werden.«
»Sie sind ein Optimist!«
Darauf stießen sie an.
2
Kaum hatten Lukas Baccus und Theo Borg das Großraumbüro des Landespolizeipräsidiums Saarbrücken – wie das LKA nach der erneuten Polizeireform nun hieß – betreten, schlug ihnen große Betriebsamkeit entgegen.
Während Lukas sich verdutzt umschaute, raufte sich Theo seine schwarzen Haare, dass sie zu Berge standen. Die Hektik hatte sich sogar auf die beiden Kanarienvögel Peter und Paul übertragen, denn sie pfiffen, was ihre Schnäbel hergaben.
Lukas steuerte zielstrebig den Vogelkäfig an und fütterte die beiden Piepmätze, wodurch es sofort ruhiger wurde. Dann schaute er sich das Treiben seiner Kollegen an und meinte: »Ich glaube, wir haben was verpasst!«
Theo murmelte: »Sieht echt nach einer heißen Sache aus.«
»Gut erkannt! Ihr seid ja geistige Überflieger!« Mit diesen Worten ging der schwergewichtige Staatsanwalt an ihnen vorbei und warf ihnen die Tageszeitung auf den Tisch. »Und das schon am frühen Montagmorgen.« Er steuerte die Kriminalkommissarinnen Andrea Peperding und Monika Blech an. Seine Miene verriet schlechte Laune, was Lukas und Theo von diesem Mann nicht kannten.
Auf ihrem Schreibtisch sprangen ihnen die Großbuchstaben der Titelseite ins Auge: »Tote Frau auf dem Ehrenfriedhof sorgt für Schieflage in der Kommunalpolitik.« Das Foto zeigte ein steinernes Kreuz, an dem Blut klebte. Darunter die Initialen des Fotografen: »DiWa«. Eine Abkürzung, die Lukas verächtlich schnauben ließ. Er ahnte, wer dahinter steckte.
»Allzeit bereit«, kommentierte Lukas schnell, um sich von seinen Gedanken abzulenken. Dabei hob er die linke Hand. Theo nahm die Zeitung, um auch zu erfahren, was los war.
»Die Zeit der Pfadfinder dürfte für dich vorbei sein!« Staatsanwalt Renske gähnte.
»Bei allem Respekt«, Lukas grinste, »aber was war los?«
»Während ihr euch die hohlen Köpfe volllaufen lassen konntet, mussten wir arbeiten«, schimpfte Andrea.
»Es ist das erste Mal, dass während eurer Bereitschaft mal was passiert. Das wird doch wohl noch zu schaffen sein«, konterte Lukas gereizt.
»Du hältst dich wohl für den Held der Arbeit oder was? Dabei besteht eure einzige Leistung darin, Scheiße zu bauen.«
»Das sagt die Richtige«, gab Lukas nicht minder schroff zurück. Die Warnungen seines Kollegen Theo überhörte er beflissentlich. Andrea schaffte es jedes Mal, ihn auf die Palme zu bringen.
»Anscheinend hast du deine Flamme schon lange nicht mehr gesehen. Ist es wieder aus zwischen euch? Würde mich ja nicht wundern.«
»Das geht dich nichts an.«
»Dann kann sie ja mit diesem Fotografen rummachen – diesem Dimitri!« Andrea grinste böse.
»Besser mit dem als mit dir«, gab Lukas cool zurück, ohne sich anmerken zu lassen, dass ihn diese Bemerkung traf. Warum hatte sich Susanne nicht bei ihm gemeldet? Vor allem, nachdem sie auf einen derart heiklen Fall gestoßen war.
Renske hob die Hand und brummte dazwischen: »Keine Beleidigungen an einem Montagmorgen in aller Frühe.«
Murrend gehorchten die beiden.
Lukas ließ sich an seinem Schreibtisch nieder und begann seinen Rechner hochzufahren.
»Was ist denn mit dir los?«, fragte Theo seinen Kollegen. »So schnell auf Konfrontationskurs – das kann uns doch nur schaden.« »Mag sein«, gab Lukas nach. »Es stinkt mir halt, dass wir seit Ewigkeiten nur Schreibkram machen dürfen, während die anderen die interessantesten Fälle bekommen.«
»Seit wir hier sitzen, war außer diesem Fall nichts Interessantes dabei«, stellte Theo klar. »Aber ich gebe dir Recht. Es ist höchste Zeit, dass wir wieder in den Außendienst dürfen. Was meinst du, wann der Kriminalrat uns endlich wieder lässt?« Damit stellte er die Frage, die beiden auf der Seele brannte.
»Keine Ahnung«, gestand Lukas. »Vielleicht, wenn wir damit aufhören, so gute Berichte abzugeben.«
Als hätten Peter und Paul Lukas’ Worte verstanden, pfiffen sie zustimmend dazwischen.
»Dein Ego möchte ich mal haben«, erwiderte Theo und warf den Vögeln einen bösen Blick zu. Dann widmete er sich der Akte, die auf seinem Tisch lag. »Hier ist die Selbstmord-Akte Vanessa Hartmann, die wir abschließen müssen.«
»Mach mal! Ich hole mir zuerst einen Kaffee!«
»Nichts da! Das machen wir zusammen«, protestierte Theo. »Ich bin nicht allein dafür verantwortlich, dass wir in diesem Dilemma stecken.«
»Schon gut! Ich komme ja wieder.« Schon hatte Lukas das lärmende Büro verlassen und steuerte den neuen, großen Kaffeeautomaten im Flur an.
Dort stand jemand davor und wartete darauf, dass sich sein Becher mit dem Gewünschten füllte. Dieser Jemand war genau der, den Lukas jetzt nicht antreffen wollte. Unauffällig versuchte er, sich umzudrehen und zu Theo zurückzukehren, doch es war zu spät. Kriminalrat Hugo Ehrling hatte ihn gesehen.
»Es fällt mir wirklich schwer, in Ihrem Fall die richtige Entscheidung zu treffen«, sagte er frostig.
Lukas schaute den Vorgesetzten wortlos an. Was hätte er auch erwidern können? Sollte dieser Luchs sein Streitgespräch mit Andrea tatsächlich gehört haben?
»Ich werde Sie und Ihren Partner Theo Borg noch eine Weile beobachten. Daran sollten Sie immer denken – was ich jedoch bezweifle.«
Lukas schluckte.
»Die Zeit im Büro können Sie dafür nutzen herauszufinden, wer die Tote ist, die gestern im Deutsch-Französischen Garten gefunden wurde. Sie hatte nämlich keine persönlichen Sachen dabei – weder Ausweis, noch Führerschein.«
Daraufhin verschwand er.
Lukas schaute sich in dem langen Flur um und stellte fest, dass er ganz allein war. Das ließ ihn hoffen, dass niemand dieses unschöne Gespräch belauscht hatte. Ehrlings Worte machten ihm klar, dass er tatsächlich auf seinen Streit mit Andrea angespielt hatte. Ab sofort musste er sich beherrschen, wenn er nicht seinen Job riskieren wollte. Er war gern bei der Kriminalpolizei. Ebenso Theo. Das waren schon zwei wichtige Gründe, einfach mal die Klappe zu halten – egal wie schwer ihm das manchmal fiel.
Mit diesen Gedanken kehrte er zurück ins Großraumbüro, wo die Hektik weiter zugenommen hatte. Inzwischen war auch Dienststellenleiter Allensbacher eingetroffen und nahm mit seiner Körperfülle den meisten Platz in dem Büro ein.
Lukas ließ sich auf seinen Stuhl sinken, als er Theo fragen hörte: »Hast du vergessen, warum du an den Kaffeeautomaten gegangen bist?«
Verdutzt schaute sich Lukas um und stellte erst jetzt fest, dass er tatsächlich keinen Kaffee mitgebracht hatte.
Mit schnaufender Stimme sagte Wendalinus Allensbacher: »Der Gerichtsmediziner hat mich angerufen und gefragt, warum noch niemand zur Obduktion bei ihm eingetroffen sei.« Seine zusammengekniffenen Augen auf Andrea Peperding gerichtet fügte er an: »Erklären Sie mir bitte, warum Dr. Stemm mich mit dieser Frage behelligt, wenn Sie genau wissen, dass es Ihre Aufgabe ist, dieser Autopsie beizuwohnen!«
Andrea wurde blass. Mit leiser Stimme antwortete sie: »Es hätte doch sein können, dass ein Kollege diese Aufgabe übernimmt.« Im Augenwinkel nahm sie Lukas’ Grinsen wahr.
»Wenn Sie an Baccus oder Borg denken, muss ich Sie enttäuschen. Sie sind für diesen Fall eingeteilt, also übernehmen Sie auch die Gerichtsmedizin.«
Monika sah, welche Mühe es Lukas kostete, sein Lachen zu unterdrücken. Rasch stellte sie sich hinter Andrea und trieb sie an, schneller zu gehen, damit sie keine Zeit bekam, eine unnötige Bemerkung zu machen. Die Zusammenarbeit mit Andrea war für Monika eine große Herausforderung, weil sie nicht zusammenpassten. Während Monika sich gerne beruflich verbessern würde, trampelte Andrea in jedes Fettnäpfchen, das zu finden war. Leider lautete die Devise bei Partnern: Mit gegangen – mit gehangen. Also konnte sich Monika entscheiden, entweder diese Abteilung zu verlassen oder die Launen ihrer Partnerin zu erdulden. In diesem Augenblick wusste sie noch nicht, welchen Weg sie wählen sollte. Der Fall der toten Frau auf dem Ehrenfriedhof weckte ihre Neugierde und trieb sie an, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das war es, was diese Arbeit für sie ausmachte und gleichzeitig ihre Entscheidung erschwerte.
Während der Fahrt nach Homburg zur Gerichtsmedizin sprachen sie kein Wort. Was gäbe es auch zu sagen. Andrea hatte mal wieder etwas verbockt. Warum wurden die Aufgaben nicht auf Monika übertragen? Sie würde Dr. Stemm bestimmt nicht warten lassen. Im Gegenteil! Vermutlich würde sie schon vor ihm in dem gekachelten Raum stehen und auf den Gerichtsmediziner warten. Aber damit wäre der Dienstweg nicht eingehalten, weil Andrea schon länger in dieser Abteilung arbeitete. Monika war immer noch das Küken.
Sie erreichten das Unigelände, passierten das Schrankenhäuschen und steuerten im Schritttempo das Gebäude der Gerichtsmedizin an.
Dr. Stemm erwartete sie schon.
Seine massige Statur ließ den Raum klein wirken. Der Anblick der toten Frau hinter ihm auf dem Stahltisch schnürte Monika die Kehle zu. Die Tote war gewaschen worden, wodurch viele Schnitte über den ganzen Körper verteilt zu erkennen waren. Anstelle des Ypsilon-Schnitts war ein T-Schnitt zu erkennen. Der Gerichtsmediziner hatte mit seiner Arbeit bereits begonnen. Aber das Gesicht war noch unversehrt. Also war er noch nicht bis zum Gehirn vorgedrungen, ein Aspekt der Autopsie, der Monika jedes Mal zusetzte. Aber heute wollte sie standhaft sein.
»Ich sehe, dass Sie bereits erkannt haben, welche delikate Untersuchung ich extra für Sie aufgehoben habe«, erklärte Dr. Stemm in süffisantem Ton. Seine laute Stimme tat Monika in den Ohren weh – ebenso das, was er sagte.
»Das wäre wirklich nicht nötig gewesen«, meinte sie nur.
Doch Andrea polterte unfreundlich: »Sie haben wohl Spaß daran, sich den Sektionsraum vollkotzen zu lassen.«
»Oh nein, liebe Frau Peperding«, erwiderte Dr. Stemm »Ich habe Spaß daran, Sie mal zum Schweigen zu bringen.«
Andrea öffnete den Mund, um etwas zu entgegnen. Doch als sie sah, wie Dr. Stemm die Stirnhaut entlang des Haaransatzes und den Augenbrauen aufschlitzte und sie ablöste, blieben ihr die Worte im Hals stecken. Danach zog er die Kopfschwarte ab und die Hirnschale kam zum Vorschein. Mit einer laut sirrenden Oszilliersäge öffnete er den Schädel und legte das Innere frei.
Monika besah sich die Röntgenaufnahmen an den Wänden, bis das Geräusch aufhörte. Doch, was dann kam, machte es noch schlimmer. Dr. Stemm entfernte gerade das Gehirn und legte es in eine Schale neben dem Seziertisch.