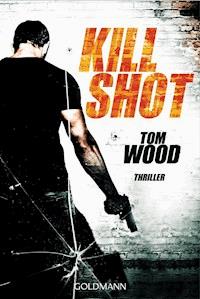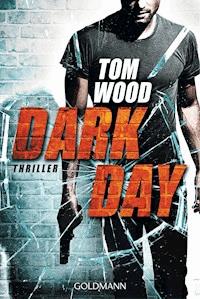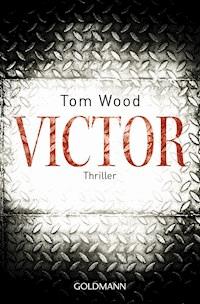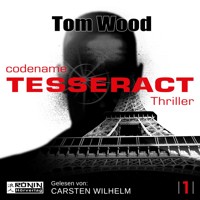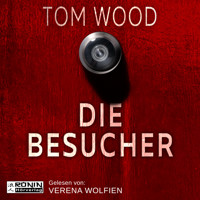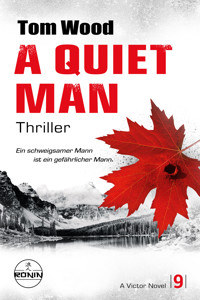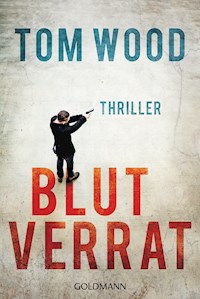
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Victor
- Sprache: Deutsch
• »Ein Wahnsinns-Thriller mit sagenhafter Energie!« Gregg Hurwitz (Autor des Bestsellers »Orphan X«)
Sie sind Schwestern, und sie bekämpfen einander mit allen Mitteln. Denn beide wollen sich das Imperium ihres verstorbenen Vaters sichern, eines Drogenbosses in Guatemala City. Der blutige Streit dauert bereits Jahre, und die amerikanische Drug Enforcement Administration versucht von heimischem Territorium aus vergebens, den Drogenkrieg zu beenden. Die Fehde fordert immer neue Todesopfer, zudem hat sich nun eine der Schwestern eine ganz besondere Waffe in diesem Kampf gesichert: Victor. Während Verrat und Intrigen innerhalb der Familie immer weitere Kreise ziehen, gerät Victor ins Zentrum eines Sturms, den er nicht stoppen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Victor ist der Auftragskiller, der immer liefert – sofern der Preis stimmt. Und Heloise Espinosa, Kopf des größten Drogenkartells in Guatemala, ist bereit, ihn zu bezahlen. Victor soll Heloises größte Konkurrentin aus dem Weg räumen: ihre eigene Schwester. Schon seit Jahren fordert die blutige Fehde der beiden immer neue Opfer, nun soll Victor über den Sieg entscheiden. Kein allzu schwerer Auftrag, wäre da nicht ein Problem. Victor ist nämlich nicht der Einzige, der Maria im Visier hat. Auf dem Territorium des Kartells nähern sich die Feinde von allen Seiten, und Victor muss sich entscheiden, welchen Weg seine Kugel nehmen soll, bevor ihm selbst jemand eine in den Kopf jagt. Seine einzige Chance besteht darin, sich mit jemandem zusammenzuschließen, der genauso tödlich sein könnte, wie er es ist.
Weitere Informationen zu Tom Wood sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Tom Wood
Blutverrat
Thriller
Aus dem Englischen von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Kill for Me« bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2019 Copyright © der Originalausgabe 2018 by Tom Hinshelwood Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagfoto: Riss: FinePic®, München; Mann mit Waffe und Steinboden: plainpicture/Stephen Carroll Redaktion: Gerhard Seidl AB · Herstellung: ik Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-21461-6V001 www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Ionica
Kapitel 1
Im Halbkreis schmiegte sich der weiße Sandstrand um die Bucht. Dunkle Wellen schwappten ans Ufer, wo verwilderte Hunde nach verwertbaren Hinterlassenschaften irgendwelcher Rucksacktouristen suchten. Am hinteren Ende des Strands rannten zwei Wildpferde hin und her. Es wirkte wie eine Art Ritual, dessen Sinn Victor nicht einmal ansatzweise erfasste.
Der Verkäufer, den er hier treffen sollte, nannte sich Jairo. Er war ziemlich alt und braun gebrannt, nicht groß, aber dafür sehr stark behaart. Sein buschiger weißer Bart reichte bis hinauf zu den Wangenknochen. Das weit geöffnete Hemd gab den Blick auf sein dichtes, nahezu farbloses Brusthaar frei. Goldene Halsketten blitzten unter dem lockigen Bewuchs. Seine Augenbrauen waren noch nicht ergraut, sondern schwarz und berührten sich fast in der Mitte. Er roch nach Rum oder nach dem einheimischen Aguardiente – Victor war noch nicht lange genug in Guatemala, um den Unterschied nur am Geruch zu erkennen.
Die Sonne schickte ihre letzten Strahlen über den Horizont, aber die drückende Hitze des Tages blieb unverändert. Der Ostwind, der irgendwie warm und kühlend zugleich über das Karibische Meer wehte, sorgte dafür, dass Victors leichte, locker sitzende Kleidung sich eng an seine Haut schmiegte.
Jairo stammte von jenseits der Grenze, aus Honduras, und war gekleidet wie ein Landstreicher. Sein Hemd war voller Fettflecken – offensichtlich hatte er sich seit Tagen regelmäßig mit Essen bekleckert. Die fadenscheinige, kurze Jeans reichte ihm bis zu den Knien, und die Beine, die daraus hervorragten, wirkten schmal und schwächlich. Seine Füße steckten in Gummisandalen, sodass die rissige Haut an seinen Fersen deutlich zu sehen war. Die Tätowierungen auf seinen sonnenverbrannten Unterarmen waren so alt und verblasst, dass Victor nicht erkennen konnte, was sie darstellen sollten.
Dieser Mann war kein international tätiger Waffenhändler. Er war kein Vladimir Kasakov, ja nicht einmal ein Georg. Er war nur ein kleiner Schmuggler im Besitz eines sehr wertvollen Gewehrs. Wie diese Waffe in seine Hände gelangt war, darüber hatte Georg Victor keine Auskunft gegeben, und auch Jairo hatte sich nicht dazu geäußert. Er hatte sie Victor nicht einmal zeigen wollen, ohne sich vorher zu vergewissern, dass dieser das Geld mitgebracht hatte.
»Zuerst will ich wissen, ob das Gewehr in einem guten Zustand ist«, hatte Victor gesagt. »Und dann bekommst du das Geld zu sehen.«
Jairo schüttelte den Kopf. »So läuft das nicht.«
Sie unterhielten sich auf Englisch, weil Victor nicht preisgeben wollte, dass sein Spanisch ebenso gut war wie Jairos. Sogar besser.
»Es läuft genau so, wie ich es sage, oder wir blasen die ganze Sache ab.«
Jairo blieb stumm. Er warf einen Blick zu den Wildpferden hinüber.
»Vergiss nicht, dass du das Gewehr unbedingt loswerden willst. Ich kann jederzeit wieder gehen und mein Geld mitnehmen, aber du? Du stehst dann mit einer Waffe da, mit der du nichts anfangen kannst.«
Jairo überlegte. Er blinzelte zwar kaum, rieb aber mit dem Daumen der einen Hand immer wieder über die andere Handfläche. Dann meinte er achselzuckend: »Meinetwegen, schau sie dir an.«
Er war die ganze Zeit über nervös, war ständig in Bewegung, voller Unruhe. Wenn er nicht von einem Bein auf das andere trat, rieb er die Handflächen aneinander. Wenn er nicht gerade die Schultern rollte, kratzte er sich im Nacken. Victor registrierte jedes einzelne verräterische Zeichen und benahm sich so, als hätte er keines davon bemerkt, als würde er nichts verstehen. Er wollte Zeit gewinnen. Er wollte sich ein Bild verschaffen.
Die Accuracy International AX-50 war ein massives, hoch entwickeltes Präzisionsgewehr, ein Meisterwerk der Waffentechnik. Sie wurde in einem Koffer aus extra gehärtetem, für militärische Zwecke entwickeltem Kunststoff geliefert, der groß genug war, um darin einen Menschen unterzubringen – zerteilt zwar, aber absolut möglich. Victor hatte schon kleinere Behältnisse zum Leichentransport benutzt. Im Inneren des Koffers lag die in ihre Einzelteile zerlegte Waffe, fein säuberlich sortiert und umhüllt von dickem Schaumstoff. Victor unterzog jedes Teil einer sorgfältigen Betrachtung und stellte, wie erwartet, fest, dass alles in einem einwandfreien Zustand war. Auch das Zubehör, das in einem Extrafach lagerte, war nicht zu beanstanden. Alles sah gut aus. Zu gut.
Er behielt seine Gedanken vorerst für sich, weil er immer noch dabei war, die Situation einzuschätzen. Jairo wurde von Minute zu Minute nervöser, weil er Victors Augen, die vom Schirm seiner Kakimütze verdeckt wurden, und dessen Gesichtsausdruck im Dämmerlicht nicht erkennen konnte.
»Was hältst du davon?«, erkundigte sich Jairo, als er die Stille nicht mehr länger ertrug. »Gefällt es dir?«
»Es ist wunderschön«, erwiderte Victor.
Jairo stocherte etwas zwischen den Zähnen hervor. »Willst du es kaufen?«
Victor nahm den Blick nicht von dem Gewehr. »Wie viel willst du dafür haben?«
»Hunderttausend. Das ist der vereinbarte Preis. Hast du das Geld dabei? Willst du es kaufen?«
Der Ladenpreis für so eine Waffe betrug nur einen Bruchteil der genannten Summe, selbst mit all dem Zubehör, aber der Schwarzmarktpreis lag natürlich erheblich höher. Dazu kam noch Jairos persönliche Provision. Bei einer solchen Waffe saß der Verkäufer am längeren Hebel. Er diktierte den Preis. Wenn Victor nicht bereit war, die geforderte Summe zu bezahlen, dann würde er nie bekommen, was er brauchte. Was immer er zuvor gesagt hatte, für ihn war diese Waffe sehr viel wichtiger, als sie dies für Jairo je sein konnte.
Er rieb sich das Waffenöl von den Fingerspitzen. »Woher hast du sie?«
Jairo zuckte mit den Schultern und trat von einem Bein auf das andere. »Welche Rolle spielt das schon? Ich frage dich ja auch nicht, woher du das Geld hast. Du hast es doch dabei, oder? In deinem Wagen?«
Victor nickte.
Er hatte den Pick-up am Ende der Düne auf den ersten längeren Grashalmen abgestellt. Jairos Wagen – ebenfalls ein Pick-up – stand mitten auf dem Strand, von Weitem sichtbar, wie abgemacht. Victor war deutlich vor der vereinbarten Zeit erschienen, aber Jairo war bereits da gewesen. Er hatte getrunken. Feuchter Schweiß glitzerte auf seiner Haut, und sein Blick war leicht glasig.
»Zeig’s mir.«
Victor klappte den Koffer zu und ließ die Schnallen einrasten, dann hob er ihn von der Ladefläche des Pick-ups. Das Ding war ziemlich schwer. Allein das Gewehr, ohne das Zubehör, wog rund zwölf Kilogramm. Er nahm den Koffer in die linke Hand und machte sich auf den Weg zu seinem Wagen. Jairo hing etwas zurück, zum Teil, weil er kurze Beine hatte, zum Teil, weil sein Schuhwerk in dem losen Sand eher hinderlich war, und zum Teil, weil er sehr nervös war.
»Hundert Riesen sind viel Geld«, sagte Victor, während er einen Fuß vor den anderen setzte. »Selbst für so eine Waffe. Schwarzmarkt ist Schwarzmarkt, das ist mir schon klar, aber das Gewehr hier ist nagelneu. An den Einzelteilen klebt noch das Industriefett. Irgendjemand hat zwar versucht, es abzuwischen, aber das ist nicht so einfach. Man muss die Waffe erst benutzen. Man muss sie zusammenbauen, damit schießen und sie anschließend wieder auseinandernehmen, putzen und ölen. Erst dann wird man das Industriefett los. Trotzdem, kein schlechter Versuch.«
Jairo tat, als sei er verwirrt. »Was spielt das schon für eine Rolle? Ein fabrikneues Gewehr ist doch ein gutes Geschäft.«
»Darauf will ich ja hinaus. Der Preis ist zu gut für ein nagelneues Gewehr. Es ist noch originalverpackt. Also, wo hast du es her?«
Jairo erwiderte achselzuckend: »Die Waffe gehört mir nicht. Ich bin nur der Verkäufer.«
Es wurde jetzt schnell dunkel, und der blaue Pick-up, den Victor bar bezahlt hatte, wirkte beinahe schwarz. Er legte den schweren Koffer auf die Ladefläche und zog eine Sporttasche unter einer Plane hervor. Die drückte er Jairo in die Hand, nahm sich eine Packung Trockenfleisch aus einer Verpflegungskiste und riss sie auf.
»Möchtest du auch was?«, fragte er Jairo.
Jairo hob den Blick. »Sieht ja widerlich aus.«
Victor kaute und zuckte mit den Schultern. Dann blieb eben mehr für ihn übrig.
Jairo hatte keinen Appetit. Er ließ keine Sekunde länger verstreichen, sondern riss die Sporttasche auf und spähte hinein. Als er die Dollarbündel sah, zeigte sich ein Lächeln auf seinem Gesicht.
»Weißt du«, sagte Victor, nachdem er seinen Bissen hinuntergeschluckt hatte, »zuerst habe ich mich gefragt, ob du vielleicht nur ein Köder bist. Ein verdeckter Ermittler. Das ist immer das größte Risiko bei so einem Deal. Ich habe befürchtet, dass irgendwelche Bullen sich hinter den Dünen auf die Lauer gelegt haben, mich mit Kameras und Ferngläsern beobachten und losstürmen, sobald ich dir das Geld gezeigt habe. Weil ich bis dahin ja gar nichts Verbotenes gemacht hätte. Ich habe also sehr sorgfältig abgewogen, habe überlegt, ob sie gute Fotos von mir bekommen haben und welche Konsequenzen ich womöglich irgendwann später befürchten muss. Ich meine, dass ich nichts Verbotenes gemacht habe, bedeutet ja nicht, dass es keine negativen Folgen haben kann. Jemand wie ich kann sich keine unnötige Aufmerksamkeit erlauben.«
Jairo hörte nur mit halbem Ohr zu. Irgendetwas an der Tasche war ihm aufgefallen. Er griff hinein.
»Du warst die ganze Zeit so nervös«, fuhr Victor fort. »Ich dachte, sie haben dich wegen irgendetwas in der Hand und zwingen dich, deinen Käufer preiszugeben. Also mich. Aber dann habe ich das Industriefett gesehen. Bei einem offiziellen Polizeieinsatz würde niemals so eine nagelneue Waffe benutzt werden. Keine Behörde könnte ein Exemplar wie dieses da in die Finger bekommen, auch nicht, um eine schäbige Existenz wie mich aus der Deckung zu locken. Die Ermittler müssten etwas aus der Asservatenkammer holen, was sie selbst beschlagnahmt haben. Darum war mir klar, dass hier irgendetwas anderes läuft. Ich habe nachgedacht. Die einfachste Erklärung ist in der Regel die richtige.«
Jairo steckte seine Hand tief in die Tasche und holte ein dickes Geldscheinbündel heraus. Dem Anschein nach handelte es sich um Hundert-Dollar-Scheine, jeweils hundert pro Bündel. Jairo klappte den ersten Geldschein um und stellte fest, dass darunter lediglich rechteckige, leere Papierstücke lagen.
»Nein, nein, nein«, murmelte Jairo.
»Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich hundert Riesen in bar mitbringe, um mitten im Niemandsland ein Gewehr zu kaufen, oder? Das ist der sicherste Weg, um zu sterben.«
»Das war ein großer Fehler.«
Victor erwiderte: »Ich habe in meinem Leben schon so viele Fehler begangen, da kommt es auf den einen auch nicht mehr an.«
»Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast.«
Victors Stimme klang schwermütig. »Wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, Jairo, dann könnten wir uns eine Menge unvermeidlicher Unannehmlichkeiten ersparen.«
Kapitel 2
Von der Sonne war inzwischen kaum mehr als eine schmale rote Linie am Horizont zu sehen. Die Pferde hatten sich mit Einbruch der Dämmerung zurückgezogen, nur die verwilderten Hunde schlichen immer noch suchend über den Strand. Sie hatten keine Angst vor der Dunkelheit, waren hungrig und entschlossen. Auch in den Wellen spiegelte sich kein Restlicht mehr, auch sie waren nur noch schwarz, genau wie die hereinbrechende Nacht.
»Wo ist das restliche Geld?«, stieß Jairo hastig und verzweifelt hervor. »In deinem Pick-up? In der Nähe irgendwo? Ich kann es nur hoffen, für dich genauso wie für mich.«
Victor zuckte mit den Schultern, so wie es Jairo auch schon mehrfach getan hatte.
»Du hast es nicht?« Jairo starrte ihn mit offenem Mund an. »Das war nicht abgemacht. Ich sollte dir das Gewehr bringen und von dir das Geld bekommen. Du weißt nicht, was du da getan hast!«
»Das Gewehr ist aber nicht das Einzige, was du mitgebracht hast, nicht wahr?«
Jairo blieb stumm.
»Die einfachste Erklärung ist in der Regel die richtige«, wiederholte Victor. »Und das hier ist eine Falle. Ein ganz simpler Raubüberfall.«
»Das war nicht meine Idee.«
»Bitte nimm es mir nicht übel, Jairo, aber das war von vornherein klar. Wenn ich geglaubt hätte, dass du hinter diesem ganzen Plan steckst, dann hätte ich mir nicht solche Mühe gegeben. Ich hätte dich im Vorbeigehen getötet und mein Leben weitergelebt, mit einem Präzisionsgewehr auf der Ladefläche und hundert Riesen für ein, zwei Partien Blackjack in der Tasche.«
Jairo starrte ihn an.
»Das war nur ein Scherz – ein halber wenigstens –, aber weißt du, was wirklich witzig ist? Jetzt, wo du weißt, dass ich Bescheid weiß, bist du längst nicht mehr so nervös wie vorhin. Woran liegt das? Wer soll die Beute bekommen?«
Victor musste ständig damit rechnen, dass seine Geschäftspartner plötzlich ein noch besseres Geschäft witterten. Betrogen zu werden kam daher nie überraschend. Er besaß lediglich einige wenige Bekannte, und die nahm er nur selten in Anspruch. Um seine Arbeit zu machen und gleichzeitig am Leben zu bleiben, musste er sich immer wieder neuer Lieferanten bedienen. Ein Anbieter, der, so wie er, im Untergrund der menschlichen Gesellschaft tätig war, war per Definition nicht vertrauenswürdig. Manche waren sogar noch unzuverlässiger als Victor.
»Marxisten«, stieß Jairo jetzt als Erklärung hervor und schüttelte dabei den Kopf. »Das sind Irre. Sie nennen sich die Armee der Armen.«
»Diese Guerillagruppe aus Honduras? Die haben sich doch schon vor Jahrzehnten aufgelöst.«
»Aber das heißt nicht, dass es nicht noch welche gibt, die das nicht akzeptieren wollen und einen neuen Krieg, eine neue Revolution anzetteln wollen. Wie gesagt: Das sind Irre.«
Jetzt war Victor klar, woher sie diese Waffe hatten. Sie war Teil einer größeren Lieferung gewesen, die irgendwann einmal gestohlen, erbeutet, vielleicht auch gespendet worden war. Anschließend hatte die Ware im Dschungel gewartet, versteckt, unangetastet, bis der Zeitpunkt gekommen war, sie zu aktivieren. Bis die Gruppe genügend Leute, genügend Waffen beisammenhatte, um sich zu offenbaren und ihre sinnlosen Ziele zu verfolgen.
»Sie sammeln Geld«, sagte Victor. »Für den Kampf.«
Jairo nickte. Dann griff er nach einem der Papierbündel und blätterte es mit dem Daumen durch, als hätte er sich getäuscht, als seien die leeren Blätter jetzt wie von Zauberhand zu Dollars geworden, als hätte die Zwickmühle, in die er sich manövriert hatte, sich in Luft aufgelöst.
»Du machst das nicht zum ersten Mal«, fuhr Victor fort. »Du warst zwar sehr nervös, aber davon abgesehen hast du alles richtig gemacht. Du bist also in Übung. Wie oft hat der Trick schon funktioniert?«
Jairo zögerte. »Du bist der Fünfte, den sie auf diese Weise ausrauben werden.«
»Wieso warst du dann immer noch so nervös? Du müsstest doch mittlerweile ein alter Hase sein. Mein fünfter Job war der reinste Spaziergang. Im übertragenen Sinn, aber auch ganz konkret. Im Gorki-Park, falls es dich interessiert.«
»Ich will das alles nicht. Ich will da nicht mitmachen«, sagte Jairo. »Ich hasse diese Leute. Aber ich habe keine Wahl.«
»Man hat immer eine Wahl«, erwiderte Victor, und dann begriff er. »Ach so … du hattest nicht etwa Angst davor, dass es schiefgehen könnte, dass ich etwas merken könnte. Du hast Angst vor dem, was passiert, wenn alles geklappt hat. Das erträgst du nicht. Darum hast du auch getrunken, habe ich recht?«
Jairo blieb stumm. Er konnte Victor nicht in die Augen sehen.
Einer der verwilderten Hunde bellte ein paar Möwen an, die ihm eines der dürftigen Häppchen stibitzen wollten, die er am Strand aufgetrieben hatte. Immer wieder stürzten sich die Vögel überfallartig vom Himmel, nur um aufs Neue von dem Hund verjagt zu werden.
»Sie werden mich nicht einfach nur ausrauben, Jairo, nicht wahr? Sie werden mich töten. Darum hat es schon viermal funktioniert: Weil niemand da war, der das Verbrechen hätte anzeigen können.«
»Ich …«
»Gib dir keine Mühe. Ich will deine Ausreden nicht hören. Aber ich möchte wissen, was sie genau vorhaben. Ich habe in der Nähe niemanden gesehen, also müssen sie ein ganzes Stück entfernt sein.« Er blickte sich um. »Lass mich raten: Ich gebe dir das Geld – und du gibst mir das Gewehr. Ich glaube, dass alles in Ordnung ist, und fahre los. Ich bin erleichtert und nicht mehr so wachsam, und dann, sobald ich den Strand verlassen habe, lande ich in einem Hinterhalt. Kommt das einigermaßen hin?«
Jairo blieb nur ein Nicken.
»Gefällt mir«, sagte Victor. »Wer immer sich das ausgedacht hat, er kennt sich aus mit solchen Dingen. Solange man die Hände am Steuer hat, ist man ziemlich eingeschränkt. Deswegen fahre ich so ungern Auto. Du wirst schon wieder nervös, Jairo. Beruhige dich, ich werde dich nicht töten.«
Jairo war verwirrt.
»Unter einer Bedingung«, fuhr Victor fort. »Nachdem ich deine Freunde getötet habe, hilfst du mir, das ganze Chaos in Ordnung zu bringen. Und damit meine ich nicht nur die Beseitigung der Leichen, sondern auch die vielen anderen Konsequenzen, die sich nicht vermeiden lassen werden. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen und kann keine unnötige Aufmerksamkeit gebrauchen. Das, was ich zu erledigen habe, ist auch so schon schwierig genug.«
»Ich verstehe nicht.«
»Das ist auch nicht nötig. Du musst lediglich wissen, dass mein Angebot absolut ehrlich gemeint ist. Ich folge eigentlich keinen Regeln, Jairo. Es gibt nicht vieles, was ich noch nicht getan habe, und noch weniger, wozu ich nicht bereit wäre. Falls es irgendwo auf dieser Welt einen schlechteren Menschen gibt als mich, dann habe ich ihn bis jetzt noch nicht kennengelernt, und ich habe viele schlechte Menschen kennengelernt, das kannst du mir glauben. Aber wenn jemand offen und ehrlich zu mir ist, dann bin ich im Normalfall auch offen und ehrlich zu ihm. Leben und leben lassen, so könnte mein Motto lauten, aber im Angesicht meiner beruflichen Tätigkeit wäre das wohl ein wenig zu zynisch. Sagen wir einfach, dass ich mich grundsätzlich an Abmachungen halte, auch wenn ich nicht automatisch davon ausgehe, dass die Gegenseite das ebenfalls tut. Allerdings hat jeder, der mich hintergeht, das Schlimmste zu befürchten. Was ich damit sagen möchte: Wer mich in Frieden lässt, den lasse ich auch in Frieden. Man könnte sagen, dass ich grundsätzlich versuche, mein Wort zu halten, aber darüber hinaus bin ich ein sehr schlechter Mensch. Wenn ich es nicht ehrlich meinen würde, dann würde ich so etwas sagen wie: ›Ich werde dich jetzt nicht töten‹ oder ›Ich helfe dir, aus dieser Zwickmühle herauszukommen‹. So könnte ich mein Wort halten und dich trotzdem später irgendwann umbringen. Das mag kindisch sein, aber wer will schon erwachsen werden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Trotzdem: Ich biete dir hiermit die einmalige Chance, deine jämmerliche Existenz fortzusetzen. Du musst dazu nichts weiter tun, als dich auf die Seite des Siegers zu schlagen. Nun? Bist du dazu bereit?«
Jairo wirkte jetzt noch verwirrter als zuvor. »Aber sie haben Gewehre.«
»Das ist eine schockierende Neuigkeit«, erwiderte Victor. »Offensichtlich ist es mir nicht gelungen, dich zu überzeugen. Das verstehe ich, denn schließlich kennst du mich noch nicht. Ich gebe dir also die Gelegenheit, noch ein wenig darüber nachzudenken. Es reicht, wenn du mir deine Antwort in wenigen Minuten gibst.«
»Du bist genauso irre wie sie.«
Victor nickte. »Noch irrer, das versichere ich dir. Aber genug geredet. Spielen wir das Spiel zunächst einmal mit, einverstanden?« Er band den Koffer auf der Ladefläche seines Pick-ups fest und reichte Jairo die Hand. »Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen.«
Jairo starrte Victors ausgestreckte Hand an.
»Nun gib dir doch wenigstens ein bisschen Mühe. Komm, spiel mit.«
Eine gebräunte Hand ergriff Victors und schüttelte sie. Jairos Griff war schlapp, und er schüttelte den Kopf, noch bevor Victor wieder losgelassen hatte. »Ach so. Sie wissen schon Bescheid.«
Er musterte Jairo – das offene Hemd, die weiten Shorts, die Tattoos und die Brustbehaarung, die Sandalen und die behaarten Beine. Nirgendwo wäre Platz für ein Aufnahmegerät gewesen.
»Nachdem du in die Tasche geschaut hast, solltest du ihnen ein Signal geben«, sagte Victor. »Aber das hast du nicht gemacht. Darum wissen sie, dass ich kein Geld dabeihabe. Sie sind hier.«
Jairo gab keine Antwort, aber das war auch nicht notwendig. Von den Dünen her, hinter den hohen Gräsern, ertönte ein lautes Rascheln, und dann waren mehrere mit Gewehren bewaffnete Gestalten zu erkennen.
Kapitel 3
Sie sahen genau so aus, wie Victor sie sich vorgestellt hatte. Sie trugen Tarnfarben, als wären sie richtige Soldaten, aber die Sachen wollten nicht so richtig zusammenpassen – olivgrün und waldfarben, US-Army-Jacken und kolumbianische Kakihosen, der Versuch einer Uniform, die jedoch im Detail erhebliche Mängel aufwies. Sie trugen Dschungelstiefel oder Wanderschuhe und dazu unterschiedliche Kopfbedeckungen: Mützen, Kappen, Schals. Sie waren insgesamt zu sechst, und jeder hatte eine israelische Galil oder eine belgische FAL in der Hand – billige Sturmgewehre und keines davon jünger als Victor. Aber sie sahen sauber und gepflegt aus, und das war immer noch das Wichtigste. Egal, wie unpassend ihre Kleidung sein mochte oder wie alt die Waffen waren, diese Typen besaßen zumindest eine gewisse Kompetenz. Es waren Amateure, aber keine Stümper.
Ihre Ankunft schreckte die verwilderten Hunde so sehr auf, dass sie sich verzogen und den Rest ihrer Beute den Möwen überließen. Beharrlichkeit siegt.
Die Anführerin der sechs war auf den ersten Blick zu erkennen. Sie ging – stolzierte – vor den anderen her, das Gesicht zu einer wütenden Fratze verzogen. Sie sah noch ziemlich jung aus, genau wie ihre Männer. Keiner von ihnen war älter als fünfundzwanzig Jahre, einer sogar noch ein Teenager. Sie waren eine Gruppe von Idealisten, die zu Extremisten geworden waren, was nach Victors Erfahrung kein langer Weg war. Einige wenige Schritte genügten. Er hatte schon mehr als genug Extremisten getötet, um das zu wissen.
Sie kam mit selbstbewussten Schritten und unbeugsamer Haltung näher, das Gesicht mit Tarnfarben beschmiert. Kurze, glatte Haare. Ein Fernglas hing an einem Lederband um ihren Hals. Im Gegensatz zu ihren Männern hielt sie kein Gewehr in der Hand, sondern hatte sich ein Pistolenhalfter um den linken Oberschenkel geschnallt. Jetzt zog sie mit der linken Hand die Pistole und richtete sie auf Victor, ließ die Waffe jedoch gesichert. Noch drohte ihm keine unmittelbare Gefahr. Sie wollten schließlich das Geld haben, und dazu brauchten sie ihn lebend.
Die Kommandeurin blieb stehen, nahe genug, aber nicht zu nahe. Victor hob die Hände.
»Nicht schießen«, sagte er monoton.
»Wo ist deine Waffe?«, fauchte sie.
Mit langsamen, deutlich sichtbaren Bewegungen hob Victor einen Hemdzipfel hoch und gab den Blick auf die Glock in seinem Hosenbund frei. Er hatte sie in den Gassen von Guatemala-Stadt gekauft, wo Handfeuerwaffen billig und jederzeit verfügbar waren.
»Weg damit«, befahl sie.
Victor gehorchte. Es war eine gute Pistole, aber für ein Sechs-gegen-Eins-Feuergefecht ungeeignet. Er schleuderte sie in Richtung Dünen, und zwar hoch in die Luft, sodass sie nicht allzu weit wegflog. Sein Blick blieb ununterbrochen auf die Frau gerichtet, daher konnte er nicht sehen, wo die Glock landete, aber er lauschte aufmerksam. Zwölf oder dreizehn Meter, registrierte er, nur für den Fall, dass er sie doch noch brauchte. Er wusste noch nicht genau, wie sich die Situation entwickeln würde, darum wollte er sich möglichst viele Optionen offenhalten.
»Wo ist es?«, herrschte sie ihn an.
»Wo ist was?« Er spielte den Ahnungslosen, aber nicht den Dummen, denn seine Antwort ließ ihre Wut nur noch größer werden. Und genau das bezweckte er.
»Das Geld«, stieß sie hervor. »Wo ist es?«
»Nicht hier. In Sicherheit. Gut versteckt.«
Sie kam ein kleines Stück näher. »Wo?«
»Ich kann dich hinbringen, wenn du willst.«
»Sag es mir, oder ich jage dir eine Kugel in den Kopf.«
Victor zuckte mit den Schultern. »Dann bekommst du aber die Hunderttausend nicht.« Er warf einen Blick auf die Tasche, die Jairo immer noch in der Hand hielt. »Oder, na ja, die restlichen neunundneunzigtausend, um genau zu sein. Aber ich schätze, tausend Dollar sind kein besonders schönes Trostpflaster, oder?«
Für Victor waren hunderttausend Dollar nicht besonders viel Geld, aber eine Bande ehrgeiziger Terroristen, die in Zelten im Dschungel hausten, konnte davon lange leben. Erst kürzlich hatte jemand zu ihm gesagt, dass Revolutionen teuer waren. Wenn das Durchschnittseinkommen in diesem Teil der Welt unter zehntausend Dollar jährlich lag, dann war es nicht schwer nachzuvollziehen, dass eine solche Gruppierung töten würde, um an das Geld zu kommen, das Victor mitgebracht hatte. Beziehungsweise nicht mitgebracht hatte.
Die Frau sagte: »Ich muss dir ja nicht gleich in den Hinterkopf schießen. Ich kann auch erst mal deinen Schwanz nehmen, wenn es sein muss.« Sie trat näher. »Dann wirst du mich anbetteln, dass du’s mir verraten darfst. Ich bin übrigens eine sehr gute Schützin.«
Victor blieb stumm. Er musste darauf nicht reagieren. Sie wussten beide, dass das ein Bluff war. Die alten Waffen und die zusammengestückelte Kleidung waren Antwort genug. Diese Leute brauchten Geld. Darum würde sie nicht riskieren, ihn allzu schwer zu verletzen. Wenn er am Schock oder infolge des Blutverlustes starb, würden ihnen die dringend benötigten Scheine durch die Lappen gehen. Das ganze Szenario war neu für sie – bis jetzt hatte die Kombination aus Hinterhalt und Erpressung immer funktioniert, und sie war sich nicht sicher, wie sie damit am besten umgehen sollte. Victor hingegen war schon öfter in vergleichbaren Situationen gewesen. Er wusste, was zu tun war. Sie aber musste improvisieren.
»Also gut«, sagte sie, nachdem sie sich ihren nächsten Schritt überlegt hatte. »Du bringst uns zu dem Geld.«
»Nein«, erwiderte er.
»Nein?«
Jetzt wusste sie überhaupt nicht mehr weiter. Seine Weigerung passte nicht in ihren Plan.
Victor fuhr fort: »Wenn ihr das Geld haben wollt, bestimme ich die Regeln. Ich bringe dich hin, aber nur dich alleine. Deine Männer warten hier. Sie könnten zum Beispiel Treibholz sammeln und für ein Feuer stapeln. Oder ein paar Revolutionslieder anstimmen, bis wir wieder da sind.«
Sie lächelte verächtlich, kam noch einen Schritt näher und antwortete, wie zu erwarten: »Nein.«
Was ihn zu der Frage führte: »Du hast doch nicht etwa Angst vor mir, oder?«
Sie zögerte, weil es auf diese Frage keine richtige Antwort gab. Hätte sie Angst zugegeben, dann hätte sie vor ihren Männern das Gesicht verloren, und hätte sie die Frage verneint, dann gab es keinen Grund, Victor nicht zu begleiten.
Sie lächelte Victor an, als würde es sich lediglich um ein Missverständnis handeln, das ein wenig außer Kontrolle geraten war, und ließ die Pistole sinken. »Wir können doch vernünftig miteinander reden, oder nicht? Du willst die Waffe. Wir wollen das Geld.«
Er nickte. »So war es eigentlich geplant. So einfach hätte es laufen können. Wenn ihr aufrichtig seid, dann bin ich es auch.«
Jairo, das konnte Victor aus dem Augenwinkel erkennen, verspannte sich.
Die Frau steckte mit einer schnellen, beiläufigen Bewegung die Pistole in das Halfter zurück. »Dafür ist es noch nicht zu spät. Siehst du? Lass uns das Geld holen. Ich komme mit dir. Meine Männer folgen uns in einem anderen Wagen. Einverstanden?«
»Natürlich.« Auch Victor lächelte jetzt, als hätte sie ihn davon überzeugt, dass das Ganze nur ein Missverständnis gewesen war, dass sie sich in Wirklichkeit doch an die ursprüngliche Absprache halten wollte.
Erfreut darüber, dass sie die Lage wieder im Griff hatte, drehte sie sich zu ihren Männern um, um ihnen zu sagen, was sie als Nächstes zu tun hatten. Sie hatte sich einen neuen Plan zurechtgelegt.
Das einzige Problem war nur, dass sie jetzt zu dicht an Victor herangekommen war. Mit einem einzigen raschen Schritt war er direkt hinter ihr, griff mit der linken Hand nach der Pistole in ihrem Oberschenkelhalfter und packte sie mit der rechten an den Haaren.
Schon im nächsten Augenblick drückte er ihr die Mündung an die Wange.
»Planänderung«, sagte er.
Kapitel 4
Panik erfasste die fünf Guerillas mit den Gewehren. Sie rissen ihre Waffen hoch, brüllten, stießen Drohungen aus. Victor ignorierte sie, denn schließlich hatte er ihre Kommandeurin zu seinem menschlichen Schutzschild gemacht. Sie war zwar deutlich kleiner als er, aber das spielte keine Rolle. Keiner der fünf Männer war ruhig genug, um einen Kopfschuss zu riskieren, schon gar nicht im Halbdunkel, schon gar nicht, solange Victor sich und seine Geisel ununterbrochen in Bewegung hielt.
Er hielt ihre Haare fest mit einer Hand gepackt und zog ihr den Kopf in den Nacken, um sie ihrer Kraft zu berauben und sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Pistolenmündung blieb fest an ihre Wange gedrückt, auch wenn gewichtige Gründe dagegen sprachen. Je näher die Waffe in ihrer Reichweite war, desto mehr Möglichkeiten hatte sie, sich dagegen zu wehren. Aber Victor ging es vor allem darum, ihr und ihren Männern etwas zu demonstrieren.
Sie sagte: »Mach bloß keine Dummheit!«
»Bis jetzt habe ich noch keine gemacht«, erwiderte Victor. »Und ich habe es auch nicht vor.«
Jeder Muskel ihres Körpers war bis zum Äußersten gespannt, aber sie wehrte sich nicht. Sie lehnte sich nicht auf. Sie wusste, dass sie ihm ausgeliefert war.
»Wir können doch eine gemeinsame Lösung finden.«
»Das versuche ich ja schon die ganze Zeit. Meinetwegen hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Ich wollte schließlich lediglich ein Gewehr kaufen.«
Sie sagte: »Nimm das Gewehr. Es gehört dir. Nimm es und verschwinde. Das Geld kannst du behalten.«
»Deine plötzliche Großzügigkeit ist wirklich rührend.«
»Du musst mich nicht töten.«
Er hatte gar nicht vor, sie zu töten. Zumindest noch nicht. Nicht, solange fünf vollautomatische Waffen auf ihn gerichtet waren, um ihn in der allernächsten Sekunde in Fetzen zu reißen. Das war der Grund, weshalb solche Geiselnahmen nie funktionierten. Weil sie nicht mehr waren als ein Bluff. Hätte der Geiselnehmer Selbstmordabsichten gehabt, dann hätte er ja keine Geisel genommen. Darum brauchte er seine Geisel auf jeden Fall lebend, weil er nur so selbst am Leben bleiben konnte. Das Problem war, dass die meisten Geiselnehmer diesen Zusammenhang erst begriffen, wenn es zu spät war, wenn sie bereits in ihre selbst gestellte Falle getappt waren.
Die fünf bewaffneten Typen jedoch verstanden diese Dynamik ebenso wenig wie ihre Anführerin. Wäre es anders gewesen, hätte es für Victor kein Entkommen gegeben. Er hatte schon mehrere vergleichbare Situationen erlebt, aber ihm wäre auch ohne diese Erfahrung klar gewesen, wie so etwas normalerweise ausging. Dazu brauchte man nicht mehr als ein bisschen gesunden Menschenverstand.
Allerdings ließ sich nicht ausschließen, dass die Guerillas irgendwann dahinterkamen, dass auch er letztendlich nur eine Geisel war, genau wie ihre Anführerin. Darum war es sinnvoll, keine Zeit zu verlieren.
Victor sagte: »Sag deinen Männern, sie sollen die Waffen fallen lassen.«
»Lässt du mich dann gehen?«
»Ich gehe hier erst weg, wenn deine Männer ihre Waffen abgelegt haben. Ansonsten nehme ich dich mit.«
Sobald sie entwaffnet waren, hatte er mehr Zeit. Dann konnte er gezielter schießen. Ihre Pistole war ein altes Ding, genau wie die Gewehre ihrer Männer. Ein Colt 1911. Robust und zuverlässig. Allerdings fasste das Magazin nur sieben Patronen. Damit blieben Victor zwei Ersatzpatronen, falls es ihm nicht gelang, alle fünf mit Kopfschüssen zu erledigen.
»Lasst die Waffen fallen«, rief sie ihren Männern zu.
Sie zögerten, was eine ganz natürliche Reaktion war. Er sah ihnen ihre Zerrissenheit an. Sie wollten zwar einerseits gehorchen und ihre Anführerin nicht gefährden, sich andererseits aber nicht schutzlos dem Geiselnehmer ausliefern. Die Anführerin wiederholte ihren Befehl – lauter und nachdrücklicher. Das reichte. Langsam ließen die fünf Männer ihre Waffen sinken.
Victor machte sich bereit. Er würde mit der linken Hand schießen. Sie war zwar seine schwächere, aber er war so gut wie beidhändig. Fünf Ziele. Sieben Kugeln. Nicht einfach, nicht ohne Risiko, aber machbar.
Bis auf den einen Faktor, den er in seine Kalkulation nicht miteinbezogen hatte.
Jairo sagte: »Lass sie los, oder ich knall dich ab.«
Mit einem schnellen Schulterblick stellte Victor fest, dass die Drohung durchaus glaubhaft war. Jairo hatte ebenfalls eine Waffe gezückt, eine Automatik. Trotz des Dämmerlichts erkannte Victor das Modell. Er hatte gewusst, dass Jairo bewaffnet war, aber er hatte nicht damit gerechnet, dass er die Waffe tatsächlich ziehen würde. Dafür war er nicht der Typ. Vielleicht lag es ja am Alkohol.
Nichts deutete darauf hin, dass Jairo ein besonders guter Schütze war, aber er stand nur wenige Meter von Victor entfernt. Und Victors Rücken war breit genug, dass auch ein schlechter Schütze auf diese Entfernung nicht danebenschießen konnte.
Victor hätte sich um hundertachtzig Grad drehen können, um seine Geisel zwischen sich und Jairos Pistole zu platzieren, doch dann hätte er den fünf Guerilleros den Rücken zugewandt. Darum beließ er es bei einer Vierteldrehung. So konnte er alle beiden feindlichen Parteien im Blick behalten. Es war nicht leicht, auf dem Sand zu manövrieren, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.
»Halt dich da raus«, sagte Victor.
»Was hast du jetzt vor?«, meldete sich die Geisel zu Wort.
»Ich mein’s ernst«, beharrte Jairo. »Lass sie los.«
Victor sah die fünf Guerilleros zaghaft näher kommen. Das Blatt hatte sich gewendet, und sie witterten eine zweite Chance. Sie würden nicht schießen, wenn er sich immer im Kreis drehte – die Gefahr, dass sie dabei ihre Anführerin trafen, war einfach zu groß –, aber sie würden auf Victor losstürmen. Und er konnte nicht alle gleichzeitig kampfunfähig machen, nicht einmal ohne die zusätzliche Bedrohung durch Jairo.
»Du wirst sterben«, zischte die Geisel.
»So langsam habe ich auch den Eindruck.«
Er hatte es mit Vernunft versucht. Er hatte es wirklich versucht, aber es hatte nichts genützt. Jetzt wurde es Zeit, ein wenig Emotion ins Spiel zu bringen.
Victor ließ die Haare der Anführerin los und schlang den Arm um ihren Brustkorb. Sobald er sie fest im Griff hatte, drückte er die Pistole von hinten an ihren linken Oberschenkel und drückte ab.
Die dichte Muskelmasse des Kniebeugers und des Quadrizeps sowie das Unterhautfettgewebe wirkten wie ein Schalldämpfer, darum war kaum mehr als ein feuchtes Schmatzen zu hören. Die Fünfundvierziger-Pistolenkugel riss ihre Hauptschlagader in Stücke und platzte dann auf der Vorderseite ihres Beins ins Freie, dicht gefolgt von Blutspritzern und Gewebefetzen.
Victor war zwar stark genug, um sie auch mit einem Arm in einer aufrechten Position zu halten, aber sie wurde von Sekunde zu Sekunde schwerer. Er hatte ihr bewusst die Hauptschlagader zerschossen, weil er wollte, dass ihre Männer sich durch das viele Blut ablenken ließen, aber dadurch konnte sie sich nicht mehr ohne seine Hilfe aufrecht halten.
Die Guerilleros wussten ebenso wenig, was sie jetzt machen sollten, wie Jairo. Regungslos vor Schreck und Entsetzen starrten sie auf die klaffende Wunde und das viele Blut. Die Angst und die Sorge um ihre Anführerin, die sekündlich bewusstlos zu werden drohte, lähmte sie.
Victor rief: »Keine Zeit für Diskussionen. Tut, was ich sage! Wenn sie nicht schnell einen Druckverband bekommt, ist sie in einer Minute verblutet. Werft eure Waffen weg!«
Die Guerilleros zögerten, aber nur für einen Moment. Sobald der erste sein Gewehr in den Sand gelegt hatte, taten die anderen es ihm nach. Nur Jairo machte keine Anstalten.
»Weg damit«, forderte Victor ihn auf.
Jairo zielte weiterhin auf ihn.
»Sie hat keine Zeit für dieses Spielchen.«
Die Pistole rührte sich nicht von der Stelle.
Einer der Guerilleros rief: »Tu, was er sagt!«
Doch Jairo reagierte nicht. Die Anführerin blutete weiter. Sie war bereits sehr blass, und es war klar, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Das konnte Victor deutlich sehen. Jairo sah es auch.
Ich hasse sie. Sie alle. Aber ich habe keine andere Wahl.
Victor begriff. Jairo hatte letztendlich doch die Seiten gewechselt, aber er hatte seine eigene Seite gewählt. Denn jetzt bot sich eine Gelegenheit, die er bis vor Kurzem noch nicht gesehen hatte. Noch vor wenigen Augenblicken hatte er von Victor verlangt, sie freizulassen – nicht, weil ihm etwas an ihr lag, sondern weil er auf der Seite der Gewinner sein wollte. Weil er sich nicht vorwerfen lassen wollte, nicht alles für den Sieg getan zu haben. Aber das war Vergangenheit, denn jetzt drohte sie zu verbluten. Jetzt hatte Jairo mit einem Mal ein anderes Ende vor Augen. Keine Guerilleros, die ihn quälten, ihn bedrohten, ihn zwangen, arglose Waffenkäufer in einen Tod zu locken, den er nicht ertragen konnte. Jetzt hatte er die Freiheit vor Augen, und alles, was er dafür tun musste, war: nichts.
Jairo wollte, dass sie verblutete. Er wollte sich vom Joch der Knechtschaft befreien. Er würde hier so lange stehen bleiben, bis sie tot war. Seine Motive waren Victor gleichgültig. Ihn interessierte nur, was das für ihn bedeutete. Wenn die Anführerin starb, ja, sobald klar war, dass sie nicht mehr zu retten war, würden die fünf Guerilleros nach ihren Waffen greifen, und dann würde Victor – auch, wenn er einen Vorsprung hatte – nicht mehr weit kommen.
Planänderung, das hatte er vorhin zu der Frau gesagt. Und jetzt war es schon wieder so weit.
Wenn die Vernunft versagte und Emotion auch nicht zum Ziel führte, dann blieb nur noch ein allerletzter Trumpf.
Gewalt.
Kapitel 5
Sechs Patronen. Sechs Ziele.
Jairo hatte eine Waffe in der Hand. Er stellte die unmittelbarste Bedrohung dar, darum schoss Victor zuerst auf ihn – nur einmal, weil ihm nicht mehr Zeit blieb. Dann ließ er die Anführerin los und wandte sich den fünf unbewaffneten Guerilleros zu. Die Frau brach auf dem Strand zusammen. Ihre Haut war mittlerweile so gut wie farblos geworden, nur ihre Lippen waren blau angelaufen. Das Blut triefte aus ihrer Tarnkleidung, sodass der Sand in ihrer Umgebung eine dunkelrote Färbung angenommen hatte.
Die fünf jungen Männer reagierten ohne zu zögern und stürzten sich auf ihre Gewehre. Jetzt, wo sie in Bewegung waren, sich duckten, zu Boden warfen oder knieten, waren sie schwerer zu treffen. Es war unmöglich, sie alle rechtzeitig zu erschießen.
Also jagte er den beiden, die am dichtesten in seiner Nähe waren, jeweils zwei Kugeln entgegen und rannte dann, so schnell er konnte, zu seinem Pick-up, schlitterte über den losen Sand und brachte sich hinter dem Wagen in Deckung.
Noch bevor er sich wieder aufgerichtet hatte, flogen ihm die ersten Kugeln um die Ohren, schlugen in den Wagen ein, rissen Grasbüschel aus den Dünen, ließen Sandwolken aufstieben oder zischten über seinen Kopf hinweg. Über ihm zerplatzte ein Fenster. Glassplitter regneten auf ihn herab. Er duckte sich hinter einen der großen, dicken Reifen. Eine Kugel durchschlug die Gummiwand, und ein kräftiger Luftstrahl pustete ihm ins Gesicht.
Sturmgewehre ratterten und hüllten ihn in einen Kugelhagel. Es war die reine Wut. Der reine Rachedurst. Sie gaben keine gezielten Schüsse ab, sondern ließen ihren Gefühlen freien Lauf. Es waren viel zu viele Kugeln, als dass Victor sie hätte zählen können, aber eines wusste er sicher: Lange konnte das Sperrfeuer nicht anhalten. Bei dreißig Patronen und einer Kadenz von sechs- bis siebenhundert Schuss pro Minute reichte ein einziger, langer Feuerstoß, um das Magazin eines Sturmgewehrs zu leeren.
Es wurde still. Nicht gleichzeitig, aber doch innerhalb weniger Sekunden verstummten die Gewehre.
Victor brauchte keine drei Sekunden, um bei einer Galil das Magazin zu wechseln und wieder schussbereit zu sein. Ungeübte Guerilleros, voll mit Adrenalin und überschäumender Wut, brauchten dafür vielleicht fünf, womöglich auch zehn Sekunden, aber auf jeden Fall nicht so lange, wie Victor gebraucht hätte, um sich in Sicherheit zu bringen.
Er spähte vorsichtig um den zerschossenen Reifen herum und unter dem Motorblock hindurch. Drei Guerilleros waren gerade dabei nachzuladen. Die beiden anderen lagen auf dem Bauch im Sand. Er hatte sie unschädlich gemacht, auch wenn er in der Düsternis nicht erkennen konnte, ob sie noch lebten oder bereits tot waren. Jedenfalls rührten sie sich nicht.
Die drei anderen jedoch luden ihre Waffen nach. Victor jagte die letzte Kugel aus seinem Colt unter dem Pick-up hindurch, doch der Winkel war zu spitz, und er verfehlte sein Ziel.
Trotzdem gewann er damit ein wenig Zeit, weil die drei Guerilleros zusammenzuckten und der jüngste von ihnen, der Teenager, sogar sein Ersatzmagazin fallen ließ.
Geduckt schob Victor sich auf den leblosen Jairo zu. Seine Pistole lag neben ihm im Sand. Der Pick-up bot zwar im Moment noch ausreichend Deckung, aber bestimmt nicht mehr lange. Selbst schlecht ausgebildete Gegner wussten, dass man einen Gegner einkreiste, wenn man zahlenmäßig überlegen war.
Er hörte leises Stöhnen und wusste, dass Jairo noch lebte. Er war bei Bewusstsein und wand sich in langsamen, schmerzerfüllten Bewegungen. Victors Kugel hatte ihn ins Gesicht getroffen, aber aus irgendeinem Grund das Gehirn ebenso verfehlt wie das Rückenmark. Bis auf einige wenige rötliche Streifen in Jairos Bartstoppeln war keinerlei Blut ausgetreten. Jairo war bei Bewusstsein, stand aber eindeutig unter Schock. Wahrscheinlich hätte die Verletzung ihn nicht einmal am Aufstehen gehindert, er wusste nur nicht, wie er das anstellen sollte.
Victor griff nach Jairos Pistole und musste beinahe ein Lächeln unterdrücken. Es war eine FN Five-seveN. Was für ein unerwartetes Geschenk. Diese Waffe war selbst auf dem Schwarzmarkt nur schwer zu bekommen. Jairo hatte sich also besondere Mühe gegeben, und er hatte offensichtlich keinen schlechten Geschmack.
»Gute Wahl«, sagte Victor, auch wenn Jairo als Antwort nur ein Stöhnen hervorbrachte.
Es war zwar nicht das zwanzigschüssige Modell – das war ausschließlich staatlichen Organisationen vorbehalten –, aber zehn Kugeln waren zehn Kugeln. Victor sah nach, ob bereits eine Patrone in der Kammer lag, und drehte sich wieder um. Vor seinem geistigen Auge schwärmten die drei Bewaffneten auf der anderen Seite des Pick-ups gerade aus, zwei in die eine und einer in die andere Richtung. Sie würden nichts überstürzen. Die Angst saß ihnen im Nacken, trotz ihrer nummerischen Überlegenheit. Sie hatten ihre Anführerin und zwei ihrer Kameraden verloren. Gut möglich, dass sie zum allerersten Mal überhaupt ein richtiges Feuergefecht mitmachten. Sie hatten vielleicht regelmäßig auf Zielscheiben geschossen und gelegentlich Ahnungslose in einen Hinterhalt gelockt, aber das war etwas ganz anderes, als einen Gegner zu haben, der sich zur Wehr setzte. Sie würden auf die harte Tour erfahren, dass sie dieser Situation nicht gewachsen waren.
Trotzdem, eine Kugel war eine Kugel, ganz egal, wer sie abgefeuert hatte. Es spielte keine Rolle, ob man von einem Amateur oder einem Profi erschossen wurde, abgesehen vielleicht von der zusätzlichen Entwürdigung.
Victor rutschte wieder hinter den zerschossenen Reifen und streckte die Hand nach oben, legte die Finger um den Griff der Beifahrertür und zog sie so weit auf, dass er in die Kabine schlüpfen konnte. Er legte sich seitlich quer über die Sitze. Niemand schoss auf ihn, also hatten sie ihn nicht gesehen. Sie waren viel zu sehr mit der Frage beschäftigt, was hinter dem Pick-up vor sich ging, als dass sie daran dachten, was sich womöglich im Inneren abspielen könnte.
Er hatte den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen, für den Fall, dass er sich schnell aus dem Staub machen musste. Der Schlüsselanhänger bestand aus Metall – Nickel oder eine andere Legierung – und hatte die Form einer nackten Frau. Billiger Kitsch, den er vom Vorbesitzer übernommen hatte, aber in diesem Fall praktisch, weil sich das wenige Restlicht darin spiegelte und Victor ihn sehen konnte, ohne unnötig Aufmerksamkeit zu erregen.
Er hörte Fußtritte knirschen. Die drei Bewaffneten waren ganz in der Nähe. Einer war um das Heck herumgeschlichen, während die beiden anderen jetzt direkt vor dem Pick-up standen. Perfekt.
Victor drehte den Zündschlüssel.
Der Anlasser jaulte, der Motor sprang an, und die Scheinwerfer erwachten zum Leben. Zwei grelle Lichtkegel bohrten sich in die Dunkelheit und erfassten die beiden Guerilleros vor dem Wagen.
Ihre Pupillen hatten sich weit geöffnet, damit sie in der Dunkelheit besser sehen konnten, darum erschraken die Männer jetzt nicht nur, sondern wurden auch noch geblendet. Sie erstarrten, konnten nichts sehen, konnten sich nicht bewegen, waren jedoch perfekt beleuchtet.
Victor hob den Kopf nur so weit, wie es absolut notwendig war, und erschoss die beiden durch die Windschutzscheibe hindurch.
Er hatte keine Zeit, um vernünftig zu zielen, darum verpasste er jedem von ihnen zur Sicherheit vier Kugeln.
Jetzt fing der Kerl am Heck des Wagens an zu schießen. Der vollautomatische Feuerstoß aus seinem Sturmgewehr riss zahlreiche Löcher in die Windschutzscheibe und das Dach. Victor warf sich auf die Sitze und wartete ab, bis der Schütze sein Magazin verschleudert hatte.
Kaum waren die Schüsse verklungen, ließ Victor sich aus der Fahrerkabine gleiten. Er rechnete damit, einen Mann vorzufinden, der erst zwanzig Prozent seines Fünf-Sekunden-Nachlade-Intervalls hinter sich hatte und daher verdutzt, verwundbar und leicht zu töten sein würde, doch stattdessen sah er eine verlassene Galil im Sand liegen und eine flüchtende Gestalt im roten Schein der Heckleuchten. Der Kerl hatte an seinem ersten Feuergefecht geschnuppert und festgestellt, dass es ihm nicht schmeckte.
Der Guerillero war schnell – es war der Teenager – und vergrößerte, angetrieben von der Angst, den Abstand mit jeder Sekunde. Er glaubte, dass sein Vorsprung ausreichend war, aber er wusste nicht, welche Waffe Victor in die Hände gefallen war. Er wusste nicht, dass die effektive Reichweite der Five-seveN fünfzig Meter betrug. Er rannte geradeaus an den Dünen entlang, sodass seine Silhouette sich scharf vor dem dunklen Himmel abzeichnete.
Victor zielte und drückte zweimal ab.
Das hätte eigentlich das Ende sein sollen, aber einer der anderen Guerilleros war immer noch am Leben.
Kapitel 6
Es war einer derjenigen, die sich gleich zu Beginn zwei Kugeln aus dem Colt eingefangen hatten. Er war zu Boden gegangen und regungslos liegen geblieben, aber jetzt war er bei Bewusstsein, am Leben und voller Zorn. Die Kugeln waren in seinen oberen Brustkorb eingedrungen. Sie hatten sein Herz verfehlt, sonst hätte er nicht mehr gelebt, und seine Wirbelsäule auch, sonst hätte er jetzt nicht gestanden. Victor war enttäuscht. Er hatte sich eigentlich für einen besseren Schützen gehalten, trotz des großen Zeitdrucks. Die hydrostatische Wirkung der Stoßwellen, die die beiden kurz aufeinanderfolgenden Einschläge hervorgerufen hatten, hatten den Kerl bewusstlos gemacht, aber keine bleibenden Schäden hervorgerufen. Victor wurde also zumindest wieder einmal deutlich vor Augen geführt, weshalb es sinnvoll war, sich an seine eigenen Richtlinien zu halten.
Der Guerillero hob sein Gewehr. Blasser Sand klebte am Lauf und am Schaft der Waffe, mit der er jetzt auf Victor zielte. Dieser ließ seine Five-seveN seitlich herabbaumeln. Der Lauf war gerade dabei abzukühlen, und Korditgeruch hing in der salzigen Seeluft. Der Guerillero wies mit einer Handbewegung darauf, und Victor ließ die Pistole fallen. Sie war ohnehin leer.
Der junge Mann mit dem Gewehr war größer und kräftiger als seine toten Genossen. Er ernährte sich besser. Entweder hatte er noch nicht so lange im Dschungel gelebt wie sie, oder er hatte den anderen das Essen gestohlen. Schweißperlen glitzerten auf seinem Gesicht. In seiner Miene war keinerlei Triumph zu erkennen, und er sagte kein Wort. Aber er genoss diesen Augenblick der stillen Vorfreude. Victor wartete ab.
Der Guerillero zielte auf Victor, drückte ab, aber nichts rührte sich.
»Der Sand dringt in die kleinste Ritze«, sagte Victor. »Das kleine Einmaleins der Waffenpflege.«
Die Ladehemmung änderte jedoch nichts an der Entschlossenheit des Guerilleros. Er war noch nicht fertig.
Darum stürmte er auf Victor los, packte den Lauf seines Gewehrs mit beiden Händen, schwang es wie einen Knüppel herum und wollte mit dem Schaft zuschlagen. Das ergab durchaus Sinn, denn schließlich war der Schaft das schwerere Ende. Beim Aufprall würde daher mehr Energie freigesetzt werden. Allerdings war die Waffe dadurch ziemlich träge. Hätte er sie andersherum gehalten, wäre der Schlag zwar nicht so kräftig, aber dafür schneller und die Chance auf einen Treffer größer gewesen.
Hatte Victor den Angreifer vor wenigen Augenblicken noch als ernst zu nehmenden Gegner betrachtet, so nahm er diese Einschätzung jetzt zurück. Der Gewehrknüppel würde ihn niemals treffen, weil der Guerillero keine Ahnung vom Kämpfen hatte. Er legte seine gesamte Energie in den ersten Schlag. Als er sein Ziel verfehlte, wurde er von der ganzen Wucht, die nun ins Leere ging, aus dem Gleichgewicht gebracht. Er war seinem Gegner schutzlos ausgeliefert. Er hatte nicht einmal versucht, Victors Reaktionsschnelligkeit zu testen.
Victor wich der ungeschickten Attacke aus und wartete auf die nächste. Er hatte keine Eile.
Immer wieder ließ der Guerillero seinen Knüppel durch die Luft sausen und schlug jedes Mal vorbei. Er besaß zwar keinerlei Geschick, aber das änderte nichts an seiner Entschlossenheit. Er hatte Biss, und manchmal war das schon genug. Die meisten Gegner hätten mittlerweile aufgegeben, doch Victor sah es seinem Blick an, dass die Toten seine Freunde gewesen waren. Victor wusste um die große Bedeutung brüderlicher Verbundenheit. Er wusste, dass sie ein dickes Band war, das im gemeinsamen Leben und im gemeinsamen Kampf geschmiedet wurde. Es schuf eine einzigartige Loyalität und eine Wildheit, die ihresgleichen suchte. Victor hatte beinahe sein Leben gelassen bei dem Versuch, seine Team-Kameraden zu retten. Er war bereit gewesen zu sterben.
Es dauerte nur wenige Sekunden, dann war der Guerillero erschöpft.
Victor versetzte ihm einen kräftigen Tritt gegen die Außenseite seines Knies. Das Bein knickte zwar nicht vollständig um, aber fast.
Der Guerillero landete auf dem Rücken im Sand und ließ dabei sein Gewehr fallen. Victor hockte sich auf ihn und stemmte sich mit den Knien auf die Oberarme seines Gegners. Der Sand hatte zwar für eine weiche Landung gesorgt, aber trotzdem wäre der Guerillero auf Beton besser bedient gewesen, weil Victor jetzt eine Handvoll Sand nahm und sie ihm ins Gesicht schleuderte. Dadurch drang der Sand in Augen, Nase und Mund seines Gegners ein, und zwar nicht nur oberflächlich. Die rauen Körner kratzten auf seiner Hornhaut und gerieten in seine Augenhöhlen, sie verstopften seine Nasenlöcher und seine Nebenhöhlen, belegten seine Zunge und rutschten ihm in den Hals.
Er fing an zu niesen, zu husten und zu röcheln.
Er konnte Victor nicht sehen und wäre ohnehin nicht zu gezielten Schlägen in der Lage gewesen. Aber er wehrte sich verzweifelt und schlug so lange um sich, bis er einen Arm frei bekommen hatte. Seine wilden, unkontrollierten Bewegungen waren für Victor eher hinderlich als wirklich gefährlich. Trotzdem schlug er den Arm seines Gegners beiseite und nutzte seinen strategischen Vorteil für einige gezielte Ellbogenschläge. Knochen brachen. Blut vermischte sich mit dem Sand und Schleim auf dem Gesicht des Guerilleros.
Victor stand auf und drehte den Mann auf den Bauch. Anschließend trat er ihm mit dem Absatz auf den Hinterkopf und drückte sein Gesicht in den Sand. Er bäumte sich auf, wand sich in alle Richtungen.
Victor hörte die Schreie der Möwen über sich und das Bellen der verwilderten Hunde in der Ferne. Er blickte auf die schwarzen Wellen, die an den Strand schwappten. Ein wunderschöner Ort, selbst jetzt, in der Dunkelheit, und so fernab von allem, dass er in seiner heiteren Gelassenheit fast unwirklich wirkte. Victor fühlte sich wohl in der Einsamkeit. Frieden war für ihn ein Ding der Unmöglichkeit, aber je weiter er von anderen Menschen entfernt war, desto größer war seine Chance, wenn nicht Frieden, so doch zumindest Zufriedenheit zu finden.
Er atmete die Meeresluft ein und war zufrieden.
Der Mann unter seinem Schuh wehrte sich noch ein paar wenige, sinnlose Sekunden lang. Als er merkte, dass er damit nichts erreichte, stieß er einen letzten, erstickten, mehrere Sekunden andauernden Schrei aus.
FÜNF WOCHEN ZUVOR
Kapitel 7
Es gab etliche Dinge im Leben, die nicht mit Geld zu bekommen waren, aber Luis Lavandier war noch keinem dieser Dinge begegnet. Er war ein wohlhabender Mann, nach allgemeinen Maßstäben sogar reich, aber im Vergleich zu seiner Arbeitgeberin war er ein Bettler. Sie bezahlte ihn gut für seine Dienste und überschüttete ihn regelmäßig mit großzügigen Geschenken und Bonuszahlungen. Er revanchierte sich dafür mit weisen Worten. Es war ein Schwindel, das war ihm klar, weil er kein bisschen weiser war als sie, aber er strahlte Gelehrsamkeit aus und war ein sehr geduldiger Mann, der jederzeit die Ruhe – oder zumindest den Anschein der Ruhe – bewahrte.
Diese innere Ruhe und die Geduld wurden jedoch regelmäßig auf die Probe gestellt.
Der heutige Tag, beispielsweise, war für den Franzosen eine ganz besondere Herausforderung gewesen. Er war zutiefst erschüttert, auch wenn er sich das nicht anmerken ließ. Er unterdrückte alle Anspannung und alle Nervosität und gab sich die größte Mühe, seine unerschütterliche Fassade aufrechtzuerhalten. Mit verschränkten Armen stand er da und sah zu, wie Dr. Flores Heloise untersuchte. Flores zeigte sich besonnen, aber durchaus besorgt. Heloise hingegen war der Inbegriff der Selbstbeherrschung. Und während Lavandiers Gelassenheit lediglich Kulisse war, war sie bei Heloise durch und durch echt. Er hatte sie schon oft erzürnt erlebt, aber noch kein einziges Mal ängstlich. Lavandier kannte niemanden, der so angstfrei war wie sie, und das war der Grund, weshalb er sie umso mehr begehrte.
Die Klinik war die exklusivste in ganz Guatemala-Stadt, vielleicht sogar in ganz Mittelamerika. Sie befand sich in einem sechsstöckigen Gebäude in einer ruhigen Nebenstraße eines der begehrtesten Wohnviertel der Stadt. Heloise war seit frühester Kindheit Patientin von Dr. Flores, seines Zeichens Klinikbesitzer und Chefarzt in Personalunion. Flores hatte schon ihren Vater, Manny Salvatierra, für den größten Teil seines Lebens behandelt, ebenso wie dessen Frau und Töchter. Aber jetzt kümmerte er sich nur noch um Heloise. Lavandier wusste nicht genau, weshalb er sich für sie und gegen Maria entschieden hatte, und er wollte es auch gar nicht wissen.
Flores war alt, aber gesund. Man merkte ihm sein Alter nicht an. Seine Bewegungen waren geschmeidig wie die eines Mannes, der nur halb so viele Jahre auf dem Buckel hatte. Er versprühte mehr Energie als Lavandier, der sich selbst durchaus für sportlich hielt. Obwohl, ein bis fünf Kilo weniger um die Hüften könnten nicht schaden, dachte er, als er seinen Bauch einzog.
»Ich weiß, was du sagen wirst, darum zögere ich«, sagte Flores, nachdem er seine Untersuchung abgeschlossen hatte.
Sie saß am Fußende einer Untersuchungsliege, regungslos und aufrecht, den Blick starr an die gegenüberliegende Wand gerichtet. Sie hatte sich während der Untersuchung nicht beklagt und keinerlei Anzeichen des Unbehagens gezeigt. Er hatte ihren Puls, Atmung und Blutdruck gemessen. Er hatte ihre Wunden gesäubert – oberflächliche Schnitte, verursacht durch Glassplitter. Gegen die Prellungen konnte er nichts unternehmen, aber sie waren ohnehin nicht der Rede wert.
»Sagen Sie es«, verlangte sie.
Er schüttelte in Erwartung ihrer Reaktion bereits den Kopf. »Ich glaube, eine Halskrause wäre gut.«
»Unmöglich.«
»Siehst du? Ich wusste, du würdest meiner Empfehlung nicht folgen. Ich bin schließlich nur dein Arzt. Was weiß ich denn schon? Ich frage mich, wieso du überhaupt zu mir gekommen bist, wo du ohnehin alles besser weißt.«
Lavandier beobachtete den Wortwechsel stillvergnügt. Flores war einzigartig, auch wenn er das nicht wusste. Eine solche Unverschämtheit hätte Heloise sich von niemand anderem bieten lassen. Er hätte sie sogar beleidigen können, ohne ihr die geringste Reaktion zu entlocken. Sie würde keinerlei Zorn empfinden. Und das, obwohl sogar ihre schlimmsten Feinde sich jederzeit, selbst bei ihren Drohungen, größter Höflichkeit bedienten. Ihre Reizbarkeit war ebenso groß wie ihre Grausamkeit.
»Warum sollte ich so ein Ding tragen?«, erkundigte sie sich.
»Weil du bei dem Unfall ein Schleudertrauma erlitten hast. Das bedeutet, dass dein Nacken geschwächt und empfindlich ist. Wenn wir ganz sichergehen wollten, könnten wir dich röntgen, aber ich glaube, es handelt sich lediglich um eine Prellung in der Umgebung des vierten und fünften Nackenwirbels. Man kann sie zwar nicht sehen, aber wir sollten sie auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schon ein leichter Schlag, und das Ganze könnte noch schlimmer werden.«
»Aber warum soll ich dann diese Stütze tragen?«
Flores erwiderte: »Ich glaube, das habe ich dir gerade eben erklärt.«
»Nein. Sie haben mir erklärt, wieso sie mir nützen würde, aber nicht, wieso ich eine tragen soll.«
Flores war verwirrt. Er war ein hervorragender Arzt und ein kluger Mann, aber seine Welt war nicht die Welt, in der Heloise lebte. Ihre Regeln, ihre Risiken überschritten seinen Horizont.
Der Franzose beschloss, ihm auf die Sprünge zu helfen. »Sie möchten, dass ihr nichts zustößt, nicht wahr?«
Flores nickte. »Natürlich. Aber …«
Heloise unterbrach ihn. »Wenn man mich mit einer Halskrause sieht, dann sieht man, dass ich verletzt bin. Schwach. Sie werden wissen, dass sie mir nahe gekommen sind, dass nicht viel gefehlt hätte. Wie lange wird diese Halskrause mich also schützen, wenn sie weitere Attentäter ermuntert, wenn sie meinen Männern demonstriert, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich stürze? Wie sehr werden sie für eine verlorene Sache noch kämpfen?«
Flores wusste nicht, was er sagen sollte.
»Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen«, sagte Heloise, während sie sich von der Liege schob. »Aber es gibt doch bestimmt auch Medikamente, die ich in so einem Fall nehmen kann, oder?«
»Ja, gegen die Schmerzen.« Er stellte ihr ein Rezept aus, aber Lavandier wusste, dass Heloise keine Tabletten nehmen würde. Sie spielte das Spiel lediglich mit, damit Flores sich nicht noch mehr Sorgen machte. Lavandier nahm das Rezept entgegen, weil er nicht nur Berater, sondern auch persönlicher Assistent war – auch wenn er sich selbstverständlich niemals dazu bereit erklärt hatte. Trotzdem würde es ihm nicht im Traum einfallen, darauf hinzuweisen, dass solche Dinge eigentlich unter seiner Würde waren. Er würde seine Vertragsbedingungen niemals in Zweifel ziehen. Letzten Endes zählte nur die Tatsache, dass Heloise seine Arbeitgeberin war – seine Göttin –, und dass sie alles von ihm verlangen konnte.
Ob sie ihn jemals gehen lassen würde? Das war eine Frage, über die er immer wieder nachdachte.
Nach dem Überfall am heutigen Morgen waren die Wachen verdoppelt worden. Sicarios standen aufgereiht im Flur und draußen am Straßenrand, dazu noch die Bewaffneten an beiden Enden der Straße. Lavandier öffnete die Tür der wartenden Limousine, und Heloise stieg ein.
Es war ein wunderschöner Tag, wie üblich um diese Jahreszeit. Lavandier, der schon immer ein großer Freund der Sonne gewesen war, genoss das äquatoriale Klima Guatemalas sehr. Er war stolz auf den leichten Bronzeton seiner Haut, der sich nicht nur das ganze Jahr über hielt, sondern der, dank seines großen Reichtums und hoher Mauern, seinen Körper vollständig bedeckte.
Das Fahrzeug hatte mehr Ähnlichkeit mit einem Panzer als mit einem Auto. Von außen besaß es die klassische, lang gestreckte Form, die bei den Reichen in aller Welt so beliebt war. Es war immer sorgfältig auf Hochglanz poliert. Die Scheiben waren getönt und das Kennzeichen personalisiert. Es konnte sich mühelos bei jeder Premiere, bei jeder festlichen Gala sehen lassen, aber es konnte noch sehr viel mehr.
Nicht genug damit, dass die Karosserie eine dicke Stahlpanzerung erhalten hatte und das Fahrwerk verstärkt worden war, um das zusätzliche Gewicht zu bewältigen. Auch der Motor war durch ein Modell mit doppeltem Hubraum und einem Kompressor ersetzt worden. Jedes der zweieinhalb Zentimeter dicken, kugelsicheren Fenster bestand aus einer speziellen Verbindung von Glas und Polymer-Kunststoff. Keines dieser Ausstattungsmerkmale war in der Welt der gepanzerten Limousinen irgendwie ungewöhnlich, aber nur die wenigsten Panzerlimousinen wurden für Kartell-Bosse in Ländern hergestellt, die fast als Kriegsgebiet eingestuft werden konnten. Der Unterboden des Wagens war ebenfalls gepanzert, aber die Panzerung war, anders als in vielen vergleichbaren Fällen, V-förmig geformt, um die Wucht einer explodierenden Mine möglichst wirkungsvoll zur Seite zu lenken.
Hätte Heloise heute Morgen in diesem Wagen gesessen, dann wäre ihnen die Fahrt zu Dr. Flores’ Klinik möglicherweise erspart geblieben. Doch Heloise saß gerne selbst am Steuer. Sie fuhr gerne Sportwagen. Und verschmähte Lavandiers warnende Worte.
Er behielt sein Ich hab’s doch gleich gesagt für sich, weil er seine Zunge gern behalten wollte. Heloise besaß lange Fingernägel, hart wie Krallen, und jedes Mal, wenn sie sie gegen ihre Feinde richtete, wurde Lavandiers Selbstbeherrschung bis zum Äußersten gefordert.
Doch die Limousine hatte nicht nur eine schützende Funktion, sondern bot auch offensive Möglichkeiten. An die Unterseite des Schiebedachs, das wie bei der zivilen Version groß genug für eine aufrecht stehende Person war, hatten die Konstrukteure ein Maschinengewehr montiert. Bei geöffnetem Schiebedach ließ das Gewehr sich ausklappen. Lavandier fürchtete den Tag, an dem Heloise ihm befehlen würde, damit zu schießen. Einer ihrer Waffenmeister hatte ihm beigebracht, wie man damit umging, aber er war selbst bei den ungefährlichen Übungen auf freiem Feld ein miserabler Schütze gewesen. Wenn es irgendwann gegen feindliche, blutrünstige Sicarios ging, würde er keine Hilfe sein. Sollte ihr Überleben jemals von Lavandiers Fähigkeiten im Umgang mit einer Waffe abhängen, dann bedeutete das den sicheren Tod.