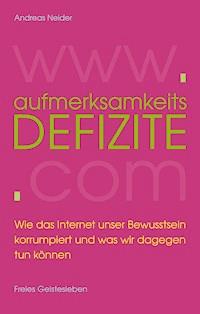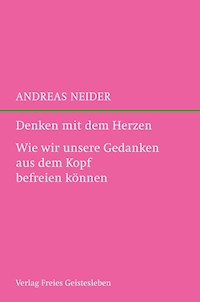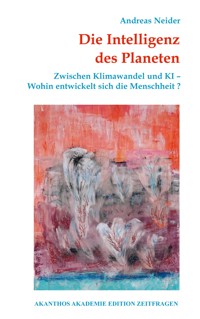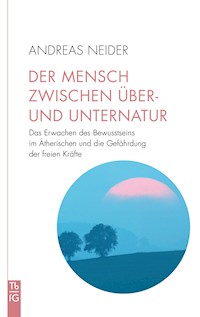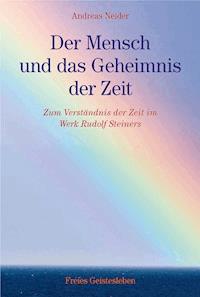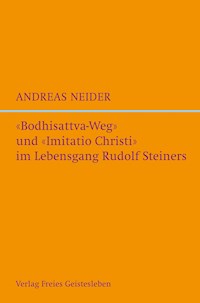
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In seinem Hauptwerk zum anthroposophischen Schulungsweg, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, hat Rudolf Steiner die Begegnung mit dem sogenannten "großen Hüter der Schwelle" beschrieben. Dabei geht es um eine Entscheidung, die der Geistesschüler, der auf der höchsten Stufe seiner Entwicklung angekommen ist, treffen muss: Wird er sich fernerhin nicht weiter inkarnieren, weil er das nicht mehr nötig hat, oder wird er sich unter Verzicht auf den eigenen Vorteil weiterhin inkarnieren, zugunsten der Weiterentwicklung aller anderen Menschen? Die oben gekennzeichnete Frage des "großen Hüters" wird im Buddhismus als die Bodhisattva-Frage bezeichnet. Woher rührte dieser buddhistische Einfluss im Werk Rudolf Steiners und wie hat sich diese Bodhisattva-Frage in der späteren Darstellung im Hauptwerk Rudolf Steiners, Die Geheimwissenschaft im Umriss, weiterentwickelt? Zunächst wird auch geklärt, was für ein Wesen dieser "große Hüter" eigentlich ist und welche Bedeutung er für die Entwicklung des Menschen auf dem anthroposophischen Schulungsweg hat. Woher kam der buddhistische Einfluss im Werk Rudolf Steiners? Ist Steiner selbst den Weg eines Bodhisattva gegangen? Das sind nur zwei der zentralen Fragen, mit denen sich dieses Buch beschäftigt. Dabei entsteht ein neues, bereicherndes Verständnis für den Lebensgang und die Individualität Rudolf Steiners.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Neider
«Bodhisattva-Weg» und «Imitatio Christi» im Lebensgang Rudolf Steiners
Eine esoterisch-biografische Studie
Verlag Freies Geistesleben
Inhalt
Prolog
Einführung
1.
Vier Arten des Verständnisses eines Bodhisattva
2.
Der Bodhisattva-Weg und das Bodhisattva-Ideal im Mahayana-Buddhismus
3.
Der Bodhisattva-Weg in Die Stimme der Stille von H. P. Blavatsky
4.
Der Bodhisattva-Weg und der «große Hüter der Schwelle» in Rudolf Steiners Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? – Novalis und die «Imitatio Christi» – Die Verbindung von Buddhismus und Christentum
5.
Der «große Hüter der Schwelle» in Die Geheimwissenschaft im Umriss – Wie der Christus sich offenbart
6.
Spirituelle Ökonomie und «das Gestanden-Haben vor dem Mysterium von Golgatha» – Das Bodhisattva-Prinzip im Lichte der «Imitatio Christi»
7.
Das Bodhisattva-Prinzip und der Ursprung des «sozialen Hauptgesetzes»
8.
Der Bodhisattva-Weg und das Michael-Christus-Erleben – Anna Samwebers Frage nach dem Wesen der Individualität Rudolf Steiners
Nachwort – Das Bodhisattva-Prinzip in Zeiten des Klimawandels und der Corona-Krise
Anmerkungen
Denken mit dem Herz
Prolog
Novalis berichtet im 5. Kapitel seiner einzigen von ihm vollendeten größeren und zu Lebzeiten publizierten Dichtung, den Hymnen an die Nacht, in einer denkwürdigen Passage von einem griechischen Sänger, der die frohe Botschaft der Geburt des Christus auf Erden nach Osten, nach «Indostan» brachte, wo sie «tausendzweigig emporwuchs».1
Diese Passage2 sei als Vorspann unseren nachfolgenden Betrachtungen vorangestellt. Der Grund dazu wird sich im Laufe der Lektüre bald erschließen.
«Von ferner Küste, unter Hellas heiterm Himmel geboren, kam ein Sänger nach Palästina und ergab sein ganzes Herz dem Wunderkinde:
Der Jüngling bist du, der seit langer Zeit
Auf unsern Gräbern steht in tiefen Sinnen;
Ein tröstlich Zeichen in der Dunkelheit –
Der höhern Menschheit freudiges Beginnen.
Was uns gesenkt in tiefe Traurigkeit
Zieht uns mit süßer Sehnsucht nun von hinnen.
Im Tode ward das ewge Leben kund,
Du bist der Tod und machst uns erst gesund.
Der Sänger zog voll Freudigkeit nach Indostan – das Herz von süßer Liebe trunken; und schüttete in feurigen Gesängen es unter jenem milden Himmel aus, dass tausend Herzen sich zu ihm neigten, und die fröhliche Botschaft tausendzweigig emporwuchs.»
Im ersten der Geistlichen Lieder von Novalis findet sich hierzu noch eine Parallelstelle, die auf denselben Kontext weist:
«Hat Christus sich mir kund gegeben,
Und bin ich seiner erst gewiss,
Wie schnell verzehrt ein lichtes Leben
Die bodenlose Finsternis.
Mit ihm bin ich erst Mensch geworden;
Das Schicksal wird verklärt durch ihn,
Und Indien muss selbst im Norden
Um den Geliebten fröhlich blühn.»3
Einführung
Rudolf Steiner hat in seinem Schulungsbuch Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?4 im letzten Kapitel ein Gespräch wiedergegeben, das sich zwischen dem Geistesschüler und dem «großen Hüter der Schwelle» abspielt. In diesem Gespräch wird der zu der bis dahin höchsten Stufe der Einweihung gelangte Geistesschüler vor eine Wahl gestellt: Sich entweder nicht weiter auf Erden zu verkörpern, weil das für ihn aufgrund seiner hohen Entwicklung nicht mehr notwendig ist; oder, sich, ohne dass dazu eine karmische Notwendigkeit bestünde, trotzdem immer wieder auf Erden zu inkarnieren, um der Befreiung aller anderen Menschenwesen willen, mit denen der auch noch so hochentwickelte Mensch ja durch die Menschheitsentwicklung von Anfang an verbunden ist.5
Der «große Hüter» erscheint in diesem Gespräch als eine höhere Stufe der zuvor auf dem Weg der Selbsterkenntnis sich vor den Geistesschüler hinstellenden Gestalt des «kleinen Hüters der Schwelle», die dem Schüler den Eintritt in die Erkenntnis der geistigen Welt solange verwehrt, bis er sich selbst als durch irdische Verstrickungen verunreinigte Wesenheit erkannt und von diesen Verstrickungen befreit hat. Als ein solch Befreiter tritt der Schüler dann vor den «großen Hüter» hin, der ihn nun auf seine menschheitlichen Aufgaben und Verpflichtungen hinweist und ihn dabei vor die erwähnte Wahl zweier Wege stellt.
Wenn man sich etwas mit dem Buddhismus beschäftigt hat, dann braucht es nicht viel, um in diesem Gespräch mit dem großen Hüter das im Buddhismus sogenannte «Bodhisattva-Ideal» wiederzuerkennen. Dieses mit einer Art von Gelöbnis verbundene «Bodhisattva-Ideal» ist im Buddhismus Bestandteil eines Schulungsweges, dem Weg eines Bodhisattva. Auf welche Weise es entstanden ist und wie es auch heute noch verwendet wird, soll im Folgenden weiter dargestellt werden. Kannte Rudolf Steiner dieses Bodhisattva-Ideal des Buddhismus und wenn ja, woher war es ihm bekannt?
Es erscheint bei genauerer Untersuchung ziemlich wahrscheinlich, dass Rudolf Steiner bei der Wiedergabe des Gespräches mit dem «großen Hüter der Schwelle» eine Quelle benutzt hat, die in einem der letzten Bücher von H. P. Blavatsky identifiziert werden kann: Die Stimme der Stille. In diesem Buch gibt Blavatsky den als Bodhisattva-Weg im Buddhismus geläufigen Schulungsweg in der ihr eigenen, poetisch erscheinenden Sprache wieder. Dieses Buch ist in Rudolf Steiners Bibliothek vorhanden, und er hat es sogar teilweise aus dem Englischen übertragen.6 Wie wir sehen werden, hat Rudolf Steiner diese Vorlage jedoch in einer stark metamorphosierten Form aufgegriffen. Dabei entsteht aber auch die Frage, ob es für dieses Gespräch, in dem es ja um die Selbstaufopferung des auf dieser Stufe angelangten Geistesschülers geht, nicht auch innerhalb der mitteleuropäischen Tradition einen weiteren Bezugspunkt gegeben hat.
In Die Geheimwissenschaft im Umriss7 verwandelt sich dann das Gespräch mit dem «großen Hüter» in der Darstellung des Erkenntnisweges des Geistesschülers in die Begegnung mit dem Christus. So könnte man von dem zu einer «Imitatio Christi» verwandelten «Bodhisattva-Weg» sprechen. Wie sich die beiden Beschreibungen der Begegnung des Geistesschülers mit diesem Hüter voneinander unterscheiden, soll im Folgenden genauer untersucht werden.
Anhand dieser beiden Texte über die Begegnung mit dem «großen Hüter» gehe ich schließlich der Frage nach, inwiefern Rudolf Steiner selbst den von ihm in diesen Texten beschriebenen «Bodhisattva-Weg», der mit der Begegnung mit dem «großen Hüter» zusammenhängt, gegangen ist, und versuche zu zeigen, wie sich das an seiner Tätigkeit als Geisteslehrer ablesen lässt. Damit wird erneut die Frage nach der eigentlichen Wesenheit Rudolf Steiners gestellt, ohne diese jedoch endgültig beantworten zu wollen.
Im ersten Kapitel wird zunächst geklärt, welche verschiedenen Arten des Bodhisattva-Verständnisses es gibt. Das zweite Kapitel führt aus, was der Bodhisattva-Weg und das Bodhisattva-Ideal im Buddhismus bedeuten. Dazu nutze ich eine der wichtigsten buddhistischen Quellen, die Darstellung des Bodhisattva-Weges von Shantideva aus dem 8. Jahrhundert.
Im dritten Kapitel folgt die Beschreibung des Bodhisattva-Weges in Die Stimme der Stille von H. P. Blavatsky, die sich in diesem Text eindeutig auf ihr allerdings nicht physisch vorliegende buddhistische Quellen bezogen hat. An diesen Text hat Steiner sich meiner Auffassung nach bei der Abfassung des «großen Hüter»-Kapitels in Wie erlangt man angelehnt. Wir greifen unserer inhaltlichen Darstellung dieses Textes hier etwas ausführlicher vor, weil damit der Gesamtzusammenhang, um den es in diesem Buch gehen wird, besser verständlich werden kann.
Dass sich Rudolf Steiner an diesem Text von H. P. B. orientiert hat, dazu gibt es außer der Tatsache, dass er diesen Text teilweise aus dem Englischen übertragen hat, einen weiteren Beleg, der mit der Auffassung Steiners vom «Nirmanakaya» des Buddha zu tun hat. Denn dabei folgt er eindeutig der Darstellung von H. P. B. in Die Stimme der Stille, wo sie den «Nirmanakaya» genau an der Stelle erwähnt, an der sich die deutlichsten Anklänge an das Gespräch mit dem «großen Hüter» finden lassen.
Aber nicht nur an dieser Stelle hat H. P. B. den Nirmanakaya dargestellt, sondern noch ausführlicher in dem Glossar zu ihrem letzten Werk Der Schlüssel zur Theosophie. Dieses Glossar hat Rudolf Steiner zusammen mit Der Schlüssel zur Theosophie vollständig aus dem Englischen übertragen. Und an beiden Stellen wird der «Nirmanakaya» des Buddha genauso charakterisiert, wie Rudolf Steiner ihn später, vor allem im Zyklus über das Lukas-Evangelium, selbst dargestellt hat.8
Damit soll nun aber nicht behauptet werden, Steiner habe über keinerlei eigene Anschauung dieser Tatsachen, also des Gespräches mit dem «großen Hüter» und des «Nirmanakaya des Buddha» verfügt und bei Blavatsky lediglich abgeschrieben. Denn sowohl die Darstellung des «großen Hüters» als auch des «Nirmanakaya» des Buddha gehen beide deutlich über die von Blavatsky geschilderten Zusammenhänge hinaus. Meiner Auffassung nach waren diese Texte Blavatskys für Rudolf Steiner aber notwendige Anknüpfungspunkte, um diese Zusammenhänge eigenständig darstellen zu können.
Diese Eigenständigkeit zeigt sich nicht nur in der Darstellung des «großen Hüters» in Wie erlangt man, sondern dann vor allem auch in der in entscheidender Weise erweiterten Schilderung der Begegnung mit dem «großen Hüter» 1909 in Die Geheimwissenschaft. Diese wird dadurch in ein völlig neues Licht gestellt, das sich bei Blavatsky nirgends findet. Und dasselbe gilt auch für den «Nirmanakaya» des Buddha, den er ebenfalls 1909 in entscheidend erweiterter Form dargestellt hat, indem er diesen mit dem nathanischen Jesus und dem im Lukas-Evangelium beschriebenen Geburtsgeschehen in Beziehung setzt.
Damit stellt sich dann aber auch die Frage, warum sich Rudolf Steiner bei seinen Darstellungen überhaupt an H. P. B. orientiert hat, wenn er doch über eigenständige Anschauungen des Gespräches mit dem «großen Hüter» und des «Nirmanakaya» verfügte. Dieses Anknüpfen an bereits von anderen erforschte Zusammenhänge entspricht, so Rudolf Steiner in den Vorträgen über Spirituelle Ökonomie, einem geistigen Gesetz:9
«Aber es gibt in der geistigen Welt ein ganz bestimmtes Gesetz, dessen ganze Bedeutung wir uns durch ein Beispiel klarmachen wollen. Nehmen Sie einmal an, in irgendeinem Jahre hätte ein beliebiger, regelrecht geschulter Hellseher dies oder jenes in der geistigen Welt wahrgenommen. Nun stellen Sie sich vor, dass zehn oder zwanzig Jahre später ein anderer ebenso geschulter Hellseher dieselbe Sache wahrnehmen würde, auch dann, wenn er von den Resultaten des ersten Hellsehers gar nichts erfahren hätte. Wenn Sie das glauben würden, wären Sie in einem großen Irrtum, denn in Wahrheit kann eine Tatsache der geistigen Welt, die einmal von einem Hellseher oder einer okkulten Schule gefunden worden ist, nicht zum zweiten Mal erforscht werden, wenn der, welcher sie erforschen will, nicht zuerst die Mitteilung erhalten hat, dass sie bereits erforscht ist. Wenn also ein Hellseher im Jahre 1900 eine Tatsache erforscht hat, und ein anderer im Jahre 1950 so weit ist, um dieselbe wahrnehmen zu können, so kann er das erst, wenn er zuvor gelernt und erfahren hat, dass einer sie schon gefunden und erforscht hat. Es können also selbst schon bekannte Tatsachen in der geistigen Welt nur geschaut werden, wenn man sich entschließt, sie auf gewöhnlichem Wege mitgeteilt zu erhalten und sie kennenzulernen. Das ist das Gesetz, das in der geistigen Welt für alle Zeiten hindurch die universelle Brüderlichkeit begründet. Es ist unmöglich, in irgendein Gebiet hineinzukommen, ohne sich zuerst zu verbinden mit dem, was schon von den älteren Brüdern der Menschheit erforscht und geschaut worden ist. Es ist in der geistigen Welt dafür gesorgt, dass keiner ein sogenannter Eigenbrötler werden und sagen kann: Ich kümmere mich nicht um das, was schon vorhanden ist, ich forsche für mich allein.»
Hierdurch kann man die Voraussetzungen, unter denen Rudolf Steiner die von ihm in Wie erlangt man und in den Vorträgen zum Lukas-Evangelium dargestellten Tatsachen erforschen konnte, besser verstehen, ohne zu der Vermutung greifen zu müssen, Rudolf Steiner habe an entscheidenden Stellen sich lediglich bei H. P. B. «bedient». Damit wird aber auch in eindrucksvoller Weise deutlich, in welcher Weise Rudolf Steiner sich an dieses Gesetz gehalten halt.
Im vierten und fünften Kapitel geht es in diesem Sinne um ein genaueres Verständnis und einen Vergleich der beiden Darstellungen der Begegnung mit dem «großen Hüter» in Wie erlangt man und Die Geheimwissenschaft. Dabei zeigen sich in beiden Darstellungen auch zwei besondere Eigenschaften des Initianten, der dem «großen Hüter» begegnet. Diese Eigenschaften möchte ich im Sinne der beiden Darstellungen als Eigenschaften eines dem Christus folgenden Bodhisattva bezeichnen.
Diese mit dem Christus verbundenen Eigenschaften gehen auch aus dem zentralen Vortrag Rudolf Steiners zur Bodhisattva-Thematik hervor. In diesem Vortrag charakterisiert er das Wesen der zwölf um den Christus versammelten Bodhisattvas und ihr stetiges Wirken in der Menschheitsgeschichte. Hier fordert er seine Zuhörer auch dazu auf, sich nicht mit dem abstrakten Begriff eines Bodhisattva zufrieden zu geben, sondern diesen durch «eine Betrachtung des Lebens» real und lebendig zu verstehen.10
Auf dieser Darstellung und weiteren Aussagen Steiners beruhte auch die in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommene Kontroverse zwischen zwei Schülern Rudolf Steiners, nämlich Adolf Arenson und Elisabeth Vreede. Die Fragestellung, um die es hier ging, und die Thomas Meyer in seinem diesbezüglichen Buch wieder aufgegriffen hat11, nämlich ob Rudolf Steiner der Maitreya-Bodhisattva, also der auf den Buddha folgende nächste Buddha gewesen sei, ist jedoch nicht Thema meiner Darstellung, weil diese meiner Auffassung nach den Blick auf die in dem vorliegenden Buch dargestellten Zusammenhänge verstellt.12
Ich nehme stattdessen eine bisher nicht wahrgenommene Perspektive ein. Mir geht es mit meiner Darstellung insbesondere um die in dieser Weise bisher nicht gestellte Frage:
Hat sich die in den beiden erwähnten Darstellungen beschriebene Begegnung mit dem «großen Hüter» im Lebensgang Rudolf Steiners selbst vollzogen und wenn ja, wann ungefähr könnte diese Begegnung stattgefunden haben13 und vor allem, welche Folgen hatte diese für ihn selbst als Mensch persönlich?
Ich stelle also die Frage, ob Rudolf Steiner der Maitreya-Bodhisattva gewesen ist, in meiner Untersuchung bewusst zurück, denn aus der von mir eingenommenen Perspektive ist diese Frage nicht die entscheidende. Wesentlicher erscheint mir zunächst einmal darauf hinzuschauen, ob sich in Rudolf Steiners Biografie die in unserer Untersuchung noch näher zu beschreibenden Eigenschaften eines Bodhisattva ablesen lassen, wie er sie selbst in den besagten beiden Texten beschrieben hat. Diese Eigenschaften tragen in Wie erlangt man noch eindeutig die Züge des ihm durch H. P. B. aus dem Buddhismus bekannten «Bodhisattva-Weges», verwandeln sich dann aber in der Schilderung in Die Geheimwissenschaft in die Züge einer «Imitatio Christi».14 Daher auch der Titel dieses Buches: «Bodhisattva-Weg» und «Imitatio Christi» im Lebensgang Rudolf Steiners.
Dabei gehe ich auch auf die Frage ein, wodurch es zu dieser Weiterentwicklung im Lebensgang Rudolf Steiners gekommen ist. Bei der Untersuchung dieser Frage werden wir uns näher mit der Wesenheit des Novalis, über die Rudolf Steiner insbesondere in der Zeit der Abfassung von Die Geheimwissenschaft sehr häufig gesprochen hat, beschäftigen.15 Das Verhältnis von Novalis zum Christus, wie wir es insbesondere in seinen Hymnen an die Nacht und den Geistlichen Liedern finden, scheint mit der Bodhisattva-Frage und der hier gemeinten «Imitatio Christi» deutlich in Beziehung zu stehen.16
Damit soll auch das Besondere des «Bodhisattva-Weges» bei Rudolf Steiner herausgestellt werden, nämlich dessen Verbindung mit dem Christus. In welch eigentümlicher Weise sich diese Verbindung mit dem Christus durch das sogenannte «Prinzip der spirituellen Ökonomie», auch im Sinne einer an Novalis angelehnten «Imitatio Christi» entwickelt hat, werden wir in diesem Zusammenhang ebenfalls genauer untersuchen.
Im Hinblick auf die Bodhisattva-Frage werde ich also zu zeigen versuchen, dass Rudolf Steiner in gewissem Sinne ein Bodhisattva war, und zwar ein im Sinne der Geheimwissenschaft dem Christus dienender und ihm folgender Bodhisattva – ein Bodhisattva, dessen Mission und Aufgabe es war und ist, die Erkenntnis der geistigen Welten, die Geisteswissenschaft, nicht nur hervorzubringen, sondern die Menschen dazu zu befähigen, diese Geisteswissenschaft selbstständig zu pflegen und weiterzuentwickeln, um damit den herrschenden Materialismus zu überwinden.
Und im selben Zusammenhang steht die mit dieser Mission aufs Engste verbundene Aufgabe Rudolf Steiners, ein wirkliches Verständnis für das Wirken und die Wesenheit des Christus zu erlangen und zu verbreiten. Eben diese Aufgabe aber, so Steiner in jenem erwähnten Vortrag vom 25. Oktober 1909, die Verbreitung eines neuen Christus-Verständnisses, sei die Aufgabe eines mit der Christus-Wesenheit verbundenen Bodhisattva.
Insofern betrachte ich Rudolf Steiner selbst seit der weiter unten noch genauer zu bestimmenden Zeit als eine Verkörperung dieses hiermit umfassten und von ihm dadurch im christlichen Sinne erneuerten Bodhisattva-Prinzips, das vor allem darin besteht, die eigenen Interessen und Bedürfnisse, den Eigennutz und letztlich den in der menschlichen Natur tief verankerten Egoismus zugunsten der Bedürfnisse, Interessen und Nöte aller anderen Menschen und Wesen auf dieser Erde zurückzustellen.
Zu dem Wirken im Sinne dieses Bodhisattva-Prinzips gehört vor allem der unmittelbar an die Veröffentlichung des Aufsatzes über den «großen Hüter» in der Aufsatzreihe zu Wie erlangt man in Lucifer-Gnosis seit Oktober 1905 erschienene mehrteilige Aufsatz über «Geisteswissenschaft und soziale Frage». In diesem Aufsatz wird das oben beschriebene Bodhisattva-Prinzip, ohne es explizit so zu benennen, als Grundlage einer modernen menschlichen Gesellschaft und als «soziales Hauptgesetz» erstmals formuliert: Einer Gemeinschaft von zusammenarbeitenden Menschen geht es dann am besten, wenn jeder Einzelne nicht aus Eigennutz und für sich, sondern für alle anderen Menschen tätig sein kann und seine eigenen Bedürfnisse von der Tätigkeit der anderen Menschen befriedigt werden können. Kurzum: Je weniger Egoismus in einer Menschengemeinschaft lebt, desto besser wird es ihr gehen und umgekehrt. Wir werden diesen Zusammenhang im sechsten Kapitel noch genauer untersuchen.
Neben dieser öffentlichen Wirksamkeit Rudolf Steiners, die nicht nur in dem genannten Aufsatz, sondern in zahlreichen öffentlichen Vorträgen zum Ausdruck kam, wirkte er aber auch innerhalb der Theosophischen Gesellschaft im Sinne des vom ihm erneuerten Bodhisattva-Prinzips. Dies geschah, wenn man die späteren Darstellungen Rudolf Steiners zur Wirksamkeit H. P. Blavatskys mit berücksichtigt, vor allem auch deshalb, um den durch Blavatsky selbst initiierten antichristlichen Tendenzen innerhalb der Theosophischen Gesellschaft entgegenzutreten.17
Dabei gehe ich davon aus, dass es Rudolf Steiner bei seiner an H. P. B. angelehnten Darstellung implizit darauf ankam, an die von ihm nicht erwähnte, im Bodhisattva-Ideal des Mahayana-Buddhismus enthaltene christliche Tendenz und damit an die innere Verbindung des Mahayana-Buddhismus mit dem Christentum anzuknüpfen und sich dadurch für das oben genannte, in diesem Sinne christliche Bodhisattva-Prinzip einzusetzen.18
Im letzten Kapitel gehe schließlich auf den Zeitraum von 1897 bis 1903 im Lebensgang Rudolf Steiners im Überblick ein, um den hier untersuchten Umschwung, der mit dem «Gestanden-Haben vor dem Mysterium von Golgatha» und eben mit den in den beiden erwähnten Texten beschriebenen Hüter-Begegnungen zusammenhängt, wie ihn Rudolf Steiner selbst in seiner Autobiografie angedeutet hat, noch genauer zu untersuchen und zu verstehen. Abschließend schildere ich als eine Art Ausblick auf die weiterhin offenen Fragen nach der eigentlichen Wesenheit Rudolf Steiners ein Gespräch, das eine enge Mitarbeiterin Rudolf Steiners, Anna Samweber, die ihm als geistigem Lehrer persönlich sehr nahestand, im Hinblick auf das Wesen seiner Individualität mit ihm geführt hat. Dieses Gespräch sagt sehr viel über das Geheimnis der Individualität Rudolf Steiners aus, auch über die Bedingungen, unter denen dieses Geheimnis in der Zukunft zu lösen sein könnte.19
Auf dieser hiermit insgesamt neu geschaffenen Grundlage wird es dann vielleicht auch möglich sein, sich die Frage nach der Beziehung Rudolf Steiners zum Maitreya-Bodhisattva und zu den anderen Bodhisattvas noch einmal neu zu stellen. Diese Untersuchung überlasse ich der weiteren Forschung.20
Zwei Bitten um Nachsicht seien zu Beginn meiner Ausführungen ausgesprochen: Zum einen komme ich in der Darstellung der zum großen Teil intimen Fragestellungen, die mit der Materie diese Buches zusammenhängen, nicht umhin, auch längere Passagen aus den diesbezüglichen schriftlichen und mündlichen Darstellungen Rudolf Steiners zu zitieren. Die Erfahrungen des Verfassers zeigen, dass der Originalwortlaut Rudolf Steiners, insbesondere bei schwerer verständlichen Zusammenhängen, dem Verständnis mehr entgegenkommt, als ein zusammenfassendes Referat. Zum anderen werden mit den in diesem Buch gegebenen Darlegungen der biografischen Entwicklung Rudolf Steiners bislang so noch nicht gesehene Perspektiven eingenommen. Die damit verbundenen Interpretationen mögen dem einen oder anderen Leser möglicherweise als zu gewagt erscheinen. Der Verfasser beansprucht deshalb auch nicht, der «Wahrheit letzten Schluss» über diese Zusammenhänge herausgefunden zu haben. Vielmehr hofft der Verfasser darauf, dass sich diese intimen Zusammenhänge den Leserinnen und Lesern im eigenen Durchdenken und Meditieren weiter aufschließen werden. Dadurch ergeben sich dann womöglich auch noch ganz neue, vom Verfasser nicht gesehene Fragestellungen, die dann auch zu noch weiteren Erkenntnissen führen können.
Um die Ausführungen der in diesem Buch enthaltenen esoterischen Zusammenhänge nicht zu komplex werden zu lassen und das Lesen somit zu erleichtern, bin ich auf die zum Teil schwierig zu verstehenden Zusammenhänge vor allem im Anmerkungsteil detaillierter eingegangen. Diese Anmerkungen kann man also zur Vertiefung des Verständnisses lesen. Der eigentliche Text sollte aber auch ohne diese Anmerkungen für sich verständlich sein.
An dieser Stelle möchte ich Johannes Greiner meinen herzlichsten Dank dafür aussprechen, dass er mir durch ein gemeinsames Seminar zum Bodhisattva-Weg im Buddhismus und in der Anthroposophie die Gelegenheit gegeben hat, das dort Vorgetragene schriftlich auszuarbeiten. Außerdem danke ich meinem Freund und Mitbegründer der AKANTHOS-Akademie Christoph Hueck für die kritische Lektüre von Teilen des Manuskriptes und seine wie immer hilfreichen Kommentare. Ebenso sei meinem Freund und Verleger Jean-Claude Lin für die stets offene Bereitschaft, neuen und ungewohnten anthroposophischen Ideen zur Verbreitung zu verhelfen, herzlich gedankt.
Andreas Neider
in der Advents- und Weihnachtszeit 2019
und in der Michaelizeit 2020
1. Vier Arten des Verständnisses eines Bodhisattva
Um den Begriff eines Bodhisattva, wie wir ihn in diesem Buch verwenden wollen, richtig zu verstehen, kommen wir nicht umhin, vier mögliche Verständnisformen eines Bodhisattva zu unterscheiden.
Zunächst haben wir die bekannteste und auch von Rudolf Steiner häufig gebrauchte Form,21 nämlich den Bodhisattva als die letzte Inkarnation eines Menschen vor dem Aufstieg zum Buddha. Der historische Buddha war in diesem Sinne in seinem uns bekannten Erdenleben ein Bodhisattva, der durch seine Erleuchtung zum Buddha wurde und sich nach seinem Tod folglich nicht mehr inkarnierte. Im buddhistischen Kontext meint der indische Ausdruck «Bodhisattva» ein nach Erleuchtung und Befreiung von irdischem Leiden strebendes menschliches Wesen. Auf den historischen Buddha folgt in der Tradition des Mahayana-Buddhismus, an die sich auch Rudolf Steiner angelehnt hat, der Maitreya-Bodhisattva, der sich vor seiner letzten Inkarnation laut Rudolf Steiner immer wieder auf Erden inkarnieren wird, um im Sinne des Christus wirksam zu sein. Dabei inkarniert sich aber ein solcher Bodhisattva im Verständnis Rudolf Steiners nur in seiner letzten Inkarnation vollständig in einem menschlichen Leib.
Als zweite Form gibt es im Hinblick auf den zum historischen Buddha gewordenen Bodhisattva aber die von Rudolf Steiner mitgeteilte Tatsache, dass sich der historische Bodhisattva nach seinem Aufstieg zum Buddha nicht in das Nirvana zurückgezogen hat, sondern in Form eines Geistleibes, des Nirmanakaya, weiterhin auf Erden wirksam war und ist. Die Wirksamkeit des «Nirmanakaya» des Buddha hat Rudolf Steiner vor allem in den Vorträgen über das Lukas-Evangelium ausführlich beschrieben, und zwar in einer deutlich über das Verständnis des «Nirmanakaya» im Buddhismus hinausreichenden Form.22
Diese Wirksamkeit entspricht insofern einem Bodhisattva, als dieser sich im Zusammenhang des Mahayana-Buddhismus, der erst nach dem Mysterium von Golgatha entstanden ist, durch ein Gelöbnis verpflichtet, sich nicht in das Nirvana zurückzuziehen, sondern auch nach seiner Erleuchtung auf Erden so lange weiterzuwirken, bis alle Wesen von irdischem Leiden befreit sein werden. Im Falle des historischen Buddha inkarnierte sich also diese Bodhisattva-Wesenheit nicht mehr in einem physischen Leib, sondern erscheint in Form eines «Nirmanakaya» wirksam.
Als dritte Form unterscheidet der Buddhismus die transzendenten oder kosmischen Bodhisattvas, die mit den zu ihnen gehörenden transzendenten oder kosmischen Buddhas zusammenwirken. Im Wesentlichen gibt es im Mahayana-Buddhismus acht solcher kosmisch wirksamen Bodhisattvas. Diese inkarnieren sich nicht als Mensch, können aber sehr wohl durch einen Menschen hindurch wirken. Von solcher Wirksamkeit hat auch Rudolf Steiner an verschiedenen Stellen gesprochen.23
Auch auf diese Form wollen wir in unserer Darstellung jedoch nicht näher eingehen. Eine der bekanntesten, kosmisch wirksamen Bodhisattva-Wesenheiten ist der zum kosmischen Amitaba-Buddha24 gehörige Bodhisattva Avalokiteshvara, der im japanischen Buddhismus Kannon und im chinesischen Buddhismus als weiblicher Bodhisattva Guanyin bekannt ist. Die künstlerische Darstellung Avalokiteshvaras zeigt eine Wesenheit mit zehn Köpfen, die übereinander und in alle Himmelsrichtungen angeordnet erscheinen. Dabei hat er hunderte von Armen und Händen, in denen sich Augen befinden. Avalokiteshvaras Haupteigenschaft ist die Fürsorge für alle in Not befindlichen Menschen. Im Mahayana-Buddhismus kann sich der Praktizierende daher immer an Avalokiteshvara, Guanyin oder Kannon wenden, wenn er sich in Not befindet.
Uns interessiert jedoch in diesem Buch hauptsächlich die vierte Form eines Bodhisattva, nämlich die ebenfalls aus dem Mahayana-Buddhismus stammende und eigentlich in diesem Kontext gebräuchlichste Form: der Bodhisattva als Erleuchtungswesen, der auf dem Wege zur Erleuchtung ein Gelöbnis ablegt, das sogenannte Bodhisattva-Gelöbnis, welches besagt, dass der nach Erleuchtung strebende Geistesschüler sich nicht zum eigenen Vorteil, das heißt um der möglichst schnellen eigenen Befreiung willen auf den Wege eines Bodhisattva begibt. Er will sich nur deshalb befreien, um auch allen anderen Wesen zur Befreiung und Erleuchtung verhelfen zu können. Deshalb geht es für ihn auch nicht um das möglichst schnelle Erreichen eines jenseitigen Nirvana. Das Ideal eines Bodhisattva besteht für ihn vor allem darin, sich so lange auf Erden wieder zu verkörpern, bis auch alle anderen Wesen befreit und erleuchtet worden sind. Diese im Zusammenhang mit dem Bodhisattva-Ideal stehende Form eines Bodhisattva ist im Mahayana-Buddhismus nicht auf eine einzelne auserwählte Persönlichkeit beschränkt. Sie ist vielmehr mit einem weiter unten näher beschriebenen allgemein zugänglichen Schulungsweg verknüpft. Auf diesen Schulungsweg werden wir in den nächsten beiden Kapiteln anhand zweier ausgewählter Quellentexte genauer eingehen.
2. Der Bodhisattva-Weg und das Bodhisattva-Ideal im Mahayana-Buddhismus
Das sogenannte Bodhisattva-Ideal spielt sowohl im Mahayana- wie im Tibetischen Buddhismus eine wichtige Rolle. Wir können an dieser Stelle jedoch nicht im Detail auf die komplizierten und zahlreichen Verzweigungen der buddhistischen Entwicklung und Lehre eingehen.25 Wir beschränken uns daher auf eine der wichtigsten historischen Quellen des Mahayana-Buddhismus, weil diese Tradition später für H. P. Blavatsky den Bezugspunkt bildete, indem sie das Bodhisattva-Gelübde des Mahayana-Buddhismus in ihrer kleinen Schrift Die Stimme der Stille aufgriff. Dieser Bezugspunkt wurde dann auch für Rudolf Steiner zu einer wichtigen Quelle seiner Darstellung des «großen Hüters» in Wie erlangt man, wobei er diese Quelle, ohne sie genauer zu bezeichnen, in entscheidender Weise metamorphosiert hat.
An der Art, wie er diese am Buddhismus orientierte Darstellung Blavatskys in den zwei einander ergänzenden Texten über die Begegnung des Geistesschülers mit dem «großen Hüter» in Wie erlangt man und in der Geheimwissenschaft in eine vollkommen eigenständige und christlich orientierte Darstellung umgewandelt hat, lässt sich in eindrucksvoller Weise zeigen, wie Steiner aus der stark unter östlichem Einfluss entstandenen Theosophie, wie sie in der Theosophischen Gesellschaft gepflegt wurde, die mitteleuropäisch-christlich geprägte Anthroposophie entwickelt hat.26
Zuerst tauchte das Bodhisattva-Ideal und das damit verbundene Gelöbnis, sich um der Befreiung aller leidenden Wesen willen immer weiter zu inkarnieren und sich nicht in das Nirvana zu begeben, im sogenannten Avatamsaka-Sutra, das um die Zeitenwende herum begonnen und im 3.–4. Jahrhundert vollendet wurde, auf.27 Auf dieses Sutra bezieht sich auch die für unseren Zusammenhang wichtigste Quelle, das im 8. Jahrhundert entstandene Bodhisattva-Caryavatara des Shantideva.
Shantideva war ein indisch-buddhistischer Mönch, der im 8. Jahrhundert in Nordindien lebte. Dort verfasste er seine zehn Kapitel umfassende Schrift, in der der Weg eines Bodhisattva und das mit einem Gelöbnis verbundene Ideal eines Bodhisattva grundlegend beschrieben werden.28 Im Mahayana-Buddhismus, der der kleinen Schrift Shantidevas zugrunde liegt, kommt diesem Gelöbnis eine zentrale Rolle zu. Denn der mit diesem verbundene Weg hat nicht mehr wie im ursprünglichen Buddhismus die eigene Befreiung von allen Leiden zum Ziel, sondern in altruistischer Weise das Mitleid mit allen leidenden Wesen und deren Befreiung. Die eigene Befreiung wurde mithin nur gesucht, um auf der Grundlage der eigenen Ungebundenheit allen anderen Wesen zur Befreiung verhelfen zu können.
Damit war es auch im Alltag eines normalen Menschen, der sich nicht hinter Klostermauern zurückziehen konnte, möglich, die Laufbahn eines Bodhisattva einzuschlagen und in der Entwicklung der «Paramitas», der sechs Vollkommenheiten, einer Gruppe ethischer und intellektueller Tugenden, seinen Vorbildern nachzuleben.29