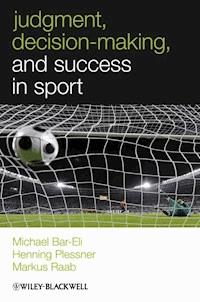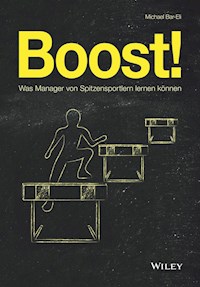
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Um in jeder Situation - in Ihrer Karriere, Ihren Hobbys, Beziehungen oder in jeder Facette Ihres Lebens - bessere Leistungen zu erbringen, ist es wichtig, psychologische Fähigkeiten zu entwickeln, die ebenso wie körperliche Fähigkeiten gelehrt, erlernt und geübt werden können. Sowohl als Einzelpersonen als auch als Gruppe können wir diese psychologischen Fähigkeiten trainieren und nutzen, um das Bewusstsein zu schärfen, Talente und technische Fähigkeiten zu fördern und Spitzenleistungen zu erreichen. Mentale Bereitschaft und psychologisches Bewusstsein sind der Schlüssel zum Erfolg in jeder Umgebung.
Nur wenige verstehen die Bedeutung psychologischer Fähigkeiten besser als der international anerkannte Professor Michael Bar-Eli. Als Sport- und Organisationspsychologe seit mehr als 35 Jahren erforscht Bar-Eli nicht nur die Wissenschaft der Leistung, sondern arbeitet auch direkt mit Spitzensportlern, Trainern und Teams zusammen, um ihnen zu helfen, ihren Erfolg auf dem Platz oder Feld zu verbessern. Boost! nimmt die Lektionen, die er aus der Sportpsychologie gelernt hat, und übersetzt sie für Führungskräfte und Manager in jeder Phase ihrer Karriere. Bar-Eli zeigt, wie jeder diese Lektionen anwenden kann, um Mitarbeiter und Angestellte besser zu unterstützen und zu inspirieren sowie ein nachhaltiges, erfolgreiches Arbeitsumfeld und Geschäft zu schaffen.
Boost! schlüsselt die komplexe Verhaltensforschung des "Vorwärtskommens" auf. Durch originelle wissenschaftliche Forschung, einzigartige Fallstudien und Anekdoten aus der Welt des Sports und darüber hinaus erklärt Bar-Eli die psychologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens und wie wir dieses Wissen nutzen können, um größtmöglich erfolgreich zu sein und unsere Karriere und unser Privatleben zu meistern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Deckblatt
Titelseite
Impressum
Widmung
Einführung
1. Teil: Aktiv werden
1. Anspannung: Ist Stress wirklich so schlecht?
2. Motivation: Die Antriebskraft definieren
3. Bestrebungen: Leistungssteigerung durch klare Zielsetzung
2. Teil: Verhalten kalibrieren
4. Selbstvertrauen: Der Umgang mit erwarteten und unerwarteten Hindernissen
5. Entscheidungen: Handeln oder Nichthandeln?
6. Kreativität und Innovation: Flops und Hits
3. Teil: Zusammenarbeiten
7. Zusammenhalt: Alle für einen und einer für alle!
8. Teamaufbau: Die Suche nach den richtigen Leuten für das richtige System
9. Führungswerte: Das Ruder übernehmen
4. Teil: Mentale Stärke entwickeln
10. Mentale Vorbereitung I: Imagination und Visualisierung in den Alltag integrieren
11. Mentale Vorbereitung II: Grundprinzipien einer wirksamen Psychoregulation
12. Ethisches Verhalten: Ist Gewinnen tatsächlich alles?
Fazit
Danksagung
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Liste der Tabellen
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Elfmeter-Ergebnisse
Tabelle 5.2: Verteilung der erfolgreichen und abgewehrten Torschüsse
Liste der Abbildungen
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Yerkes-Dodson-Gesetz
Abbildung 1.2: Flow- Zustand und (I)ZOF
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Motivationszustand versus Leistung
Abbildung 2.2: Komponenten und Ebenen der Motivation
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Der Straddle oder Wälzsprung
Abbildung 6.2: Der Fosbury-Flop
Abbildung 6.3: Entwicklung der Hochsprung-Weltrekorde, 1910 – heute (durchgezogene Linie).
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Positives Aufgaben-Soziogramm: Person, mit der man gerne auf dem Spielfeld/im Unternehmen zusammenarbeiten würde
Abbildung 8.2: Negatives Aufgaben-Soziogramm: Person, mit der man ungerne auf dem Spielfeld/im Unternehmen zusammenarbeiten würde
Abbildung 8.3: Positives soziales Soziogramm: Person, die Ihnen im Team am meisten zusagt (z. B. Ihr bester Freund im Team)
Abbildung 8.4: Negatives soziales Soziogramm: Person, die Ihnen im Team am wenigsten zusagt (zum Beispiel die Sie nicht mögen)
Abbildung 8.5: Positives Führungssoziogramm: Die Person, die sich am besten als Teamleiter/Mannschaftskapitän eignet
Abbildung 8.6: Negatives Führungssoziogramm: Die Person, die sich am wenigsten als Teamleiter/Mannschaftskapitän eignet
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Die Dimensionen der Psychoregulation
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Die Lombardische Spielvariante
Abbildung 12.2: Die Machiavellistische (oder Nicolo-basierte) Spielvariante
Abbildung 12.3: Die Coubertinsche Spielvariante
Guide
Cover
Table of Contents
Begin Reading
Pages
3
4
5
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
e1
Michael Bar-Eli
Boost!
Was Manager von Spitzensportlern lernen können
Aus dem Englischen von Ursula Bischoff
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
Das englische Original erschien 2018 unter dem Titel Boost. How the Psychology of Sports Can Enhance Your Performance in Management and Work bei Oxford University Press, 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States.
© Oxford University Press 2018
All rights reserved.
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Umschlaggestaltung: bauer-design, Mannheim
Umschlagabbildung: faithie@stock/adobe.com
Satz: Lumina Datamatics
Print ISBN: 978-3-527-50972-0
ePub ISBN: 978-3-527-82382-6
Für Asaph, meinen Grund für alles
Einführung
»It’s now or never …«
Elvis Presley
Der 7. Juli 1974 war ein strahlender Sommertag, ein Sonntag. Als junger israelischer Soldat auf Urlaub sah ich mir das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft, Deutschland (die BRD zu damaliger Zeit) gegen die Niederlande, im Olympiastadion in München an. Johan Cruyff, das Aushängeschild der niederländischen Mannschaft, hatte gerade den Ball in seinen Besitz gebracht und dribbelte in Richtung Tor, dann beschleunigte er plötzlich sein Tempo und stürmte in den Strafraum. Noch bevor die Deutschen den Ball auch nur das erste Mal berühren konnten, wurde Cruyff gefoult und dem niederländischen Team ein Strafstoß zuerkannt.
Johan Neeskens, der den Strafstoß ausführen sollte, zielte auf die Mitte des Tors, doch Torwart Sepp Maier vollführte einen Hechtsprung, wie bei Torhütern häufig der Fall. Der Ball landete im Netz. Die Niederlande führten 1:0, und seit Spielbeginn waren erst zwei Minuten vergangen. Obwohl die Niederlande am Ende 1:2 verloren, hätte dieser Strafstoß Deutschland den Titel kosten können. Aber warum sprang Maier? Hätte er einfach stillgestanden und sich nicht vom Fleck bewegt, wäre ihm der Ball buchstäblich in die Arme gefallen!
Rückblickend geht mein Interesse an Sportpsychologie auf jenen spannenden Abend zurück. Während der folgenden zwanzig Jahre ließ mich die Torwart-Frage nicht mehr los, zumal ich ähnliche Situationen immer wieder miterlebte – es hatte den Anschein, als wären Torhüter darauf programmiert, den Ball mit einem Hechtsprung abzufangen, selbst dann, wenn es wesentlich effektiver gewesen wäre, die Stellung in der Mitte des Tors zu halten. Nach Beendigung meiner Militärzeit erhielt ich meine Promotion und wurde Universitätsprofessor, aber die Frage trieb mich nach wie vor um. Erst 1995 gelang es mir gemeinsam mit einigen Kollegen, sie aus der wissenschaftlichen Perspektive aufzurollen und die Aktivitäten eines Torwarts empirisch zu erforschen, was zu einer 2007 veröffentlichten Studie führte.
Wir werteten Videoaufnahmen von Strafstößen aus, die weltweit bei Fußballspielen (der Männer) in der ersten Liga und bei Meisterschaften gesammelt wurden. Wir stellten fest, dass sich die Torhüter fast immer nach links oder rechts bewegten, um den Ball abzuwehren, obwohl die Chancen größer gewesen wären, wenn sie ihre Position in der Mitte des Tors beibehalten hätten. Weitere Studien und Analysen dieses nicht-optimalen Verhaltens führten zu der Entdeckung, dass offenbar eine »Handlungsneigung« vorlag – der Impuls eines Menschen oder einer Gruppe, auch dann aktiv zu werden, wenn es nutzlos ist oder den eigenen Interessen zuwiderläuft. Anders ausgedrückt: Die Torhüter glaubten, während eines Strafstoßes »etwas tun« zu müssen, weil Nichtstun (zum Beispiel in der Mitte bleiben) im Falle eines Tors ein schlechteres Gefühl in ihnen ausgelöst hätte, als wenn sie aktiv geworden wären (zum Beispiel mit einem Hechtsprung); daher die Handlungsneigung.
»Interessant«, sagen Sie vielleicht. »Und was soll das?« Sie haben Recht: Ich hätte es dabei bewenden lassen und die Entdeckungen nutzen können, um Torhütern vor Augen zu führen, wie sie ihre Leistungen künftig verbessern. Aber mir fiel auf, dass die Anwendungsmöglichkeiten dieser Studie wesentlich breiter gefächert sind. Ich gelangte zu einer einfachen Maxime: Manchmal ist Nichthandeln die beste Handlungsoption. Und das gilt nicht nur in der Welt des Fußballs. Gleich ob es um Aktienverkäufe geht, wenn der Markt einen Tiefstand erreicht hat (statt den unvermeidlichen Aufschwung abzuwarten); um Vorträge, die so oft geprobt werden, bis sie einstudiert und steif klingen (statt locker und fließend); um Entscheidungen, bei denen man das Für und Wider akribisch auflistet (statt auf das eigene Bauchgefühl zu hören); oder um das Mikromanagement eines Teams oder einer Firma (statt Mitarbeitern eigenständiges Arbeiten zu ermöglichen) – wir alle verschwenden Zeit und Energie damit, »zu handeln«, obwohl es besser wäre, wenn wir uns zurücklehnen und der Natur ihren Lauf lassen würden.
Diese einzigartige, keineswegs intuitive Maxime fand großen Widerhall sowohl in der Wissenschaftsgemeinde als auch in den Medien. 2008 wurde die Studie im New York Times Magazine als eines der innovativsten, bahnbrechendsten Forschungsprojekte des Jahres bezeichnet. Mir wurde klar, dass es in einem Großteil meiner Forschungsarbeiten, die sich schon seit Jahren auf den Sport konzentriert hatten, eigentlich immer um die menschliche Leistung generell ging.
Das Leistungskonzept – die Messung und Beurteilung eines zielgerichteten Verhaltens – spielt in der westlichen Kultur der Gegenwart eine Schlüsselrolle. Jeder ist bestrebt, besser zu werden – nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch, was Hobbys, Beziehungen und andere Aktivitäten gleich welcher Art betrifft. Und um die eigene Leistung in gleich welcher Situation zu steigern, ist die Fokussierung und Entwicklung der psychischen Fähigkeiten unabdingbar, die den Erfolg begünstigen.
Genau wie ihre physischen Entsprechungen können auch psychische Fähigkeiten gelehrt, gelernt und durch Übung feingeschliffen werden. Wenn Sie das menschliche Verhalten sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen besser verstehen, können Sie diese psychische Kompetenz stetig weiterentwickeln und nutzen, um Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu schärfen, Talente und Fertigkeiten auszubauen und Ihren persönlichen Leistungsgipfel zu erreichen. Dabei stehen die mentale Leistungsbereitschaft und psychische Achtsamkeit im Vordergrund – sie befähigen uns, in jedem Umfeld erfolgreich zu sein.
Als einer der ersten Forscher mit Schwerpunkt auf den psychischen Einflussfaktoren, die eine prägende Auswirkung auf menschliche Spitzenleistungen im Sport haben – beispielsweise Stress, Anspannung, Motivation, Bestrebungen, Selbstvertrauen, Entscheidungsprozesse, Sozialdynamik, mentale Vorbereitung und ethisches Verhalten – habe ich festgestellt, dass diese Determinanten nicht nur für den Sport von entscheidender Bedeutung sind. Ich begann, Gemeinsamkeiten zu entdecken: zwischen dem Verhalten und der mentalen Leistungsbereitschaft von Spitzenathleten und Firmenlenkern; bei der Kreativität, die Hochsprung-Champions und die innovativsten Unternehmen gleichermaßen auszeichnet; bei der Fähigkeit, Teams zu motivieren und zu führen, gleich ob als Trainer einer Baseballmannschaft oder als CEO eines Fortune-500-Unternehmens; bei Zielsetzungen im Firmen- und im Sportsektor; beim Streben nach einem optimalen Stressniveau, um Präsentationen oder Strafstoß-Aktivitäten zu verbessern; und in vielen anderen Bereichen.
Die Denk- und Verhaltensmuster, die mit Spitzenleistungen im Sport einhergehen, führen auch bei vielen anderen menschlichen Vorhaben zu Spitzenergebnissen. Lektionen aus der Sportpsychologie lassen sich auf sämtliche Bereiche anwenden, in denen wir uns bemühen, menschliches Verhalten zu verstehen, sind aber besonders aussagekräftig in der Welt der Unternehmen, der Wirtschaft und der Finanzen.
Angesichts der aktuellen Fortschritte bei der Entschlüsselung des Verhaltens von Einzelpersonen und Gruppen sind die Lektionen für Führungskräfte in einem zunehmend vielfältigen internationalen Unternehmens- und Wirtschaftsumfeld heute wichtiger als jemals zuvor. Heute ist es für jeden, der ein Team leitet – gleich ob im mittleren Management oder auf höchster Leitungsebene – ein absolutes Muss, diese Lektionen über die Unterstützung, Anleitung und Motivation von Kollegen und Mitarbeitern umzusetzen, um ihnen zu helfen, ihre persönliche Maximalleistung zu realisieren und ein Arbeits- und Unternehmensumfeld zu schaffen, das den Erfolg nachhaltig fördert. Durch Beobachtung der ganz spezifischen psychischen Kräfte, die menschliches Verhalten antreiben, können Führungskräfte in allen Sparten lernen, ihren »Sweetspot«, sprich ihre effektive Zone zu finden, um ihre eigene Leistung und die ihres Unternehmens zu verbessern und stetig zu steigern.
Als Sportpsychologe habe ich dieses Thema nicht nur seit annähernd vier Jahrzehnten erforscht, analysiert und darüber geschrieben, sondern auch in der Praxis mit Sportlern, Trainern und Mannschaften an der Verbesserung ihrer Leistungen gearbeitet. In diesem Buch werden die Lektionen aus der Sportpsychologie auf die menschlichen Verhaltensweisen und Leistungen übertragen; sie zeigen, dass wir dieses Wissen nutzen können, um persönliche Spitzenleistungen zu erzielen und den Erfolg sowohl im Berufs- als auch im Privatleben zu fördern.
Vielleicht fragen Sie sich, warum dieses Buch erst jetzt entstanden ist, obwohl ich schon Anfang der 1970er Jahre, als ich noch Soldat war, über die psychischen Einflussfaktoren der menschlichen Leistung nachgedacht hatte. Das liegt zum Teil daran, dass sich Wissenschaftler generell einem Problem gegenübersehen: Sie haben gelernt, Ideen mit wissenschaftlicher Präzision zu formulieren und schriftlich festzuhalten. Vielleicht habe ich mich auf diesem vertrauten wissenschaftlichen Terrain einfach sicherer gefühlt … doch dann trat etwas ein, was meine Lebenssicht dramatisch veränderte und mich aus einem tief verwurzelten Gefühl der Dringlichkeit bewog, dieses Buch zu schreiben. Es begann mit einem winzigen, kaum merklichen Zittern meiner rechten Hand – nichts, was besonderer Aufmerksamkeit bedurfte. Erst später fand ich heraus, dass es ein erster Gruß meines neuen Lebenspartners war: die Parkinson-Krankheit.
Danach entwickelten sich nach und nach motorische Symptome, beispielsweise Muskelstarre, Schwierigkeiten beim Gehen, allgemeine Verlangsamung und gelegentlich zittrige Hände. Schreiben wurde zum Kraftakt, und meine Handschrift schrumpfte auf Miniaturformat. Die Medikamente konnten die Symptome weitgehend in Schach halten, vor allem die motorischen Beeinträchtigungen, obwohl die Wirkung mit dem Fortschreiten der Krankheit vermutlich nachlassen wird. Infolgedessen begab ich mich auf eine Selbstfindungsreise, dachte über meine Vergangenheit und meine Zukunft nach und überlegte, was ich nun mit der Zeit anzufangen gedachte, die mir für eine annehmbare Lebensqualität blieb.
Mir wurde klar, dass es mir trotz der medikamentösen Behandlung nur für eine begrenzte Zeitspanne möglich sein wird, mehr oder weniger normal zu arbeiten. Ich begriff, dass sich auch dann, wenn meine grauen Zellen einigermaßen intakt blieben, meine Hände früher oder später weigern würden, sich den Anordnungen des Gehirns zu fügen und die Tastatur zu bedienen. In dem Augenblick wusste ich, dass ich dieses Buch schreiben musste¸ jetzt oder nie. Wie Elvis sang: »It’s now or never.«
In den folgenden Kapiteln spüren wir den verborgenen und oftmals übersehenen psychischen Kräften nach, die menschliche Leistungen antreiben. Ich habe dabei auf meine ursprünglichen Forschungen und praktischen Erfahrungen im Sport – und in anderen Bereichen, wie Bildung, Militärwesen, Kunst, Literatur und Geschichte – zurückgegriffen, um Schlussfolgerungen und Erkenntnisse im Rahmen eines breiteren Leistungsspektrums zu veranschaulichen und zu zeigen, wie sie von Einzelpersonen, Organisationen und Teams bei Projekten und Aktivitäten gleich welcher Art in die Praxis umgesetzt werden können. Sie haben allgemeine Gültigkeit, sind aber besonders effektiv in Situationen mit starkem Wettbewerbsdruck, Stress oder existenzgefährdenden Risiken.
Diese Lektionen sind für Fach- und Führungskräfte aller Ebenen, die nicht nur ihre individuelle Leistung verbessern, sondern auch ihre Mitarbeiter inspirieren und zum Gesamterfolg ihres Unternehmens oder Teams beitragen wollen, von unschätzbarem Wert.
In diesem Fall ist Handeln angesagt: Fangen wir also an!
1. Teil:AKTIV WERDEN
1.Anspannung: Ist Stress wirklich so schlecht?
»Lauf, Forrest! Lauf!«
Jenny zu Forrest in Forrest Gump
Als Jugendlicher begeisterte ich mich für alles, was mit der Luftfahrt zu tun hatte, und wollte unbedingt Flugzeugmodelle aus Kunststoff und Balsaholz nachbauen. Meine erste Eigenkreation war eine Mikojan-Gurewitsch (MiG) 17, ein sowjetisches Kampflugzeug, das 1952 seinen Dienst aufgenommen hatte. Als Fünfzehnjähriger kollidierte diese Freizeitbeschäftigung jedoch mit meinem ungeduldigen Charakter, sodass mein erstes auch mein letztes selbstgebautes Modell wurde. Dennoch hängte ich es stolz in mein Zimmer, wo ich es jahrelang Tag und Nacht vor mir sah.
Jahre später, am Montag, den 8. Oktober 1973, war ich als Soldat der Israelischen Streitkräfte in der Wüste Sinai an einem Stützpunkt für Hawk-Flugabwehrraketensysteme stationiert. Der Jom-Kippur-Krieg war ausgebrochen; Ägypten und Syrien hatten Israel unverhofft angegriffen, und wir regulären Wehrpflichtigen hatten keine Ahnung, was genau passiert war. Wir wussten nur, dass vor jedem Angriff der ägyptischen Luftwaffe ein Fliegeralarm ertönte, der uns ermöglichte, uns beizeiten in Sicherheit zu bringen.
Doch an jenem Tag geschah nichts dergleichen.
Wir waren im Freien, arbeiteten an den Raketen und Startrampen, um sie für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Plötzlich – ohne jede Vorwarnung – sah ich mein Flugzeugmodell vor mir, so dicht, als befände sich die MiG nur wenige Schritte entfernt. Mir wurde bewusst, dass sie bereits über uns hinweggeflogen war, doch wenn weitere Kampfflugzeuge folgten, würden sie aus der Richtung der Sonne kommen (um die Flugabwehreinheiten zu blenden). Und richtig, von dort nahte eine weitere MiG 17, hielt direkt auf uns zu. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte – ich hatte keine Zeit zum Überlegen, reagierte blind.
»MiGs!«, brüllte ich, und alle stürmten los, um Schutz zu suchen. Ich rannte wie verrückt und stürmte in den nächsten Bunker, unmittelbar bevor der Eingang von zwei Raketen getroffen und vollkommen zerstört wurde. Ich erinnere mich noch heute, mehr als vierzig Jahre später, an den Geruch der Explosion.
Als der Spuk vorüber war, kroch ich aus dem halbzerstörten Bunker und entdeckte zwei riesige Krater im Sand. Sie erinnerten an eine Mondlandschaft, aber sie stammten von einer 250-Kilo-Bombe, die genau dort eingeschlagen hatte, wo ich ein paar Sekunden früher entlanggelaufen war. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich nicht auf Anhieb die MiG erkannt, die anderen gewarnt und Schutz gesucht hätte. Als ich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, überwältigte mich der Schock. Der 8. Oktober ist seither »mein zweiter Geburtstag«, weil ich weiß, dass ich das große Glück hatte, zu überleben. Und seit mehr als vierzig Jahren bewegt mich die Frage: Schulde ich meine Rettung einem Zufall oder der Vorsehung?
Fakt ist, dass beide eine Rolle spielten, aber ein weiterer wichtiger Faktor kam hinzu: das menschliche Gefühl der Anspannung. Anspannung – definiert als psychophysiologischer Zustand erhöhter Achtsamkeit und Reaktionsbereitschaft auf äußere Reize – ist stets mit von der Partie, wenn es um Stress, Nervosität, Druck, aber auch um Motivation geht. Das Konzept lässt sich Jahrtausende zurückführen, in die Zeit unserer prähistorischen Vorfahren.
Wenn sich die Menschen in grauer Vorzeit von Angesicht zu Angesicht einem Bären oder dem Angriff eines anderen Raubtiers gegenübersahen, blieben ihnen drei Reaktionsmöglichkeiten: kämpfen, fliehen oder die Suppe auslöffeln. Anders ausgedrückt: Sie konnten nicht von der Stelle weichen, sich umdrehen und Fersengeld geben oder mit den Folgen leben. Auch damals waren das menschliche Gehirn und das menschliche Verhalten schon in der Entwicklung begriffen, und die innere Anspannung trug zur Leistungs- und Überlebensfähigkeit bei.
In der Welt der Unternehmen werden Sie, genau wie im Sport, nicht mit Situationen konfrontiert, die über Leben und Tod entscheiden, wie die Soldaten in der Schlacht oder der prähistorische Mensch, der sich gegen Bären behaupten musste, aber Anspannung oder ein hohes Maß an Stress lassen sich sowohl in gewöhnlichen als auch in außergewöhnlichen Situationen zu Ihrem Vorteil nutzen. Ein gesunder, positiver Umgang mit Stress führt nicht nur zu größerer beruflicher Produktivität, sondern auch zu mehr Zufriedenheit und Erfüllung in allen Lebensbereichen.
Stresstheorien
»Es ist weder die stärkste Spezies, die überlebt, noch die intelligenteste, sondern diejenige, die sich am besten an Veränderungen anpasst.«
Charles Darwin zugeschrieben1
In den 1930er Jahren entwickelte der in Österreich geborene kanadische Mediziner Hans Selye (1907-1982) die Theorie, dass das Allgemeine Anpassungssyndrom (AAS) für die kurz- und langfristigen Reaktionen des Körpers auf »Stress« verantwortlich sei, ein Begriff, den er prägte. Stress ist das Reaktionsmuster des Körpers auf eine Bedrohung oder Herausforderung, und es beinhaltet drei Phasen: Alarm, Widerstand und Erschöpfung oder Erholung. Die Logik, die sich dahinter verbirgt, ist einfach: Wenn der Körper angegriffen wird (unter Anspannung steht), muss er als Erstes die Bedrohung oder Herausforderung identifizieren (Alarmphase) und danach zusätzliche Ressourcen für den Umgang mit der Situation bereitstellen und mobilisieren, vor allem Energie.
Während der 1920er Jahre entwickelte Walter Bradford Cannon (1871-1945), Professor für Physiologie an der Harvard Medical School, das sogenannte Konzept der »Homöostase«, das sich auf das Bemühen bezieht, den Gleichgewichtszustand zwischen dem menschlichen Körper und seiner Umgebung Tag für Tag aufrechtzuerhalten. Wird dieses Gleichgewicht gestört – beispielsweise durch eine akute, unverhoffte Bedrohung –, muss der Körper seine Energiereserven zur Verfügung stellen und die Aufmerksamkeit auf die Bewältigung der bedrohlichen Situation konzentrieren.
Nach der Mobilisierung der Energie bleibt der Widerstand noch eine Weile auf einem hohen intensiven Aktivierungsniveau, bis eine von zwei Phasen eintritt: die Erholungsphase, in der die Bedrohung erfolgreich überwunden, entfernt oder ausgemerzt wurde und die Rückkehr in den Normalzustand der Homöostase stattfinden kann; oder die Erschöpfungsphase, in der sämtliche Bewältigungsmechanismen erfolglos eingesetzt wurden und wir der Belastung, die von der Bedrohung ausgeht, nichts mehr entgegenzusetzen haben.
Die Natur hat den Stress geschaffen, um unsere Überlebensfähigkeit zu stärken – so einfach ist das. Ein hohes Maß an Stress liefert uns die zusätzliche Energie, die wir brauchen, um uns in Situationen zu behaupten, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen; dann greifen wir auf sämtliche Ressourcen zu, die unerlässlich sind, um uns zu schützen und mit der Bedrohung fertigzuwerden. Aber was ist mit der täglichen Leistung, die uns abverlangt wird, auch ohne Bedrohung oder Gefahr im Verzug?
Stress und Leistungsbereitschaft
»Stress ist nicht zwangsläufig negativ; es kommt darauf an, wie man damit umgeht.«
Hans Selye, »Vater der Stressforschung«
Ein klassisches Experiment, das 1908 von Robert M. Yerkes (1876-1956), einem Pionier der US-amerikanischen Psychologie, und seinem Kollegen John D. Dodson durchgeführt wurde, ist für die Frage, wie Stress die Leistung beeinflusst, von zentraler Bedeutung. Die beiden Forscher untersuchten »die Beziehung zwischen der Stärke eines Reizes und der Geschwindigkeit der Gewohnheitsbildung«, so der Titel ihrer Studie, die im Journal of Comparative Neurology and Psychology veröffentlicht wurde. Sie entdeckten, dass Mäuse, denen man regelmäßig leichte Elektroschocks verabreichte, leichter lernten, aus einem Labyrinth hinauszugelangen. Waren die Stromstöße zu schwach oder zu stark, fielen die Leistungen der Mäuse ab. Auf dieser Erkenntnis aufbauend, entwickelten sie das sogenannte Yerkes-Dodson-Gesetz, das den Zusammenhang zwischen Stress und Leistungsfähigkeit zeigt, dargestellt als U-förmige Kurve. Die Leistungsfähigkeit steigt mit dem Erregungs- oder Aktivierungsniveau, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt; erhöht sich das Niveau über dieses Maß hinaus, tritt ein negativer Effekt ein: Die Leistungsfähigkeit nimmt ab (wie bei einem umgekehrten U, siehe Abbildung 1.1). Ist das Erregungs- oder Aktivierungsniveau zu niedrig, lässt die Leistungsfähigkeit ebenfalls nach.
In alltäglichen Situationen kann ein ideales Stress- und Erregungsniveau dazu beitragen, dass wir Aufgaben bewältigen, Leistungserwartungen gerecht werden oder übertreffen und Schwierigkeiten überwinden. Denken Sie an den zusätzlichen Druck am Arbeitsplatz, wenn ein wichtiger Termin bevorsteht – manchmal fühlt er sich überwältigend an, aber er kann auch zu Ihrer Fähigkeit beitragen, schnell und gewissenhaft zu arbeiten. Das ist ähnlich wie bei einem Unentschieden am Ende der letzten Spielminuten im Basketball. Ein einziger Treffer kann den Sieg klarmachen, und der Druck ist zermürbend; Spieler, die unter extremer Anspannung leiden, sind anfälliger dafür, Fehler zu begehen, während diejenigen, die auch dann ihre Konzentration und ihre Spitzenleistung aufrechterhalten können, ihr Team zum Sieg führen.
Aber wenn der Stress eine so wichtige Rolle spielt, warum ist er dann dermaßen in Verruf geraten?
Abbildung 1.1: Yerkes-Dodson-Gesetz
Chronischer Stress
Ein Teil der Antwort ist der sogenannte »chronische Stress«, das heißt die Belastung durch extreme Umstände oder Situationen über einen längeren Zeitraum. Stress dieser Art wirkt wie ein Bumerang und hat mehr Nachteile als Vorteile (wie ein Blick auf die rechte Seite der Kurve in Abbildung 1.1 zeigt).
Immer mehr Forschungsergebnisse belegen, dass Überarbeitung das Privatleben beeinträchtigt, Familie, Gesundheit und die Produktivität am Arbeitsplatz eingeschlossen. Eine Studie aus dem Jahr 2015 deutet sogar darauf hin, dass Überstunden zum Tod von jährlich 120 000 Menschen beigetragen haben könnten.2 Es liegt auf der Hand, dass dieser Stress nicht gut ist, weder für Sie noch für Ihre Mitarbeiter oder Kollegen. Das ist eine wichtige Lektion für jeden Manager, Bereichsleiter oder Firmenchef: Wenn Ihre Mitarbeiter ständig unter Stress stehen, leidet die Leistung.
Im Lauf der Jahre hat man sich bemüht, die sogenannten Stressoren – diejenigen Faktoren in unserer Umgebung, die uns nachhaltig beeinträchtigen und die gleiche Wirkung haben, als sähen wir uns einer Bedrohung gegenüber – zu identifizieren und zu verorten. Für Teams im Sport kann der Schiedsrichter ein Stressfaktor sein. Ein Basketballspieler aus der ersten Liga, mit dem ich gearbeitet habe, hatte ein Problem mit einem bestimmten Schiedsrichter, den er als Bedrohung wahrnahm. Dieser hatte ihn mehrmals – nach Aussage des Spielers fälschlicherweise – beschuldigt, ein Foul begangen zu haben.
»Jedes Mal, wenn ich ihn vor mir sehe, werde ich wütend«, gestand er. »Bei ihm handle ich mir bei jedem Spiel gleich zu Beginn zwei Fouls ein.«
Mit welchem Ergebnis?
Die Wut des Spielers führte zu einem hochgradigen Erregungszustand, der ihn zu aggressivem Verhalten veranlasste. Am Ende beging er jedes Mal, wenn besagter Schiedsrichter eingesetzt war, gleich am Anfang des Spiels völlig unnötige Regelverstöße – offenbar eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Angenommen, Sie können Ihren Chef auf den Tod nicht ausstehen. Am liebsten würden Sie das tun, was Ihr prähistorischer Vorfahre mit dem Bären zu machen pflegte – ihn umbringen; die Alternative wäre, zu kündigen. Die erste Option ist jedoch zu extrem (und ungesetzlich obendrein!) und die zweite unmöglich, weil Sie Rechnungen zahlen und das tägliche Brot für Ihre Familie verdienen müssen.
Da Sie ihn jeden Tag zu Gesicht bekommen, stauen sich Wut und heimlicher Groll auf, doch statt Ihren Gefühlen Luft zu machen, lächeln Sie, versuchen freundlich zu sein und kochen sogar Kaffee für ihn. Die Unterdrückung der Gefühle kann im Lauf der Zeit zu Stress und zusätzlichem Druck führen, unter dem nicht nur die Psyche, sondern auch der Körper leidet. Sie laufen Gefahr, sich Magengeschwüre, Herzprobleme oder einen Nervenzusammenbruch einzuhandeln. Diese sogenannten »psychosomatischen Erkrankungen« sind grundlegend auf GAS zurückzuführen, generalisierte Angststörungen, die durch extreme, unkontrollierbare Sorgen gekennzeichnet sind; im Kern handelt es sich um »eingesperrte Aggressionen«, die sich schlussendlich gegen uns selbst richten – eine weitere Quelle des schlechten Rufs, der Stress anhaftet.
Wenn Sie in solchen Situationen jedes Mal in Wut geraten, bestrafen Sie sich unbewusst immer wieder für etwas, worauf Sie keinen Einfluss haben. Das bezeichne ich als »Vollgas im Leerlauf« oder FIL – bis zum Anschlag Gas geben, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Sie sind wütend und erregt, aber Ihre Gefühle bleiben unter der Oberfläche verborgen; daher besteht das Risiko, ein Magengeschwür zu entwickeln. Vielleicht haben Sie gleichzeitig einen Fuß auf dem Gaspedal und den anderen auf der Bremse, was noch schlimmer ist und zur Folge haben kann, dass der Motor abgewürgt wird und irgendwann den Geist aufgibt.
Als Leiter eines wie auch immer gearteten Teams sollten Sie den Sweetspot ausfindig machen, wenn es um das richtige Ausmaß von Stress geht, sowohl im Hinblick auf Ihren eigenen Zustand als auch den Ihrer Gruppe. Dieser »optimale Punkt« oder Bereich ist von Ihrer Persönlichkeit (und dem Profil Ihrer Gruppe), der anstehenden Aufgabe und der Beschaffenheit des Umfelds abhängig, in der sie ausgeführt werden soll. Bevor Sie sich auf die Suche nach diesem optimalen Bereich begeben, sollten Sie herausfinden, wie sich Ihre Wahrnehmungen oder die Wahrnehmungen anderer auf Ihr Stressniveau auswirken.
Subjektive Wahrnehmung
»Ich habe dieser bescheuerten Scheibe gezeigt, wo‘s langgeht.«
Daley Thompson
Einer der verblüffendsten Augenblicke in der Geschichte der modernen Olympischen Spiele war das Zehnkampf-Duell 1984, das zwischen dem britischen Leichtathleten Daley Thompson und seinem deutschen Konkurrenten Jürgen Hingsen stattfand. Jahrelang hatten sich die beiden mit ihren Rekorden gegenseitig übertrumpft, doch bei den sechs Wettkämpfen, die den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles vorausgingen, hatte Thompson trotz Hingsens Weltrekorden jedes Mal besser abgeschnitten.
In Los Angeles lief es darauf hinaus, dass die siebte Disziplin – der Diskuswurf – über das Endergebnis entscheiden würde. Hingsen war in absoluter Bestform. Thompsons Leistung wirkte im Vergleich schwach (der Diskuswurf war schon immer seine Achillesferse gewesen) – bis zum letzten Wurf. Als die Scheibe landete, hatte er einen neuen persönlichen Rekord erzielt. Hingsen war dermaßen überrascht, dass er offenbar resignierte: Die restlichen Disziplinen absolvierte er rein mechanisch und musste sich am Ende mit der Silbermedaille zufriedengeben. Thompson holte Gold. In seiner Autobiografie beschrieb er die Spiele aus seiner Sicht:
In diesem einen Augenblick war ich nicht von dem Gedanken besessen, zu gewinnen. Einige Leute scheuen vor der Hochspannung zurück, die mit einem solchen Moment der Entscheidung verbunden ist. Für mich war diese Herausforderung genau das, wonach ich Ausschau gehalten hatte, die Krönung all dessen, wofür ich trainiert hatte. Und mich ihr bei Olympischen Spielen zu stellen – ein unglaubliches Gefühl. Ich konnte mich in dieser Situation behaupten und mein größtes persönliches Hindernis überwinden, die Disziplin, die ich am wenigsten beherrsche, den Diskuswurf. Ich habe dieser bescheuerten Scheibe gezeigt, wo‘s langgeht.3
Thompson bewies, dass er fähig war, Spitzenleistungen zu erzielen, wenn es darauf ankam. Er deutete die Situation rein funktional: Er nahm den Augenblick höchster Anspannung nicht als Bedrohung wahr, sondern begrüßte ihn als eine Chance, sein Können unter Beweis zu stellen.
Anat Draigor (geb. 1960) – vermutlich die beste israelische Basketballerin aller Zeiten und seit einem Vierteljahrhundert eine gute Freundin von mir – sagte einmal: »Weißt du, in diesen spannungsgeladenen Augenblicken wird ein Spiel wirklich interessant und herausfordernd; sonst wäre es ziemlich langweilig.« Diese Einstellung zeichnet echte Gewinner aus. In ihren Augen – und in Thompsons – bieten solche intensiven stressreichen Augenblicke positive Herausforderungen statt Horrorerfahrungen.
Die subjektive Sichtweise spielt eine große Rolle, die in hohem Maß bestimmt, wie wir unsere Umwelt erfahren. Subjektive Überzeugungen haben einen nachhaltigen Einfluss auf unser Verhalten, das oftmals in erster Linie von unseren Wahrnehmungen und der Deutung des Stressniveaus in einer bestimmten Situation geprägt wird.
1966 veröffentlichte Professor Richard L. Lazarus, ein Pionier der psychologischen Stressforschung an der University of California in Berkeley, ein bahnbrechendes Buch mit dem Titel Stressund Stressbewältigung; darin stellte er die Theorie auf, dass der kognitive Prozess der »Beurteilung« einer Situation ausschlaggebend dafür ist, ob sie als potenziell bedrohlich oder positiv wahrgenommen wird. Und er erklärte, dass unser Verhalten in dieser Situation auch von der subjektiven Einschätzung abhängig ist, ob wir die Ressourcen besitzen, um das vorliegende Problem in Angriff zu nehmen.
Angenommen, Sie sollen befördert werden. Ist das nach Ihrer Einschätzung eine positive oder eine negative Situation? Positiv, werden Sie vermutlich auf Anhieb sagen – aber ist das immer der Fall? Nicht zwangsläufig, zumindest wenn wir das bekannte Peter-Prinzip4 zugrunde legen, das besagt, dass Mitarbeiter in Unternehmen entsprechend ihrer Leistung im derzeitigen Aufgabenbereich befördert werden und so lange aufsteigen, bis sie eine Position erreichen, in der sie dem Leistungsanspruch nicht mehr gerecht werden – und ihre »Stufe der Unfähigkeit« erreicht haben. Ist es nicht mit viel negativem Stress verbunden, wenn Sie Aufgaben zu erledigen haben, die Ihre Kompetenz übersteigen? Würde diese Überforderung nicht Stress und andere Probleme nach sich ziehen?
Solche Beförderungen kommen häufiger vor, als Sie denken, und der Grund ist oft, dass sie zu früh erfolgen. Die aufgestiegenen Mitarbeiter treten ihre neue Stellung anfangs mit einer positiven Perspektive an, müssen aber bald feststellen, dass sie sich in ihrer neuen Rolle unwohl fühlen und auf neue Herausforderungen und Aufgaben nicht ausreichend vorbereitet sind.
Eine Beförderung, die nur auf dem Papier besteht, ruft ähnliche Probleme hervor, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise einen neuen Titel erhält, mit dem keinerlei Vorteile verbunden sind, gleich ob monetärer oder sonstiger Art. Solche Beförderungen sind häufig mit mehr Arbeit verbunden, aber die Betroffenen haben das Gefühl, nicht ablehnen zu können. Aus subjektiver Sicht wäre es durchaus möglich, sie eingehend und aus unterschiedlichen Blickwinkeln unter die Lupe zu nehmen, das Für und Wider abzuwägen und zu entscheiden, wie der nächste Schritt auf der Karriereleiter beschaffen sein sollte. Vielleicht sind Sie ja auch rundum zufrieden mit Ihrer derzeitigen Position oder haben eine andere Stellung im Unternehmen im Visier, wo Ihre Fähigkeiten nach Ihrer Auffassung besser eingesetzt wären. Es kommt alles auf Ihre subjektiven Erfahrungen und Ihre Sichtweise an.
Wenn Sie sich mit Ihrer persönlichen Stresswahrnehmung auseinandersetzen, können Sie Probleme oder Hindernisse, mit denen Sie konfrontiert werden, besser einschätzen. Wenn Sie jede Herausforderung wie Daley Thompson mit seinem olympischen Diskuswurf angehen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie Ihre Aufgaben erfolgreich bewältigen und trotz Konflikten und Druck die darin enthaltenen Chancen entdecken. Mit dieser Strategie erreichen Sie persönliche Spitzenleistungen: Ihren optimalen Bereich.
Mehr ist mehr, weniger ist mehr: Maximierung durch Optimierung
»Weil sie … weder zu groß noch zu klein ist, sondern irgendwo dazwischen; nicht zu klug, nicht zu dumm – ist sie alles, was ich mir schon immer gewünscht habe, wie nach Maß gefertigt.«
Kaveret, Israelische Rockband, »Kacha hi baèmza«
John M. Hobermans 1992 erschienenes Buch Mortal Engines befasst sich mit der Entmenschlichung des Sports. Darin heißt es, dass die modernen westlichen Sportorganisationen ihre Athleten auf dem Altar der Leistungssteigerung opfern (beispielsweise den Sprinter und Olympiateilnehmer Ben Johnson) und sie mit Hilfe wissenschaftlicher Experimente in »menschliche Maschinen« verwandeln. Dieser Prozess, erklärt Hoberman, hat darüber hinaus immense Auswirkungen auf die wissenschaftliche Erforschung der menschlichen Leistungsfähigkeit generell.
Seine Metapher für Athleten – und allgemein für Menschen in Leistungssituationen – ist verblüffend, denn wir sprechen tatsächlich von Maschinen. In den alten Stammeskulturen nichtwestlicher Prägung wurden sportliche Betätigungen oft mit Begriffen wie »Spiel« oder »Wettkampf« in Verbindung gebracht; nach Auffassung des britischen Professors Sir Isaiah Berlin (1909-1997) spiegeln sie altüberlieferte Traditionen wider, in denen Sport als Ausdruck menschlicher Aktivität galt, genau wie tanzen, singen, kämpfen oder beten5.
Viele Menschen betrachten den modernen Hochleistungs- oder Elitesport als Gegensatz zu den sportlichen Disziplinen der griechischen Antike, die mit der Harmonie von Körper, Geist und Seele in Verbindung gebracht werden.6 Heute ist der Sport ein Produkt wissenschaftlicher Überlegungen und rationaler Herstellungsmethoden; mit anderen Worten: Elitesportler sind »sterbliche Maschinen« oder menschliche Maschinen, vergleichbar mit den Arbeitnehmern an vielen modernen Arbeitsplätzen.
Hoberman war der Erste, der in mir den Gedanken an diese tiefgreifende, allgegenwärtige Metapher hervorrief. Im Lauf der Zeit wurde mir bewusst, dass viele meiner Aktivitäten als Sportwissenschaftler mit dem Konzept der »Optimierung« und »Maximierung« verbunden sind – die Sportwissenschaft bemüht sich in der Tat, die Funktionsweise der Athleten durch eine permanente Steigerung ihrer Leistungen zu optimieren (genau wie jede andere Maschine), um ihr Potenzial maximal auszuschöpfen. Dieses Konzept spiegelt die zweckorientierte, werturteilsfreie Rationalität wider, die sich auf die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel konzentriert, mit denen ein bestimmte Ziel erreicht werden soll, und wird mit dem großen deutschen Denker Max Weber in Verbindung gebracht (1864-1920). Im Sportbereich ist man bemüht, die Leistungen durch stetige Optimierung zu maximieren – das ist das ultimative Ziel, das bei Athleten im Elitesport angestrebt wird.
Um der Schnellste, die Nummer 1, der Champion, der Topstar zu sein (oder das Potenzial voll ausschöpfen zu können), muss man persönliche Bestleistungen abliefern, das heißt, optimal funktionieren. Um herausragende Leistungen zu erbringen, müssen jedoch bestimmte Aspekte Schritt für Schritt optimiert werden, damit das Gesamtpaket maximiert werden kann. Dieses Prinzip bezeichne ich als »Maximierung durch Optimierung«.
Ein anschauliches Beispiel ist der ehemalige deutsche Automobilrennfahrer Michael Schumacher mit seinem Ferrari. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister, zweifellos einer der größten aller Zeiten in dieser höchstrangigen Serie des Formelsports, benötigte ein fehlerlos funktionierendes Fahrzeug. Um der Schnellste zu sein, muss sich jede einzelne Komponente des Fahrzeugs im bestmöglichen, sprich optimalen Zustand befinden. Die technischen Bauelemente müssen außerdem optimal zusammenwirken und aufeinander abgestimmt sein, damit das »Gesamtpaket« Ferrari Höchstgeschwindigkeit erreichen kann.
Auch Schumacher war in diesem Sinne ein unverzichtbarer Teil des Systems – in dem die Leistungsfähigkeit des Rennwagens und die Leistungsfähigkeit des Piloten einander entsprechen. Deshalb werden »Mensch-Maschine-Systeme« entwickelt. Ein Rennwagen ist benutzerfreundlich, und Schumacher trainierte damit, um zu verstehen, wie er funktionierte, und seine eigenen Fähigkeiten anzupassen. Das Gleiche gilt für Piloten in einem Kampfjet oder beim Training im Flugsimulator, genau genommen für jeden Leistungsträger, Sportler inbegriffen. Bevor die Medien Wind davon bekamen, dass Lance Armstrong unerlaubte leistungssteigernde Substanzen benutzte, sprich gedopt hatte, schilderte Autor Daniel Coyle The Talent Code7, wie beeindruckt er von Armstrongs Bedürfnis war, »jede Dimension des Wettbewerbs zu optimieren« – offenbar, um seine Leistungen Schritt für Schritt zu maximieren (leider mit unerlaubten Mitteln, wie sich später herausstellte).
Spitzenleistungen und Flow-Zustand
Die Maximalleistung eines Sportlers, auch persönliche Höchst- oder Spitzenleistung genannt, wird oft von einem »Flow-Zustand« oder einer »höchstmöglichen Glückserfahrung« geprägt oder begleitet. Athleten beschreiben diesen Zustand als das Gefühl, »auf Autopilot zu sein«, »die Welt ringsum zu vergessen«, »wie hypnotisiert« oder »in Trance« zu sein. Ein gutes Beispiel war der deutsche Ausnahme-Torwart Oliver Kahn im Champions-League-Finale 2003 zwischen seiner Mannschaft, dem FC Bayern München, und FC Valencia.
Im Elfmeterschießen, das über Sieg und Niederlage entschied, gelang es ihm, drei von sieben Torschüssen oder 42,86 Prozent abzuwehren. Wenn man den Strafstoß mitzählt, den er während der regulären Spielzeit nicht halten konnte, waren es insgesamt drei von acht Schüssen oder 37,5 Prozent – weit über die Basisrate von 25 Prozent hinaus (das heißt die grundlegenden Chancen eines Torhüters, einen Strafschuss abzufangen). Er schrieb seinen Erfolg »einem Zustand der absoluten Konzentration« zu, »mit optimaler Kontrolle über meine Gefühle und Gedanken«.8
Der Flow-Zustand ist gleichwohl ein Ereignis, das selten eintritt – ein Idealzustand, den ein Leistungsträger anstrebt, aber nicht immer erreicht. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum der russische Sportpsychologe Yuri L. Hanin das Yerkes-Dodson-Gesetz mit seiner Hypothese von der umgekehrten U-Kurve kritisierte; er hielt es für unwahrscheinlich, dass es nur einen einzigen optimalen Erregungs- oder Aktivierungszustand gibt, der zur Maximalleistung unterschiedlicher Athleten in unterschiedlichem Kontext führt. Um seine Hypothese zu belegen, benutzte er das State-Trait-Angstmodell (STAI), das von dem US-amerikanischen Psychologen Charles D. Spielberger (1927-2013) und seinem Team9 entwickelt wurde. Der Test erfasst Angstzustände anhand eines Fragebogens, wobei zwischen Angst als emotionaler vorübergehender Zustand (State-Angst) und Angst als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal (Trait-Angst) unterschieden wird. Im Anschluss führte Hanin systematische retrospektive Feldforschungen in verschiedenen sportlichen Disziplinen durch, wo er Angstzustand und Leistungsniveau der Sportler beobachtete.
Er stellte fest, dass Spitzensportler eine individuelle Angstzone hatten, in der persönliche Höchstleitungen erfolgten, und die schlechten Leistungen außerhalb dieser Zone verortet waren. Er definierte diese Zone auf der STAI-Skala als Angstzonenparameter vor dem Wettkampf, plus oder minus 4 Punkte (eine Standardabweichung von annähernd 0,5) und bezeichnete sie als optimale Funktionszone (ZOF).
Folglich kritisierte Hanin das Yerkes-Dodson-Gesetz mit der Begründung, dass es eine optimale Zone zwischen Aktivierungs- und Leistungsniveau gebe, in der die individuelle Maximalleistung erreicht werden könne. Diese individuelle ZOF ist die Angstzustandszone, in der das Leistungspotenzial maximal ausgeschöpft wird, während schlechte Leitungen außerhalb dieser Zone angesiedelt sind (Abbildung 1.2).
Abbildung 1.2: Flow- Zustand und (I)ZOF
Später ergänzte Hanin dieses Konzept, schloss weitere emotionale Zustände ein und betonte die Individualität der ZOF (IZOF).10 Wichtig ist jedoch die Tatsache, dass wir Sportpsychologen zufrieden sind, wenn sich unsere Athleten in der (I)ZOF befinden; sollte es ihnen gelingen, in den Flow-Zustand zu gelangen, wäre das ein großartiger Bonus, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass dieses Ereignisses eintritt.
Wenn man die Hauptpunkte des Yerkes-Dodson-Gesetzes und der Hanin-Hypothese miteinander kombiniert, hat man zwei mögliche, aber nicht optimale Erregungszustände, in denen sich Athleten befinden können, und zwei entsprechende Strategien, um die Leistung zu verbessern und das Leistungsmaximum anzustreben:
Zu wenig Erregung, bei der »Mehr ist mehr« die richtige Strategie wäre – und der Athlet gut beraten ist, die Anspannung zu steigern, um zu versuchen, optimale Bedingungen zu schaffen.
Zu viel Erregung, bei der »Weniger ist mehr« die richtige Strategie wäre – und der Athlet gut beraten ist, die Anspannung abzubauen, um zu versuchen, optimale Bedingungen zu schaffen.
Das gilt natürlich auch für andere Lebensbereiche, beispielsweise bei einer Prüfung oder einem Vorstellungsgespräch. Wenn Sie müde, lethargisch oder innerlich unbeteiligt sind, ist das Aktivierungsniveau vermutlich zu niedrig, und jemand sollte Sie aufrütteln. Sind Sie dagegen zu angespannt, ängstlich oder gestresst, ist das Aktivierungsniveau vermutlich zu hoch, und Sie sollten sich entspannen.
Die Persönlichkeitsmerkmale spielen ebenfalls eine wichtige Rolle: Es gibt Menschen, die ständig angespannt sind, und andere, die entspannt sind, oder Typ-A- und Typ-B-Persönlichkeiten. Typ-A-Persönlichkeiten sind in hohem Maß leistungs- und wettbewerbsorientiert, haben ständig das Gefühl, unter Zeitdruck zu stehen, finden es schwer, sich zu entspannen, und reagieren ungeduldig oder wütend auf Verzögerungen oder Menschen, die in ihren Augen inkompetent sind. Typ-B-Persönlichkeiten können unaufgeregt arbeiten und sich ohne schlechtes Gewissen entspannen. Sie haben selten das Gefühl, unter Zeitdruck zu stehen – oder unter der damit einhergehenden Ungeduld zu leiden – und geraten selten in Wut.11
Auch das Ausmaß der Erfahrung fällt ins Gewicht – es macht einen großen Unterschied, ob Sie ein alter Hase oder ein Neuling in Ihrem Metier sind. Wenn Sie Ihre berufliche Laufbahn in der Welt der Unternehmen als Assistent beginnen, neigen Sie vermutlich dazu, sich an Kollegen mit mehr Erfahrung zu orientieren, die Unternehmensabläufe, unternehmenspolitische Entscheidungen oder eine bestimmte Branche genau kennen. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das Wissen um Ihre eigenen Stärken und Schwächen ist unerlässlich, um Strategien zu ermitteln, die dazu beitragen, Ihre persönlichen Höchstleistungen zu erzielen. Und vergessen Sie nicht die subjektive Wahrnehmung: Wie Sie eine Aufgabe einschätzen (fällt sie Ihnen leicht oder schwer, sehen Sie sich ihr zum ersten Mal gegenüber?), ist von zentraler Bedeutung.
Um Ihr optimales Stress- und Erregungsniveau oder das Ihres Teams zu ermitteln, gilt es auch das Umfeld zu berücksichtigen. Das Umfeld, das Führungskräfte und Vorgesetzte auf allen Leitungsebenen schaffen und pflegen, entscheidet in hohem Maß über die Leistung der Mitarbeiter. Wo würden Ihre Nerven eher blank liegen, in einem Stadion mit 80 000 Besuchern oder beim Mannschaftstraining? Oder genießen Sie den Auftritt vor großem Publikum, wie Daley Thompson und Anat Draigor? Wenn Sie Ihr Team verstehen und kennen, wenn Sie mit jedem Mitglied vertraut sind, fällt es Ihnen leichter, ein angemessenes Umfeld zu schaffen.
Ein Beispiel sind die Großraumbüros: Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts überwogen die traditionellen Einzelbüros, die zugunsten der neuen Anordnung weitgehend aufgegeben wurden. In den USA waren Ende 2014 bereits um die siebzig Prozent Großraumbüros ohne oder nur mit halbhohen Abtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen.12 Ein solches Umfeld, in dem der Schwerpunkt auf weitläufigen offenen Räumen ohne Barrieren zwischen Schreibtischen und Büros liegt, wurde zunächst als spannende Neuerung betrachtet, als eine Möglichkeit, sich von der typischen Zellenbauweise zu verabschieden und Transparenz, Kollegialität und Teamarbeit zu fördern. Unternehmen wie Google, Facebook, Yahoo, eBay, Goldman Sachs und American Express setzten diese Idee um.13
Was viele nicht vorhersahen, waren die Begleitumstände: ein hoher Geräuschpegel und der Mangel an Privatsphäre, was bei den Mitarbeitern mehr Stress erzeugte – und nicht von der positiven Art. Studien aus den letzten zehn Jahren haben gezeigt, dass sich Großraumbüros negativ auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt, sowohl im Hinblick auf ihre physische Umgebung als auch auf die von ihnen geschätzte Produktivität.14 Zusätzlich zum Stress und der geringeren Zufriedenheit verschlechterten sich auch die Beziehungen innerhalb der Belegschaft.15 Was anfangs als Chance galt, Engagement und Kommunikation der Mitarbeiter zu fördern, erwies sich als Bumerang: Obwohl die Kommunikation in diesem Umfeld zunahm, wurde die Gespräche kürzer und oberflächlicher.16
Natürlich ist es schwierig, es jedem recht zu machen. Einige Mitarbeiter ziehen Stehpulte vor, während andere lieber am Schreibtisch sitzen, manche wünschen sich ein eigenes Büro oder mehr Aufenthaltsräume oder andere Snacks in den Verkaufsautomaten. Unter dem Strich ist es wichtig zu entscheiden, welches Umfeld die Leistung des Teams bestmöglich fördert – diese effektive Zone zu finden, mag schwierig sein, aber sie führt zur Entwicklung einer leistungsstarken, erfolgreicheren Belegschaft. Wenn Ihre Mitarbeiter sich unbehaglich fühlen oder gestresst sind, nimmt die Anspannung irgendwann überhand, und die Leistung leidet. Als Teamchef sollten Sie herausfinden, wie Sie Stress abbauen und Ihr Team in die optimale Funktionszone zurückbringen können.
Die Beziehung zwischen Erregungs- und Leistungsniveau, wie im Yerkes-Dodson-Gesetz beschrieben, ist nur ein klassisches Beispiel unter vielen für das allgegenwärtige Prinzip der Maximierung durch Optimierung. Ein Biomechaniker versucht beispielsweise, die Bewegungsabläufe der Athleten zu verbessern; der Coach, der ein Kraft- und Ausdauertraining anberaumt, bemüht sich, das Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung zu finden (um ein Übertraining – eine chronische Überlastungssituation – zu vermeiden); und ein guter Arzt verordnet nur absolut unerlässliche Arzneimittel in optimaler Dosierung – nicht zu viel, nicht zu wenig (wenn ich zu viel von meinen Parkinson-Medikamenten nehme, laufe ich Gefahr, eine Dyskinesie zu entwickeln, eine Störung des Bewegungsablaufs in einer bestimmten Körperregion; nehme ich zu wenig, kann ich mich überhaupt nicht bewegen). Alle diese Bausteine sollten zu einem homogenen Ganzen zusammengefügt werden, »optimierende Voraussetzungen« genannt, wie bei Michael Schumachers Formel-1-Rennen in seinem Ferrari.
Das Komplexe vereinfachen
»Wenn man das Spiel eines Tennispartners durchkreuzen will, muss man ihn nur bitten, es zu erklären.«
Daniel Kahneman, Nobelpreisträger
Zu Beginn der 1950er Jahre entwickelten die US-amerikanischen Psychologen Clark Hull und Kenneth Spence die sogenannte »neobehavioristische Triebtheorie«; sie besagt, dass erhöhte Anspannung lediglich die Leistung bei vertrauten oder einfachen Aufgaben verbessert (beispielsweise Sit-ups: Je stärker Sie die Bauchmuskulatur anspannen, desto größer die Wirkung der Übung).17 Natürlich sind viele Aufgaben, denen sich Fach- oder Führungskraft gegenübersehen, nicht unbedingt einfach, was auch für Elitesportler gilt. Was ist also mit den komplexen Aufgaben?
Mit zunehmender Komplexität werden immer mehr »nicht gelernte oder nicht vertraute Elemente« in die zu verrichtende Aufgabe eingebunden; rufen sie ein hohes Maß an Erregung hervor, nimmt die Leistung ab. Denken Sie beispielsweise an einen Neuling, der zu lernen versucht, den Golfball über eine Entfernung von ca. 200 Metern zu schlagen, und unter Stress steht. Das führt uns zu Yerkes-Dodson und der umgekehrten U-Kurve zurück. Was sollten Sie also tun, wenn bei einfachen Aufgaben eine lineare Beziehung zwischen Erregungs- und Leistungsniveau besteht, komplexe Aufgaben hingegen mit einer umgekehrten U-Kurve in Zusammenhang stehen? Die Antwort lautet: die komplexen Aufgaben in einfache umwandeln.
Jetzt denken Sie vielleicht, das sei einfacher gesagt als getan, aber es gibt eine systematische Methode, die man als »Chunking« bezeichnet. Chunking ist ein zielgerichteter Prozess des Wissenserwerbs durch Bündelung von Informationen oder Lerninhalten. Beispielsweise erforschte der Nobelpreisträger Herbert Simon diese Bündelungsstrategie bei Schachspielern.18 Schachanfänger werden zu Schachexperten, weil sie die zugrundeliegenden Strukturen des Spiels auf einer tieferen Ebene erfassen. Sie lernen, wie man die verschiedenen Konstellationen im Gedächtnis abspeichert, zuordnet und abruft, indem man die einzelnen Informationsbausteine zu größeren, bedeutungsvollen Einheiten zusammenfasst, sprich bündelt (zum Beispiel »Königsangriff durch Schwarz«). Neues Informationsmaterial wird dann neu kodiert, in immer größere inhaltlich bedeutungsvolle Chunks eingebunden und im Arbeitsgedächtnis abgelegt.
Wenn man dieses Konzept auf andere menschliche Leistungsbereiche überträgt, schafft man durch die Sammlung kleiner eigenständiger Bausteine beinahe mühelos mehr Lernkompetenz. Die Fähigkeit, die erworben werden soll, wird in die einzelnen Elemente zerlegt, aus der sie sich zusammensetzt, und diese werden zunächst separat im Gedächtnis abgespeichert. Dann wird der Lernprozess Schritt für Schritt fortgesetzt, indem man diese Elemente zu immer größeren miteinander verbundenen Bündeln zusammenfügt. Auf diese Weise kann eine komplexe Aufgabe vereinfacht werden (weil Körper und Gehirn durch die Übung zunehmend damit vertraut werden). Dieses Konzept lässt sich auch auf Ihre eigenen Aufgaben und Aktivitäten anwenden.
Einfacher ausgedrückt: Sie sollten Ihre Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu verrichten, genauso aufbauen wie bei den einfachen Aufgaben, die Sie aus dem Effeff beherrschen: Schritt für Schritt. Damit verwandelt sich der kurvenartige Zusammenhang zwischen Erregungs- und Leistungsniveau und wird beinahe linear. Wie Daniel Coyle in seinem Buch Die Talent-Lüge erklärt, muss ein erstklassiger Turner »nicht lange nachdenken«, sondern handelt einfach. Natürlich spielen die Reaktion des Einzelnen oder der Gruppe auf Stress und Erregung und die subjektive Wahrnehmung nach wie vor eine Rolle.
Viele Jahre lang befürwortete der führende deutsche Sportpsychologe Jürgen Nitsch, mein Berater von 1980 bis 1984, als ich noch Doktorand war, die sogenannte »Handlungstheorie«. 1994 verfasste er einen Artikel über »die Organisation des motorischen Verhaltens«, in dem er vorschlug, über unser »situationsspezifisches Verhalten« nachzudenken.19 Und was, bitte schön, bedeutet das? Ganz einfach. Denken Sie an den Wurf eines Basketballspielers. Oberflächlich betrachtet »ist ein Wurf ein Wurf« – oder? Ziehen Sie nun aber einmal folgende Unterschiede in Betracht:
Würfe können aus unterschiedlicher Entfernung ausgeführt werden.
Würfe können mit oder ohne Beteiligung von Defensivspielern ausgeführt werden.
Würfe können in der »Garbage Time«, in den letzten Spielminuten einer bereits entschiedenen Partie, oder in einer entscheidenden Phase des Spiels ausgeführt werden.
Würfe können von mir (einem Neuling) oder von LeBron James (einem Profi) ausgeführt werden.
Dazu kommt, dass selbst ein Freiwurf, der als Mutter aller Routineabläufe gilt, eine vollkommen andere Bedeutung hat, je nachdem, ob er während letzten Spielminuten in einer ruhigen Trainingsatmosphäre (wo das Ergebnis keine Auswirkungen hat) oder in einem Turnier auf höchster internationaler Ebene ausgeführt wird, wo er über die Meisterschaft entscheiden könnte! Die beiden Würfe lassen sich nicht über einen Kamm scheren!
Mit Nitschs situationsspezifischem Verhaltensmodell kann die Einfachheit oder Komplexität durch die eigene subjektive Gestaltung der Aufgabe bestimmt werden. Es kann beispielsweise einfach sein, zu Hause vor dem Spiegel zu üben, wie man ein gutes Vorstellungsgespräch führt, aber in der realen Situation könnte es sich als wesentlich schwieriger erweisen. Diese Herangehensweise spiegelt die Philosophie von Friedrich Wilhelm Nietzsche wider (1844 – 1900), der einmal sagte: »Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.«20
Wenn wir zum Zehnkampf zwischen Thompson und Hingsen zurückkehren und die beiden Athleten miteinander vergleichen, trug Thompson den Sieg davon: Er betrachtete die Aufgabe »Leistung X in hochgradigem Erregungszustand zu erbringen« subjektiv als eine positive Herausforderung. Hingsen nahm die scheinbar gleiche Aufgabe negativ (vielleicht sogar als Bedrohung) wahr. Deshalb sahen sich die beiden in Wirklichkeit nicht der gleichen Aufgabe gegenüber.
Gerd Müller – der »Bomber der Nation«, einer der größten Torjäger in der Geschichte des Fußballs – soll einmal gesagt haben: »Wenn du erst lange nachdenkst, ist es schon zu spät« (bezugnehmend auf seine phänomenale Erfolge).21 Aber Müllers »Chunks« beinhalteten nicht nur, Tore zu erzielen, sondern Tore vor allem in spielentscheidenden, stressreichen Situationen zu erzielen, was ihm immer wieder gelang (einschließlich des Tors im Finale der Weltmeisterschaften 1974, das Deutschland den Sieg über die Niederlande einbrachte).
Die tiefere Bedeutung hinter Müllers Worten basiert auf verschiedenen Theorien über menschliche Denkvorgänge und Problemlösungsstrategien, die sich auf den sogenannten »dualen Denkprozess« konzentrieren. Denkprozesse können intuitiv, instinktiv, unbewusst und automatisch erfolgen. Sie können aber auch abwägend, logisch, bewusst und mühevoll sein. Nobelpreisträger Daniel Kahneman bezeichnete diese dualen Prozesse als System 1 bzw. System 2. In einem Interview in der israelischen Wirtschaftszeitschrift Kalkalist erklärte er:
Gute Tennisspieler spielen beinahe ohne nachzudenken und reagieren nahezu automatisch auf komplexe Ballwechsel und Finten. Wenn man einen Tennispartner aus dem Konzept bringen will, muss man ihn nur bitten, den Bewegungsablauf der Hand bei seinem fantastischen Aufschlag zu erklären. Wenn System 2 etwas zu erklären versucht, was unbewusst geschieht, gerät System 1 ins Stocken.22
Wahrscheinlich könnte Gerd Müller seine Torerfolge mit Kahnemans System 1 erklären, wenn er es gekannt oder davon gehört hätte.
Zusammenfassung
Ein hohes Maß an Stress oder Anspannung muss nicht immer schlecht sein – manchmal kann es sogar Menschenleben retten. Doch wenn es um Leistung und zielführendes Verhalten geht, sollten wir einen optimalen Erregungs- oder Aktivierungszustand anstreben. Er stellt eine unabdingbare Voraussetzung für Bestleistungen dar, neben Persönlichkeitsmerkmalen und Kompetenzniveau, die ebenfalls eine Rolle spielen. (Sie befinden sich beispielsweise vor einer Prüfung in optimaler mentaler Verfassung, aber wenn Sie nicht gelernt haben – vergessen Sie’s! Die Basketballerin Anat Draigor verstand etwas von ihrem Metier; ein optimaler Erregungs- oder Aktivierungszustand alleine hätte ihr nicht zu Starruhm verholfen.)
Zwischen Erregungs- und Leistungsniveau besteht ein U-förmiger Zusammenhang, und der Sweetpoint – genauer gesagt, die optimale Leistungszone – wird von drei wichtigen Elementen geprägt: von der Persönlichkeit (Daley oder Jürgen? Experte oder Neuling?); der Aufgabe (einfach oder komplex?); und der subjektiven Beschaffenheit des Umfelds, in dem sie verrichtet werden soll (Training oder Wettkampf? Zu Hause oder in einem Gruppenraum? Welche Bedrohung stellt eine bestimmte Situation dar?).
Wir kommen im 11. Kapitel noch einmal auf das Thema zurück, in Zusammenhang mit meinen Studien zur Krisentheorie, die besagt: Je mehr wir uns vom optimalen Erregungs- oder Aktivierungszustand entfernen, desto größer die Gefahr einer Leistungsbeeinträchtigung. Es gilt also, optimale Bedingungen zu schaffen, um die Leistung zu maximieren und die Wahrscheinlichkeit eines Flow-Zustands zu erhöhen, nicht nur vor, sondern auch während der Durchführung bestimmter Aktivitäten.
Das ist das ganze Geheimnis. Und wie setzt man dieses Wissen erfolgreich in die Praxis um? Das ist eine schwierigere Frage, die wir im weiteren Verlauf des Buches ergründen und beantworten.
Übungen für den Alltag
Auf individueller Ebene:
Zielen Sie auf einen optimalen Stress- und Aktivierungszustand ab, um aufmerksam, engagiert und produktiv zu bleiben, ohne sich zu überfordern oder in einen chronischen Stresszustand zu geraten.
Denken Sie daran, dass Hindernisse und Aufgaben subjektiv eingeschätzt werden – Ihre persönliche Wahrnehmung kann entscheidend dazu beitragen, wie Sie mit Stress umgehen und in welchem Maß er Ihre Leistung beeinflusst.
Vereinfachen Sie komplexe Aufgaben, indem Sie diese in kleinere, eigenständige Elemente zerlegen und anschließend mit Hilfe der Chunking- oder Bündelungsmethode zu größeren Bausteinen zusammenfassen.
Auf Führungsebene:
Ermitteln Sie die effektive Zone im Hinblick auf Ihr persönliches Stressniveau und das Ihres Teams.
Das Umfeld, das Führungskräfte aller Leitungsebenen schaffen und pflegen, ist für die Leistung der Belegschaft von entscheidender Bedeutung – sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern und Kollegen darüber, was für alle Beteiligten am besten ist, und versuchen Sie, diese Präferenzen in die Arbeitsumgebung einzubinden.
Machen Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Mannschaft Typ-A- und Typ-B-Persönlichkeiten gibt, die es entsprechend zu motivieren gilt: Bei der Typ-A-Gruppe müssen Sie vermutlich Stress und Ängste abbauen, während die Typ-B-Gruppe ein wenig zusätzlichen Ansporn oder Druck benötigt.
2.Motivation: Die Antriebskraft definieren
»Wer ein ›Warum‹ zum Leben hat, erträgt fast jedes ›Wie‹.«
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Ende der 1980er Jahre nahm ich meine Tätigkeit als psychologischer Berater der israelischen Tischtennis-Nationalmannschaft auf, die in Zusammenarbeit mit dem Wingate Institute erfolgte, dem israelischen »Zentrum für Leibeserziehung und Sport«. Als ich den Spielern das erste Mal beim Training zusah, war ich überrascht, weil sie ständig brüllten und fluchten: »Idiot!«, »Was sollte denn das?«, »So was Bescheuertes!« oder »Mann, jetzt reiß dich zusammen!« Solche Ausbrüche kamen häufig vor, teilweise mit noch drastischeren Formulierungen und Redewendungen, die ich lieber nicht wiedergeben möchte. Ich war verblüfft über den Umgangston und dachte, meine Aufgabe sei klar umrissen. Doch nach eingehender Beobachtung erkannte ich, dass die Spieler nur dann laut fluchten, wenn sie einen Fehler gemacht hatten; sie beschimpften nicht ihre Mannschaftskameraden, sondern sich selbst!
Als ich wissen wollte, warum sie so reagierten, erklärte sie mir, sie würden sich damit »aufputschen«, um sich anzuspornen und zu motivieren. Eine seltsame Gewohnheit, vor allem angesichts dessen, dass wir als Gesellschaft gelernt haben, Erfolg sei eine Sache des positiven Denkens. Doch wie sich herausstellte, waren die Spieler überzeugt, dass Selbstkritik und negative innere Selbstgespräche stärker motivieren als Zuspruch oder anfeuernde Worte.
Seltsamerweise glaubten auch die damals besten israelischen Tischtennisspieler allen Ernstes, diese kontraproduktive Taktik sei ein hochwirksamer Leistungsansporn. Eine bizarre Gewohnheit, die traditionsgemäß von einer Trainer- und Spielveteranen-Generation zur nächsten weitergegeben wurde, wie ich später herausfand, sodass eine ganz eigene Motivationskultur entstand. Diese Erfahrung weckte das Interesse in mir, die menschliche Motivation in einem sportlichen Leistungsumfeld besser zu verstehen. Dazu musste ich jedoch die grundlegenden Aspekte der Motivation einbeziehen.
Angenommen, Sie wollen eine ganz einfache, alltägliche Aktivität in Angriff nehmen, beispielsweise mit dem Auto zur Arbeit fahren. Was brauchen Sie dazu? Diese vier grundlegenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Sie müssen Energie als Antriebskraft für die Bewegung erzeugen, indem Sie den Motor starten.
Mit Hilfe der produzierten Energie müssen Sie das Lenkrad betätigen, um den Wagen in die gewünschte Richtung zu steuern.
Sie müssen den Bewegungszustand erhalten, die Geschwindigkeit anpassen, Verkehrszeichen beachten und die Fahrt so lange wie erforderlich fortsetzen.
Sobald Sie an Ihrem Arbeitsplatz angekommen sind, haben Sie Ihr Ziel erreicht.
Diese Beschreibung der vier Schritte ist genau der Prozess, den wir als »Motivation« bezeichnen. Motivation hat mit der Energie zu tun, die unser Verhalten prägt (mit den Beweggründen oder Antriebskräften) und denjenigen Faktoren, die dieses energievolle Verhalten in eine bestimmte zielführende Richtung lenken. Deshalb ist das erste Element der Motivation unser vertrauter Weggefährte aus dem 1. Kapitel: der Erregungs- oder Aktivierungszustand. Das zweite ist die Richtung, dann kommt der Energieerhalt und schlussendlich das Ziel – damit haben wir alles, was wir brauchen, um jedes beliebige Vorhaben im Leben erfolgreich umzusetzen.
Wie einer meiner Professoren in Jerusalem vor einigen Jahren behauptete, geht es in der Psychologie in Wirklichkeit immer um die Motivation, ein unglaublich vielschichtiges und breit gefächertes Thema. Deshalb gilt es, die Grenzen unseres Motivationskonzepts festzulegen, auch wenn sie in gewisser Hinsicht willkürlich sind. Doch vorher sollten wir dem Begriff »Motivation« auf den Grund gehen. Er leitet sich vom lateinischen Substantiv motivum her, was »Beweggrund« oder »Antrieb« bedeutet. Warum sollten wir andere Menschen überhaupt motivieren? Oder uns selbst? Warum ist es unerlässlich, Menschen in Bewegung zu versetzen oder ihnen Antrieb zu verleihen?
Sokrates, Plato und Aristoteles, drei berühmte Philosophen der griechischen Antike, glaubten an die Macht einer inneren Kraft, die man heute als Motivation bezeichnen könnte. Das Gleiche gilt für René Descartes – einen der größten Denker des modernen Zeitalters nach der Renaissance –, dessen Abhandlungen über den Menschen als einer der ersten Versuche betrachtet werden können, eine philosophisch geprägte Motivationstheorie zu entwickeln. Einige Zyniker würden vermutlich des Teufels Advokat spielen und auf der ideologischen Ebene behaupten, dass sich hinter der Fassade der Motivation die Ausbeutung des Menschen im Dienste einer großmächtigen Industrie verbirgt. In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts begann die Motivation in diesem Kontext eine wichtige Rolle zu spielen, gemeinsam mit dem Entwicklungsprozess, der die Psychologie als legitime wissenschaftliche Disziplin verankerte.
Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts war das Wort »Motivation« in aller Munde. Die Welt der Psychologie verwendete es verstärkt zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, genau in der Phase, in der die Industrialisierung in vielen Teilen der Welt Fahrt aufnahm, die USA, Westeuropa und Japan eingeschlossen. Angesichts dieses Zeitgeists überrascht es nicht, dass die Menschen motiviert waren – das heißt, »einen Grund für eine bestimmte Handlungsweise hatten«. Ansonsten wären sie vermutlich im Zustand der Homöostase verblieben (den Sie bereits aus dem 1. Kapitel kennen).
Einige Motivationstheorien beschrieben die Menschen als maschinenähnliche Organismen, durch innere oder äußere Kräfte gesteuert und zum Handeln gezwungen. In Zeiten der beschleunigten Industrialisierung entwickelte sich diese Idee rasch weiter, vor allem im Geist von Frederick Taylor (1856-1915) und des von ihm begründeten »Scientific Management«, eines rein wissenschaftlich orientierten Betriebsführungsansatzes. Taylor begann seine Karriere als Arbeiter in einem Stahlwerk, wurde zum leitenden Ingenieur befördert und galt später als der Erste, der die wichtige Rolle der Motivation für die berufliche Leistung erkannte.
Taylor glaubte nicht nur, dass eine sorgfältige Auswahl und Ausbildung von Mitarbeitern für Spitzenleistungen unerlässlich sind, sondern auch eine Steigerung der Motivation und Produktivität durch eine Verbesserung der Löhne und Gehälter erzielt werden kann, wobei er den Stellenwert der ökonomischen Effizienz betonte. Dieses Managementkonzept, bisweilen auch Taylorismus genannt, war eng mit der Automatisierung und Mechanisierung von Arbeitsabläufen verbunden und mit den Ideen des Fordismus verknüpft. Sowohl der Taylorismus (die bürokratische Steuerung von Arbeitsprozessen) als auch der Fordismus (die technische Steuerung von Arbeitsprozessen) waren fest in der damaligen Kultur verankert, stießen aber auch auf heftige Kritik. Charlie Chaplins Film Moderne Zeiten (1936) nahm diese neue Kultur am Arbeitsplatz ins Visier, prangerte satirisch eine Welt an, in der Menschen durch äußere Kräfte angetrieben werden mussten, weil sie sonst keinen Grund gehabt hätten, überhaupt etwas zu tun.