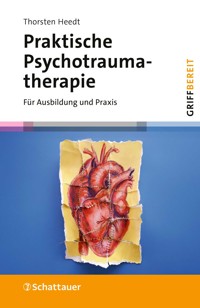27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
• Basiswissen: Für angehende Fachärztinnen und Psychologen in Ausbildung und für alle, die mit Borderline-Patienten arbeiten • Von anderen lernen: Alles Wissenswerte über die 4 wichtigsten Therapien der BPS • Griffbereite Konzeption: Verliert sich nicht in Details, durch und durch ein Praxisbuch Ihr Patient oder Ihre Patientin mit Borderline-Persönlichkeitsstörung lässt ein ruhiges, kontinuierliches Arbeiten an der Problematik kaum zu, verwirrt das Behandlungsteam, entwertet die Therapie oder droht bei anstehender Entlassung mit Selbstverletzung oder gar Suizid? Sie haben keine Zeit, erneut die umfangreiche Grundlagenliteratur zu lesen, und auch die Kollegen wissen gerade nicht weiter? Dann ist schneller Rat gefragt und dieses Buch ein Glücksgriff! Informativ, konzis und auf der Höhe der Forschung bietet dieses Buch einen schnellen und doch fachkundig-genauen Überblick über die Störung und die möglichen Vorgehensweisen in bestimmten Therapiephasen und -situationen. Es definiert, was eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ausmacht und stellt das nötige neurobiologische Grundlagenwissen sowie die wenigen existierenden psychopharmakologischen Behandlungsansätze vor. Der Hauptteil führt in die vier wesentlichen Therapieansätze der BPS ein, die Ihnen schulenübergreifend eine Hilfe sind: - die DBT: Dialektisch-Behaviorale Therapie nach M. Linehan - die MBT: Mentalisierungsbasierte Therapie nach A. Bateman und P. Fonagy - die Schematherapie nach J. Young - sowie die TFP: Transference-focused Psychotherapy nach O.F. Kernberg Ein abschließendes Kapitel reflektiert, wie die Zukunft der Borderline-Therapie aussehen sollte: integrativ die erfolgreichen Prinzipien der wichtigsten Borderline- Therapieverfahren aufgreifend und zu etwas Neuem verbindend. Dieses kleine Buch geht einen großen Schritt in diese Richtung. Dieses Buch richtet sich an- Assistenzärzte- Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik- Ärzte mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie- Psychologen- Psychotherapeuten- ferner Patienten/Betroffene
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thorsten Heedt
Borderline-Persönlichkeitsstörung
Das Kurzlehrbuch
Impressum
Dr. med. Thorsten Heedt, MHBA
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Ärztlicher Gutachter
DRV Rheinland
40194 Düsseldorf
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis
Die Medizin unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, immer nur dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches entsprechen können. Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Therapie und der Auswahl sowie Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet. Gleichwohl werden die Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel und Fachinformationen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spezialisten zu konsultieren. Fragliche Unstimmigkeiten sollten bitte im allgemeinen Interesse dem Verlag mitgeteilt werden. Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische oder therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung.
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Schattauer
www.schattauer.de
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung einer Enkaustik von © Nele Bäumer-Heedt − Explosive Leere
Lektorat: Volker Drüke, Münster
Projektmanagement: Dr. Nadja Urbani, Stuttgart
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-40009-0
E-Book: ISBN 978-3-608-11516-1
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20402-5
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1 Allgemeines zur Borderline-Persönlichkeitsstörung
1.1 Symptomatik
Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung
Kernsymptome
Probleme der Emotionsregulation
Negatives Selbstbild
Interpersonelle Schwierigkeiten
Sexualität
Invalidierende Entwicklungsumgebung
Epidemiologie
Komorbiditäten
Diagnostik
Resilienzstörung
1.2 Die Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Die Trauma-Hypothese
Linehans biosoziale Theorie
Biosoziales Entwicklungsmodell (BDM)
Selbys Emotionale-Kaskaden-Modell
Die Sicht der MBT
Hughes’ Sicht
Zukünftiges
1.3 Kritik des Persönlichkeitsstörungskonzepts
1.4 Neurobiologie
Neurofunktionelle Korrelate abnormer Emotionsregulation
Emotion und Kognition
Empathiestörung
Unterscheidung seelischer Zustände
Impulsivität
Neurobiologie selbstverletzenden Verhaltens
Interpersonelle Stile im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsstörungen
Soziale Kognition
Auswirkungen von Psychotherapie
1.5 Psychopharmakologische Behandlung
Antipsychotika
Antidepressiva
Stimmungsstabilisierer
Oxytocin
Weitere Substanzen
Verschreibungspraxis
1.6 Repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS)
1.7 Psychotherapie
Wer Therapie erhält
Wie man BPS-Patientinnen in Therapie bringt
Komplizierte Organisation einer Behandlung
Evidenzlage der großen Therapien
Ökonomischer Nutzen von Psychotherapie
Patientinnen, die sich nicht bessern
Smartphones und Internet
Prognose stationärer Behandlung
Integrierte Behandlung
Collaborative Care Programs (CCP)
Intermittent-continous eclectic therapy
2 DBT
2.1 Der Glaube an die Patientin
2.2 Validieren als Behandlungsprinzip
Validierung von Emotionen
Verhaltensvalidierung
Kognitionsvalidierungen
2.3 Emotionsphobie
2.4 Dialektische Behandlungsstrategien
Dialektik in der therapeutischen Beziehung
Dialektische Strategien im Einzelnen
Anspornen und »Cheerleading«
Problemlösetechniken
2.5 Information der Patientin
2.6 Verpflichtungsstrategien
Ebenen der Verpflichtung
Wiederholte Verpflichtung
Motivationstechniken
2.7 Struktur der DBT
Erste Phase
Zweite Phase
Dritte Phase
Strukturierung der Therapiestunden
Verhaltensanalyse
2.8 Therapievertrag
2.9 Telefonberatung
2.10 Dynamische Hierarchisierung der Therapieziele
2.11 Wochenprotokoll
2.12 Skills
Suchtdruck
Umgang mit unangenehmen Gefühlen
Skills für den Umgang mit Traumatisierungen
Notfallkoffer
Anspannungskurven bzw. Spannungsprotokolle
Fertigkeitentraining in der Gruppe
2.13 Umgang mit Suizidalität in der DBT
2.14 Reduktion von therapiegefährdendem Verhalten
Therapiegefährdende Verhaltensweisen
Therapiegefährdendes Verhalten seitens des Therapeuten
2.15 Aggressive Impulsdurchbrüche
2.16 Stationäre Krisenintervention
2.17 Supervision und Fallbesprechungen
2.18 Therapieabbruch durch den Therapeuten
2.19 Körpertherapie
2.20 Varianten der DBT
DBT-ACES
DBToP-gB
DBT-F
DBT-RO
DBT-S
DBT-PTSD
2.21 Neurobiologische Auswirkungen der DBT
3 MBT
3.1 Struktur der MBT
3.2 Mentalisieren
3.3 Wie Mentalisieren funktioniert
3.4 Die BPS aus MBT-Sicht
3.5 Prämentalistische Modi
Äquivalenzmodus
Als-ob-Modus
Teleologischer Modus
Mentalisierungsprobleme in der Adoleszenz
Verringerung der Top-Down-Kontrolle
3.6 Therapeutische Grundhaltung
3.7 Grundinterventionen
3.8 »Stop and rewind«
3.9 Diagnostik in der MBT
3.10 Therapieansatz der MBT
3.11 Mentalisierungsgerüst (»Mentalizing scaffold«)
3.12 Fremdes Selbst (»Alien self«)
3.13 Umgang mit selbstverletzendem Verhalten
3.14 Medikation
3.15 MBT bei anderen Störungsbildern
3.16 Ähnlichkeiten zwischen MBT und EMDR
Was passiert bei der MBT?
4 Schematherapie
4.1 Grundlagen der Schematherapie
4.2 Ursachen der BPS aus schematherapeutischer Sicht
4.3 Schemata
4.4 Schema-Modi
4.5 Schemata von BPS-Patientinnen
4.6 Grundprinzipen der Schematherapie-Behandlung
4.7 Einzelheiten der Behandlung
Diagnostik
Rahmenbedingungen
Mitschneiden der Behandlung
Behandlungstechniken
Die Therapiephasen
Telefonkontakte
Nachbeeltern und Fürsorge
Aufmerksamkeit richten auf Zusammenhänge zwischen Verhalten und Schema-Modi
Umgang mit Suizidalität
Umgang mit selbstschädigendem Verhalten
Einbeziehung des Partners
Grenzen setzen und Konfrontation der Patientin
Funktionsanalyse
Erlebnisorientierte Techniken
Rollenspiele
Kognitive Techniken
Verhaltensbezogene Techniken
Pharmakologische Therapie
Umgang mit Krisen
Umgang mit Traumata
5 TFP
5.1 Ansatz der Objektbeziehungstheorie
5.2 Die Borderline-Persönlichkeitsorganisation
Die paranoid-schizoide Position
5.3 Therapieansatz der TFP
Prinzip der technischen Neutralität und der gleichschwebenden Aufmerksamkeit
5.4 Containing, Klärung, Konfrontation, Deutung
5.5 Der stabile Behandlungsrahmen
5.6 Diagnostik der TFP
5.7 Therapeutische Strategien
Behandlungsrahmen
Kombination von TFP mit anderen Verfahren
Behandlungstechnik im Einzelnen
Behandlungs- und Deutungsprozess
Gefahren der therapeutischen Arbeit
Arbeit mit der Gegenübertragung
Gelungene Deutungen
Deutung von der Oberfläche zur Tiefe
Aktive Rolle des Therapeuten
»Verbotene« Techniken
Zusammenfassung
5.8 Einzelne Behandlungstaktiken
Behandlungshierarchie
Umgang mit häufigen Behandlungskomplikationen
Patientinnen mit BPS und sexuellem Missbrauch in der Anamnese
Zusammenfassung
5.9 Frühe Behandlungsphase
Das therapeutische Bündnis
Verlauf einer Sitzung in der frühen Behandlungsphase
Zusammenfassung
5.10 Mittlere Behandlungsphase
Vertieftes Verständnis wichtiger Übertragungsmuster
Die Sexualität der BPS-Patientin
Vertieftes Verständnis der Spaltung und Integrationsbestrebungen
Wechselnde Projektionen, Integration und verbesserte Realitätsprüfung
Erweiterung des Fokus in der mittleren Behandlungsphase
Ausgewogene Betrachtung der Übertragung und des äußeren Lebens der Patientin in der Therapie
Innere Repräsentationen, Identifizierung und Projektionen
Fortschritte in der Therapie und Reaktion der Patientin
Zusammenfassung
5.11 Fortgeschrittene Behandlungsphase
Agieren außerhalb der Sitzungen
Anzeichen für strukturelle Veränderungen
Technisches Vorgehen in der fortgeschrittenen Behandlungsphase
Beendigung der Therapie
5.12 Veränderungsprozesse in der TFP
Untergruppen der BPS aus TFP-Sicht
Bindung
5.13 Zeichen der Besserung nach TFP
6 STEPPS
7 Exkurs: die PTBS
7.1 Neurobiologie der PTBS
7.2 Genetik
7.3 Epigenetik
7.4 Psychotherapie
8 Vergleich der Borderline-Therapien
8.1 Theoretische Fundierung
8.2 Erlernbarkeit
8.3 Erklärbarkeit
8.4 Erlernbarkeit durch andere Berufe
8.5 Adressierung aller Symptome des Störungsbildes
8.6 Diagnostik
8.7 Psychopharmaka
8.8 Komorbiditäten
8.9 Kindheitstraumata
8.10 Behandlungsindikation
8.11 Therapieabbruchstendenzen
8.12 Einzel- versus Gruppentherapie
8.13 Supervision und Selbsterfahrung
8.14 Grenzverletzungen
8.15 Spezifische Techniken
8.16 Evaluationskonzepte
8.17 Ideologie- und Religionsfreiheit
8.18 Zusammenfassung
9 Die Borderline-Therapie der Zukunft
9.1 Die ideale Borderline-Therapie
9.2 Was fehlt?
9.3 Die Zukunft
Nachwort
Sachverzeichnis
In Gedenken an meine Mutter
Vorwort
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung, mitunter auch verkürzt als Borderline-Störung bezeichnet, hat mich schon seit Beginn meiner Laufbahn als ärztlicher Psychotherapeut und Psychiater in verschiedenerlei Hinsicht fasziniert: Ich verstand nicht, warum
eine typische (wenn es denn so etwas gibt) Borderline-Patientin sich zunächst so freundlich bis passiv verhält, um mich dann im nächsten Ausblick aus einem Ärger heraus anzuschreien,
diese Patientinnen oft eine gewaltige Unruhe auf der Station verbreiten, den Therapeuten – auch mich – zeitweise völlig innerlich destabilisieren können und Selbstzweifel induzieren können,
sie oft Therapien scheinbar aus einer Laune heraus abbrechen,
sie sich häufig so schwer verletzen,
so oft Selbstmordversuche eine Rolle spielen,
sie insgesamt so unglaublich schwer zu behandeln sind,
sie von Therapeut zu Therapeut eilen, um doch keine Hilfe zu erfahren.
Und dergleichen mehr.
Ich begriff, dass es sich um die therapeutisch am schwierigsten zu behandelnde Gruppe handelt (neben den »Narzissten«, so meine ich jedenfalls) und dass man eine Menge Erfahrung und therapeutischer Kunstfertigkeit benötigt, um diesen Patientinnen wirklich helfen zu können. Daher begann ich, mich für das Thema zu interessieren, was im Übrigen Überlappungen zum Thema der Psychotraumatologie aufweist (vgl. Heedt 2017). Eine erste Erkenntnis war, dass das Selbstbild(1) der Patientinnen brüchig ist, aber auch die Fremdwahrnehmung fundamental gestört ist und dass diese Patientinnen häufig schwer traumatisiert sind, wenngleich nicht alle. Dann merkte ich, dass mein Uraltbild therapeutischer Abstinenz mit dem Therapeuten als »weiße Wand«, also jemandes, der sich als eigenständige Person wenig zu erkennen gibt, in diesem Fall zu nichts führt.
Anfangs las ich – noch als Assistenzarzt – in einem Buch, dass der Therapeut mehr reden müsse als üblich. Längere Sprechpausen bewirkten, dass die Patienten sich eher verlassen fühlten. Also fing ich an unter dem Einfluss dieses holzschnittartigen Ratschlags in den Therapien gleichsam wie ein Wasserfall auf die Patienten einzureden und ständig aktiv zu suggerieren, dass ich ihnen helfen möchte. Natürlich führte dies zu nichts als Ärger. Im Laufe der Jahre wuchs meine Behandlungskompetenz schrittweise, wenngleich ich immer noch regelmäßig ratlos nach der einen oder anderen Therapiestunde zurückbleibe. Man lernt niemals aus, so sagt ja das Sprichwort, und so ist auch das Erweitern der Behandlungskompetenz ein »ongoing process«. Möge Ihnen dieses Buch ein wenig helfen, auch Ihre eigene zu erweitern und Sie anspornen, mehr über das Störungsbild zu lesen und vielleicht noch eine spezifische DBT-, MBT-, Schematherapie oder TFP-Fortbildung (das sind die Haupt-Therapierichtungen) zu beginnen. Das käme sicherlich Ihren Patienten zugute, und das würde auch mir in jeder Hinsicht eine große Freude bereiten, da es die Situation der Borderline-Patienten in diesem Land langfristig verbessern könnte, die allzu oft erst gar nicht in (Psycho-)Therapie ankommen, obwohl sie derer dringend benötigen. Vielleicht trägt es auch dazu bei, dass Ärzte weniger (in den meisten Fällen) überflüssige Medikamente verordnen, sondern lieber ihre psychotherapeutischen Kenntnisse erweitern. Möge es Ihnen ein Wegweiser im Dickicht der Borderline-Therapien sein.
Ich danke allen, die mir in irgendeiner Weise Inspiration und – auch indirekt – Hilfe beim Schreiben dieses Buchs gegeben haben. Zu erwähnen ist insbesondere meine Frau Nele Bäumer-Heedt, die mich jederzeit – auch durch die Erstellung eines wunderbaren Titelbildes – unterstützt hat.
Besonderer Dank gebührt zudem den nachstehend angeführten Forschern, die mir via Researchgate bereitwillig, ohne mich je persönlich getroffen zu haben, zahlreiche wertvolle Fachartikel, mich somit an ihrem reichen klinischen Erfahrungsschatz teilhaben lassend, zukommen ließen (der Platzersparnis halber ohne Titelnennung): Andreas Heinz, Peter Fonagy, Martin Bohus und Christian Schmahl.
Einzelne Artikel, die mir überaus nützlich waren, schickten mir zudem die folgenden Forscher: Egon Bachler, Darryl Bassett, Michael Berk, Edda Bilek, Andrea Bulbena-Cabré, Susan Brown, Chloe Campbell, Gabriele Ende, Eva Fassbinder, Christian G. Huber, Joost Hutsebaut, Jack R. Keefe, Hannah Little, Lars Mehlum, Inga Niedtfeld, David L. Streiner, Svenja Taubner, Katherine Thompson und viele mehr, die mir leider persönlich noch alle völlig unbekannt sind.
Nicht zuletzt danke ich Frau Nadja Urbani von Klett-Cotta/Schattauer für ihre fortwährende Unterstützung sowie Volker Drüke für die gewissenhafte Durchsicht des Manuskripts.
Thorsten Heedt, im Herbst 2018
Literatur
Heedt, T (2017). Psychotraumatologie. Stuttgart: Schattauer.
Einleitung
Patientinnen, die unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden, sind besonders und anders. Viele von ihnen haben schwere Traumatisierungen durchlitten, aber beileibe nicht alle; die Therapie gestaltet sich unglaublich schwer, weil hier Probleme auf ganz unterschiedlichen Ebenen lauern. Auf einer psychotherapeutischen Lehr-CD, die ich mir anlässlich der jedes Jahr stattfindenden und traditionell von mir besuchten Lindauer Psychotherapiewochen einmal kaufte, wurde einmal folgender, anschaulicher Vergleich (sinngemäß) dargelegt: Man besucht eine Vorstellung von »Romeo und Julia«, aber irgendwie ist es seltsam. Der eigentliche Held der Vorstellung kauert hilflos in der Ecke und ist blind, an einer Stelle brennt es plötzlich, und an einigen Stellen der Bühne sind die Planken lose, sodass die Schauspieler drohen hineinzustürzen. Mit anderen Worten: Man kann sich überhaupt nicht auf die Geschichte konzentrieren, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen und man von einer Katastrophe in die andere stürzt. Und genauso verhält es sich tatsächlich bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung: In der Behandlung dieses Störungsbildes kämpft man unaufhörlich mit der Einhaltung der Rahmenbedingungen durch die Patientinnen.
Auch ist es schwer, als Psychotherapeut die Contenance zu bewahren. Die Patientin zwingt den Therapeut ständig in eine Art der therapeutischen Beziehung, die genauso instabil wie die Innenwelt der Patientin selbst ist.
Fallbeispiel
Einmal stritt ich mich mit meiner früheren Oberärztin, da wir in einer therapeutischen Gruppe eine Borderline-Patientin hatten, die die ganze Gruppe in Aufruhr brachte. Beziehungsweise: Es war gar nicht klar, ob die Patientin eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte, aber meine damalige Oberärztin hatte in der Gegenübertragung den Eindruck, ihr würde »der Boden unter den Füßen weggezogen«. Das war für sie das Diagnostikum, zu entscheiden, dass die Patientin wohl eine Borderlinerin sei. Ich hielt eine solche Einschätzung – ich glaube zurecht – für gefährlich. Natürlich kann dies ein Hinweis sein, ist aber nicht beweisend, da die momentane Verfassung des Therapeuten, seine eigene Vorgeschichte, aber auch temporäre Verfassungen des Patienten diesen Eindruck erwecken können. Auch die Gruppendynamik mag dazu beigetragen haben, auch mag es noch zahlreiche weitere Einflussfaktoren geben.
Ich halte scheinbare absolute Gewissheit über die Einschätzung der Patientin grundsätzlich für zweifelhaft. Aber der wahre Kern an dieser Anekdote ist, dass Borderline- und generell strukturell schwer gestörte Patienten auch den Therapeuten selbst in Irritation und Aufruhr bringen können und dass dies eine der Hauptschwierigkeiten in der Behandlung ist. Es ist oft kompliziert, den therapeutischen Fokus aufrechtzuerhalten, man bedarf immer der Rückmeldung durch das Behandlungsteam und benötigt einen guten Supervisor im Hintergrund, sonst überfordert einen die Aufgabe.
Eine weitere Geschichte mag das übliche Problem illustrieren, welches sich oft zeigt:
Fallbeispiel
Ich untersuchte in der Notaufnahme eine Patientin mit Borderline-Störung, die sich kürzlich erneut schwer selbst verletzt hatte. Ich bemühte mich, besonders auf die Patientin einzugehen und ihr mit besonderer Empathie zu begegnen. Schon nach wenigen Minuten hatte ich den Eindruck, dass sich die Patientin bei mir sehr gut aufgehoben fühlte. Ich saß letztlich länger als üblich bei Neuaufnahmen bei der Patientin und hatte geglaubt, es bestünde bereits ein erstes zartes Pflänzlein eines guten therapeutischen Arbeitsbündnisses. Zudem hatte ich mit ihr einen gemeinsamen Therapieplan entworfen und ihr schon Einiges zum Störungsbild erklärt. Ich ging daher hochzufrieden aus dem Gespräch und fühlte mich prima. Eine Stunde später erfuhr ich, dass sich die Patientin überhaupt nicht von mir verstanden gefühlt, auf mich geschimpft und bereits die Klinik verlassen hatte.
Abgesehen davon, dass all dies auch Folge meines schlechten Ausbildungsstandes oder eigener therapeutischer Schwächen sein könnte, passiert so etwas aber nicht nur mir, sondern vielen Therapeuten in ähnlicher Weise bei Borderline-Patienten. Es kommt generell zu therapeutischen Missverständnissen. Woher das kommt und wie man das Behandlungsergebnis verbessern kann, davon handelt dieses Buch. Ich wünsche viel Freude bei der Auseinandersetzung mit der Materie. Gendertechnisch sei noch erwähnt, dass meist in diesem Buch für Borderline-Patienten die weibliche Form verwendet wurde, weil die überwiegende Mehrzahl der Borderline-Patienten, die mir im klinischen Kontext begegnet sind, weiblich sind.
Merke
Fortwährende Missverständnisse in der Behandlung sind neben dem Leitsymptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung, der mehrfach täglich plötzlich einschießenden aversiv erlebten inneren Anspannung, m. E. das Hauptcharakteristikum der Behandlung von Borderline-Patientinnen und prinzipiell unvermeidbar (so etwa wie man, aus der Physik bzw. der Heisenberg’schen Unschärferelation bekannt, aus prinzipiellen Gründen nicht gleichzeitig Ort und Impuls eines Teilchens bestimmen kann).
1 Allgemeines zur Borderline-Persönlichkeitsstörung
1.1 Symptomatik
Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung
Die Borderline-Störung gehört zu den Persönlichkeitsstörungen, heißt daher auch, genauer, »Borderline-Persönlichkeitsstörung«. Was ist überhaupt eine Persönlichkeitsstörung? Sind wir nicht alle oder wenigstens viele ein bisschen »persönlichkeitsgestört«? Nein, in der Psychiatrie ist mit einer Persönlichkeitsstörung ein spezifisches Störungsbild gemeint, welches seinen Ursprung in Kindheit und Jugend nimmt und insbesondere zu fortwährenden Schwierigkeiten in den sozialen Beziehungen der betroffenen Personen führt. Es gibt eine ganze Reihe an Persönlichkeitsstörungen innerhalb der internationalen Krankheitsklassifikation ICD-10, und die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist nur eine davon. Die allgemeinen Kritierien einer Persönlichkeitsstörung sind in der Übersicht zu sehen.
Merke
Allgemeine Kriterien einer Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60 Schwere Störungen der Persönlichkeit und des Verhaltens)
G1. Dauerhafte Abweichung von Normen in Bezug auf Kognition, Affektivität, Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung, Handhabung zwischenmenschlicher Beziehungen
G2. Allgemein unflexibles, unangepasstes, unzweckmäßiges Verhalten
G3. Hoher Leidensdruck und nachteiliger Einfluss auf die soziale Umwelt, bedingt durch G2
G4. Stabile Abweichung von langer Dauer mit Beginn im späten Kindesalter oder Adoleszenz
G5. Nicht erklärbar durch andere psychische Störung. Aber Überlagerung durch andere Störungsbilder möglich
G6. Nicht bedingt durch organische Erkrankung, Verletzung oder anderweitige Funktionsstörung
Im Folgenden wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung in der Regel als »BPS« abgekürzt. Die BPS (Internationale Krankheitsklassifikation ICD-10: F60.31) ist eine Unterform der sogenannten emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.3), von der es auch einen impulsiven Typus (ICD-10: F60.30) gibt. Die Unterschiede kann man den folgenden Übersichten entnehmen. Der impulsive Typus ist vor allem charakterisiert durch emotionale Instabilität und reduzierte Impulskontrolle. Hier kommt es gehäuft zu Ausbrüchen von gewalttätigem Verhalten, insbesondere falls die Patientin kritisiert wird. Die BPS hingegen zeigt noch eine Reihe weiterer Symptome, die in der Folge eingehend dargelegt werden.
Merke
F60.30 Emotional instabile Persönlichkeitsstörung – Impulsiver Typus
Drei der folgenden Verhaltensweisen, darunter Punkt 2.:
Unerwartetes Handeln ohne Berücksichtigung der Konsequenzen
Streitereien und Konflikte mit anderen, wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden
Wut-/Gewalt-Ausbrüche mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens
Schwierigkeiten bei Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden
Unbeständig-unberechenbare Stimmung
Merke
F60.31 Emotional instabile Persönlichkeitsstörung – Borderline Typus
Mindestens drei von fünf Kriterien des impulsiven Typus, dazu zwei der folgenden:
Unsicherheit bezüglich Selbstbild, Zielen und »inneren Präferenzen«
Neigung, sich auf intensive/instabile Beziehungen einzulassen
Übertriebene Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden
Häufig Drohungen/Handlungen mit Selbstbeschädigung
Anhaltende Leeregefühle
Kernsymptome
Bei der BPS findet man die Kernsymptome
affektiver Instabilität (die Gefühlslage schwankt den ganzen Tag über, vor allem zeigen sich immer wieder heftige unerträgliche Anspannungszustände),
emotionaler Dysregulation (die Gefühlslage läuft sozusagen aus dem Ruder, die Patientin bekommt es nicht hin, halbwegs in ausgeglichener Stimmung über den Tag zu kommen) sowie
eines schlechten interpersonellen Funktionsniveaus (mit anderen Worten, die Beziehungen zu anderen gestalten sich meist überaus problematisch und anstrengend) (Lieb et al. 2004).
Besonders problematisch ist, dass die Suizidraten erhöht sind (6–8 %), und bis zu 90 % der Patienten selbstverletzendes Verhalten zeigen, welches nicht primär suizidal ausgerichtet ist, sondern anderen Funktionen dient (z. B. Abbau von Spannung, Selbstbestrafung, das Bedürfnis, sich zu spüren, usw.) (Zanarini et al. 2008). Typisch ist auch das Auftreten von Hochrisikoverhalten und impulsiver Aggression(1). Man findet eine dysfunktionale Emotionsverarbeitung und soziale Interaktion als psychologische Hauptmechanismen (Witt et al. 2017). Das typische Symptomenbild offenbart ▶ Abb. 1-1.
Abb. 1-1 Kernsymptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach ICD-10
Probleme der Emotionsregulation
Stiglmayr et al. (2017) vergleichen die Emotionalität des BPS-Patienten mit einem Ferrari: Dieser reagiere sensibler auf Berührungen des Gaspedals. Da die BPS-Patientin den »emotionalen Ferrari« aber als nicht regelbar erlebt, vermeidet sie phobisch ihre Emotionen in Bezug auf sämtliche abgrenzbaren Emotionen wie Scham, Schuld usw. oder verwendet z. B. selbstverletzendes Verhalten oder Substanzkonsum zur Regulation.
BPS-Patientinnen können zwar Emotionen differenzieren und modulieren, mit zunehmender Anspannung geht diese Fähigkeit aber verloren (Ebner-Priemer et al. 2007; Stiglmayr et al. 2017). Stiglmayr benennt die Anspannung des BPS-Patienten als eine Art »Hintergrundrauschen«, welches die Entschlüsselung emotionaler Signale erschwere (Stiglmayr et al. 2008). Bei der BPS kommt es zu Schwierigkeiten bei der Verarbeitung emotionaler Stimuli (Yeomans et al. 2017). Die Patienten können negative Stimuli nicht angemessen verarbeiten oder durch Neubewertung dämpfen (Koenigsberg et al. 2009). Intensive Affekte werden häufig durch interpersonelle Probleme ausgelöst, durch z. B. Trennungen oder Erleben von Zurückweisung.
Besonderheiten der Gesichtserkennung
Interessant ist in dem Zusammenhang, dass BPS-Patientinnen Schwierigkeiten haben, den Ausdruck von Gesichtern richtig zu interpretieren. Als Beleg sei folgende Studie erwähnt: Matzke et al. (2014) untersuchten, ob sich BPS-Patienten signifikant in Bezug auf die eigene emotionale Reaktion auf Gesichter unterscheiden. Zu diesem Zweck erhielten 28 weibliche BPS-Patienten im Vergleich zu 28 gesunden Personen eine Gesichtserkennungsaufgabe mit dynamischen Gesichtsbildern, wobei die Aktivität verschiedener Gesichtsmuskeln erfasst wurde. Außerdem bewerteten die Teilnehmer die emotionale Intensität der gezeigten Gesichter und die Intensität ihrer subjektiven Gefühle. Im Vergleich zu den Kontrollen zeigten BPS-Patienten eine verstärkte Antwort des M. corrugator supercilii (»Augenbrauenrunzler-Muskel«) in Bezug auf ärgerliche, traurige oder Ekelausdrücke und abgeschwächte Antworten des Levator labii superioris (»Oberlippenheber«) in Bezug auf glückliche und überraschte Gesichtsausdrücke. Diese Untersuchung belegt, dass die Gesichtserkennung bei BPS-Patienten nicht generell schlechter ist und dass Borderline-Patienten in Bezug auf die emotionale Verfassung anderer auch nicht generell überreagieren. Stattdessen zeigten sie eine reduzierte Gesichtsreaktion auf positive soziale Signale und eine gesteigerte Gesichtsreaktion auf negative soziale Signale. Dieses Muster könnte zu den Schwierigkeiten beitragen, die BPS-Patienten in ihren sozialen Interaktionen zeigen.
Negatives Selbstbild(2)
Laut Winter et al. (2017) sind negative Selbstbewertungen bei Patientinnen mit BPS sehr häufig, aber erstaunlich wenig untersucht. Auch Santangelo et al. (2017) betonen, welche große Rolle die Instabilität des Selbstbildes bei der BPS spielt und wie eng dies mit der affektiven Instabilität bei BPS-Patientinnen zusammenhängt.
Interpersonelle Schwierigkeiten
Während Gesunde es schaffen, vertrauensvolle Beziehungen, auf die sie sich verlassen können, aufzubauen, gelingt dies BPS-Patientinnen extrem schlecht (Krueger et al. 2007). Sie können vor dem Hintergrund individueller Faktoren, häufig in Verbindung mit Misshandlungs- oder Missbrauchserfahrungen in der Vorgeschichte, soziale Interaktionen schlecht emotional regulieren. Sie fühlen sich oft vom Gegenüber abgelehnt, unabhängig davon, ob dies auch real zutrifft (Renneberg et al. 2012; Staebler et al. 2011). Die Patientinnen reagieren feindselig auf drohende Zurückweisung (Berenson et al. 2011) und reagieren eher reflexhaft statt reflektiert. BPS-Patientinnen sind zudem im Sinne der Bowlby’schen Bindungstheorie überzufällig häufig »unsicher gebunden« (Barone 2003).
Hyperaktivierungsstrategien
Um ihre Innenwelt und die Interaktionen mit anderen zu regulieren, benutzen BPS-Patientinnen häufig sogenannte Hyperaktivierungsstrategien. So baut die BPS-Patientin unangemessen enge Bindungen zu anderen auf, was auch neuronale Kreisläufe beeinträchtigt, die der Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit anderer dienen. Diese Patientinnen idealisieren ihre Therapie und den Therapeuten und neigen dazu, natürliche Grenzen(1) der Beziehung zu überschreiten. Wenn die eigenen Bedürfnisse dann nicht wie erwünscht erfüllt werden, kippt die Stimmung rasant, und sie werden entwertend und feindlich gesinnt. Gerade in stationären Einrichtungen, die ja schnell die Aufnahme einer vertrauensvollen Bindungsatmosphäre stimulieren, kann es schnell dazu kommen, dass das Bindungssystem der Patientin rapide hyperaktiviert wird. Therapien, die die Aufnahme einer zu frühen intensiven Bindung stimulieren sind daher nicht ohne Risiko. Daher intensiviert beispielsweise die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT), eine der etablierten Verfahren zur Behandlung der BPS, die Therapeutenbeziehung erst in späteren Therapiephasen, wenn die Patientin gelernt hat, besser unter Stress zu mentalisieren, d. h. sich in die eigene seelische Innenwelt und die eines anderen einzufühlen, was diesen Patientinnen üblicherweise unter Stress nicht so gut gelingt (Bateman und Fonagy 2013).
Deaktivierungsstrategien
Andere BPS-Patientinnen nutzen eher Deaktivierungsstrategien, d. h., sie neigen dazu, im Fall von emotionalem Stress sich innerlich emotional zu distanzieren. Je höher der Stress allerdings wird, desto schwieriger wird es, diese Maske aufrechtzuerhalten – Gefühle von Unsicherheit und negative Selbstrepräsentationen nehmen zu. Sie haben physiologische Auffälligkeiten, etwa erhöhte Blutdruckwerte, erscheinen aber äußerlich relativ ruhig und geben auch an, nicht gestresst zu sein. Dies kann bei nichttolerablem Stress dann in plötzliches Schwitzen und Schwindelgefühle umschlagen. Einen plötzlichen Anstieg des Stresslevels attribuieren sie selbst dann eher äußeren Umständen als dem Thema (z. B. mit der Behauptung, zu schlecht geschlafen zu haben). Ihre Mentalisierungsfähigkeit ist limitiert. Sie neigen dazu, intellektualisierende und rationalisierende Erklärungen abzugeben, was man als »Als-ob-Modus(1)« (»Pretend-mode«) bezeichnet, ein zentraler Begriff, auf den ich noch zu sprechen kommen werde (Bateman und Fonagy 2013).
Mischstrategien
Andere Patientinnen, und zwar solche mit eher desorganisiertem Bindungsverhalten, zeigen sowohl Schwierigkeiten beim Mentalisieren als auch eine Tendenz zum Hypermentalisieren, benutzen aber deaktivierende Strategien, wenn die hyperaktivierenden scheitern. Die hyperaktivierenden Strategien führen oft letztlich zu einem Verlust der Mentalisierungsfähigkeit, während die deaktivierenden Strategien dazu führen, dass die wesentlichen emotionalen Inhalte vermieden werden. Diese Patientinnen verlieben sich z. B. rasch, fühlen sich dann genauso schnell vernachlässigt oder betrogen, können aber auch ihren Eigenanteil an dieser Entwicklung nicht reflektieren – aufgrund ihres Mangels an Mentalisierungsfähigkeit.
Merke
Patientinnen, die eher deaktivierende Strategien verwenden, ziehen sich häufig aus den Beziehungen zurück und beschäftigen sich allein; wenn man versucht, ihre Innenwelt zu explorieren, langweilen sie einen mit sachlichen Schilderungen ohne Gefühlsinhalt. Man sollte dann in der Therapie genau herausarbeiten, welche Situationen jeweils das hyperaktivierende und welche das deaktivierende Verhaltensmuster triggern, sodass man besser herausfinden kann, was sensible Felder sind, die in der Therapie zu Problemen führen könnten (Bateman und Fonagy 2013).
Die bereits erwähnte MBT, die noch eingehend im Verlaufe dieses Buchs dargestellt wird, fokussiert daher auf die Stabilisierung des Selbsterlebens. So soll die kontinuierliche Fähigkeit zur Mentalisierung während interpersoneller Kontexte sichergestellt und der Patientin geholfen werden, ein optimales »Arousal« (Erregungsniveau) während ihrer Interaktionen aufrechtzuerhalten.
Die Patientinnen sind ständig in ihren Interaktionen vom Verlust ihrer Mentalisierungsfähigkeit bedroht. Währenddessen sind die eigenen Erfahrungen entweder überreal oder aber erscheinen bedeutungslos. Diese verzerrten subjektiven Zustände sind jeweils von reißendem psychischem Schmerz begleitet, den andere oft nicht nachvollziehen können. Daher ist ein wichtiges Therapieziel, Affekte bei sich und anderen richtig zu identifizieren und eigene auszudrücken. Dies ist so wichtig, weil sonst oft die therapeutische Beziehung wegen permanenter Missverständnisse in der Therapie nachhaltig gefährdet ist.
Alexithymie
New et al. (2012) untersuchten die Rolle der Alexithymie (Unfähigkeit, Gefühle zu lesen) bei BPS (da man annahm, dass Borderlinerinnen diese häufiger zeigen). Die Untersuchung hatte 79 BPS-Patientinnen, 76 gesunden Kontrollen und 39 Patienten mit vermeidender Persönlichkeitsstörung zur Grundlage, wobei es darum ging, den Einfluss der Alexithymie und ihren Einfluss auf das interpersonelle Funktionieren zu beurteilen. Dazu wurden u. a. die Reaktionen auf emotional gefärbte Bilder mittels einer Computeraufgabe gemessen, wo sich die Probanden entweder auf die Erfahrung des im Bild gezeigten Individuums oder auf die eigene vorgestellte Erfahrung fokussieren sollten. Patienten mit BPS hatten große Schwierigkeiten, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und zeigten zugleich ein hohes Stresslevel. Sie offenbarten ein intaktes »empathisches Besorgtsein«. Die klarsten Unterschiede zu Kontrollen bei der Computeraufgabe zeigten sich während selbstbezogener Antworten auf negatives Bildmaterial. Die BPS-Patientinnen reagierten stark auf die Gefühle anderer, waren aber darin beeinträchtigt, die Gefühle und die Perspektive anderer zu beschreiben.
Invalidierende Entwicklungsumgebung
Sozial ist die typische BPS-Patientin oft in einem nichtvalidierenden (also bestätigend-unterstützenden) Umfeld aufgewachsen. Es handelt sich meist um eine soziale Umgebung, in der eigene Gefühle eher in Abrede gestellt werden und das Kind nicht lernt, eigene Gefühle zu benennen und zu regulieren. In diesen Familien kommt es häufig zu Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen, sodass viele BPS-Patientinnen daher an einer PTBS(2)-Komorbidität leiden, und zwar bis zu 60 % (Zanarini et al. 1998).
Komorbiditäten
Auffällig ist das hohe Maß des Auftretens von Komorbiditäten(1). Das sind Störungsbilder, die parallel zu der BPS zusätzlich vorhanden sind, z. B. von Depressionen, Angststörungen (McGlashan et al. 2000). Im Einzelnen zeigen die Patientinnen affektive Störungen (80 %), Angststörungen (80 %), Essstörungen (70 %), Substanzmissbrauch (60 %), PTBS(3) (60 %), weitere Persönlichkeitsstörungen (80 %), häufig auch dissoziative Störungen (50–80 %) (Sipos und Schweiger 2003; Priebe et al. 2013).
Ängste(1)
Häufig entwickeln BPS-Patientinnen auch diverse Ängste. Bulbena-Cabré et al. (2017) verweisen darauf, dass man Angst als klinisches Phänomen bei der BPS ernstnehmen soll. Viel zu wenig sei dies untersucht, und es gebe eine deutliche neurobiologische Überlappung mit Auffälligkeiten im limbischen System, der HPA-Achse und in Serotonintransporter- und Glukokortikoidtransportergenen sowie atypischen Regulationsvorgängen im autonomen Nervensystem (zur Erklärung der vorstehenden Begriffe sei auf die gängigen Lehrbücher der Physiologie und Neurophysiologie verwiesen). Man solle auch die somatischen Beschwerden der Patientinnen ernstnehmen und seinen Blick für neuere Therapieansätze erweitern. Sinnvoll sei etwa die Gabe von Medikamenten wie Syntocinon (Wirkstoff: Oxytocin), aber auch die Rolle der »nutritional psychiatry« (Auswirkungen von Ernährung) und insbesondere die Rolle des Mikrobioms (die Gesamtheit der den Menschen besiedelnden Mikroorganismen) seien beachtenswert.
Brück et al. (2018) zeigten, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Patientinnen unter Gelotophobie leiden, d. h. der Angst, ausgelacht zu werden – ein Phänomen, das bisher viel zu wenig untersucht sei.
Psychosen
Die Bedeutung psychotischer Phänomene bei BPS-Patientinnen scheint im Allgemeinen unterschätzt zu werden. In einer Untersuchung von Schroeder et al. (2018) berichteten 36 % der Patientinnen über vielgestaltige und lange anhaltende Wahrnehmungsveränderungen sowie 21 % von Wahnvorstellungen. Es besteht nach Ansicht der Autoren die Gefahr der Trivialisierung dieser Phänomene durch Begriffe wie »Pseudohalluzinationen«, was die Behandlung erschweren könnte.
Bassett et al. (2017) diskutierten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen bipolarer Störung, die auch zu den Psychosen zählt, und BPS. Es gibt viele neurobiologische und klinische Gemeinsamkeiten dieser Störungsbilder. Manche Forscher meinten sogar, dies als eigenständige »Mood disorder« definieren zu müssen (»Fluoxothymia«), aber im Augenblick hat sich doch eher die Erkenntnis durchgesetzt, dass die BPS ein eigenständiges Störungsbild darstellt.
Diagnostik
Diagnostizieren kann man die BPS nicht nur durch klinische Untersuchung und Befragung, sondern auch durch Zuhilfenahme verschiedener Hilfsmittel: Zum einen gibt es das IPDE (International Personality Disorder Examination; Loranger 1999), das SKID-II (Strukturiertes Klinisches Interview) und das DIB-R (revidierte Version des Diagnostischen Interviews für Borderline-Patienten; Stiglmayr et al. 2017). Zum anderen gibt es die BSL (Borderline-Symptom-Liste; Bohus et al. 2007), die sich zur Selbstbeurteilung und Verlaufsbeobachtung eignet.
Diagnosestellung nach ICD-10
Zur Diagnose der BPS müssen nach ICD-10 die allgemeinen Kriterien einer Persönlichkeitsstörung erfüllt sein. Das bedeutet, dass sich charakteristische und dauerhaft ausgeprägte Abweichungen von kulturell erwarteten und akzeptierten Normen in Bezug auf unterschiedliche Bereiche zeigen, verbunden mit deutlichem Leidensdruck. Zur Diagnosestellung müssen mehrere Symptome zusammentreffen (Habermeyer et al. 2008), u. a.:
wechselnde, instabile Stimmung,
Neigung zu Ausbrüchen intensiven Ärgers (gewalttätiges Verhalten wird bei dieser Patientengruppe leicht ausgelöst, wenn impulsive Handlungen behindert werden),
Störungen und Unsicherheiten bezüglich des Selbstbildes, der Ziele und der inneren Präferenzen,
chronische Leeregefühle(1),
Neigung zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen,
übermäßige Anstrengungen, nicht verlassen zu werden,
Neigung zu Suiziddrohungen oder selbstschädigenden Handlungen.
Kernproblem ist aber die Affektregulationsstörung, gekennzeichnet durch maladaptive (schlecht ans Problem angepasste) Verhaltensweisen. Schon auf geringe Auslöser reagieren die Patientinnen mit überwältigenden negativen Gefühlen. Es kommt, und das ist das Leitsymptom des Störungsbildes, zu heftigen Anspannungszuständen, die mehrfach am Tag auftreten (Habermeyer et al. 2008; Stiglmayr et al. 2001). Die Patientinnen fühlen sich oft innerlich leer, wie abgestorben oder innerlich tot, geraten in gedankliche Teufelskreise von Selbstverachtung, einhergehend mit Scham- und Schuldgefühlen. Auch können dissoziative Derealisationszustände auftreten.
Definition
Dissoziation ist ein vielgestaltiges Phänomen, wo z. B. Teile des Erlebens gleichsam ausgeblendet werden. Es kommt besonders häufig im Zusammenhang mit Psychotraumata vor, ist aber grundsätzlich zunächst einmal unspezifisch.
Interpersonell löst das Erleben von Nähe und Geborgenheit sehr widersprüchliche Gefühle aus. Es kommt oft zu Missverständnissen in den persönlichen Beziehungen, was dann zu Kontaktabbrüchen führen kann. Die Patientinnen wechseln häufig zwischen Idealisierung und Entwertung in Bezug auf Beziehungspersonen, es zeigt sich also eine sehr instabile Beziehungsgestaltung. Auch kommt es zu Selbstverletzungen oder parasuizidalen Handlungen (z. B. neben den Gleisen entlanggehen). Das selbstverletzende Verhalten neigt zur Chronifizierung, da die Patientinnen sich oft danach ruhig und entspannt fühlen – dissoziatives Erleben wird gemindert (die Patientinnen spüren sich wieder).
Im Rahmen des selbstschädigenden Verhaltens kann z. B. auch bulimisches Essverhalten(1) auftreten. Drogen(1)- oder Alkoholmissbrauch, Hochrisikoverhalten, übermäßiges Geldausgeben, promiskuitives Verhalten sowie aggressive Durchbrüche können vorkommen, obwohl BPS-Patientinnen oft vom Grundcharakter her eher unsichere Persönlichkeiten sind (Habermeyer et al. 2008). Die Kognition(1) ist durch stabile dysfunktionale Grundannahmen gekennzeichnet, z. B. von der, dass die Welt feindselig, die Patientin aber selbst machtlos sei. Auch neigen sie zu Schwarz-Weiß-Denken. Sie zeigen eine ausgeprägte Identitätsunsicherheit, können schlecht ihre eigene Innenwelt und auch die anderer reflektieren. Sie empfinden sich selbst oft als grundsätzlich nicht liebenswert und haben Angst vor Trennungssituationen (Habermeyer et al. 2008).
Fallbeispiel
Mehrere Kinder von mehreren Vätern
Immer wieder beunruhigend ist die Instabilität einiger Patientinnen in Bezug auf ihre privaten Beziehungen. Ich habe es nicht selten erlebt, dass eine Patientin auf die Station kommt, die derart instabile Beziehungen führt, dass sie mehrere Kinder von mehreren Vätern hat, und beinahe jedes davon ans Jugendamt abgeben musste. Kein Wunder – zuerst wird der Partner idealisiert, später aufgrund des brüchigen Bildes vom Gegenüber als Bedrohung wahrgenommen und fortgejagt.
Daher ist es so wichtig, dass alles getan wird, diese Patientinnen in Psychotherapie zu bringen, um Schaden von sich und ihren Kindern abzuwenden (wenngleich es auch die denkbar liebevollsten und fürsorglichsten Borderline-Mütter gibt, mit Problemen in anderen Bereichen).
Im Allgemeinen sagt man aber, dass Borderline-Patientinnen nicht instabile Beziehungen im Sinne von kurz dauernd führen, sondern durchaus längere, die aber extrem turbulent verlaufen, da sie von den häufigen Stimmungsumschwüngen, Trennungsdrohungen, Wiederversöhnungen und ähnlichen Wechselfällen ihrer Beziehungswelt geprägt sind.
Diagnosestellung nach DSM 5
Im DSM-5 (APA; Falkai et al. 2015), dem vorrangig in der Forschung verwandten System der American Psychiatric Association, werden neun Kriterien angeführt, in den Hauptkategorien Störungen der Affektregulation(1), der Identität sowie der sozialen Interaktion. Die beobachtbare Störung der Affektregulation zeichnet sich dadurch aus, dass überschießende emotionale Zustände rasch auslösbar sind und dann übermäßig stark ausfallen und sehr lange anzuhalten. Sie werden zudem von der Patientin als undifferenziert und unkontrollierbar erlebt. Die undifferenzierten Emotionen werden eher als diffuse Anspannung erlebt und gehen oft mit dissoziativem Erleben einher (Stiglmayr et al. 2017; Stiglmayr et al. 2005). Die beobachtbare Identitätsstörung zeigt folgende Facetten (Wilkinson-Ryan und Westen 2000; Stiglmayr et al. 2017):
Aufgehen in einer einzigen Rolle (Rollen-Absorption),
Gefühl innerer Zerrissenheit (Inkohärenz),
in Abhängigkeit von der Bezugsperson wechselnde Identität (Inkonsistenz),
Schwierigkeiten in der Übernahme einer sozialen Rolle (fehlende Rollenakzeptanz).
Die DSM-Kriterien sind in der folgenden Übersicht dargestellt. Bohus soll übrigens das Beziehungsverhalten von Borderline-Patienten als das »chronisch Pubertierender auf hohem Niveau« charakterisiert haben (Stiglmayr et al. 2017).
Merke
Kriterien nach DSM-5 (nach Falkai et al. 2015)
Tiefgreifendes Muster von Instabilität in Bezug auf interpersonelle Beziehungen, Selbstbild, Affekte, Impulsivität. Beginn: frühes Erwachsenenalter. Fünf Kriterien müssen erfüllt sein:
Hektisches Bemühen, Verlassenwerden zu vermeiden
Muster instabiler intensiver Beziehungen mit typischem Wechsel zwischen Idealisierung und Entwertung
Ausgeprägte andauernde Instabilität des Selbstbildes/der Selbstwahrnehmung
Impulsivität in mindestens selbstschädigenden Bereichen (Geldausgeben, Sexualität, Substanzmittelkonsum, Essanfälle, rücksichtloses Fahren etc.)
Wiederholte suizidale Handlungen, Drohungen oder selbstverletzendes Verhalten
Affektive Instabilität wegen hochgradiger Reaktivität der Stimmung/Misslaunigkeit, Reizbarkeit, Angst, meist nur Stunden andauernd
Chronische Leeregefühle
Unangemessene heftige Wut(ausbrüche)
Vorübergehende belastungsinduzierte paranoide Vorstellungen oder dissoziative Symptome
Resilienzstörung
Peter Fonagy ist Mitbegründer der MBT und fokussiert zunehmend auf Gedanken wie Salutogenese und Resilienz(1). In einem aktuellen Paper erklärt er (Fonagy et al. 2017), dass bei vielen Persönlichkeitsstörungen vor allem ein Fehlen von Resilienz charakteristisch ist.
Definition
Resilienz(2) meint die psychische Widerstandsfähigkeit, die uns Krisen bewältigen lässt und zu einer weiteren Persönlichkeitsreifung beiträgt.
1.2 Die Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Winsper et al. (2017) fassen in einem aktuellen Review die Entwicklung gängiger Theorien zur Entwicklung der Borderline-Störung zusammen: Sie stellen dar, wie die defiziente Koregulation (zwischen Mutter und Kind) und die defiziente soziale Interaktion in der Kindheit emotionale Dysregulation und Defizite der sozialen Kognition(2) im Rahmen der Entwicklung bedingen und wie über positive Feedback-Schleifen maladaptive soziale Erfahrungen diese Abläufe verschlimmern. Die Autoren beschreiben einen Wandel des Verständnisses des Störungsbildes im Laufe der letzten Jahrzehnte.
Die Trauma-Hypothese
So habe man zunächst angenommen, die Borderline-Persönlichkeitsstörung wäre mit Kindheitstraumata assoziiert. Dieses vor allem in den 80er-Jahren propagierte Modell sei aber eine zu simplifizierende Herangehensweise an das Problem. So komme wahrhaft schwerer Missbrauch nur in einer Minderzahl der Patienten vor, während Misshandlung in der Kindheit ein nichtspezifischer Risikofaktor für eine ganze Bandbreite psychopathologischer Erscheinungen sei (Winsper et al. 2017; Paris 2009).
Linehans biosoziale Theorie
In den 90er-Jahren habe sich dann vor allem Marsha Linehans biosoziale Theorie etabliert, die multifaktorielle Interaktionen zwischen Diathese (das ist die Neigung des Körpers zur Entwicklung einer bestimmten Krankheit) und Stressoren beschreibt. Die Theorien dieser Zeit betonten allesamt die Bedeutung psychosozialer Risikofaktoren (Winsper et al. 2017; Paris und Zweig-Frank 1992; Linehan 1993; Millon 1993).
In letzter Zeit konzentriere man sich mehr auf Besonderheiten der Entwicklung bei der BPS: Im Rahmen eines entwicklungspsychopathologischen Modells betrachte man mögliche ätiologische Pfade auf verschiedenen Ebenen der Entwicklung in Bezug auf genetischer, neuronaler, Verhaltens-, familiärer und sozialer Ebene (Winsper et al. 2017). Die heutigen Theorien könne man grob unterteilen in solche, die entweder die emotionale Dysregulation oder aber maladaptive soziale Wahrnehmungsprozesse in den Fokus der Ätiologie rücken.
Biosoziales Entwicklungsmodell (BDM)
Das BDM (Biosoziales Entwicklungsmodell; Crowell et al. 2009) bleibt nicht bei Linehans Hypothese stehen, die die BPS vor allem als Störung der emotionalen Dysregulation begreift, entstehend aus maladaptiven Transaktionen zwischen biologischen Vulnerabilitäten und einer invalidierenden Entwicklungsumgebung. Das BDM geht stattdessen davon aus, dass Impulsivität(2) und emotionale Dysregulation sich unabhängig und in einer geordneten Abfolge von Entwicklungsschritten herausbilden und durch Umweltrisikofaktoren potenziert werden. So könne ein Kind mit besonderer Impulsivität als Persönlichkeitseigenschaft in einer Hochrisikoumgebung unfähig sein, extreme Emotionen im Lichte unsteten Elternverhaltens zu regulieren. Maladaptive Regulationsprozesse könnten dann zu negativen sozialen und kognitiven Folgen führen, bis dann, in der Mitte der Adoleszenz, maladaptive Coping-Strategien einsetzten (Winsper et al. 2017). Dies verschärft das Risiko des Auftretens einer BPS, indem es zu weiteren invalidierenden Reaktionen der Umwelt führe und die soziale Entwicklung weiter behindere.
Selbys Emotionale-Kaskaden-Modell
Selbys Emotionale-Kaskaden-Modell (Emotional Cascades Model, ECM; Selby et al. 2009