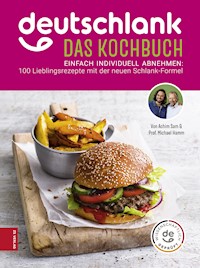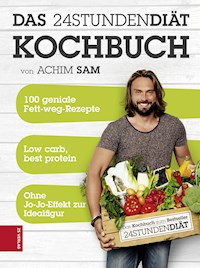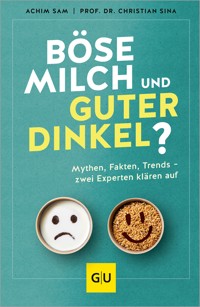
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mythen, Fakten, Trends – Zwei Experten klären auf Ist Milch wirklich ungesund? Macht Dinkel schlank? Und was steckt hinter den neuesten Ernährungstrends? Wer sich zwischen widersprüchlichen Ernährungsmythen verloren fühlt, findet in diesem Buch endlich Klarheit! Endlich Durchblick im Ernährungsdschungel Die Ernährungsexperten Achim Sam und Prof. Dr. Christian Sina räumen mit hartnäckigen Mythen auf und geben dir 100 fundierte Antworten auf die wichtigsten Ernährungsfragen unserer Zeit. Statt Halbwahrheiten erhältst du wissenschaftlich fundierte Fakten – verständlich und alltagstauglich erklärt. Was dieses Buch bietet: - 100 Fragen, 100 klare Antworten: Von Milch über Superfoods bis Detox – zwei Experten klären auf. - Kompetenz trifft Praxis: Achim Sam (Podcaster & Bestsellerautor) und Prof. Dr. Christian Sina (Ernährungsmediziner) teilen ihr geballtes Wissen. - Entspannt gesund essen: Schluss mit Verzicht und strengen Regeln – genieße ohne schlechtes Gewissen. - Mythen-Check: Was stimmt wirklich bei Ernährungstrends wie Superfood oder Detox? - Praktische Tipps: Sofort umsetzbare Ansätze für eine gesündere Ernährung im Alltag. Warum du dieses Buch brauchst: Du möchtest endlich wissen, was wirklich gesund ist? Lass dich von zwei Ernährungsexperten durch den Info-Dschungel führen! Dieses Buch bringt Klarheit, Genuss und alltagstaugliche Tipps – ohne Verbote oder komplizierte Regeln. Jetzt bestellen und entspannt gesund genießen! Deine Küche (und dein Gewissen) werden es dir danken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
IMPRESSUM
eBook: © 2025 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Grillparzerstraße 12, 81675 München
GU ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
www.gu.de/kontakt|[email protected]
ISBN 978-3-8338-9535-7
1. Auflage 2025
GuU 8-9535 08_2025_02
DIE BÜCHERMENSCHEN HINTER DEM PROJEKT
Verlagsleitung: Eva-Maria Hege
Lektorat: Stella Paschen
Korrektorat: Andrea Lazarovici
Mitarbeit am Text: Bernd Neumann
Covergestaltung: Editorial Design, Sabine Krohberger, München
eBook-Herstellung: Liliana Hahn
BILDNACHWEIS
Illustrationen: Claudia Klein
Fotos: Gulliver Theis; eachfilm GmbH; Shutterstock: (asiandelight), (Bojsha),(Carey Jaman), (Dorota Milej), (Elena Veselova), (Esin Deniz), (Ground Picture), (Hryshchyshen Serhii), (InesBazdar), (Kulkova Daria), (Lobachad), (mariaeleman), (mikeledray), (Nastyaofly), (Natalia Mechik), (New Africa), (Oksana Mizina), (Olena Rudo), (pundapanda), (Rimma Bondarenko), (Roman Samborskyi), (Sea Wave), (Sergii Koval), (SerPhoto), (Tatevosian Yana), (Tatjana Baibakova)
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
WERDE TEIL DER GU-COMMUNITY
Du und deine Familie, dein Haustier, dein Garten oder einfach richtig gutes Essen.
Egal, wo du im Leben stehst: Als Teil unserer Community entdeckst du die neuesten GU-Bücher als erstes, du genießt exklusive Leseproben und wirst mit wertvollen Impulsen und kreativen Ideen bereichert.
Worauf wartest du? Sei dabei! www.gu.de/gu-community
www.instagram.com/gu.verlag/
www.facebook.com/gu.verlag
de.pinterest.com/guverlag/
de.linkedin.com/company/gräfe-und-unzer-verlag-gmbh
www.youtube.com/user/gubuchvideo
WARUM UNS DAS BUCH BEGEISTERT
Dieses Buch räumt mit Ernährungsmythen auf und lädt zu einem entspannten, genussvollen Umgang mit Lebensmitteln ein.
Eva-Maria Hege, Verlagsleitung
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
wie wunderbar, dass du dich für ein Buch von GU entschieden hast! In unserem Verlag dreht sich alles darum, dir mit gutem Rat dein Leben schöner, erfüllter und einfacher zu machen. Unsere Autorinnen und Autoren sind echte Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten, die ihr Wissen mit viel Leidenschaft mit dir teilen. Und unsere erfahrenen Redakteurinnen und Redakteure stecken viel Liebe und Sorgfalt in jedes Buch, um dir ein Leseerlebnis zu bieten, das wirklich besonders ist. Qualität steht bei uns schon seit jeher an erster Stelle – jedes Buch ist von Büchermenschen für Buchbegeisterte gemacht, mit dem Ziel, dein neues Lieblingsbuch zu werden.
Deine Meinung ist uns wichtig, und wir freuen uns sehr über dein Feedback und deine Empfehlungen – sei es im Freundeskreis oder online.
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
P.S. Hier noch mehr GU-Bücher entdecken: www.gu.de
WICHTIGER HINWEIS
Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrung des Verfassers dar. Sie wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für persönlichen kompetenten medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbstverantwortlich. Weder Autoren noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
WAS IST WIRKLICH GESUND UND WAS NUR EIN HYPE IM INTERNET?
Darf ich noch Milch trinken?
Ist Dinkel gesünder als Weizen?
Und hilft Apfelessig wirklich beim Abnehmen?
In diesem Buch geben Achim Sam und Prof. Dr. Christian Sina einen aktuellen, wissenschaftlich fundierten Überblick über gesunde Ernährung. Sie zeigen, was die moderne Forschung über Lebensmittel und Essgewohnheiten weiß – und wie sich dieses Wissen in den Alltag integrieren lässt.
Ohne dogmatische Regeln, aber mit klarem Blick auf das Wesentliche!
Vorwort und Einleitung
Warum dieses Buch?
Kaum ein anderes Thema bewegt die Menschen so sehr wie die richtige Ernährung. Kaum ein anderes Thema wird so leidenschaftlich diskutiert – und kaum ein anderes ist mit so vielen Mythen, Halbwahrheiten und fragwürdigen Trends behaftet. Was gestern als bahnbrechend galt, ist heute schon wieder überholt. In einer Studie preisen Forscher etwas als gesund an, die nächsten verteufeln es. Und dazwischen stehen wir alle: verunsichert, überfordert und auf der Suche nach verlässlichen Antworten – die nicht nur wissenschaftlich fundiert sind, sondern auch im Alltag praktisch anwendbar.
Genau deshalb haben wir dieses Buch geschrieben. Wir, das sind Dipl. oec. troph. Achim Sam und Prof. Dr. med. Christian Sina. In unserer Arbeit – ob mit Patienten, in Podcasts oder sozialen Medien – erleben wir täglich, wie stark das Bedürfnis nach seriösen Informationen ist. Fragen wie diese begegnen uns ständig:
Was sollte ich essen?
Wie nehme ich gesund ab?
Sind Kohlenhydrate schlecht?
Ist Zucker so gefährlich wie Rauchen?
Und wie sieht es mit Milch aus – gesund oder nicht?
Oft genug kursieren mehr Mythen dazu als gut belegte Fakten. Hier setzt unser Buch an. Wir haben die häufigsten Ernährungsfragen gesammelt, sie kritisch hinterfragt und wissenschaftlich eingeordnet. Dabei war uns besonders wichtig, die Themen so zu erklären, dass sie jeder versteht und unsere Tipps leicht umzusetzen sind.
Ernährungswissenschaft ist komplex. Doch wenn wir Wissen nicht verständlich vermitteln, bleibt es nutzlos. Deshalb verzichten wir in diesem Buch bewusst auf komplizierte Fachbegriffe, endlose Studienauswertungen und schwer verdauliche Theorie. Stattdessen liefern wir Ihnen kurze und präzise Antworten, basierend auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und ergänzt durch unsere Einschätzungen.
Unser Ziel ist es, Ihnen Orientierung im Ernährungsdschungel zu geben. Ohne Dogmen, leere Versprechungen oder übertriebene Heilsbotschaften. Am Ende geht es nicht um die neueste Diät oder den nächsten Superfood-Hype. Es geht darum, eine Ernährung zu finden, die nicht nur gesund ist, sondern auch zu Ihnen und Ihrem Leben passt.
Wir wünschen Ihnen viele Aha-Momente, spannende Erkenntnisse und vor allem: viel Freude beim Lesen und Essen!
Dipl. oec. troph. Achim Sam &
Prof. Dr. med. Christian Sina
Wir benutzen in unserem Buch das generische Maskulinum, um den Text besser lesbar zu machen. Alle genannten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angeben, ausdrücklich auf alle Geschlechter.
Einleitung
Vor etwa 2,5 Millionen Jahren ernährten sich die frühen Menschen als Sammler und Jäger. Je nachdem, wo sie ansässig waren, verzehrten sie pflanzliche Materialien wie Wurzeln, Knollen, Früchte, Nüsse und Samen. In Küstenregionen kamen Fische und Meeresfrüchte hinzu, andernorts Vögel, Insekten(larven) sowie kleinere Wirbeltiere bis hin zu Großsäugern wie Mammuts. Rund 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung begann im Nahen Osten die landwirtschaftliche Revolution: Weizen, Gerste, Erbsen, Linsen, Schafe und Ziegen wurden gezielt angebaut beziehungsweise gezüchtet.
Obwohl Ackerbau und Viehzucht aufkamen und sich unser Ernährungsverhalten über die Zeit stetig änderte, bleiben wir genetisch immer noch Jäger und Sammler. Deren Erbgut tragen wir noch immer in uns. Das bedeutet, dass wir nach Verhaltensmustern handeln, die sich über Jahrtausende entwickelt haben. Praktisch bedeutet das: Nach Möglichkeit stopfen wir uns mit möglichst fetten und süßen Speisen voll, etwa Chips, Schokolade oder Gänsebraten. Für unsere meist nomadisch lebenden Vorfahren war dies eine überlebenswichtige Strategie. Denn sie mussten so viel Kalorien wie möglich zu sich nehmen und in Form von Fett einlagern, um karge Zeiten überstehen zu können. Angesichts der allzeit verfügbaren Nahrungsmittel in den Supermärkten der Industrienationen und unserem sesshaften Lebensstil ist diese Strategie jedoch überflüssig. Sogar kontraproduktiv. Denn sie hat uns eine Epidemie des Übergewichts beschert, die für zahlreiche Zivilisationskrankheiten mitverantwortlich ist: Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Gicht, Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs beispielsweise.
WAS STUDIEN TATSÄCHLICH ÜBER ERNÄHRUNG AUSSAGEN
Die meisten Erkenntnisse zu unseren Ernährungsgewohnheiten und deren Folgen für die Gesundheit stammen aus sogenannten epidemiologischen Studien. In solchen Untersuchungen wird eine große Gruppe von Personen hinsichtlich ihrer Ernährungsgewohnheiten befragt und meist über mehrere Jahre hinweg auf bestimmte Gesundheitsdaten überprüft, etwa Blutdruck oder die Entwicklung von Krebs. Aus diesen Daten – Ernährungsgewohnheiten und Gesundheitswerten – errechnen die Wissenschaftler dann beispielsweise Korrelationen zwischen dem Fettkonsum und dem Auftreten von Herzinfarkten. Eine der ersten großen Studien dieser Art war die »Sieben-Länder-Studie«. Sie startete 1958 mit knapp 13.000 gesunden Männern mittleren Alters aus Italien, Griechenland, Finnland, Japan und den USA. Die Forschungsarbeit sollte folgende Frage beantworten: Ist die Ernährung – insbesondere der Fettkonsum – für Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich? Damals wurde die Frage mit einem klaren Ja beantwortet.
Doch solche Untersuchungen haben einen hervorstechenden Makel: Sie können nur Zusammenhänge zwischen menschlichen Essgewohnheiten und gesundheitlichen Parametern vermuten, ohne diese aber zu beweisen.
Ein Beispiel aus der Studie: Ein hoher Fettkonsum trat bei Probanden gemeinsam mit Übergewicht und Herzinfarkten auf. Anhand der epidemiologischen Untersuchung kann aber nicht geklärt werden, ob der hohe Fettkonsum – wie von Ancel Keys, dem Initiator der Studie angenommen – tatsächlich Übergewicht und Herzinfarkte auslöst.
Zuträglich war dann auch nicht, dass im Nachhinein herauskam, dass Ancel Keys nur einen Teil der Studienergebnisse publiziert hatte. Und zwar den Teil, der belegen sollte, dass der Konsum von fetthaltigen Speisen tatsächlich mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist.
Um wirklich eine kausale Beziehung nach dem Motto »Fettkonsum macht fett« feststellen zu können, bedarf es sogenannter Interventionsstudien.
Die wohl erste Studie dieser Art führte der britische Schiffsarzt James Lind (1716–1794) im Jahre 1753 durch. Zu jener Zeit starben zahlreiche Seeleute an einer Krankheit, die wir heute Skorbut nennen. Was zu der Zeit noch niemand wusste: Die Krankheit beruht auf einer Mangelversorgung mit Vitamin C. Auch wenn mindestens seit dem Jahr 1600 bekannt war, dass Zitronen gegen Skorbut helfen können, hatte sich diese Maßnahme in der Seefahrt nicht durchgesetzt. Das passierte erst, nachdem Lind seine Studie durchgeführt hatte. Lind teilte für seine Interventionsstudie zwölf Matrosen mit Skorbut in sechs Gruppen ein. Alle erhielten dieselbe Diät. Die erste Gruppe bekam zudem einen knappen Liter Apfelwein täglich. Gruppe zwei nahm 25 Tropfen Schwefelsäure ein, Gruppe drei sechs Löffel voll Essig, Gruppe vier erhielt einen knappen Viertelliter Seewasser, Gruppe fünf zwei Apfelsinen sowie eine Zitrone täglich und die letzte Gruppe eine Gewürzpaste und Gerstenwasser. Die Behandlung von Gruppe fünf musste abgebrochen werden, als nach sechs Tagen die Früchte ausgingen. Aber zu diesem Zeitpunkt war einer der Matrosen bereits wieder dienstfähig und der andere beinahe erholt.
Damit war bewiesen, dass Inhaltsstoffe von Zitrusfrüchten Skorbut heilen oder verhindern können. Heute wissen wir, dass es sich dabei um Vitamin C handelt. Als der britische Seefahrer James Cook (1728–1779) dann mit der »Endeavour« 1768 seine erste Weltumsegelung antrat, nahm er Vitamin-C-haltiges Sauerkraut, eingekochten Zitronen- und Orangensaft sowie Bier-Vorstufen wie Malzextrakt und Stammwürze mit an Bord. So konnte er größere Verluste unter seinen Leuten verhindern.
Diese beiden Studientypen – epidemiologische und Interventionsstudien – bestimmen im Wesentlichen, was wir heute über Ernährung denken.
Als »Goldstandard« für Interventionsstudien gelten in der Forschung »randomisierte kontrollierte Studien« (RCTs). Sie folgen den Grundprinzipien
der Randomisierung (zufällige Einteilung der Teilnehmer in Gruppen),
der Kontrolle (Vergleich zwischen Interventions- und Kontrollgruppe[n]) und
der Verblindung (Teilnehmer und/oder Forscher wissen nicht, wer welcher Gruppe zugeteilt ist)
Das Ziel dieses Ansatzes ist, zu wissenschaftlich korrekten Schlussfolgerungen zu kommen und Verzerrungen sowie andere statistische Fehler möglichst zu vermeiden.
Auch wenn das meiste Datenmaterial in den Ernährungswissenschaften aus epidemiologischen Untersuchungen stammt, werden wir uns in diesem Buch möglichst auf RCTs berufen, da nur sie uns exakte Daten über Ursache und Wirkung (Kausalität) liefern können.
Ernährungs-Basics
Diese Nährstoffe sind essenziell für Ihre Gesundheit
So viel Kalorien benötigen Sie tatsächlich
Wie viel Flüssigkeit braucht der Körper?
Von guten und schlechten Nahrungsfetten
Ist Zucker wirklich so schädlich?
Bringen Nahrungsergänzungsmittel was?
1. Nährstoffe, auf die wir nicht verzichten können
Unser Körper ist ein wahrer Meister darin, bestimmte Nahrungsbestandteile in andere Substanzen umzuwandeln. Wenn wir beispielsweise zu viel Einfachzucker (Glukose) essen und der Körper diese bereitgestellte Energie nicht direkt verbrauchen kann, wird der Zucker in der Leber zu Fetten verstoffwechselt und dann im Fettgewebe eingelagert. Dieses Gewebe ist ideal, um Energie zu speichern. In der Steinzeit war dieser Prozess der Energieumwandlung ein Überlebensvorteil. Heute führt er dazu, dass wir nicht nur unliebsame »Fettpölsterchen« entwickeln, sondern auch vermehrt krank machende Fettdepots rund um und in unseren inneren Organen entstehen. Ein Beispiel dafür ist die Leber.
Die Umwandlung von Glukose in Fettsäuren ist nur einer von vielen Tausenden Vorgängen, bei denen unser Körper Nährstoffe in andere biochemische Bausteine transformiert, um sie unseren Bedürfnissen anzupassen.
Doch dieses Bäumchen-wechsel-dich-Spiel hat Grenzen: Eine ganze Reihe von überlebenswichtigen Nahrungsstoffen wie die meisten Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren sowie Fettsäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. Deshalb müssen sie direkt mit der Nahrung aufgenommen werden. Solche Nahrungsinhaltsstoffe nennen wir essenziell.
VITAMINE
Die meisten Vitamine sind für den menschlichen Körper essenziell, allerdings gibt es Ausnahmen. Vitamin D (Calciferol) wird bei ausreichender UV-Bestrahlung in unserer Haut hergestellt. In Deutschland genügt es meistens, zwischen März und Oktober täglich für 5 bis 25 Minuten unbedeckt mit Gesicht, Händen und Teilen von Armen und Beinen in der Sonne zu sein. So kann der Körper im Normalfall genügend Vitamin D herstellen. Im Winter ist die Vitamin D-Bildung aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung eingeschränkt – für einen gesunden Organismus ist das in der Regel kein Problem. Denn: Der Körper kann das Vitamin im Fettgewebe speichern und über bestimmte Nahrungsmittel, zum Beispiel fette Seefische, aufnehmen. Eine zusätzliche Einnahme von Vitamin D in Form von Nahrungsergänzungsmitteln sollte mit dem Arzt abgesprochen werden, wenn chronische Erkrankungen vorliegen und ein nachgewiesener Mangel besteht.
Die zweite Ausnahme ist Vitamin K, das unter anderem für die Blutgerinnung von zentraler Bedeutung ist. Das Vitamin kommt in mehreren Variationen vor, von denen K1 und K2 die wichtigsten sind. K1 können wir nur mit der Nahrung aufnehmen, zum Beispiel über grünes Blattgemüse wie Grünkohl oder Spinat. K2 hingegen wird auch von Bakterien in unserem Darm hergestellt.
Ausnahme Nummer drei ist Vitamin B3 (Niacin), das der Körper aus der essenziellen Aminosäure Tryptophan, einem Grundbaustein der Eiweiße, selbst herstellen kann. Erwachsene benötigen täglich zwischen 11 und 16 mg Niacin am Tag, je nach Geschlecht und Alter. Um diese Menge an Niacin produzieren zu können, benötigt der Körper zwischen 660 und 960 mg Tryptophan. Das sind umgerechnet etwa 250 g Hühnerbrust, 290 g Thunfisch oder 480 g gekochte Sojabohnen täglich.
Auch Vitamin B7 (Biotin) gehört zu den eingeschränkt essenziellen Vitaminen, da es wie Vitamin K2 von Darmbakterien hergestellt wird. Ob diese Produktion im Darm tatsächlich unseren Bedarf deckt, ist bislang aber noch unbekannt.
Diese Tabelle dient zur Übers icht aller Vitamine, die wir täglich in bestimmten Mengen brauchen, wie es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt. Zudem sieht man, in welchen Lebensmitteln die höchsten Mengen dieser Vitamine vorkommen.
Vitamin
Tagesbedarf Erwachsene (DGE)
Reichlich enthalten in (je 100 g):
A (Retinoläquivalent)
700 µg
Schweineleber (36.000 µg); Leberwurst, grob (8.300 µg); Möhren (1.500 µg); Grünkohl (862 µg); Spinat (795 µg)
D (Calciferol)
20 µg
Aal, geräuchert (90 µg); Bückling (30 µg); Forelle (22 µg); Lachs (16,3 µg)
E (Tocopherol)
12–15 mg
Weizenkeimöl (174 mg); Sonnenblumenöl (63 mg); Maiskeimöl (34 mg); Sojaöl (17 mg); Paranüsse (7,6 mg)
K
60–80 µg
Grünkohl (817 µg); Spinat (305 µg); Rosenkohl (236 µg); Brokkoli (155 µg)
B1 (Thiamin)
1,0–1,3 mg
Sonnenblumenkerne (1,9 mg); Schinken, ohne Fettrand (1,1 mg); Sojabohnen (1 mg)
B2 (Riboflavin)
1,1–1,4 mg
Hühnerleber (2,49 mg); Camembert, 40 % (0,6 mg); Sojabohnen (0,5 mg)
B3 (Niacin)
11–16 mg
Kleie (17,7 mg); Erdnüsse (15,3 mg); Hühnerleber (11,6 mg); Thunfisch (8,5 mg)
B5 (Pantothensäure)
6 mg
Ostseehering (9,3 mg); Schweineleber (6,8 mg); Bäckerhefe (3,5 mg); Vollmilch (2,7 mg); Erdnüsse (2,7 mg); Erbsen (2 mg)
B6 (Pyridoxin)
1,2–1,6 mg
Sojabohnen (1 mg); Walnüsse (0,9 mg); Kotelett (0,6 mg); Linsen (0,6 mg)
B7 (Biotin)
30–60 µg
Speisekleie (44 µg); Erdnüsse (34 µg); Bäckerhefe (33 µg); Schweineleber (27 µg)
B9 (Folsäure)
300 µg
Limabohnen (360 µg); Kichererbsen (340 µg); Sojabohnen (210 µg)
B12 (Cobalamin)
4 µg
Steckmuscheln (144 µg); Schweineleber (39 µg); Ostseehering (11 µg)
C (Ascorbinsäure)
95–110 mg
Hagebutte (1.250 mg); Sanddornbeeren (450 mg); Paprika (140 mg); Brokkoli (115 mg); Rosenkohl (112 mg)
Quelle: Eucell (www.eucell.de/ernaehrung/lebensmittellisten); Bell, S. (2012). Souci – Fachmann – Kraut, food composition and nutrition tables.
MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE
Auch sämtliche Mineralstoffe beziehungsweise Spurenelemente sind für den menschlichen Körper essenziell, müssen also regelmäßig über die Nahrung zugeführt werden. Welche Stoffe das sind, wie viel wir davon zu uns nehmen sollten und worin sie in besonderem Maße enthalten sind, steht in der folgenden Tabelle:
Mineralstoff/ Spurenelement
Tägliche Zufuhrempfehlung (DGE)
Reichlich enthalten in (je 100 g):
Chlorid
2.300 mg
siehe Seite 172 u. Seite 215
Chrom
30–100 µg
Paranüsse (100 µg); Gouda/Edamer, 45 % (95 µg); Weizenvollkornbrot (49 µg)
Eisen
10–15 mg
Schweineleber (18 mg); Linsen (7,5 mg); Kichererbsen (6,9 mg)
Fluorid
3,1–3,8 mg
schwarzer Tee (9,5 mg); Walnüsse (0,7 mg); Speisesalz, fluoridiert (0,25 mg)
Jod
180–200 µg
Schellfisch (243 µg); Kabeljau (155 µg); Krabben/Garnelen (130 µg); Hering (52 µg)
Kalium
4.000 mg
Sojabohnen (1.775 mg); Limabohnen (1.725 mg); weiße Bohnen (1.320 mg)
Kalzium
1.000 mg
Emmentaler, 45 % (1.050 mg); Mozzarella (632 mg); Sojabohnen (201 mg)
Kupfer
1,0–1,5 mg
Cashewkerne (3,8 mg); Vollmilchschokolade (1,3 mg); Emmentaler, 45 % (1,2 mg)
Magnesium
300–400 mg
Cashewkerne (267 mg); Mandeln (252 mg); Sojabohnen (220 mg)
Mangan
2,0–5,0 mg
Haselnüsse (5,7 mg); Haferflocken (4,5 mg); Heidelbeeren (4,2 mg)
Molybdän
50–100 µg
Buchweizen (485 µg); Rotkohl (127 µg); Hafer (70 µg); Knoblauch (70 µg)
Natrium
1500 mg
siehe Seite 172 u. Seite 215
Phosphor
700 mg
Weizenkleie (1.240 mg); Sojabohnen (570 mg); weiße Bohnen (430 mg)
Selen
60–70 µg
Bückling (140 µg); Thunfisch (82 µg); Hering (43 µg)
Zink
7–10 mg
Austern (7–160 mg); Rindfleisch (4,4 mg); Paranüsse (4 mg); Haferflocken (4 mg)
Quelle: Eucell (www.eucell.de/ernaehrung/lebensmittellisten); Bell, S. (2012). Souci – Fachmann – Kraut, food composition and nutrition tables.
Natrium und Chlorid gehören zwar zu den essenziellen Mineralien, dennoch haben wir keine Lebensmittel mit besonders viel Natrium- beziehungsweise Chlorid-Gehalt angegeben. Der Grund: Da Speisesalz aus Natriumchlorid besteht, nehmen wir die beiden Mineralien eher zu viel als zu wenig zu uns. Die Empfehlung der DGE liegt bei bis zu 6 g am Tag. Die tatsächliche Zufuhr der Bundesbürger liegt aber deutlich höher, bei 8 bis 10 g täglich. Speisesalz führt bei einem nicht unerheblich großen Anteil der Bevölkerung – sogenannten »salzsensitiven« Personen – oft zu deutlichen Blutdruckerhöhungen. Daher sollte man auf zu viel Salz verzichten (s. Seite 172 u. Seite 215).
ESSENZIELLE FETTSÄUREN
Zu den essenziellen Fettsäuren zählen die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind die Alpha-Linolensäure (ALA) (aus pflanzlicher Herkunft), die Eicosapentaensäure (EPA) und die Docosahexaensäure (DHA). Die letzten beiden kommen vor allem in fettreichen Meeresfischen und Kaltwassersäugetieren vor. Die Omega-6-Fettsäure Linolsäure (LA) ist ebenso wie die Gamma-Linolensäure (GLA) pflanzlichen Ursprungs. Die Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure (AA) hingegen kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Wie hoch der geschätzte tägliche Bedarf ist und worin die Fettsäuren vorkommen, steht in der folgenden Tabelle.
Fettsäure
Bedarf/Tag (zirka)
Besonders viel in (je 100 g):
Alpha-Linolensäure (ALA)
2 g
Leinöl (54 g); Leinsamen (16,7 g); Walnussöl (12,9 g); Rapsöl (9,2 g); Sojaöl (7,5 g); Walnüsse (7,5 g)
Eicosapentaensäure (EPA)
250 mg