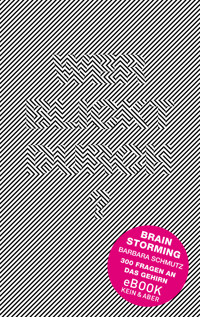
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was ist ein Geistesblitz? Wie kommt es zu falschen Erinnerungen? Sitzt das Bauchgefühl im Kopf? Was passiert beim Tagträumen? Können wir bewusst vergessen? Gibt es im Gehirn Raum für eine Seele?
Gespräche mit 17 führenden internationalen Gehirnforscherinnen und Gehirnforschern zu Bewusstsein und künstlicher Intelligenz, Traum und Schlaf, Sucht und Drogen, Lernen und Gedächtnis und zur Zusammenarbeit zwischen Gehirn und Darm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Barbara Schmutz, geboren 1963, ist Journalistin, Autorin und Drehbuchautorin. Sie besuchte die Schweizer Journalistenschule MAZ, die Drehbuchschule SAL in Zürich und hat einen MAS in Applied Ethics der Universität Zürich. Sie arbeitet für verschiedene Schweizer Zeitungen und Magazine. 1997 gewann sie für eine Artikelserie den Swiss Press Award. 2006 drehte sie für das Schweizer Fernsehen SRF einen Dokumentarfilm über das Attentat von Zug, dem 14 Politikerinnen und Politiker zum Opfer fielen.
ÜBER DAS BUCH
Was ist ein Geistesblitz? Wie kommt es zu falschen Erinnerungen? Sitzt das Bauchgefühl im Kopf? Was passiert beim Tagträumen? Können wir bewusst vergessen? Gibt es im Gehirn Raum für eine Seele?
Gespräche mit 17 führenden internationalen Gehirnforscherinnen und Gehirnforschern zu Bewusstsein und künstlicher Intelligenz, Traum und Schlaf, Sucht und Drogen, Lernen und Gedächtnis und zur Zusammenarbeit zwischen Gehirn und Darm.
Für meinen Bruder Christoph
Inhalt
Vorwort
01 Peter Brugger
02 Lutz Jäncke
03 Isabelle Mansuy
04 Luca Regli
05 Boris Nikolai Konrad
06 Katrin Preller/Jean-Marc Fritschy
07 Michael Schredl
08 Peter Klaver
09 Pascal Kaufmann
10 Felix Hasler
11 Jessica Peter
12 Gregor Hasler
13 Silvia Arber
14 Thomas Nevian
15 Josef Bischofberger
16 Jürg Kesselring
Dank
Vorwort
Ursprünglich hätte es für ein Schweizer Magazin einen längeren Text zum Gehirn geben sollen: fünfzig Fragen zu unserem Denkorgan, sechs bis acht Seiten, illustriert mit Bildern.
Ich vertiefte mich in Lektüre über das Gehirn, las Bücher, studierte Studien. Schrieb Fragen über Fragen auf. Mich interessierte Alltägliches, das, was uns allen passiert: Ein Wort liegt uns auf der Zunge, aber wir können es partout nicht sagen. Weshalb nicht? Was ist in unserem Gehirn blockiert? Und Allnächtliches: Wieso verlieren wir im Schlaf das Bewusstsein? Ich schrieb die Frage auf den Block, die Neurowissenschaftler und Philosophinnen möglicherweise bis in alle Ewigkeit beschäftigen wird: Wie entsteht Bewusstsein?
300 Fragen hatte ich zusammengetragen. Für die Antworten suchte ich nach Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. Auf Universitäts-Homepages, in Neuro-Sciences-Netzwerken und in Studien recherchierte ich Spezialistinnen und Spezialisten. Fürs Gedächtnis, für Lernprozesse, für psychische Krankheiten, für Sucht, für Schlaf, für Neuroplastizität, für neurophilosophische Fragen, für das Zusammenspiel zwischen Gehirn und Darm. Mit 17 Frauen und Männern konnte ich über das Gehirn diskutieren. Rund zwanzig Fragen bekamen mehrere Wissenschaftler gestellt. Die einen antworteten auf dieselbe Frage ähnlich, andere komplett unterschiedlich, und eröffneten mit ihren Ansichten immer wieder neue Welten.
Es gab intensive Gespräche, anregende, inspirierende, zuversichtlich und nachdenklich stimmende. Und überraschende. Mit dem Neurologen, der die Idee eines Bewusstseins außerhalb des Gehirns verfolgt, weil er überzeugt ist, dass es noch andere Erkenntiswege gibt als die Naturwissenschaft. Und mit dem Neurobiologen, der ein erstaunliches Thema aufs Tapet brachte: Unser Gehirn funktioniert mit einer Zufallskomponente.
Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklärten ihre Forschung und die Erkenntnisse, die sie daraus gewonnen hatten, so detailliert und verständlich, dass ich nur weniges für Laien übersetzen musste. Wurde es kompliziert, bekam ich einen Sachverhalt nochmals geschildert, Grafiken gezeigt und Hirnmodelle auseinandergenommen. Und weiß nun: Unser Kopf beherbergt ein Wunderwerk.
01 »Theoretisch könnte man das Gehirn aus dem Körper entfernen und in einer Nährlösung lagern.«
Der Neuropsychologe Peter Brugger sagt, weshalb es für das Gehirn schwierig wäre, den Körper zu verlieren. Warum er das Bauchgefühl in der rechten Hirnhälfte verortet und was im Gehirn von Menschen passiert, die erklären, sie seien hellsichtig.
Wieso haben wir zwei Hirnhälften?
Das ist ein Rätsel, über das Wissenschaftler seit Längerem streiten. Wäre es nicht besser, wir hätten nur ein motorisches Zentrum statt zwei, die koordiniert werden müssen? Andererseits ist es immer gut, etwas doppelt zu haben, falls ein Teil ausfallen sollte. Wir haben ja auch zwei Augen, die doppelte Anlage brauchen wir für das Tiefensehen. Das bringt mich auf einen Gedanken: Möglicherweise dienen unsere beiden Hirnhälften auch einer Art vertieftem Sehen, sodass wir in der Tiefe des Gehirns einen Sachverhalt auf zwei Arten betrachten können.
Was passiert, wenn einem Menschen eine Hirnhälfte entfernt wird?
Erwachsene wären auf der Körperseite, die von der entfernten Hirnhälfte gesteuert wird, gelähmt. Kindern, die an schwerer Epilepsie leiden, wurde früher manchmal eine Hirnhälfte herausoperiert, damit sich die Anfälle nicht mehr über das ganze Gehirn entladen. Sie konnten danach immer noch beide Körperhälften bewegen, waren aber auf derjenigen Seite, welche von der entfernten Hirnhälfte gesteuert wurde, ein wenig behindert.
Ist eine Hirnhälfte dominant?
Dominant wofür? Beim Rechtshänder ist die linke Hirnhälfte besser in der sprachlichen Verarbeitung, also sprachdominant. Die rechte Hirnhälfte hingegen erkennt besser Gesichter. Die Sprachverarbeitung selbst ist noch mal unterteilt in verschiedene Dominanzen oder besser: Kompetenzen. Die linke Hirnhälfte ist bestimmend, wenn es um klare, enge Assoziationen geht, wie »Tisch und Stuhl«. Sind die Assoziationen aber viel weiter, zum Beispiel »Tisch und Blume«, weil die Blume in einer Vase ist und diese auf dem Tisch steht, ist die rechte Hirnhälfte aktiv. Wer bei Fluss an Wasser denkt, hat die linke Hirnhälfte aktiviert, wem bei Fluss Reise in den Sinn kommt, arbeitet mit der rechten Hirnhälfte.
Wieso sind die meisten Menschen Rechtshänder?
Das ist nicht bekannt. Wohl aber, dass es in allen Kulturen und in allen Zeiten der Menschheitsentwicklung mehr Rechtshänder gab. Das zeigen uns Handabdrücke bei Höhlenmalereien, wir sehen, mit welcher Hand sich der Mensch abgestützt hat, und mit welcher er malte. Meistens mit der rechten. Aber auch an Gebrauchsinstrumenten erkennt man, dass bereits in frühen Zeiten auf zehn Rechtshänder gerade ein Linkshänder kam.
Rechtshändigkeit überwiegt auch in Kulturen, die von rechts nach links schreiben. Wieso das?
Das ist eine große Frage – wie kommen Kultur und Natur zusammen? Die Schreibrichtung ist dafür das schönste Beispiel. Wir wissen, dass Angehörige von Kulturen, die von rechts nach links schreiben, ein bisschen anders reagieren bei Aufgaben, bei denen es um rechts und links geht, etwa dann, wenn sie eine Linie halbieren müssen.
Wie sieht denn ihre halbierte Linie aus?
Die gesehene Mitte ist ein wenig zur rechten Seite hin verschoben, also zum Zeilenanfang hin. Interessant ist aber, dass bei Menschen, die von rechts nach links schreiben, die Sprachdominanz genauso in der linken Hirnhälfte angesiedelt ist wie in unserer Kultur. Wir haben alle das gleiche Gehirn. Auffallend ist auch, dass die meisten horizontal orientierten Sprachen von links nach rechts geschrieben werden. Weshalb dies so ist, ist mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass auch Tiere, zum Beispiel Küken, von links nach rechts zählen: Kleine Körnermengen sind für sie eher mit links assoziiert, große mit rechts.
Es gibt eine Entwicklungsphase, während der Kinder aus Kulturen, in denen die Schrift von links nach rechts verläuft, plötzlich von rechts nach links schreiben. Warum tun sie das?
Das ist in der Tat eine spannende Beobachtung. Sie führte zu anhaltenden Kontroversen. Einerseits gehen uns Bewegungen von der Körpermitte nach außen hin einfacher von der Hand als solche in umgekehrter Richtung. Dies führt dazu, dass gerade linkshändige Kinder im Vorschulalter vermehrt von rechts nach links, also in Spiegelschrift schreiben. Es gibt aber auch noch einen anderen Faktor, der Fünf- bis Sechsjährige dazu verführt, spiegelbildliche Buchstaben zu schreiben: Die Tatsache, dass unser Zeichensystem mehr nach rechts hin ausgerichtete Buchstaben und Ziffern hat – zum Beispiel die Buchstaben B, C und F und die Ziffern 5 und 6 – als nach links hin orientierte wie etwa der Buchstabe J oder die Ziffern 3 und 7. Unabhängig davon, ob ein Kind Links- oder Rechtshänder ist, treten Spiegelschriftfehler vor allem in der letzteren Kategorie auf, allerdings nur, solange das Kind noch nicht flüssig schreiben kann.
Der Körper braucht das Gehirn. Wie ist es umgekehrt, braucht das Gehirn auch einen Körper?
Theoretisch könnte man das Gehirn aus dem Körper entfernen und es in einer guten Nährlösung lagern. In Roald Dahls Küsschen, Küsschen gibt es dazu eine wahnsinnig schöne Geschichte von einem Gehirn, das auf einem Bücherregal lebt. Künstlich ernährt bräuchte es keine Hand, um das Essen zu greifen, keine Füße, um irgendwo hinzugehen, wo es Essen findet und Sachen pflücken kann, und verdauen müsste es auch nicht. Physisch ließe sich ein Leben ohne Körper wohl vorstellen. Trotzdem wäre es für das Gehirn, das an den Körper gewöhnt ist, wahrscheinlich schwierig, Letzteren zu verlieren. Es gäbe keine Sozialkontakte mehr …
… und keine Berührungen.
Doch, Phantom-Berührungen, den Körper würden wir noch spüren, als Phantom. Aber hoffentlich keine Schmerzen mehr. Das wäre die Hölle, weil wir nicht fähig wären, jemanden zu bitten, die Schmerzen zu lindern. Aber ja, die Frage ist interessant, wozu ein Körper biologisch da ist. Als Neurowissenschaftler könnte ich sagen, um das Gehirn rumzutragen, es an die Futterplätze zu bringen, in die Gesellschaft zu tragen und zu künftigen Partnern.
Dafür müsste der Körper aber nicht so groß sein.
Das stimmt. Obwohl: Zum Laufen brauchts ein Herz-Kreislauf-System und zum Ernähren einen Verdauungstrakt. Das braucht Platz.
Ab und zu hört man, Menschen würden nur rund zehn Prozent ihres Gehirns nutzen.
Das ist Unsinn. Teilweise verbreitet von Gruppen wie Scientology. Wir brauchen immer das ganze Gehirn. Aber nicht immer zu hundert Prozent bewusst. Beim Autofahren zum Beispiel laufen in unserem Gehirn viele Prozesse ab, die wir größtenteils gar nicht wahrnehmen. Unser Gehirn arbeitet so, dass einmal dieses Areal mehr genutzt wird, ein anderes Mal ein anderes. Und je nach Fertigkeiten sind bei manchen Menschen bestimmte Hirnareale ausgeprägter als bei anderen. Ein Langstreckenläufer braucht seine Beinareale im Gehirn häufiger als ein Nichtsportler und setzt sie deshalb geschickter ein. Menschen, die viel lesen und viel schreiben, benutzen die entsprechenden Areale mehr als diejenigen, die kaum schreiben und selten lesen. Und dann passiert es auch immer wieder, dass bestimmte Areale plötzlich Aufgaben von anderen übernehmen. Zum Beispiel bei Menschen, die erblinden. Der visuelle Cortex, der bisher für das Sehen zuständig war, wird nun für anderes eingesetzt.
Wofür denn?
Zum Beispiel für Berührungseindrücke. Denken Sie an die Brailleschrift, diese wird ja via Fingerspitzen gelesen.
Wird das Bauchgefühl vom Kopf gesteuert?
Ja. Das Bauchgefühl ist gleichbedeutend mit Intuition, ich verorte es in der rechten Hirnhälfte. Die rechte Hemisphäre, das ist bei allen Menschen so, ist zuständig für Wachsamkeit, für Vorsicht, für das Negative, die Angst. Mein Bauchgefühl sagt nicht: »Geh in dieses oder jenes Land in die Ferien.« Wenn sich das Bauchgefühl meldet, dann häufig, weil es mir signalisieren will, dass ich in einer bestimmten Angelegenheit oder einem bestimmten Menschen gegenüber vorsichtig sein soll. Das Bauchgefühl sagt: Aufpassen!
Was passiert im Gehirn von Menschen, die überzeugt sind, sie seien hellsichtig?
Menschen, die von sich sagen, sie seien hellsichtig, beurteilen Situationen anders. Sie erzählen von Begebenheiten, die andere als unglaublichen Zufall schildern würden. Ein Beispiel: Sie träumen, dass Sie in einem Wettbewerb ein rotes Auto gewonnen haben, und gewinnen dann wenig später tatsächlich ein rotes Auto. Kehrte dieser Traum jede Nacht wieder, würde jeder glauben, dass er hellsichtig oder prophetisch begabt sei. Wird nun aber dem Menschen, der vom roten Auto geträumt hat, am nächsten Tag sein grünes Fahrrad gestohlen, kommt er nicht unbedingt auf die Idee, dass Traum und Diebstahl etwas miteinander zu tun haben. Es sei denn, er glaubt an Übersinnliches und sagt: »Das kann kein Zufall sein!« Etwas nüchternere Menschen würden höchstens denken: »Interessant, dieser Symbolismus – ich träume von einem roten Auto und anderntags wird mir mein grünes Fahrrad gestohlen.« 1
Mit beidem ist man unterwegs, mit dem Auto und dem Fahrrad.
Genau, und Rot und Grün sind Komplementärfarben. Nun gibt es aber noch eine dritte Gruppe von Menschen und für die ist klar: Dieser Traum war kein Zufall, sondern ein Wink – ich hätte mein Fahrrad besser abschließen müssen. Wir konnten hier, am Institut für Neuropsychologie, zeigen, dass Menschen, die von sich sagen, sie seien hellsichtig – ich nenne sie Gläubige –, weiter assoziieren als andere. Dafür machten wir folgenden Versuch: Wir teilten den Versuchsteilnehmern das Wort »Löwe« mit und baten sie, einen Knopf zu drücken, wenn sie ein nächstes Wort hören, das einen Sinn ergibt, zum Beispiel »Bauch«. Also, auf »Löwe« folgt »Bauch«, die Teilnehmer drücken den Knopf. Auf »Löwe« folgt »Mähne«, die Teilnehmer drücken den Knopf schneller, weil »Mähne« mit »Löwe« assoziiert wird. Folgte auf »Löwe« »Streifen« drückten sie ebenfalls schneller.
Afrika, Zebra …
… und Tiger. Das schnelle und weite Assoziieren sind Eigenschaften eines kreativen Geistes. Allerdings besteht die Gefahr, dass Sachen gesehen und miteinander in Verbindung gebracht werden, die objektiv keine Verbindung haben. Es ist bekannt, dass auch paranoid schizophrene Menschen schneller und weiter assoziieren. Die Mechanismen im Gehirn der Gläubigen sind dieselben wie bei Menschen mit paranoider Schizophrenie.
Hirnforschung gibt es schon lange. Aber bei der Behandlung von psychischen Krankheiten oder von chronischen Schmerzen ist die Wissenschaft noch nicht viel weiter. Weshalb nicht?
Interessant, dass Sie sagen: Hirnforschung gibt es schon lange, Fortschritte bei psychischen Erkrankungen aber noch nicht viele. Sie bringen Gehirn und Psyche zusammen und sagen damit, dass psychische Erkrankungen Krankheiten des Gehirns sind. Ich erforsche Menschen mit Xenomelie, das sind Menschen, die einen Arm oder ein Bein als nicht zu ihrem Körper gehörend betrachten und die Extremität amputiert haben wollen. Ich stellte fest, dass gewisse Areale in ihrem Gehirn anders sind als bei Kontrollpersonen. Und doch würde ich daraus nicht schließen, dass der Amputationswunsch rein neurologisch bedingt ist, er hat eine neurologische Mitbedingung.
Und der Rest?
Internet, Kommunikation, Kultur, Forschung. Ich komme mir manchmal ethisch ein bisschen grenzwertig vor, denke, am besten würde ich mit dieser Forschung aufhören.2
Weil es dann die Krankheit nicht mehr gäbe?
Das ist eben die Frage. Züchten wir eine Störung heran, indem wir darüber reden? Vor hundert Jahren gab es das Krankheitsbild der Xenomelie noch nicht, beziehungsweise der Amputationswunsch wurde als sexuelle Perversion betrachtet, weil mehr als die Hälfte der Betroffenen amputierte Glieder sexuell anziehend findet. In Japan und China kennt man Xenomelie auch heute noch nicht. Wenn man in diesen Ländern jemanden fragt, ob er das Gefühl habe, dass ein bestimmter Körperteil nicht zu ihm gehöre, hält er einen für verrückt. Und ich mache jede Wette, dass in Ländern, in denen Krieg herrscht und viele Menschen wegen Landminen Arme und Beine verloren haben, kein Einziger einen gesunden Körperteil amputiert haben will.
Zurück zur ursprünglichen Frage. Weshalb gibt es trotz Hirnforschung bei der Behandlung von psychischen Krankheiten oder von chronischem Schmerz nicht mehr Fortschritte?
Weil in der Forschung mit jeder Frage, die beantwortet wird, mindestens fünf neue, wesentliche Fragen entstehen und dazu noch fünfhundert am Rand, für die man keine Zeit hat. Immer mehr Fragen heißt, die Erkenntnisse werden stetig präziser. Dank der Hirnforschung wissen wir heute, dass für Halluzinationen und Wahn, die bei Schizophrenie auftreten, im Gehirn andere Areale zuständig sind als für die Lethargie, die bei dieser Krankheit ebenfalls vorkommt. Aus diesen Erkenntnissen kann die Pharmazie bessere Medikamente machen, das sind Riesenfortschritte. Psychische Probleme wird es immer geben, aber man betrachtet sie differenzierter. Die Fragen ändern sich, aber sie werden nicht kleiner.
Der Computer hat die Handschrift mehr oder weniger aus dem Alltag verdrängt. Wird sich das auf unser Gehirn auswirken?
Ziemlich sicher, ja. Schreiben mit einem Computer ist völlig anders als schreiben von Hand. Vor allem, wenn es darum geht, ein kompliziertes Problem zu skizzieren. Ich notiere mir dann jeweils die einzelnen Sachverhalte auf ein Papier oder zeichne sie gar auf. Verbinde mit Pfeilen gewisse Wörter, streiche andere durch, aber so, dass ich sie immer noch lesen kann. Der Rückgang der Handschrift wird mit Sicherheit große Veränderungen im Gehirn bewirken.
Welche?
Das wäre eine spannende Frage für die Forschung.
Kurzbiografie Peter Brugger
Peter Brugger, geboren 1957 in Zürich, ist Professor für Verhaltensneurologie und Neuropsychiatrie an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2019 leitete er die Abteilung Neuropsychologie der Klinik für Neurologie am Universitätsspital Zürich, dann hat er die Leitung der Neuropsychologie an der Rehabilitationsklinik Valens übernommen. Brugger konzentriert sich in seiner Forschung darauf, wie Raum, Körper, Zahl und Zeit im Gehirn repräsentiert sind. Er untersucht Halluzinationen und Identitätsstörungen, interessiert sich dafür, wie außerkörperliche Erfahrungen zustande kommen und welche psychologischen und neuronalen Grundlagen der Glaube ans Übersinnliche hat. Zudem erforscht er Menschen mit Xenomelie. Diese Menschen betrachten einen Arm oder ein Bein als nicht zu ihnen gehörig und wollen die Extremität amputiert haben.
Peter Bruggers Forschung: www.tinyurl.com/peterbrugger
1Peter Brugger publizierte in verschiedenen Zeitschriften zu Hellsichtigkeit und zum Glauben an Außersinnliches, beruhend auf Studien und Experimenten. Eine Auswahl:
»Ich seh etwas, was du nicht siehst«, Psychologie Heute (September 2006)
»Wo glauben Sie hin?«, Gehirn & Geist (März 2007)
»Moderner Aberglaube und seine biologischen Wurzeln«, Reinhard Neck, Christiane Spiel (Hg.) Wissenschaft und Aberglaube (2020).
2P. Brugger: »Der Wunsch nach Amputation. Bizarre Macke oder neurologische Störung?«, Ars Medici, (Februar 2011).
P. Brugger et al: »Limb amputation and other disability desires as a medical condition«, www.thelancet.com/psychiatry (Dezember 2016), Vol 3., S. 1176–1186.
02 »Ich bin überzeugt, dass wir irgendwann Gehirne konstruieren können, die so denken wie Menschen.«
Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie, überlegt, ob auch Roboter Menschenrechte haben.
Unser Gehirn verändert sich im Lauf des Lebens, neue neuronale Netzwerke entstehen, andere verschwinden. Weshalb haben wir trotzdem bis ans Lebensende das Gefühl, mehr oder weniger derselbe Mensch zu sein?
Das, was wir sind beziehungsweise glauben zu sein, ist im Wesentlichen eine Interpretation unseres Gehirns und die Folge unserer Erinnerung. Ich bin ein großer Anhänger des Konstruktivismus, weil ich sicher bin, dass unser Gehirn ein Interpretationsorgan ist. Wir sind blind für den größten Teil dessen, was auf uns einprasselt, und nehmen die Welt nicht als Ganzes wahr, sondern aus bestimmten Perspektiven. Aus dem kleinen Teil der Informationen, die wir mitbekommen, konstruieren wir unser Leben und unsere Person. Wir sind Konstrukteure unserer eigenen Welt. Das spiegelt sich auch in einem Wort wider, das wir in der Psychologie verwenden, um zu beschreiben, wie wir die Welt interpretieren: Wir sprechen von Wahrnehmung. Da steckt der Begriff Wahrheit drin, doch Wahrheit hat nur lose Bezüge zur Realität, zur Art und Weise, wie wir die Realität interpretieren. Wahrnehmung ist Sinnesphysiologie plus Kognition plus Interpretation. Im Grunde leben wir in einer Matrix.
Wir sehen weder Röntgenstrahlen noch UV-Licht, und im Vergleich mit anderen Lebewesen hören wir schlecht. Weshalb limitiert das Gehirn die Realität um uns herum?
In jedem Moment fluten auf unser Sensorium 11 Millionen Bit pro Sekunde ein, davon nehmen wir bewusst 11 bis 60 Bit wahr. Mehr würde in unserer Wahrnehmungswelt keinen Sinn machen. Das Gehirn limitiert die Realität nicht im Sinne eines Defizits. Der Mensch ist ein biologisches Lebewesen, wir sind Tiere. Um zu überleben, hat sich das Tier Mensch an eine bestimmte Umwelt angepasst. Die Sinnesorgane und die Wahrnehmung jedes Lebewesens, ob Mensch oder Kakerlake, sind an die Welt angepasst, in der es lebt. Und für diese jeweilige Welt ist sein Sensorium spezialisiert. Unser Hören, Sehen, Fühlen ist so ausgerichtet, dass wir in dieser Welt überleben können. Wir können die wichtigsten Feinde identifizieren und wir haben sozialen Umgang gelernt, das Zusammenleben mit anderen Menschen. Wir sind also perfekt an unsere Umwelt angepasst.
Wenn mehrere Menschen an einem Tisch sitzen – schließen sich dann die Gehirne der Einzelnen zu einem einzigen großen Netzwerk zusammen?
Die Menschen schließen sich tatsächlich mental zusammen. Sprechen zwei, drei Menschen über das Gleiche, synchronisieren sich ihre Gehirne. Das sieht man an der Hirnaktivität, die immer ähnlicher wird. Das ist ein Ausdruck des gleichen Denkens, des Mitschwingens, des Mitfühlens, der Empathie. Die Hirnaktivitäten der einzelnen Menschen aktivieren sich gegenseitig und kommen so in die gleichen Oszillationsmuster. Das hat mit einem der wichtigsten Mechanismen zu tun, wenn nicht sogar mit dem wichtigsten überhaupt, den die Natur dem Homo sapiens mitgegeben hat: Aufbau und Erhalt von sozialen Bindungen mit Mitmenschen, die für uns relevant und wichtig sind. Wir haben eine ganze Reihe von psychologischen Mechanismen tief in unser Gehirn eingebrannt, um sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten und ihn zu schätzen.
Welche Mechanismen sind das?
Mimik, Gestik, Körpersprache und die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen. Wir nennen dies Theory of Mind. Wir versuchen zu ergründen, was unser Gegenüber denkt, machen uns Gedanken über unseren Gesprächspartner und verhalten uns entsprechend. Dafür sind wir hochgradig spezialisiert. Und auch darauf, zu anderen Lebewesen eine Bindung aufzubauen, das machen wir über Kommunikation, über Handlungen, über Zusammenarbeiten. Am besten funktioniert das Sozialverhalten von Angesicht zu Angesicht. Physisch präsent sein ist sehr wichtig.
Warum verwenden wir so viel Energie darauf, soziale Bindungen aufzubauen?
Weil der größte Feind des Menschen der Mensch ist. Wir sind empathische Egoisten, wir nutzen andere Menschen aus. Wollen wir verhindern, selbst ausgenutzt zu werden, müssen wir Bindungen aufbauen, die Menschen herauspicken, auf die wir uns verlassen, denen wir vertrauen können. Wir sind fantastisch gut im Erkennen von Mimik, wir hören aus Stimmen Emotionen heraus, sind unfassbar sensibel im Aufbauen und Pflegen von sozialen Kontakten. Wenn uns jemand Gutes tut, uns sozial anerkennt, ist dies das schönste Geschenk, das man uns machen kann. Der Verlust von sozialer Anerkennung hingegen ist der größte Stressor überhaupt. Und Vertrauensmissbrauch gehört zu den schlimmsten Enttäuschungen. Würden wir Letzteren mit Vernunft betrachten, würden wir erkennen, dass der Mensch, der einmal aus der Spur geraten ist, trotz seiner Verfehlung, der Mensch ist, der mich so gut versteht wie sonst keiner. Aber wir bleiben misstrauisch. Ist das Vertrauen einmal verletzt worden, bleibt ein Leben lang etwas hängen.
Braucht unser Gehirn zwingend andere Menschen oder könnte es sich auch selbst genügen?
Wir sind soziale Wesen, das ist tief in uns drin. Sozial eingebunden zu sein ist einer der Grundantriebe des menschlichen Daseins. Man kann natürlich in bestimmten Situationen tief enttäuscht sein von anderen Menschen und sich von ihnen abkehren. Aber das sind Ausnahmen.
Nehmen wir an, Sie wären der letzte Mensch auf Erden. Wie würden Sie diese Einsamkeit ertragen wollen?
Das wäre nicht einfach. Ich müsste wohl Alternativwelten erfinden, so wie es Robinson Crusoe auf der einsamen Insel tat.
Der Schriftsteller Daniel Defoe 3 ließ seine Figur wissen, dass es nach wie vor Menschen gibt. Ihnen aber wäre klar, dass Sie der letzte Verbliebene sind. Was unternähmen Sie, um ohne menschliche Bindung nicht zu verzweifeln?
Ich würde versuchen, Ersatzwesen zu finden, Tiere, mit denen ich sprechen könnte. Die Lust an der Kommunikation ist beim Menschen ja enorm. Das ist ein eingebrannter Antrieb. Alleinsein ist schwierig, wohl das Schwierigste überhaupt.
Es gibt Altruisten und Misanthropen, Extrovertierte und Introvertierte. Unterscheiden sich die Gehirne dieser Menschen voneinander?
Anatomisch können wir nicht erkennen, ob jemand extrovertiert oder introvertiert ist, ich bin aber sicher, dass wir die Unterschiede irgendwann werden sehen können. Die Grundlagen für unsere Persönlichkeit sind verwoben in den Netzwerken unseres Gehirns. Alles, was wir tun – lieben, denken, fühlen, hassen, das ganze Drama unseres Lebens wird generiert von den neuronalen Netzwerken unseres Gehirns. Demzufolge sind Persönlichkeitsunterschiede die Konsequenzen ganz verschiedener neurophysiologischer Aktivierungsmuster.
Am besten erkennt das Gehirn Gesichter. Weshalb?
Mimik gehört zu den wichtigsten biologischen Signalen, die wir gesendet bekommen und die wir aussenden. Wir sind Weltmeister im Erkennen von Mimik. Wir haben spezielle Hirnstrukturen dafür, die trainiert und ständig verbessert werden müssen. Mimik ist für unseren Aufbau von Beziehungen von herausragender Bedeutung. Sie ist wahrscheinlich der wichtigste soziale Kanal, den wir benutzen.
Weshalb haben wir unsere Mimik manchmal nicht unter Kontrolle?
Wir können einen großen Teil unserer Mimik manipulieren, die spontane aber, die wichtige, die haben wir nicht im Griff. Angst, Überraschung, Ekel, Verachtung, Freude. Bei echter Freude lachen Mund- und Augenpartie, die Muskeln um den Mund und um die Augen sind simultan aktiv. Von den Models, von Heidi Klum etwa, kennen wir das gestellte Lächeln, bei dem die Augen nicht mitlachen. Beim echten Lachen, das von Emotionen getrieben ist, werden die Mundwinkel hochgezogen und gleichzeitig die Augenmuskulatur kontrahiert, Duchenne-Smile nennen wir das. Mit der spontanen Mimik, den Basissignalen, zeigen wir unseren Mitmenschen, welche Emotionen gerade in uns aktiv sind. Unser Gegenüber sieht unsere Gefühle und kann daraus ableiten, wie es sich am besten verhält. Unabhängig von der Sprache, die wir sprechen, unabhängig von der Ausbildung, die wir haben: Alle Menschen auf der Welt können sich mit Mimik und Gestik verständigen. Es gibt Untersuchungen mit taubblind geborenen Kindern, die in der Mimik von anderen Menschen weder Freude noch Angst jemals gesehen hatten, und die auch die dazugehörigen Lautäußerungen nie gehört hatten, und doch zeigte sich auf ihren Gesichtern Freude oder Angst, wenn sie solche empfanden.
Vergleicht man das Gehirn eines Menschen aus der Steinzeit mit dem Gehirn eines heutigen Menschen: Welche Unterschiede zeigen sich?
Keine großen. Die Gehirne sind im Prinzip gleich. Das, was drin ist, ist anders. Der Steinzeitmensch konnte nicht lesen, aber die Hirngebiete, die heute fürs Lesen reserviert sind, waren bereits da, er nutzte sie einfach für anderes. Für manche der heutigen Menschen ist es schwer nachvollziehbar, dass sich unser Gehirn kaum von demjenigen des Steinzeitmenschen unterscheidet. Wir sind, wie unser Vorfahre damals, empathische Egoisten. Wir können moralisch und unmoralisch sein, friedfertig und aggressiv, rigide und kreativ. Wir haben alles in uns drin. Gerade auch die Aggressivität, obwohl wir glauben, wir hätten sie zu einem Großteil überwunden. Gar nix haben wir überwunden. Die basalen menschlichen Antriebe erkennen wir immer dann, wenn es um uns selbst geht. Panik im Flugzeug: Der friedfertigste Aktivist wird über andere hinwegtrampeln. Da entfalten sich Mechanismen, die wir ansonsten unterdrücken. Stehen unsere Interessen oder die unserer Familie auf dem Spiel, werden wir immer ungemütlich. In solchen Situationen kommt auch zum Ausdruck, was für unser Überleben wichtig ist – wir sind nicht für die heutigen großen Gesellschaften konstruiert, sondern für kleine Gruppen. In diesen können wir Bindung leben. Die Menschen, zu denen wir enge Bindungen aufgebaut haben, die sind uns wichtig, die beschützen wir. Zu den anderen können wir zwar kognitive Bindungen aufbauen, aber emotional sind sie uns …
… egal.
Das ist der Punkt, genau.
Unterscheiden sich Frauengehirne von Männergehirnen?
Der größte Unterschied ist die Größe. Frauen haben etwas kleinere Gehirne als Männer, sie sind im Mittelwert circa 200 Gramm leichter, dafür ist der Vernetzungsgrad ein bisschen größer. Das heißt, die Anzahl Neuronen ist wahrscheinlich bei Männern und Frauen die gleiche. Aber bei Frauen sind mehr Neuronen pro Volumeneinheit untergebracht als bei Männern. Es gibt auch Männer mit Gehirnen so groß wie Frauengehirne und Frauen mit Gehirnen so groß wie Männergehirne. Eines wissen wir heute sicher – die Anatomie des Gehirns ist nicht entscheidend für das vermeintlich unterschiedliche Verhalten der Geschlechter.
Früher bekamen die Menschen Wissen und Informationen vorgelesen. Wofür war das Areal, das wir heute fürs Lesen brauchen, reserviert?
Ich vermute, dass Steinzeitmenschen die Leseareale für die Formerkennung nutzten, sie malten ja bereits Bilder, symbolhafte Gemälde. Vielleicht diente ihnen das Leseareal dazu, hinter den Symbolen Informationen zu erkennen.
Das Human Brain Project will das Gehirn simulieren, um Krankheiten besser erforschen zu können. Lassen sich das Gehirn und seine Funktionen tatsächlich nachbilden. Auch Humor, Schlagfertigkeit, Esprit?
Die Wissenschaftler des Human Brain Projects wollten aus einem Rattengehirn eine digitale Rekonstruktion des Gehirns machen. Geschafft haben sie dies bisher nicht mal ansatzweise. Ich würde das Projekt als gescheitert betrachten. Trotzdem gefällt mir die Idee, das Gehirn zu simulieren, man soll sie weiterverfolgen. Ich würde mich aber auf digitale Rekonstruktionen von Denkprozessen konzentrieren. Was Esprit, Humor, Schlagfertigkeit betrifft – diese psychologischen Funktionen, die als Kernfähigkeiten des Menschen gelten, sind tatsächlich schwierig nachzubilden. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir diese Fähigkeiten nicht überbewerten. Willibald Ruch, Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Universität Zürich, untersuchte Witze und stellte fest, dass es zwei, drei unterschiedliche Kategorien von Witzen gibt und dass diese überall auf der Welt gleich ankommen. Es gibt die inkonsistenten Witze mit grotesken Details und mit Wendungen, über die man nachdenken muss. Es gibt die plumpen Witze, die Stammtischwitze, und die sexistischen Pointen. Ich würde behaupten, letztere beide machen bis zu sechzig Prozent der Witze aus. Der deutsche Komiker Mario Barth erzählt solche Witze und füllt damit Fussballstadien. Auf den Rängen sitzen Durchschnittsmenschen und lachen sich die Hucke voll. Platte Witze könnte man durchaus rekonstruieren und damit wahrscheinlich auch einen Roboter zum Lachen bringen.
Kann ein Roboter ähnlich kreative Ideen haben wie das menschliche Gehirn?
Wir betrachten den Menschen als wahnsinnig kreatives Wesen, aber neunzig Prozent unseres Lebens bestehen aus Gewohnheiten, aus Sachen, die wir jeden Tag machen. Auch Menschen, die eine außergewöhnliche Leistung erbracht haben, sind nicht ihr ganzes Leben lang kreativ. Einen Steve Jobs gibt es nicht dutzendfach, und auch unglaublich gute Maler findet man nicht viele. Ja klar, auch Computer können kreativ sein. Kreativität ist Zufall, kombiniert mit Wissen, das bereits vorhanden ist. Auf Arte gibt es eine Serie, sie heißt Real Humans und erzählt von Robotern, die aussehen wie Menschen und sich auch so verhalten. Erst designten die Forscher in Real Humans Gärtner-Roboter, Chauffeur-Roboter, Nanny-Roboter. Später dann bauten sie auch Roboter, die Unterhalter sind, Freunde, Liebespartner. Ich bin überzeugt, dass wir irgendwann Gehirne werden konstruieren können, die so denken und sich so verhalten wie Menschen.
Wären ihre Netzwerke so plastisch wie das Gehirn des Menschen?
Mit Sicherheit, Roboter-Netzwerke sind lernfähig. Wir könnten ihnen Grenzen einbauen, zum Beispiel dafür sorgen, dass sie nicht töten. Innerhalb der Grenzen, die wir ihnen setzen, könnten sich die Netzwerke der Roboter aber individuell entwickeln. So wie sich unsere Gehirne entwickeln. Es gäbe zu uns keinen Unterschied mehr.
Hätten die Roboter dann auch Menschenrechte?





























