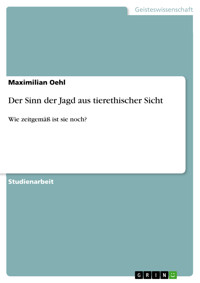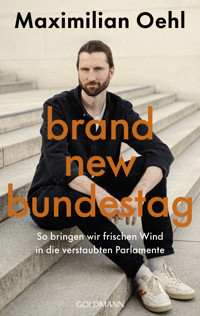
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Demokratie steckt fest – daran können wir alle etwas ändern.
»Brand New Bundestag zeigt, was demokratische Disruption in der Praxis heißt, wie aus kleinen Ideen echte Macht erwachsen kann und warum es sich lohnt, für politische Utopien zu kämpfen.« Luisa Neubauer
Die politischen Systeme in unserem Land wirken festgefahren und verstaubt. Sie scheinen kaum in der Lage, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Es ist höchste Zeit, das zu ändern und frischen Wind in die Parlamente zu bringen. Doch wie? Als Gründer der Organisation Brand New Bundestag, Politikstratege und Innovationsgestalter zeigt Maximilian Oehl pragmatische Wege auf, wie das deutsche politische System von innen heraus erneuert werden kann. Mit praktischen Beispielen und Erfahrungen aus dem politischen Berlin sowie Einblicken in das Innenleben der Parteien bundesweit macht das Buch Mut und zeigt, wie jede*r von uns unkompliziert und effektiv zu einer wirkungsvollen Demokratie beitragen kann. Wenn die authentischsten, kompetentesten und mutigsten Köpfe sich durchsetzen, retten wir nicht nur unsere Demokratie, sondern auch unsere Gesellschaft.
»Unsere Demokratiedebatte ist von erschütternden Diagnose oder selbstgefälligem Schönreden geprägt. Wege zu ihrer wehrhaften und effektiven Erneuerung liegen aber genau dazwischen. Deshalb ist dieses Buch so wichtig: es zeigt anschaulich, welche Spielregeln des politischen Betriebs ein Update brauchen und wie eine demokratische Kultur der von Populist:innen gewünschte Spaltung ein Schnippchen schlagen kann. Demokratie ist, so werden Sie feststellen, ein Tuwort.« Maja Göpel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Die politischen Systeme in unserem Land wirken festgefahren und verstaubt. Sie scheinen kaum in der Lage, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Als Gründer der Organisation Brand New Bundestag, Politikstratege und Innovationsgestalter zeigt Maximilian Oehl pragmatische Wege auf, wie das deutsche politische System von innen heraus erneuert werden kann. Mit praktischen Beispielen und Erfahrungen aus dem politischen Berlin sowie Einblicken in das Innenleben der Parteien bundesweit macht das Buch Mut und zeigt, wie jede*r von uns unkompliziert und effektiv zu einer wirkungsvollen Demokratie beitragen kann.
Autor
Dr.MaximilianOehl ist Experte für politische und gesellschaftliche Innovationen und Gründer der Initiative Brand New Bundestag, die sich für Vielfalt, Überparteilichkeit und wirksame Prozesse in der Politik einsetzt. Als Jurist war er unter anderem Initiator der ersten studentischen Refugee Law Clinic in Köln, die Migrant*innen kostenlose Rechtsberatung anbietet, und Gründungsvorsitzender des gleichnamigen Bundesverbands. Heute engagiert er sich als Gründer und Leiter von Media Force für eine wehrhafte digitale Demokratie, indem er die Bekämpfung von Desinformation und Extremismus in den sozialen Medien vorantreibt. 2025 ehrte ihn die WirtschaftsWoche als einen von »Deutschlands 30 bis 2030«, zudem wurde er zweimal als Teil der Capital »Top 40 under 40« ausgezeichnet.
Maximilian Oehl
brand
new
bundestag
So bringen wir frischen Wind in die verstaubten Parlamente
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach §44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe Oktober 2025
Copyright © 2025: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Antje Steinhäuser
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Coverfoto: Maximilian Gödecke Photography
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
JS · CB
ISBN 978-3-641-32977-8V001
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
Prolog
Teil 1: Diagnose
Erstes Kapitel: Waffeln oder Glühwein?
Zweites Kapitel: Was bringt mir das hier drinnen?
Teil 2: Handlungsempfehlungen
Drittes Kapitel: Was bitte ist ein »brandneuer« Bundestag? Und wie erschaffen wir ihn?
Viertes Kapitel: How to move politics
Fünftes Kapitel: Quasselbude for future
Sechstes Kapitel: Ab in die Brand New Democracy 2035
Epilog
Dank
Anmerkungen
Prolog
Jahrelang haben wir auf diesen Abend hingearbeitet. Ich steige auf mein Fahrrad und radle von Berlin-Friedrichshain hinein in das politische Zentrum der Republik, nach Mitte. Angekommen in einer kleinen holzvertäfelten Souterrain-Bar, die österreichische Weine und Spinatknödel zu bieten hat, begrüße ich meine Kolleg*innen. Ich bin aufgeregt. Die Anspannung von allen ist zu spüren. Wenig später heiße ich in dem kleinen Raum über 30 Bundestagsabgeordnete unterschiedlicher Parteien willkommen, die meisten von ihnen frisch zum ersten Mal in dieses Amt gewählt. Es ist einer der ersten Abende im politischen Berlin, an dem sie überhaupt zusammenkommen. Darunter sind spätere Parteivorsitzende und Regierungsmitglieder. Warum macht Ihr eigentlich Politik? Und was wollt Ihr in dieser Wahlperiode erreichen? Diese Fragen diskutieren wir in der Runde, der Abend wird lang, später kommen noch deutschlandweit bekannte Aktivist*innen, Autor*innen und Künstler*innen dazu.
Szenenwechsel. Wenige Wochen zuvor, am 27.September 2021 schrecke ich aus meinem Bett auf. Es ist 5:31 Uhr, mein Handy klingelt. Dran ist Kassem Taher Saleh aus Dresden. Er klingt euphorisch, seiner Stimme ist jedoch auch eine tiefe Erschöpfung anzuhören. »Digga, ich bin drin.«
Wo drin? Im Deutschen Bundestag. Wieso Kassem gerade mich in diesen frühen Morgenstunden anruft? Weil ich ihm, zusammen mit gut 250 Ehrenamtlichen, dabei geholfen habe, einer der 736 Abgeordneten zu werden.
Moment, was? Ja, Ende 2019 hatte ich mit zwei Freund*innen eine Organisation mit dem Namen Brand New Bundestag (BNB) zu genau diesem Zweck gegründet. Auch diese Geschichte begann – in meinem Bett.
Springen wir gut zwei Jahre zurück. An einem Freitagvormittag im Mai 2019 liege ich in besagtem Bett und netflixe. Die Doku zieht mich in ihren Bann: Es ist Knock Down the House (Frischer Wind im Kongress), Protagonistin ist Alexandria Ocasio-Cortez, inzwischen weltweit bekannt als Ikone der amerikanischen Progressiven unter ihren Initialen »AOC«.
Der Film porträtiert die Aufstiegsgeschichte einer jungen, damals 28-jährigen Latina aus der Bronx, die gerade noch als Barkeeperin hinter dem Tresen einer New Yorker Cocktail-Bar auf ordentliches Trinkgeld hoffte und plötzlich, wenige Wochen später, im Juni 2018, eben dort zur Kandidatin der US-Demokraten für das Abgeordnetenhaus wird – nachdem sie im innerparteilichen Wettbewerb völlig überraschend den damals 56-jährigen »big shot« Joseph Crowley geschlagen hat. Crowley ist zum damaligen Zeitpunkt der viertmächtigste Abgeordnete der Partei in Washington, D.C. und wird als Nachfolger der Fraktionsvorsitzenden Nancy Pelosi gehandelt.
Crowley gibt etwa 3,3 Millionen US-Dollar für seinen Wahlkampf aus, bei AOC ist es weniger als ein Zehntel davon. Er erhält die öffentliche Unterstützung des gesamten demokratischen Parteiestablishments, sie nicht. Ihn kennt jede*r, sie damals so gut wie niemand. Und dennoch gewinnt sie diese parteiinterne Wahl – ein Sieg, der in der Hochburg der US-Demokraten (die Republikaner haben bei Wahlen regelmäßig keine Chance) mehr oder weniger gleichbedeutend ist mit dem Einzug in das Abgeordnetenhaus.
Ich bin fasziniert. Ja, auch von AOC, ihrem Charisma, ihrer Eloquenz, ihrer inhaltlichen Kompetenz. Doch was mich elektrisiert, ist etwas anderes: Die Organisationsstrukturen, die ihren Wahlerfolg möglich gemacht haben. Denn AOCs Kandidatur beginnt mit ein paar Klicks. Ihr Bruder hat etwas von zivilgesellschaftlichen Organisationen – mit klingenden Namen wie Brand New Congress oder Justice Democrats – gehört, die nach überzeugenden »working-class, everyday Americans« suchen, die sich um politische Mandate bewerben wollen beziehungsweise sollten. Klarer Fall aus der Sicht von Gabriel Ocasio-Cortez: Seine kluge, energische Schwester wäre eine hervorragende Repräsentantin ihrer Community.
Auf die Nominierung durch Gabriel folgt ein mehrstufiges Auswahlverfahren, in dem Alexandria sich durchsetzt – sie wird offizielle Kandidatin von Brand New Congress und Justice Democrats. In der Folge erhält sie Coachings, Hilfe beim Fundraising, Support durch Hunderte Ehrenamtliche sowie vielfältige anderweitige Unterstützung bei ihrer Wahlkampagne. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg.
Am Abend dieses Tages im Mai 2019 denke ich: So etwas brauchen wir in Deutschland auch. Ich diktiere ein Memo in mein Handy und versende leicht aufgekratzt ein paar WhatsApp-Nachrichten. Danach gehe ich schlafen.
So beginnt die Geschichte von Brand New Bundestag (BNB). Unsere Initiative unterstützt bei der Bundestagswahl 2021 erstmals überparteilich Kandidierende, elf an der Zahl. Nominiert wurden sie auf der BNB-Website von Geschwistern, Freund*innen, Kolleg*innen. Jene, die sich im Auswahlverfahren durchsetzen, supporten wir gemeinsam mit unseren Volunteers durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Coachings und strategische Beratung, gerade im innerparteilichen Wettbewerb um aussichtsreiche Kandidaturen. Vier von ihnen werden in der Wahlnacht zu Abgeordneten.
Kassem ist einer davon. Es ist seine erste Wahl. Als Kandidat. Und als Wähler. Kassem ist erst seit 2018 deutscher Staatsangehöriger, geboren wurde er 1993 im Irak. 2019 trat er bei B90/Die Grünen ein, im Herbst 2020 wurde er BNB-Kandidat. Im September 2021 ist er Mitglied des deutschen Bundestages (MdB).
Sehr, sehr wenige Menschen in der Politik legen eine solche Karriere hin wie Kassem. Die meisten sind jahre- oder jahrzehntelang in Parteistrukturen aktiv. Viele sind intrinsisch davon angetrieben, etwas Gutes für die Gesellschaft zu bewegen – bei einigen jedoch gerät diese Mission merklich aus dem Blick. In der Politik geht es eben viel auch um Verlässlichkeit, um informelle Netzwerke, um die Absicherung von Macht.
Diese für Außenstehende meist unsichtbaren Strukturen in Parteien führen zu mess- und spürbaren Auswirkungen, für uns alle. Nicht nur sind viele Gruppen in unseren Parlamenten unterrepräsentiert (angefangen etwa bei Frauen, Menschen ohne höheren Bildungsabschluss oder mit ostdeutschen Biografien, stark betroffen sind auch Menschen mit internationaler Familiengeschichte, Behinderungen oder aus der Queer-Community), was erwiesenermaßen schlechtere politische Entscheidungen zur Folge hat1 – wir leben auch in einem demokratischen System, in dem Menschen nur bedingt nach ihrer Eignung oder ihrem Mut zur Gestaltung für politische Ämter ausgewählt werden. Schnell gelten solche Personen als zu »pushy«, ihr ungewöhnliches Maß an Energie wird als anstrengend zurückgewiesen, lieber bleibt man bei den alten Ritualen und Gewohnheiten.
Natürlich zeigt ein Blick in andere Sektoren, etwa die freie Wirtschaft, dass hieran nichts ungewöhnlich ist. Auch hier gibt es beispielsweise in großen Konzernen gerade für besonders gestaltungswillige Personen oftmals »gläserne Decken«, sie werden ausgebremst und suchen sich dann ein anderes Tätigkeitsfeld, gründen etwa ein eigenes Startup. Doch in der Politik geht es eben um so viel mehr. Die Menschen in politischer Verantwortung sind es schließlich, die die Weichen stellen, wohin unsere Gesellschaft steuert. Ob wir zeitgenössische Herausforderungen mutig angehen, dabei auch grundlegende Strukturen infrage stellen – oder uns lieber an den Status quo klammern.
Eigentlich ist es so einfach in der repräsentativen Demokratie: Die Menschen in den Parlamenten entscheiden stellvertretend für die Wähler*innen, die in Deutschland lebende Bevölkerung. Doch wer repräsentiert eigentlich die Bevölkerung? Was wird aus diesem System, wenn die mutigsten Gestalter*innen gerade nicht den Weg in die Politik gehen, sondern sich in Zivilgesellschaft oder Wirtschaft verwirklichen? Wenn viele Gruppen und Perspektiven systematisch ausgeschlossen werden, an den strukturellen Hürden der Parteiarbeit scheitern?
Viele der politischen Debatten, die wir tagtäglich in den Medien erleben, sind aus meiner Sicht – die sich aus den langjährigen Erfahrungen bei BNB, in der Parteiarbeit und in der Zivilgesellschaft speist – Symptome für eine Erkrankung unseres demokratischen Systems. Der Patientin Demokratie geht es nicht gut. Sie hat sich viele ungesunde Gewohnheiten zugelegt über die gut 70 Jahre ihres bisherigen Lebens. Sie ist zu satt und gleichgültig geworden, bewegt sich selten vom Fleck und hat sich damit abgefunden, dass schwer durchschaubare Machtnetzwerke bestimmen, wer bei Kandidaturen zum Zug kommt. Sie akzeptiert eine systematische Missrepräsentation vieler in Deutschland vertretener Sichtweisen. Die wohl schlimmste Diagnose jedoch ist: Sie glaubt nicht mehr daran, dass sie es besser kann. Ob frisch gewählte Abgeordnete, langjährige Spitzenpolitiker*innen, Partei-Basismitglieder oder zivilgesellschaftlich Engagierte: Fast niemand hält für möglich, dass sich grundlegende Logiken und Prozesse in der Demokratie wirklich verbessern beziehungsweise überhaupt verändern lassen. Die allerwenigsten glauben daran, dass es möglich ist, unsere Gesellschaft noch besser zu machen – etwa indem wir unser Verständnis von Wirtschaft ändern und anpassen, indem wir Methoden ersinnen und umsetzen, wie wir die Wirtschaft einhegen, damit sie nicht dazu führt, dass unser Planet durch Klimagase unbewohnbar wird.
Die Patientin muss sich dringend behandeln lassen. Doch sie erkennt nur punktuell ihre Erkrankung. Sie ist träge geworden und verbreitet nur noch selten Lebensfreude. Sie geht davon aus, dass ihr sowieso niemand helfen könne. Womöglich ist unsere Patientin in eine Art depressiven Gemütszustand verfallen.
Wie gehen wir mit so jemandem um? Wie gehen wir mit einer Demokratie um, die nur noch bedingt an ihre eigenen Versprechungen glaubt? Mit einer politischen Kultur, die sich selbst beschränkt und große Veränderungen weitgehend als Träumereien abtut?
In jedem Fall gilt: Eine Kranke geben wir nicht auf. Im Gegenteil, wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Mal Ermunterung, mal einen Tritt in den Hintern, insgesamt viel Verständnis und ja, Liebe. Aus unserer Liebe zur Demokratie – dieser Herrschaftsform, die weiß Gott nicht perfekt und doch die beste ist, die sich Menschen bislang ausgedacht haben – kann sich jene Veränderung speisen, die wir brauchen, um den großen Herausforderungen unserer Zeit begegnen zu können. Es ist dringlich. Erhält die Patientin keine Behandlung, droht ihr der Tod. Denn sie steht im – seit dem Ukrainekrieg auch gewalttätigen – Konflikt mit Autokratien. Sie trägt extremistische Fremdkörper in sich, die sie schleichend vergiften und Fantasien eines faschistoiden Regimes verwirklichen wollen.
Doch die gute Nachricht ist: Es kann Heilung geben. Wenn wir uns – als Bürger*innen, als Zivilgesellschaft – darauf besinnen, welch einen großen Stellenwert die Patientin für uns hat. Sie ist Garantin unseres Lebens, unserer Liebe, unserer Beziehungen zu Familie und Freund*innen. Unsere Leben wären komplett andere ohne die Demokratie. Das sollte und muss der Weckruf sein für uns, systemische Defizite nicht länger hinzunehmen und uns an die Arbeit zu machen.
Dieses Buch soll ein Beitrag hierzu sein. Es erzählt Geschichten aus unserer Demokratie, die offenlegen, an welchen Symptomen die Patientin krankt. Es erzählt meine Geschichte von gut dreizehn Jahren politisch-sozialem Unternehmertum und meinen Versuchen, der Patientin zu helfen. Und Geschichten wie jene von Kassem, die zeigen, dass die Abwehrkräfte unserer Demokratie noch existieren – wenn sie zielgenau aktiviert werden.
In diesem Buch erwähnte oder zu Wort kommende Menschen erscheinen teils mit ihren echten Namen, teils anonymisiert, je nach persönlicher Präferenz. Ich bin ihnen in den letzten dreizehn Jahren in Parteipolitik und Zivilgesellschaft begegnet, habe Gespräche mit ihnen geführt oder mit ihnen zusammengearbeitet. Die Begegnungen mit diesen Menschen sind mir in Erinnerung geblieben und waren für mich Denkanstöße zum Zustand unserer Demokratie.
Die Erfahrungen, die ich in unserem demokratischen System machen durfte, sind Mosaiksteine eines größeren Bildes. So geht es weniger um die Personen und Charaktere, die sich hinter diesen Namen verbergen, als vielmehr um die Erkenntnisse, die sich aus ihren Geschichten gewinnen lassen. Ihre Geschichten sind Symptome der Erkrankung, Paradigmen unserer demokratischen Kultur.
Im ersten Kapitel berichte ich von Diskussionen über Waffeleisen in einer Partei-Hochschulgruppe und was das damit zu tun hat, dass wir manchmal das Gefühl haben, nicht wirklich von den bestmöglichen Leuten repräsentiert zu werden.
Ich erzähle von Abgeordneten, die in ihrem Büro im Deutschen Bundestag sitzen und angesichts von Demos vor der Tür fragen: Was bringt mir das hier drinnen? Wir werden uns im zweiten Kapitel gemeinsam ansehen, was das mit den Defiziten unseres Parlaments beziehungsweise unserer politischen Kultur zu tun hat.
Im dritten Kapitel lernen wir, neben jener von Kassem, weitere Geschichten des Brand New Bundestag kennen (Spoiler: unter anderem jene von den Bundestagsabgeordneten Rasha Nasr und Armand Zorn) – weshalb und wie wir uns auf den Weg gemacht haben, diese zur überparteilichen Community gewordene Organisation zu gründen – und beleuchten, wie dies unsere Demokratie voranbringen kann.
Danach, im vierten Kapitel, springen wir in die Mitte des Parlaments und schauen uns an, wie wir Politik effektiv bewegt bekommen – how to move politics in challenging times. Darin erläutere ich, was der »BNB-Parlamentskreis« ist und wie er sich in konkrete Gesetzgebungsverfahren einbringt. Und was all das mit Movement Politics zu tun hat.
Im fünften Kapitel beginnen wir gemeinsam zu träumen – den Traum von einem zukunftsfähigen Parlament, das stellvertretend für uns alle auf eine breit wahrgenommene, wirkmächtige Art und Weise die großen Fragen unserer Zeit diskutiert, nachhaltige Lösungen entwickelt und hierdurch gesellschaftliche Konflikte befriedet. Eine »Quasselbude for Future«, genau so wie es unser demokratisches Ideal vorsieht.
Zum Abschluss dieses Buches, im sechsten Kapitel, wagen wir es, ein großes, anziehendes Bild unserer Brand New Democracy im Jahr 2035 zu entwerfen. Wir träumen also weiter – von einer lebendigen, zukunftsgerichteten Demokratie, die in uns regelmäßig euphorische Gefühle auslöst. Geht nicht, gibt’s nicht? Doch, geht und kann’s geben.
In diesem Sinne mögen die einzelnen Kapitel Dir, liebe*r Leser*in, eine Erkundungstour im Backstage unserer Demokratie ermöglichen – und Dich hoffentlich das eine oder andere über unsere Demokratie besser verstehen lassen sowie Aufschluss bieten, wie Du die Patientin bei der Heilung unterstützen kannst. Denn Demokratie kann mehr. Mit ein bisschen Hilfe – und unser aller anpackender Hände – kann sie alles sein: Die beste Staatsform für uns alle, dynamisch, inklusiv und transformativ. Brand New.
Teil I: Diagnose
Erstes KapitelWaffeln oder Glühwein?
Mein altes Fahrrad klappert gewaltig, als ich es an einem grauen Novemberabend 2008 im Nieselregen über das Kopfsteinpflaster der Heidelberger Altstadt quäle. Ich bin in gespannter Erwartung, verspüre Tatendrang und Aufbruchstimmung und habe eine Menge Ideen – noch unausgegoren, aber hier werden sie hoffentlich im Austausch mit anderen Gestalt annehmen und zu Projekten werden. Angekommen an meinem Zielort bin ich froh, dass das Schutzblech nicht abgefallen ist, und schlinge das viel zu dünne Zahlenschloss um einen Laternenpfahl. Während ich in das kleine Büro im Souterrain mit seinen 70er-Jahre-Sperrholzmöbeln hinabsteige, denke ich an Menschen, deren Initiative und Energie mich beeindruckt haben. Allen voran an meine unerschütterliche Großtante Luise Oehl, die kommunistische Widerstandskämpferin gegen die Nazis.2 Doch ebenfalls an Menschen wie meinen leidenschaftlichen Geschichtslehrer, der mit uns auch nach der Schule noch gerne über Politik und Gesellschaft philosophierte und keine Gelegenheit verstreichen ließ, uns zu politischem Engagement zu ermutigen. Oder an Florian, den Gründer der ghanaischen Stipendienorganisation, für die ich im ländlichen Südwesten des Landes deren Stipendiat*innen betreut hatte. So viel ist möglich, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht.
Wo geht es hier zur politischen Mitgestaltung, bitte?
Einige Leute sind schon da, es gibt Kaffee und Apfelschorle. Ich grüße etwas unbeholfen in die Runde und versuche, meine Verlegenheit zu überspielen, indem ich mir vermeintlich konzentriert die ausliegenden Flyer zu anstehenden Parteiveranstaltungen, Wahlkampfterminen und den lokalen Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene ansehe. Es trudeln noch einige weitere Leute ein und schließlich sitzt etwa ein Dutzend Studierender um einen großen hellbraunen Konferenztisch, der aus vier zusammengeschobenen Schreibtischen besteht, darauf allerlei Süßkram, Handys, Schreibblöcke und Stifte, Laptops. Irgendjemand hat Lebkuchen mitgebracht. Und dann beginnt die Sitzung der Hochschulgruppe einer landläufig bekannten deutschen Partei.
Der Vorsitzende eröffnet und führt die Redner*innenliste, die verschiedenen Agenda-Punkte werden feinsäuberlich nacheinander abgearbeitet. Ich bin erst das zweite Mal bei diesem Treffen dabei und versuche noch zu durchdringen, worum es eigentlich genau geht – die versteckten Rituale und Gesten zu lesen und wer hier wie viel Einfluss und Standing hat. Inhaltlich bin ich komplett verloren und bereits nach einer halben Stunde ziemlich ermattet. Es geht um die Vorbereitung von einer Konferenz auf Landesebene, um die Anreise und wer wen mitnehmen kann, um die Verpflegung dort, viele mir unbekannte Namen schwirren durch den Raum, zwischendrin macht irgendjemand einen Inside-Joke, auf den hin die meisten Leute lachen (ich nicht), einige tippen auf ihren Laptops mit, andere lesen parallel Uni-Texte oder tuscheln kurz miteinander.
Je länger die Sitzung dauert, desto stärker merke ich, wie eine zunächst kaum spürbare und dann immer drängendere Unruhe in mir aufsteigt. Ich fange an, auf meinem harten 70er-Jahre Stuhl herumzurutschen und zunehmend gelangweilt die Plakate zu studieren, die an den Wänden hängen. Teilweise sind es alte Wahlkampfplakate, teils Sinnsprüche, die inhaltliche Forderungen der Partei aufgreifen oder irgendwie ironisieren. Allmählich werde ich müde und frage mich, ob das wirklich der beste Zeitvertreib für diesen Novemberabend war. Mein Magen knurrt und ich schnappe mir einen Lebkuchen.
Nach sage und schreibe knapp drei Stunden nähert sich die Sitzung allmählich ihrem Ende. Ich habe jetzt eine ungefähre Ahnung davon, was bei dieser Landeskonferenz passieren wird – unter anderem muss ein neuer Vorstand der Jugendorganisation der Partei gewählt werden –, jedoch keinen Schimmer, was genau das Programm dieser Gruppe ist, was sie inhaltlich bei der Konferenz erreichen will oder wo die argumentativen Konfliktlinien innerhalb des Verbandes verlaufen. Zwar wurden im Verlauf der Sitzung auch ab und an »Anträge« erwähnt, tief inhaltlich eingestiegen ist aber niemand. Es gab lediglich ein paar kurze Anmerkungen von jenen Leuten, die sich offenbar alle kennen und weitgehend einig sind; die einzelnen Punkte waren für die Runde und den Vorsitzenden dann jeweils schnell erledigt.
Ich bereite mich innerlich langsam darauf vor, wieder auf mein Rad zu steigen und im inzwischen strömenden Regen nach Hause zu fahren, da intensiviert sich die Debatte noch einmal. Die Hochschulgruppe will einen Wahlkampfstand zur anstehenden AStA-Wahl organisieren – doch die Anwesenden können sich nicht einigen, ob es dort Waffeln oder Glühwein geben soll. Verdutzt beobachte ich, wie plötzlich so leidenschaftlich für die eine oder andere Option gestritten wird wie bisher noch zu keinem anderen Zeitpunkt an diesem Abend. Bis schließlich der Vorsitzende das Machtwort spricht: Es wird Glühwein geben (ist weniger Sauerei als mit dem ganzen Waffelteig). Ich bin erleichtert, dass das jetzt auch geklärt ist, und ziemlich platt, als der Vorsitzende die Sitzung endlich schließt.
Ich verabschiede mich knapp und wieder recht unbeholfen von meinen Sitznachbar*innen, packe mich in meinen Wintermantel und gehe zügig nach draußen. Puh, endlich frische Luft.
In den Wochen und Monaten danach schaue ich noch ab und zu bei der Gruppe vorbei, treffe mich mit dem Vorsitzenden auf einen Kaffee in der Mensa, trinke auch einen Glühwein mit den Kolleg*innen an besagtem Stand – und doch hinterlässt der Abend im November einen ziemlich ernüchternden Eindruck.
Denn ich bin nach Heidelberg gekommen, um dort Jura zu studieren – aus ziemlich idealistischen Motiven heraus. Jura ist die »Sprache des Systems«, so dachte ich mir, die ich erlernen will, um unsere Gesellschaft zum Besseren verändern zu können.
Seitdem ich zwölf Jahre alt bin, ist der Weltspiegel in der ARD am Sonntagabend eine meiner Lieblingssendungen. Ich bin schon als Teenie ein »Politik-Nerd«, interessiere mich für so ziemlich alle politischen Entwicklungen, vor allem für die Außen- und Migrationspolitik. In der Schule nehme ich nach Ende des regulären Unterrichts, für viele meiner Freunde nicht nachvollziehbar, zweimal in der Woche an einem Arbeitskreis zu Politik und Zeitgeschichte sowie einer Debattiergruppe teil. Schon damals besuche ich ab und an Veranstaltungen der Jugendorganisationen unterschiedlicher Parteien. Man könnte also meinen, ich sei auf die Parteiarbeit in gewisser Weise vorbereitet gewesen.
Nach dem Abitur und dem Studienbeginn sah ich im November 2008 dann auch endlich die Zeit gekommen, intensiver in einer Partei mitzumischen und »Politik zu gestalten«, wie es so schön heißt. In all diesen Jahren der innerlichen Vorbereitung schwebte mir aber eindeutig nicht die Frage »Glühwein oder Waffeln?« vor.
Je länger dieser Abend und die sehr ähnlichen Erfahrungen mit der Gruppe in den Wochen danach in mir nachhallen, desto frustrierter und enttäuschter werde ich, was meine Chancen der politischen Mitgestaltung betrifft. Meine Hoffnung schwindet, in solchen Strukturen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln zu können.
Mit Karteileichen in die bessere Zukunft für alle?
So wie mir im November 2008 geht es vermutlich Tausenden von Menschen – egal ob alt oder jung, West oder Ost, aus akademischen oder nicht-akademischen Berufen, ob mit Migrationsbiografie oder ohne. Viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben sehr ähnliche Erfahrungen bei ihren ersten parteipolitischen Gehversuchen gemacht, die allermeisten haben sich nach kurzer Zeit wieder abgewendet. Und jene, die nicht wieder ausgetreten sind, haben sich mehrheitlich in die innere Emigration hin zur Karteileiche begeben.
Diese Erfahrung machen etliche Leute unabhängig von der Partei – ob links, grün, sozialdemokratisch, liberal oder konservativ, das Frustrationspotenzial beim Parteieinstieg ist überall riesig.
Nun könnte man natürlich sagen: Gut, ist doch eine Form der Selektion. Bleiben eben die dabei, die es am meisten wollen. Ja, stimmt zwar. Doch zu welchem Ergebnis kommen wir damit? Dass eben die Hartnäckigsten dabeibleiben. Die Privilegierten, die ihren Alltag so organisieren können, dass abends und am Wochenende noch genügend Zeit und Energie für das Parteiengagement bleibt. Die finanziell unabhängig oder zumindest solide aufgestellt sind. Jene, die die Sprache der parteiinternen Netzwerke und Logiken sprechen oder schnell sprechen lernen. Deren Eltern, Onkeln oder Tanten vielleicht schon in der Partei aktiv waren oder zumindest ihr Engagement wertschätzend und unterstützend begleiten. Tendenziell die, die ihr Leben lang am selben Ort wohnen bleiben und nicht wegen Ausbildung oder Beruf umziehen beziehungsweise gar aus ihrem Herkunftsland fliehen müssen.
Erwischen wir mit diesem Modus die Leute in unserem Land, die sich am besten dafür eignen, die Bevölkerung in unseren Parlamenten zu repräsentieren? Die mutig vorangehen, den Status quo nachhaltig zu verbessern suchen und daran glauben, dass wir Dinge grundlegend anders machen können? Die tief in der Zivilgesellschaft verankert sind, auch in Bereichen fernab der Parteien? In Migrant*innen-Selbstorganisationen, in der lokalen Pflege- oder Mieter*innen-Initiative, in der Klimabewegung? Bilden wir auf diese Art und Weise die Vielfalt der Perspektiven in unserem Land angemessen ab?
Dem 21. Deutschen Bundestag gehören 32,4 Prozent Frauen (Bevölkerungsanteil: 50,7 Prozent), 11,6 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte (Bevölkerungsanteil: 29,7 Prozent) und 3,3 Prozent Menschen mit Behinderungen (Bevölkerungsanteil: 9,3 Prozent) an.3 Weitere diesbezügliche Berechnungen liegen für den aktuellen Bundestag noch nicht vor,4 aber wenn wir in die Vergangenheit blicken, sehen wir, dass die Zusammensetzung des Parlaments in der Regel auch in Sachen Bildung und Herkunft nicht viel mit der durchschnittlichen Bevölkerung zu tun hat. Dem 19. Deutschen Bundestag hätten, um den Anteil an der Gesamtbevölkerung angemessen zu repräsentieren, unter den damals insgesamt 709 Abgeordneten zusätzlich 244 Abgeordnete mit Hauptschulabschluss und 18 weitere Abgeordnete mit ostdeutschen Biografien angehören müssen.5
Geht es darum, die deutsche Bevölkerung im Bundestag eins zu eins nachzubilden? Braucht es hierfür eine Art mathematische Formel? Nein, natürlich nicht. Argumente in diese Richtung, die darauf abzielen, das Benennen von Repräsentationslücken ins Lächerliche zu ziehen, sind argumentative Blendgranaten, die von ernsthaften Herausforderungen ablenken sollen.
Jenseits der Tatsache, dass auch ein gewählter weißer Mann mit akademischem Abschluss die Interessen von in der deutschen Gesellschaft unterrepräsentierten Gruppen mitberücksichtigen kann und muss, ist es doch nur einleuchtend, dass zahlenmäßig massiv zu wenig vertretene Perspektiven es schwerer haben, in unseren Parlamenten auch wirklich in Gesetzesform gegossen zu werden. Um hier nur einen Aspekt herauszugreifen: 52,7 Prozent der Deutschen arbeiten in nicht-akademischen Berufen.6 Der Anteil von Nicht-Akademiker*innen im Deutschen Bundestag lag in der Vergangenheit stets bei unter 15 Prozent.7 Ist es vor diesem Hintergrund eine Überraschung, dass Deutschland sehenden Auges in einen Fachkräftemangel gesteuert ist? Dass allen öffentlichen Beteuerungen zum Trotz nie entscheidend nachgebessert worden ist, was die gezielte Förderung und Ausbildung von Menschen in nicht-akademischen Berufen betrifft? Ist womöglich sogar schon der europaweit geltende Fokus auf immer höhere Akademisierungsraten verfehlt, da unsere Gesellschaft schlicht nach wie vor einen höheren Bedarf gerade auch an technischen Berufen hat? Und es darum gehen würde, deren Ansehen hochzuhalten und bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen? Zumal akademische »knowledge jobs« im KI-Zeitalter voraussichtlich an Bedeutung verlieren werden?
Auch wenn es gute Gründe für die Akademisierung der Berufswelt gibt,8 liegt der Schluss nahe, dass wir in all diesen Aspekten eben einen fast ausschließlich von Akademiker*innen gestalteten Arbeitsmarkt erleben. Dass die Abgeordneten in unseren Parlamenten ihren eigenen Lebensweg und die Chancen ihrer akademischen Bildung stärker bei ihren gesetzgeberischen Entscheidungen vor Augen haben, ist zumindest nicht fernliegend. So kann eine starke Missrepräsentation von Perspektiven eben doch für eine verfehlte Politik sorgen. Sosehr sich der Anwalt oder Lehrer auch in einen Facharbeiter hineinzuversetzen versucht und entsprechende Studien liest – er wird sich schwertun, die Details und Besonderheiten von technischen Berufen angemessen zu berücksichtigen, zumal ihm persönliche Erfahrungswerte fehlen.
Neben der Repräsentation ist mir noch ein weiterer Aspekt wichtig. Wenn sich parteipolitisches Engagement oftmals so anlässt wie bei mir im November 2008 in Heidelberg, laufen wir Gefahr, vor allem jene Menschen als potenzielle Politiker*innen zu verlieren, die wirklich etwas in Bewegung bringen wollen. Und ist das nicht genau das Problem, mit dem viele von uns sich aktuell konfrontiert sehen? Das Gefühl, dass es in der Politik nicht richtig vorangeht? Dass wir bei aller ausführlicher Beschreibung der bestehenden Herausforderungen selten Menschen erleben, die einen mutigen, hoffnungsvollen Entwurf unserer Zukunft zeichnen? Und dabei zudem rüberbringen, wirklich daran zu glauben, ihn auch umsetzen zu können?
In vielen Fällen braucht man nach wie vor für eine politische Karriere vor allem – Sitzfleisch. Bekommen wir so Menschen in Ämter, die einen großen Tatendrang verspüren und die Gesellschaft schnellstmöglich zum Besseren verändern wollen? Wohl kaum.
Klar erleben wir immer wieder mal Geschichten wie jene von Verena Hubertz, die als Startup-Unternehmerin in die Politik wechselte, schnell für den Bundestag kandidierte, dort direkt zur stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden und inzwischen zur Bundesministerin aufstieg. Doch diese Geschichten bleiben die absolute Ausnahme. Der Regelfall sind eher Biografien wie jene von Olaf Scholz, der vom Juso-Bundesvorstand bis hin zum Kanzler so gut wie jedes politische Mandat beziehungsweise Parteiamt ausübte und zwischenzeitlich unter anderem bereits SPD-Generalsekretär, Regierender Bürgermeister in Hamburg und Bundesfinanzminister war.
Es geht nicht darum, diese Lebenswege grundsätzlich verächtlich zu machen. Vielmehr braucht es wohl in den Parteien wie auch in unseren Parlamenten eine gute Mischung zum einen aus Personen, die die dortigen formellen und informellen Gepflogenheiten bestens kennen, und zum anderen aus solchen, die neue Ideen und einen ordentlichen Schwung an Energie mit hineinbringen.