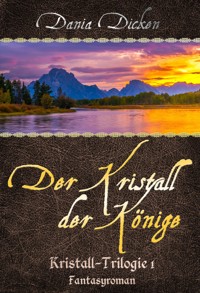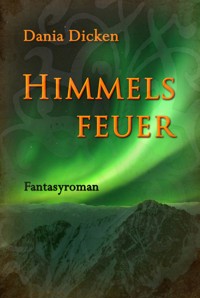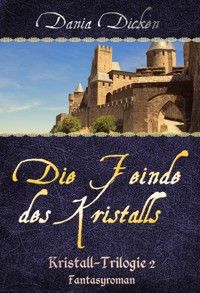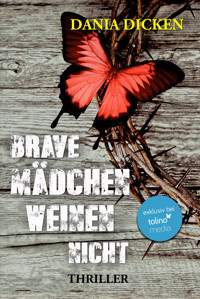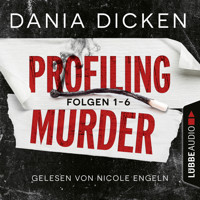4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Für Libby Whitman geht ein Traum in Erfüllung, als sie ihre Ausbildung an der FBI Academy in Quantico beginnt, um Profilerin zu werden. Die Anwesenheit ihrer besten Freundin Julie tröstet sie ein wenig darüber hinweg, dass sie ihren Kollegen Owen in Kalifornien zurücklassen musste, für den sie stärkere Gefühle hegt, als sie wahrhaben will. Doch nicht nur Owen überrascht Libby ganz unverhofft, sondern auch das FBI: Sie soll ihre Ausbildung unterbrechen und nach Utah reisen, um dort gegen eine polygame Mormonensekte zu ermitteln. Ein Schock für Libby, denn zehn Jahre zuvor ist sie selbst aus dieser Sekte geflohen – und hat ihre Mutter an sie verloren. Aber das FBI lässt ihr keine Wahl und so muss sie sich den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dania Dicken
Brave Mädchen schweigen still
Libby Whitman 2
Thriller
Wenn die Freiheit erst einmal Wurzeln geschlagen hat,
wächst sie rasend schnell.
George Washington
Prolog
Das konnte er vergessen. Das konnten sie alle vergessen. Unbeweglich saß sie auf dem Sofa und starrte ihn trotzig an.
„Es ist deine Pflicht vor Gott, mein Liebes. Ich möchte, dass du Shelley und Emma jetzt begleitest. Es gibt einiges, was sie dir noch beibringen müssen.“
„Was sie mir beibringen müssen? Ich lasse mich doch von den beiden nicht noch mal anfassen! Was soll denn das? Seid ihr alle übergeschnappt?“, rief sie aufgebracht.
„Nicht in diesem Ton, junge Dame! So lautet Saras Gesetz und du weißt, es ist ein göttliches Gesetz. So steht es in der heiligen Schrift. Du musst wirklich noch lernen, dich unterzuordnen!“
Sie schnaubte verächtlich. „Das ist doch krank, was ihr hier macht. Ich will das nicht! Lasst mich in Ruhe. Ich werde dich nicht heiraten!“
„Das bestimmst nicht du! So ist es abgesprochen!“
Nun sprang sie auf. „Na und? Du kannst mich nicht zwingen und das weißt du!“
Sie schrie immer lauter. Hinter ihm am Türrahmen sah sie die Gesichter von einigen Kindern der anderen Frauen, die neugierig ins Wohnzimmer spähten. Shelley und Emma saßen bereits neben ihr auf dem Sofa und warfen ihr erwartungsvolle Blicke zu.
Nur über ihre Leiche. Sie wusste genau, was jetzt kommen sollte, denn sie hatten es ja schon einmal gemacht, vor ein paar Tagen. Da hatte sie die beiden mit einer Mischung aus Nervosität und Angst begleitet, weil sie noch nicht gewusst hatte, was sie erwartete. Die beiden sollten sie in den Pflichten einer gehorsamen Ehefrau unterweisen – in allen Pflichten.
Auch denen im Bett.
Sie hatte es über sich ergehen lassen, weil sie wie gelähmt gewesen war. Shelley und Emma waren echte Miststücke, das hatte es nicht gerade besser gemacht, als die beiden an ihr herumgefingert hatten. Ihr wurde schlecht beim bloßen Gedanken daran – und bestimmt würde sie nicht zulassen, dass sie das wiederholten. Göttliches Gesetz hin oder her. Das war doch alles krank.
„Du solltest langsam gehorchen“, sagte er und klang dabei bedrohlich ruhig.
„Du kannst mich nicht zwingen.“
„Und ob ich das kann!“, brüllte er.
Jetzt sprang sie auf und starrte ihm genau ins Gesicht. „Versuch’s doch.“
Mit diesen Worten stapfte sie an ihm vorbei und wollte zur Tür, um das Haus zu verlassen. Sie würde jetzt nach Hause gehen und ihrem Vater klarmachen, dass sie George nicht heiraten konnte. Das war ausgeschlossen. Doch da packte er sie plötzlich unsanft von hinten und riss sie herum.
„Ich werde dir zeigen, wer hier das Sagen hat!“, brüllte er ihr mitten ins Gesicht.
„Lass mich los!“, schrie sie, aber er dachte gar nicht daran. Seine Finger gruben sich in ihren Oberarm, als er sie zu ihrer Überraschung nun selbst zur Haustür zerrte. Er griff nach seinem Schlüsselbund, zog sie mit sich nach draußen und warf die Tür hinter sich zu. Wortlos stieß er sie zu seinem Geländewagen und brüllte: „Du wirst jetzt einsteigen!“
„Sonst was?“
Es war schon dunkel draußen, deshalb sah niemand, wie er ihr so hart ins Gesicht schlug, dass ihr Kopf nach hinten flog und ihr das Blut nur so aus der Nase schoss. Sie fühlte sich benommen und wehrte sich nicht, als er sie dazu zwang, sich auf den Beifahrersitz des Wagens zu setzen. In den Taschen ihres langen Leinenkleides suchte sie nach einem Taschentuch und als sie eins gefunden hatte, hielt sie es sich unter die blutende Nase. George stieg derweil auf der Fahrerseite ein und fuhr abrupt an. Schweigend legte sie den Kopf in den Nacken und fing das Blut mit dem Taschentuch auf.
Zu ihrer Überraschung sagte George ebenfalls nichts. Ihr war es recht, sie hatte ihm sowieso nichts zu sagen. Das hatte Jessop sich ja schön überlegt, dass sie George heiraten sollte. Als ob er nicht schon genügend Frauen gehabt hätte. Aber ihn würde sie auch noch in die Flucht schlagen, das war ihr ja schon zuvor gelungen.
Sie wurde erst misstrauisch, als George Short Creek nach Süden hin verließ und sich schließlich mit dem Auto in die Wüste schlug. Ein Verdacht keimte in ihr auf.
„Wohin fahren wir?“, fragte sie beunruhigt.
„Wirst du schon sehen.“
„Ich werde es meinem Vater sagen, wenn du mich schlecht behandelst. Dann kannst du das mit der Hochzeit vergessen.“
„Das glaube ich kaum. Dein Vater ist ja froh, dass ich dich nehmen will.“
Wie vom Donner gerührt sah sie ihn an und sagte nichts mehr. Unruhig beobachtete sie, wie George mit ihr immer tiefer hinein in die Wüste fuhr. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Nur konnte sie rein gar nichts dagegen tun.
Sie starrte einfach vor sich hin und wartete, bis sie schließlich einen einsamen Wohnwagen mitten im Nirgendwo erreicht hatten.
Er würde es wirklich tun. Sie hatte Recht gehabt.
„Was hast du jetzt vor?“, fragte sie nervös, als er den Motor abstellte und schon aussteigen wollte.
„Ich werde dich zur Vernunft bringen“, sagte er, als wäre es das Normalste der Welt. Wie angewurzelt saß sie da, während er die Fahrertür hinter sich zuwarf, und schaute sich fieberhaft um.
Sie waren wirklich mitten im Nirgendwo. Jetzt hatte es keinen Sinn mehr, eine Flucht zu versuchen. Sie konnte nirgends hin. Sie konnte bloß noch versuchen, ihm die Augen auszukratzen.
George öffnete die Beifahrertür und sah sie erwartungsvoll an. Sie rührte sich keinen Millimeter, weshalb er sie grob packte und mit Gewalt aus dem Wagen zerrte.
„Lass mich los, du tust mir weh!“, schrie sie wütend.
„Du willst es ja nicht anders.“
„Du bist ein krankes Schwein!“
Er reagierte gar nicht darauf, sondern zerrte sie zu dem Wohnwagen, schloss die Tür auf und zwang sie dazu, hineinzugehen. Sie wehrte sich nicht, weil sie wusste, dass es zwecklos war.
George schaltete das Licht an und als ihr Blick auf die lange Kette fiel, die an einer Wand befestigt war, wurde ihr kalt.
„Ich will nicht“, stieß sie ängstlich hervor.
„Das hättest du dir vorher überlegen können.“ George gab ihr einen Stoß und brachte sie zu ihrem Entsetzen dazu, genau zu der Kette hinüber zu gehen. Daran waren Handschellen befestigt. Er hielt eine ihrer Hände fest umklammert und machte Anstalten, die Handschellen darum zuschnappen lassen zu wollen. Sie überlegte kurz, ob sie sich wehren wollte, aber sie konnte darauf verzichten, dass er sie noch mal schlug. Gewinnen würde er sowieso.
Schweigend und voller Wut starrte sie ihn an, doch das beeindruckte ihn nicht.
„Du bleibst jetzt so lange hier, bis du ein wenig umgänglicher bist“, sagte er. „Du bist ja nicht das erste Mädchen, das glaubt, mich beeindrucken zu können. Lass dir gesagt sein, das klappt nicht. Alicia war auch mal wie du und jetzt sieh sie dir an. Eine brave, fügsame Ehefrau.“
„Sperrst du mich jetzt hier ein?“, fragte sie ungläubig.
„Das hast du in der Hand. Wirst du brav sein?“
„Du kannst mich mal!“, schrie sie und versetzte ihm einen Stoß. Er sollte bloß machen, dass er wegkam.
Doch das reizte ihn nur. Erneut schlug er ihr ins Gesicht, diesmal traf er ihr Auge. Sie schrie vor Schmerz auf und spürte augenblicklich, wie es anschwoll.
„Du freches kleines Miststück, ich werde dir zeigen, wer hier das Sagen hat!“, brüllte er. „Und das bist nicht du, das verspreche ich dir. In ein paar Tagen werden wir ja sehen, ob du immer noch so ein großes Mundwerk hast.“
„Du kriegst mich nicht klein“, erwiderte sie, während sie mit einer Hand ihr geschwollenes Auge berührte.
„Ich kriege euch alle klein. Und jetzt zieh deine Schuhe aus.“
„Meine Schuhe?“
„Mach schon, oder willst du noch eine Ohrfeige?“
Wollte sie nicht. Zitternd zog sie ihre Schuhe aus, die er ihr sofort mit einer hastigen Handbewegung wegnahm.
„Nur um sicherzugehen. Du bleibst jetzt erst mal hier. Wenn du Durst hast, im Kühlschrank ist Wasser.“
Mit diesen Worten stapfte er aus dem Wohnwagen, machte das Licht aus und warf die Tür hinter sich zu, ehe sie überhaupt wusste, wie ihr geschah. Reglos stand sie da und versuchte zu verstehen, was gerade passiert war.
„George?“, rief sie, doch Augenblicke später wurde der Motor des Geländewagens gestartet und der Wagen fuhr davon.
Sie schluckte. Er meinte das tatsächlich ernst. Sie hatte schon davon gehört, dass andere Frauen so lange weggesperrt worden waren, bis sie sich fügsamer benahmen. Aber das …
Schließlich fing sie sich wieder und warf einen Blick in den Kühlschrank. Darin standen drei Wasserflaschen, aber ansonsten war er leer. Nichts zu essen.
Sie verstand. Er würde sie hungern lassen. Bastard. So leicht bekam man sie nicht klein.
Zumindest hoffte sie das. Sie wusste ja nicht, wann er wiederkam – und was er dann tun würde.
Mittwoch, 3. Februar
„Sie alle sitzen heute hier, weil Sie motiviert sind, auch die grausamsten und komplexesten Vergehen aufzuklären. Profiling hat weder mit Hokuspokus zu tun, noch ist es so eine schillernde Tätigkeit, wie manche Fernsehserien Ihnen weismachen wollen. In der Behavorial Analysis Unit hier in Quantico wälzen wir normalerweise Akten, führen Telefonate, pinnen Fotos an Korkwände und gehen mittags in die Kantine.“
Gelächter erfüllte den Hörsaal. Nick Dormer grinste kurz und blickte genau in Libbys Richtung. Aus seinem Grinsen wurde ein Lächeln, das sie instinktiv erwiderte.
„Meine Aufgabe ist es, Ihnen alles mit auf den Weg zu geben, was Sie für diese Tätigkeit brauchen können. Von grundlegender Bedeutung beim Profiling ist es, nur gesicherte Daten zu verwenden, um sich nicht in Spekulationen zu verlieren. Will heißen: Sie arbeiten mit dem, was der Fall Ihnen liefert. Das können Erkenntnisse sein, die sie am Tatort oder Leichenfundort gewonnen haben – beides muss ja nicht zwangsläufig identisch sein. Das können auch Erkenntnisse von der Spurensicherung sein oder der Obduktionsbericht. Irgendwas, womit Sie arbeiten können, gibt es eigentlich immer. Zentral dabei ist die Frage: Warum hat der Täter ausgerechnet dieses Opfer gewählt? Wer kann mir den Fachbegriff dafür sagen?“
Libby hob ihre Hand. Nick sah es, aber er ließ seine Blicke weiter schweifen und ließ einen der anderen Rekruten zu Wort kommen.
„Viktimologie“, sagte ein junger Mann.
„Richtig.“ Dormer nickte und fuhr fort. Bequem zurückgelehnt saß Libby auf ihrem Platz und hörte ihm zu. Er hatte eine angenehme Art, vor den Rekruten zu sprechen – von ihrer Universität war sie Schlimmeres gewöhnt. Aber sie hatte auch nichts anderes erwartet.
„Die Viktimologie lebt von Informationen über das Opfer. Was kennzeichnete diese Person? Welches Geschlecht hat sie, wie waren ihre Lebensgewohnheiten? War sie kriminell? War sie ein Zufallsopfer? Gehörte das Opfer zu einer Hochrisikogruppe wie etwa Prostituierten? Das alles verrät Ihnen viel. Wissen Sie über das Opfer Bescheid, kommen Sie auch dem Täter näher. Beim FBI tendierten wir für lange Zeit dazu, Täter in zwei Typen einzuteilen: Den organisierten und den unorganisierten Täter. Zwar wissen wir inzwischen, dass das eine zu starke Vereinfachung ist, aber es gibt durchaus Täter, die ihre Taten akribisch bis ins kleinste Detail planen. Das macht es den Ermittlern häufig schwer, sie zu fassen, denn sie sind intelligent. Teilweise interessieren sie sich für die Ermittlungen, manche mischen sich sogar ein. Das sollten Sie immer bedenken, wenn Sie mit vermeintlichen Zeugen konfrontiert werden.“
Bislang lag Libbys Laptop zugeklappt vor ihr auf dem Tisch. Nick erzählte nichts, was sie nicht schon wusste, deshalb verzichtete sie auf Notizen. Langweilig fand sie es dennoch nicht. Der Profiling-Kurs stand noch ganz am Anfang – sie wusste, sie würde hier bald noch eine Menge lernen.
Auch Julie hörte Nick einfach nur zu. Libby linste im Augenwinkel zu ihrer Freundin, die gleich neben ihr saß. Sie würde Nick ewig dankbar dafür sein, dass er ihre Freundin aus England hergeholt hatte und sie nun zusammen die FBI Academy besuchen konnten. Das war nur möglich, weil Nick alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, denn jemanden aus dem Ausland innerhalb von vier Wochen nach Quantico zu holen grenzte schon fast an ein Wunder. Bei der Tochter einer der namhaftesten Profilerinnen in ganz Großbritannien hatte es allerdings funktioniert, denn Andrea Thornton hatte selbst schon mit der BAU zusammen gearbeitet. Man wusste hier, wer Julie war.
Sie hatte erst vor kurzem ihren Master in Kriminologie und Forensischer Psychologie an der Kingston University in London gemacht und gerade überlegt, wie es für sie weitergehen sollte, als die Einladung aus den USA gekommen war. Natürlich hatte sie sofort zugesagt.
Zum FBI gehen konnte sie trotzdem nicht, weil sie keine amerikanische Staatsbürgerin war, aber dass ausländische Staatsbürger die Academy besuchten, war keine Seltenheit. In jeder Klasse waren zehn Prozent der Plätze für Nichtamerikaner reserviert – so schuf man sich Verbündete.
„Essenziell beim Profiling ist es, vorliegende Indizien und Beweise immer wieder neu auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. Haben Sie etwas Neues erfahren, das bisherige Erkenntnisse in einem anderen Licht erscheinen lässt? Gehen Sie alles noch mal durch. In dieser Veranstaltung werden Sie lernen, wie Sie wissenschaftliche Erkenntnisse auf Ihre tägliche Arbeit anwenden. Aus dem Tathergang und weiteren Merkmalen lässt sich oft erstaunlich präzise ableiten, welche Merkmale der Täter hat. Sexuell motivierte Serienmörder etwa morden fast immer in ihrer eigenen ethnischen Gruppe, also verrät Ihnen die Ethnie des Opfers etwas über den Täter. Ein populäres Beispiel für einen Ausnahmetäter ist der Nightstalker – Richard Ramirez hat verschiedenste Opfer getötet und eine seiner Taten sogar satanistisch motiviert erscheinen lassen. Das war selbst für die Profiler damals eine echte Herausforderung.“
Libby stimmte ihm in Gedanken zu. Mit dem Fall des Nightstalkers hatte sie sich bereits ausführlich in den Unterlagen ihrer Mutter beschäftigt. Sadie wusste viel über ihn, weil sie seinerzeit im Fall seines Nachahmers, des Son of the Nightstalker, ermittelt hatte – Brian Leigh, mit dem Libby auch persönlich konfrontiert worden war.
„In dieser Veranstaltung werden Sie viele Fallbeispiele kennenlernen, denn so haben die Urväter unserer Disziplin, Robert Ressler und John Douglas, in den 1970er Jahren begonnen. Sie haben im Gefängnis Täter wie John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, den Son of Sam oder Ted Bundy besucht und mit ihnen gesprochen. Diese Interviews waren es, die ihnen einen tiefen Einblick in die Psyche solcher Täter gewährt haben – und zum Glück sind die meisten von ihnen ja verdammt gesprächig.“ Nick sagte das mit einem gewissen Unterton und hatte prompt die Lacher auf seiner Seite.
„Daraus ging das Crime Classification Manual hervor, mit dem wir heute noch arbeiten, und aufgrund dieser Forschung wissen wir heute, dass es verschiedene Typen von Serienmördern gibt. Holmes und Holmes unterscheiden vier verschiedene Typen: Den visionären Typen, der oft psychotisch agiert und glaubt, dass Stimmen ihm die Taten befehlen. Nummer zwei ist der missionsorientierte Typ, der sich für eine bestimmte Aufgabe berufen fühlt – die Straßen von Prostituierten zu säubern, um ein Beispiel zu nennen. Nummer drei ist der hedonistische Killer, dem es nur um seine eigenen Lust- und Glücksgefühle bei der Tat geht. Dazu gehören die sexuell motivierten Serienmörder. Der vierte Typ ist der machtorientierte Typ, der im wahren Leben wenig zu sagen hat und sich so etwas beweisen will. Welcher Typ, denken Sie, ist der häufigste?“
Libby und Julie hoben gleichzeitig den Arm. Mit einem Lächeln sah Nick in ihre Richtung und nickte Julie zu.
„Sexuell motivierte Serienmörder“, sagte sie.
„Richtig. Wodurch sind sie gekennzeichnet?“ Nun nickte er Libby zu.
„Wer einmal damit angefangen hat, kann oft nicht mehr aufhören. Sie haben oft sehr spezielle Präferenzen bei der Opferwahl und nicht selten sadistische Neigungen. Sie müssen sich von Tat zu Tat steigern, um noch das gleiche Hochgefühl zu erleben.“
„Genau. So erschreckend diese Täter auch agieren mögen – ihre Profile sind meist am einfachsten zu erstellen, denn sie sind ziemlich berechenbar und ähneln sich häufig in Grundzügen.“
Julie hob eine Hand, woraufhin Nick sie aufrief.
„Ich habe eine Frage: Geht es Sexualmördern nicht auch häufig um Macht?“
„Sicher, auch wenn Macht hier nicht das Hauptmotiv ist. Dem sexuellen Sadisten geht es darum, zu beobachten, wie das Opfer leidet. Das ist es, was ihn sexuell erregt. Was Foltermethoden für ihre Opfer angeht, sind diese Täter ja häufig erschreckend kreativ. Umgekehrt morden die machtorientierten Täter in der Hauptsache, um ihr Ego zu stärken. Überschneidungen sind gegeben, aber wenn wir uns hier im Kurs den Fallbeispielen zuwenden und die einzelnen Tätertypen im Detail untersuchen, werden Sie sehen, wo genau der Unterschied liegt.“
Julie nickte, so dass Dormer fortfuhr. „In diesem Kurs werden Sie auch lernen, welche Risikofaktoren dazu führen können, dass jemand zum Serienmörder wird. Desolate Familienverhältnisse, eine gestörte Sexualentwicklung, Alkoholismus, häusliche Gewalt, der Einfluss der Medien – es werden verschiedene Faktoren diskutiert. Ich erkläre Ihnen auch, woran Sie einen Psychopathen erkennen, denn damit werden Sie es sicherlich irgendwann zu tun bekommen. Psychopathie kann angeboren sein, in Gehirnscans wurden teils massive Unterschiede zu den Gehirnen der Probanden aus der Kontrollgruppe festgestellt. Aber das ist auch keine Überraschung: Wer weniger Furcht und Empathie für andere Menschen empfindet, der kann skrupelloser agieren.“
Libby hätte Nick tagelang zuhören können, doch mit Blick auf seine Armbanduhr sagte er: „Für heute sind wir leider schon am Ende, aber ich möchte Sie bitten, sich bis zur nächsten Sitzung intensiv mit einem Täter Ihrer Wahl auseinanderzusetzen. Bitte reichen Sie mir zu Beginn unseres nächsten Termins ein mindestens zweiseitiges Essay über diesen Täter ein. Darin sollten Sie herausstellen, welchem Tätertyp Sie ihn zuordnen und warum. Gute Informationen finden Sie auch in VICAP, mit dem System sind Sie ja bereits vertraut. Vielen Dank.“
Sofort begann es zu rascheln und Gemurmel wurden laut. Die Rekruten packten ihre Taschen und verließen den Hörsaal. Jetzt stand erst mal die Mittagspause an, bevor sie danach zum Ausdauertraining und auf den Schießstand gingen. Libby hatte keine Ahnung, wer es sich ausgedacht hatte, dass man mit vollem Magen im Wald auf der Yellow Brick Road durch den Matsch robben sollte, aber besonders clever fand sie das nicht.
Nachdem sie ihren Laptop eingepackt hatte, wartete sie auf Julie, die ebenfalls ihre Tasche packte, und sagte: „Ich muss Nick noch was fragen.“
„Okay, ich komme mit.“
Beide kannten Nick schon lange, für Libby war er fast so etwas wie ein väterlicher Freund. Ihre Mutter hatte oft mit ihm zusammen gearbeitet oder ihn zumindest um Rat gebeten – und nicht zuletzt hatte Libby ihrer Mum einmal zusammen mit Nick das Leben gerettet. Es war eine Ehre für sie, jetzt von ihm ausgebildet zu werden.
Libby und Julie gingen die Treppe hinunter und gesellten sich zu Nick, der ebenfalls einpackte und sich dabei mit einem anderen Rekruten unterhielt. Als sie fertig waren, lächelte er die beiden jungen Frauen an.
„Schon ein interessantes Bild, wie alle eifrig mitschreiben und ihr beiden zuhört, als würde ich über eure Lieblingsserie sprechen.“
Libby lachte amüsiert. „Du weißt, dass ich die Bücher meiner Mum auswendig kenne.“
„Sicher. Solange ihr euch nicht langweilt …“
„Im Gegenteil“, bekräftigte Julie.
„Was kann ich denn für euch tun?“
„Ich nehme nicht an, dass ich über Rick Foster oder Brian Leigh schreiben darf“, sagte Libby.
„Ich sage dir nicht, was du hier tun oder lassen darfst, nur so viel: Es geht darum, die Methoden des Profiling an einem unbekannten Fallbeispiel auszuprobieren. Mir ist klar, dass du alles über Sexualsadisten weißt, deshalb könntest du dich ja mal mit Harold Shipman, Ted Kaczynski oder Andrew Cunanan beschäftigen – oder vielleicht mit einer Frau? Wie wäre es mit Susan Atkins oder Aileen Wuornos?“
„Gute Idee“, sagte Libby.
„Das gilt natürlich auch für dich“, sagte Nick mit Blick auf Julie. „Kein Jonathan Harold oder Amy Harrow.“
„Nein, schon klar“, erwiderte Julie. „Vielleicht nehme ich wirklich eine Frau.“
„Großartig. Ich freue mich schon auf eure Ergebnisse!“
Die beiden lächelten und verabschiedeten sich. Während sie sich auf den Weg zur Kantine machten, verschwand Nick in die entgegengesetzte Richtung. Libby folgte Julie in die Kantine und studierte den Speiseplan. Erfreut stellte sie fest, dass es Tacos gab. Sie mochte mexikanisches Essen. Zusammen stellten die beiden sich an der Essensausgabe an und Libby griff nach einem Salat.
„Mit deinem ganzen gesunden Essen bekommt man ja ein schlechtes Gewissen neben dir“, sagte Julie, die sich schon einen Joghurt als Dessert geschnappt hatte und gerade in Richtung Pasta spähte.
„Du machst mir Spaß, du musst die Yellow Brick Road ja nicht bestehen“, erwiderte Libby stirnrunzelnd.
„Nein, zum Glück nicht. Das Sportprogramm hier hat es wirklich in sich.“
„Allerdings.“ Libby beobachtete, wie Julie sich einen Teller Pasta holte, während sie zu den Tacos griff. Doch, Tacos waren auch okay.
Beide reihten sich in die Kassenschlange ein und unterhielten sich weiter über die Yellow Brick Road, als plötzlich eine tiefe Stimme von hinten sagte: „Dass du nicht von hier bist, hört man auch.“
Julie drehte sich um und sah dem jungen Mann hinter sich in die Augen. Er überragte sie mindestens um einen Kopf, hatte dunkles Haar und stahlblaue Augen.
„Findest du?“, erwiderte sie.
„Dein Akzent ist sowas von britisch.“
„Okay, du hast mich erwischt.“
Er lächelte breit. „Ich bin Kyle.“
„Julie“, erwiderte sie. „Das ist meine Freundin Libby.“
Kyle schüttelte beiden die Hände. „Sehr erfreut. Vorhin in Dormers Kurs habt ihr nicht ein einziges Wort mitgeschrieben.“
„Nein … Wir sind beide hier, weil wir Profiler werden wollen.“
Überrascht zog er die Brauen in die Höhe. „Ach was. Das wisst ihr schon?“
„Ich habe in England meinen Master in Kriminologie und Forensischer Psychologie gemacht und Libbys Mum war schon Profilerin beim FBI.“
Kyle nickte anerkennend. „Nicht schlecht. Ich habe ja keine Ahnung, was das Bureau mit mir vorhat, wenn ich erst mal fertig bin. Ich hoffe ja, ich komme in irgendeine gute Stadt und nicht irgendwo in ein Nest im Mittleren Westen. Du bist Gaststudentin hier, nehme ich an?“
Julie nickte. „Ich bin Engländerin, ich gehe also nicht zum FBI. Schade eigentlich. Obwohl – wenn ich an die Yellow Brick Road denke …“
„Der Pfad ist mörderisch. Hast du ihn schon ganz geschafft?“
„Noch nicht. Du?“
Während die beiden sich unterhielten, bezahlte Libby schon mal und suchte nach einem Tisch. Sie war nicht überrascht, dass Kyle sie begleitete und sich während des Essens mit Julie unterhielt. Grundsätzlich hätte es sie nicht gestört – Kyle war ziemlich nett Julie schien seine Gesellschaft zu genießen, aber wenn Libby ehrlich war, neidete sie es ihrer Freundin ein wenig. Es hielt ihr deutlich vor Augen, was sie gerade nicht haben konnte.
Schweigend konzentrierte sie sich aufs Essen und dachte an Owen. Zuletzt hatte sie ihn vor Weihnachten gesehen – an ihrem letzten Tag beim San José Police Department. Natürlich hatten die Kollegen sich das Maul darüber zerrissen, wie sie es wohl angestellt hatte, ohne die nötige Berufserfahrung vom FBI genommen zu werden, aber keiner von ihnen wusste von dem Empfehlungsschreiben, das Owen ohne ihr Wissen nach ihrer Zusammenarbeit im Fall Cassidy Maxwell aufgesetzt und nach Quantico geschickt hatte.
Es war nicht, dass Libby ihm dafür nicht dankbar war. Sie war ihm sogar sehr dankbar. Sie bereute jetzt aber, dass sie vor ihrem Umzug kein einziges Mal mit ihm ausgegangen war.
Sie hätte es tun sollen. Jetzt war sie seit fünf Wochen in Quantico und dachte immer noch ständig an ihn. Das wurde auch nicht dadurch besser, dass er ihr in regelmäßigen Abständen schrieb und sich erkundigte, wie es ihr ging. Ob es ihr in der Academy gefiel. Wie es war, das alles zusammen mit einer Freundin zu bestreiten. Und jedes Mal, wenn sie wieder eine Nachricht von ihm bekam, spürte sie, dass sie echte Gefühle für ihn hegte.
Vor ihrem Umzug hatte sie nicht mit ihm ausgehen wollen, um sich und ihm keine Hoffnungen zu machen. Es war ja nicht bloß, dass sie zur Academy ging – sie wollte in Quantico bei der BAU bleiben. Knapp dreitausend Meilen entfernt von San José, wo Owen eine gute Position als Detective bekleidete.
Sie wusste, dass er interessiert an ihr war. Er hatte es ihr deutlich gezeigt und das tat er auch immer noch, indem er ihr regelmäßig schrieb. Häufiger als ihr Ex-Freund Kieran, der seinen Traumjob in Seattle angetreten hatte und laut seiner Aussage wahnsinnig glücklich damit war. Das freute Libby, die nun ebenfalls ihren Traum vom FBI leben konnte – aber sie hatte Owen verloren.
Vor drei Wochen hatte sie schon einen schwachen Moment gehabt und ihm nachts im Bett vorm Schlafengehen nur einen Satz geschrieben: Du fehlst mir. Danach hatte sie wie hypnotisiert auf ihr Handy gestarrt und seine Antwort abgewartet. Die war prompt gekommen: Du mir auch. Sehr sogar.
Das machte es nicht besser. Sie hatte dann bedauert, dass Quantico so weit von San José entfernt war und er hatte geantwortet: Leider. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei dir.
Mehr hatten sie darüber nicht geschrieben. Es war illusorisch, das wussten sie beide. Aber es versetzte Libby einen heftigen Stich ins Herz.
In diesem Moment hätte sie Julie und Kyle den Hals umdrehen können, denn die beiden verstanden sich bestens. Sie war schon fast froh, als Kyle nach dem Essen von einem anderen Rekruten angesprochen wurde und beschloss, ihn zu begleiten.
„Wir sehen uns später. Hat mich sehr gefreut.“
„Mich auch“, erwiderte Julie, während Libby bloß gequält lächelte. „Wir sehen uns!“
Gedankenverloren blickte sie Kyle hinterher, während Libby ihr Glas leerte und die Arme vor der Brust verschränkte.
„Was machst du denn für ein Gesicht?“, fragte Julie besorgt.
„Ach, nichts.“
„Sag schon.“
Libby seufzte tief. „Es ist ja nichts Neues. Gerade musste ich an Owen denken und versuche die ganze Zeit, mir zu sagen, dass es kein Fehler war, nach Quantico zu gehen.“
„Oh nein, nicht doch. Natürlich war das kein Fehler! Er hat dich doch empfohlen, er wollte das.“
„Ja, warum auch immer. Ich kriege ihn einfach nicht aus dem Kopf, verdammt noch mal!“
Mitfühlend legte Julie einen Arm um ihre Schultern. „Vielleicht findet sich eine Möglichkeit.“
Libby brummte nur missfällig. Daran glaubte sie nicht wirklich.
Donnerstag, 4. Februar
Während sie durch den Wald rannte, musste Libby an Jodie Foster denken, die als angehende FBI-Agentin Clarice Starling in der legendären Anfangssequenz des Films „Das Schweigen der Lämmer“ auch diesen Pfad gelaufen war.
Der Film war älter als Libby selbst, aber sie hatte ihn einmal in der Filmsammlung ihrer Eltern entdeckt und zum ersten Mal angesehen, noch bevor sie beschlossen hatte, auch zum FBI zu gehen. Seitdem hatte sie ihn mehrmals gesehen, weil Sadie gesagt hatte, dass er die FBI-Arbeit gar nicht so unrealistisch darstellte. Libby konnte das inzwischen bestätigen. Die Yellow Brick Road hatte im Film ziemlich anstrengend, nervtötend und schmutzig ausgesehen – und genau das war sie auch. Drei Meilen ging es durch einen Wald in Virginia, über Hürden, Kletternetze, Abhänge hinauf und hinunter, durch einen Bachlauf und am Schluss drei weitere Meilen einfach nur geradeaus, um zu beweisen, welch langen Atem man hatte.
Die Rekruten liefen den Pfad am Ende ihrer Ausbildung an der Academy in der Gruppe, aber um sich nicht bis auf die Knochen zu blamieren, hatte Libby sich fest vorgenommen, jede Woche mindestens einmal die ganze Strecke zu laufen, um ein wenig zu trainieren. Sie beneidete Julie, die zwar auch mitlaufen würde, für die es aber nicht extrem peinlich wurde, wenn sie den Pfad nicht schaffte. Libby war danach jedes Mal völlig erledigt und reif für die Dusche.
Während sie sich an einem Sicherungsseil festhielt und eine felsige Klippe emporkletterte, verfluchte sie ihre Entscheidung, an die National Academy zu gehen. Blöde Idee. Was hatte sie sich dabei gedacht?
Es war ein kühler, bewölkter Tag. Sie fror zwar nicht, aber die Luft war so kalt, dass es in der Lunge weh tat. Vor lauter Anstrengung hatte sie inzwischen einen widerlichen Blutgeschmack im Mund. Als sie endlich oben angekommen war, blieb sie kurz vornübergebeugt stehen, stemmte die Arme gegen die Oberschenkel und atmete tief durch. Den Hindernispfad im Wald hatte sie zu zwei Dritteln geschafft, aber ihre Knie waren längst weich. Sie war jetzt schon seit gut vierzig Minuten unterwegs. Wie sollte sie denn den Rest in einer akzeptablen Zeit schaffen? Alles, was über einer Stunde lag, war blamabel.
Als sie wieder halbwegs Energie hatte, rannte sie weiter. Bald hatte sie das aufgespannte Kletternetz erreicht, hangelte sich daran hoch und ließ sich auf der anderen Seite herab gleiten. Marines hatten diesen Folterpfad irgendwann für angehende FBI-Agenten erschaffen. Sadisten.
Aber Libby wusste, dass man als FBI-Agent topfit sein musste. Das war nicht bloß eine Behauptung. Die Narben und Geschichten ihrer Eltern hatten es bestätigt.
Also Schluss mit Jammern. Sie rastete wieder kurz und rannte dann weiter. Vielleicht reichte einmal die Woche trainieren auch einfach nicht.
Sie kletterte über eine Hürde und spürte, wie ihre Kleidung ihr am Leib klebte. Wenig später hatte sie den Hindernisparcours geschafft und musste nur noch drei Meilen weit laufen. Nur.
Als sie es endlich geschafft hatte, zeigte die Uhr an ihrem Handgelenk fast anderthalb Stunden. Mist. Sie musste wirklich besser werden.
Mit wackligen Beinen stakste sie in die Unterkünfte zurück, hatte sich ein Handtuch um den Hals gelegt und versuchte, die an ihrer verschwitzten Stirn klebenden Haare zu ignorieren. Sie stank bestimmt nach Schweiß.
Frustriert betrat sie ihr Zimmer und fand Julie am Schreibtisch vor ihrem Laptop. Ihre Freundin drehte sich um und zog überrascht die Brauen hoch.
„Oh Mann. Du siehst ja aus.“
„Ich hasse es“, knurrte Libby und streifte sich die Schuhe ab, ohne überhaupt die Schleifen zu lösen.
„Ich habe auch Respekt davor.“
„Du bist das doch noch gar nicht ganz gelaufen.“
„Nein, und wenn ich dich so sehe, vergeht mir auch die Lust …“
Libby erwiderte nichts, sondern riss sich vor dem Bad die verschwitzte Kleidung vom Leib, ließ alles am Boden liegen und verschwand unter der Dusche. Das tat gut. Während das warme Wasser über ihren Körper lief, wurde ihr klar: Sie hätte es schlimmer treffen können: Yellow Brick Road im Sommer. Das war ganz bestimmt der Overkill.
Sie wusch sich den Schweiß ab und kam langsam wieder zu Kräften. Als sie schließlich nur in ein Handtuch gewickelt und noch mit leicht feuchten Haaren zurück ins Zimmer ging, lächelte Julie.
„Na, geht es wieder?“
Libby nickte. „Jetzt ist es besser.“
Mit diesen Worten wühlte sie in ihrem Kleiderschrank herum und holte frische Sachen heraus. Neugierig blieb sie hinter Julie stehen und spähte über ihre Schulter.
„Aileen Wuornos“, sagte sie. „Du nimmst tatsächlich eine Frau.“
„Ja, die Idee hat mir gefallen. Gibt ja wirklich nicht allzu viele.“
„Nein, und von ihrem Typ schon gar nicht. Wo ordnest du sie ein?“
„Sie war eine machtorientierte Serienmörderin“, sagte Julie. „Überleg mal, sie wurde für die Morde an sechs Männern zum Tode verurteilt. Wenn man sich ihre Biografie anschaut, ist es ziemlich offensichtlich. Ihr Vater saß zum Zeitpunkt ihrer Geburt im Gefängnis und sie war vier Jahre alt, als ihre Mutter sie und ihren Bruder verlassen hat. Sie wurde schon als Kind von Familienmitgliedern vergewaltigt und hat mit fünfzehn das Kind ihres Bruders bekommen. Wenig später war sie obdachlos und hat sich fortan als Prostituierte durchgeschlagen. Das Leben hatte nur Scheiße für sie übrig, um es mal so zu sagen. Sie hat in Bars Streit gesucht und sich mit ihren Freiern angelegt. Irgendwann war ihr Hass auf die Welt so groß, dass sie es einfach nur noch allen zeigen wollte. Also hat sie ihre eigenen Freier erschossen und ausgeraubt.“
Libby nickte zustimmend. „Klingt logisch.“
„Wen nimmst du?“
„Ted Kaczynski, den Unabomber. Es ist vielleicht nicht schwierig, ihn zuzuordnen – er ist der missionsorientierte Typ. Ich finde den Fall aber wahnsinnig spannend.“
„Ist er auch“, stimmte Julie ihr zu. Libby hatte ihr Essay schon am Vorabend begonnen, sich dann aber so in der Recherche verloren, dass sie es noch nicht fertiggestellt hatte. Das war aber nicht schlimm, sie brauchte es erst am nächsten Tag.
Der University and Airline Bomber oder kurz Unabomber Ted Kaczynski hatte zwischen 1978 und 1995 sechzehn Briefbomben verschickt, die insgesamt drei Todesopfer und über zwanzig Verletzte gefordert hatten. Die Ermittlungen des FBI hatten über 50 Millionen Dollar gekostet und waren jahrelang mit einem gigantischen Aufwand betrieben worden, bis Kaczynski 1995 sein Unabomber-Manifest an zwei Zeitungen verschickt und angeboten hatte, mit dem Verschicken von Bomben aufzuhören, wenn das Manifest gedruckt würde. Daraufhin hatte sein eigener Bruder ihn anhand des Textes identifiziert und die Ermittler verständigt, die einen hochintelligenten Sonderling in seiner Hütte in Montana vorgefunden und festgenommen hatten.
Der Doktor der Mathematik hat einen IQ von 165, entschloss sich aber nach seiner Zeit an der Universität, als Selbstversorger und Einsiedler in Montana zu leben, weil ihm die zivilisierte Gesellschaft zuwider war. Sein Hass auf die Technologie und die moderne Gesellschaft nach der industriellen Revolution äußerte er im Verschicken von Bomben an Personen, die für ihn all das verkörperten, was er ablehnte.
Kaczynski zu nehmen war vielleicht nicht besonders kreativ, aber Nick hatte ihn ihr selbst vorgeschlagen, weil er wenig mit Sadisten zu tun hatte. Libby fand den Fall jedoch so interessant, dass es ihr nicht schwer fiel, darüber etwas zu schreiben.
Vorher war es jedoch an der Zeit für das Abendessen. Libby ging ins Bad, um sich umzuziehen. Sie war noch nicht ganz fertig, als sie ein Klopfen an der Tür ihres gemeinsamen Zimmers hörte und sich schnell den Pullover überzog. Julie ging zur Tür und Libby spähte aus dem Bad, während Julie die Tür zum Flur öffnete. Davor stand Kyle.
„Oh, hi“, begrüßte Julie ihn überrascht.
„Ich war gerade auf dem Weg zum Abendessen und wollte mal fragen, ob du Lust hast, mich zu begleiten.“
Julie lächelte. „Oh, das ist ja nett. Gerne. Libby?“
„Bin fertig“, sagte Libby und verließ das Bad. „Hi, Kyle.“
„Hi“, erwiderte er.
Libby und Julie zogen ihre Schuhe an und verließen das Zimmer. Kyle musterte Libby interessiert. „Du warst auf der Road.“
Libby nickte. „Sehe ich so zerstört aus?“
Darüber musste er lachen. „Nein, ich habe dich vorhin von dort aus dem Wald kommen sehen. Ist echt eine harte Strecke. Ich bin sie bislang zweimal gelaufen.“
„Oh, und ich dachte, ich wäre faul …“
Er grinste breit. „Nein, mich übertrifft man da so schnell nicht.“
Libby musterte ihn von Kopf bis Fuß, während sie die Treppe hinab liefen. „Dabei bist du doch gut gebaut.“
Überrascht zog er die Brauen hoch. „Du bist ganz schön direkt.“
Libby zuckte mit den Schultern. „Keine Angst, ich komme euch beiden schon nicht in die Quere.“
Kyle blickte verlegen zu Julie, die bloß lachte. „Libby hat eine große Klappe, da gewöhnst du dich dran.“
„Na ja, wenn ihre Mum schon beim FBI war …“
„Ihr Dad auch. Liegt bei ihr sozusagen in der Familie.“
„Wow. Und deine Mum ist auch Profilerin … vor euch muss man sich ja richtig in Acht nehmen.“
„Ach, wir sind ganz lieb. Oder, Libby?“
Während sie die Kantine betraten, nickte Libby. „Völlig. Außer bei Serienmördern.“
Kyle lachte. „Klingt so, als würdest du welche kennen.“
„Ja, ist aber schon eine Weile her.“
„Ernsthaft?“ Kyle machte große Augen.
„Ja, Brian Leigh, den Son of the Nightstalker. Den hat ein Freund meiner Mum, der beim FBI SWAT war, erschossen.“
„Okay … und ich dachte, ich hätte einen krassen Background.“
„Wieso, was hast du denn gemacht? Du hast gestern nur erzählt, dass du beim Chicago PD warst.“
„Ja, in der Gang Unit. Chicago hat ja ein gewisses Problem mit Gangs … und ich war dort auch schon einige Male undercover.“
„Cool“, sagte Libby.
„Cool?“, fragte Julie erstaunt. „Was ihr Amerikaner so cool findet.“
Das Gespräch wurde unterbrochen, weil sie sich etwas zu essen holten und nacheinander bezahlten, aber als sie zusammen am Tisch saßen, nahm Kyle das Gespräch wieder auf. Er zog den Ausschnitt seines Pullovers so weit zur Seite, dass man unterhalb seines Schlüsselbeins eine alte Schussnarbe sehen konnte.
„Angeschossen wurdest du also auch schon“, stellte Libby fest.
Er nickte. „Ich habe den Job trotzdem immer gern gemacht.“
„Würdest du so etwas beim FBI auch weiterhin machen wollen?“, fragte Julie.
„Schon, ja. Vielleicht. Je nachdem, wo ich so lande … Und was hast du vor, wenn du hier fertig bist? Gehst du zurück nach England?“
Julie zuckte mit den Schultern. „Ich weiß es nicht, drüben hat man als Profiler nicht dieselbe Bedeutung wie hier. Aber da ich keinen amerikanischen Pass habe, kann ich hier nicht zu den Ermittlungsbehörden gehen.“
„Könntest du denn hier nicht anders als Profiler arbeiten?“
„Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich mag die USA wahnsinnig gern und möchte unbedingt bleiben.“
Kyle lächelte. „Das wäre ja schön.“
„Ich habe im Herbst mein Studium beendet und war gerade dabei, mich zu orientieren. In England habe ich mich schon an den entsprechenden Stellen beworben und hatte auch hier in Quantico angefragt, wie das laufen würde. Ich wollte auf jeden Fall zur Academy gehen – am liebsten mit Libby zusammen, aber ich dachte, dass sie die nötige Berufserfahrung noch nicht hat und habe mich deshalb nicht offiziell beworben. Als Antwort kam dann aber gleich eine Einladung zurück und Nick Dormer hat mir geschrieben, dass Libby doch schon zur Academy geht. Und so sind wir jetzt beide hier.“
„Ist ja stark. Ihr kennt SSA Dormer?“
Julie nickte. „Er hat schon mit meiner und mit Libbys Mum zusammengearbeitet.“
„Das ist toll, wirklich. Man muss Glück haben, um hier genommen zu werden.“
„Oder gut sein“, sagte Libby. „Gang Unit in Chicago spricht ja sehr dafür, dass du es drauf hast.“
Kyle grinste. „Und du? Haben sie für dich eine Ausnahme gemacht?“
Libby überlegte erst, was sie antworten sollte, aber dann nickte sie. „Nach einem Empfehlungsschreiben eines Detectives beim San José PD, ja. Mir fehlten eigentlich noch anderthalb Jahre bei der Polizei.“
„Wow. Ich war jetzt fünf Jahre Polizist in Chicago. Was hast du denn angestellt, dass der Detective dich empfohlen hat?“
„Ich habe ihm das Leben gerettet“, sagte Libby nach kurzem Zögern und versteckte sich hinter ihrem Essen.
„Ach komm, erzähl doch mal. Das klingt nach einer tollen Geschichte.“
Libby zuckte mit den Schultern. „Na ja, die Typen, gegen die wir ermittelt haben, haben uns erwischt. Sie haben erst unsere verdeckten Ermittler erschossen und dann schnappte die Falle zu. Sie wollten uns beide umbringen, meinen Partner zuerst … und weil ich keine kugelsichere Weste mehr trug, hatte ich eine Chance, die Kerle anzugreifen. Ich beherrsche Kampfsport.“
„Jetzt erzähl schon die ganze Geschichte“, sagte Julie. „Die waren zu dritt, zwei waren bewaffnet und du hast Handschellen getragen.“
Kyle machte große Augen. „Ernsthaft?“
Libby nickte. „Am Ende hatte ich beide Waffen und zwei von ihnen waren tot.“
„Verstehe. Wenn der Detective das dem FBI geschildert hat, haben die sicher eingesehen, dass du keine zwei Jahre Berufserfahrung mehr sammeln musst …“
„Sieht so aus“, erwiderte Libby wortkarg.
„Nicht dein Lieblingsthema?“, fragte Kyle überrascht.
„Sie vermisst den Detective“, erwiderte Julie grinsend.
„Ah.“ Kyle grinste wissend. Libby beschloss, nichts dazu zu sagen, sondern starrte auf ihr Essen. Ja, sie vermisste Owen wahnsinnig. Die Art und Weise, wie Kyle Julie ansah, erinnerte sie an Owen. Er hatte sie auch manchmal so angesehen.
War es ein Fehler gewesen, zu gehen? Ja, sie hatte immer davon geträumt, Profilerin beim FBI zu werden. In der Behavioral Analysis Unit. Es hatte also keine Möglichkeit gegeben, an der Westküste zu bleiben.
Aber sie hatte es an ihren Eltern gesehen: Einen Partner zu haben, auf den man sich immer verlassen konnte, war so wahnsinnig viel wert – und bei Owen hatte sie dieses Gefühl gehabt. Da hatte sie sich angenommen und unterstützt gefühlt. Warum nur war die BAU in Quantico?
Sie hätte gern ausprobiert, ob ihr Gefühl sie trog. Vielleicht war es auch nur das Extreme an der Situation gewesen, das sie so für Owen hatte empfinden lassen.
Aber sie wusste, dass das nicht stimmte. Sie und Owen hatten sich zueinander hingezogen gefühlt und Owen hatte ein wahnsinniges Opfer gebracht, indem er ihr den Weg zum FBI geebnet hatte.
„Kino klingt gut.“ Julies Stimme holte Libby in die Wirklichkeit zurück. „Zwar möchte ich am liebsten wie ein Murmeltier am Wochenende schlafen, aber vielleicht schaffe ich es ja für eine Weile aus dem Bett …“
Kyle grinste. „Ich muss am Samstag auch noch trainieren und eine Ausarbeitung schreiben. Die gehen ja hier nicht davon aus, dass man sich am Wochenende auf die faule Haut legt.“
Während die beiden sich weiter unterhielten und offensichtlich voll auf einer Wellenlänge lagen, aß Libby auf und verließ den Tisch bald.
„Bin schon mal oben“, sagte sie zu Julie, die überrascht protestieren wollte, es dann aber doch nicht tat. Libby wollte ihr und Kyle den nötigen Freiraum lassen und die beiden nicht mit ihrer Trauermiene nerven.
Nein, sie hatte es immer noch nicht geschafft, Owen zu vergessen. Vielleicht würde sie es auch nicht. Auf ihrem Zimmer angekommen, setzte sie sich aufs Bett und griff nach ihrem Handy. Sie hatte ihren Nachrichtenverlauf mit ihm schon offen und überlegte, ihm zu schreiben, doch dann tat sie es nicht. Wenn sie ihm jetzt schrieb, dass sie ihn furchtbar vermisste und er auch noch entsprechend antwortete, war es ganz aus. Nein, gerade wäre es falsch gewesen, den Kontakt zu ihm zu suchen. Das hätte ihr nur vor Augen geführt, was sie nicht haben konnte.
Stattdessen setzte sie sich an ihren Laptop und öffnete das Essay über Ted Kaczinsky. Vielleicht half das dabei, sich abzulenken.
Sie hatte schon zwei Absätze geschrieben, als die Tür aufging und Julie hereinkam. Sie hatte einen zufriedenen Gesichtsausdruck, der aber sofort verschwand, als sie Libby ansah.
„Warum bist du vorhin abgehauen?“, fragte sie.
„Sah so aus, als wärt ihr prima ohne mich zurechtgekommen.“
„Schon, ja … er hat ein wenig mit mir geflirtet. Ich mag ihn. Er findet dich aber auch nett, glaube ich.“
„Klar, aber interessiert ist er an dir. Ist auch okay so. Er kann nichts dafür, dass unser Land so beschissen groß und Owen so weit weg ist.“
„Sag es ihm, Libby.“
„Und wie würde das helfen? Er hat sein Leben in San José.“
„Es macht mich fertig, dich so zu sehen.“
„Da muss ich jetzt durch. Aber es ist okay, wenn du dir Kyle angelst. Er ist in Ordnung.“
„Ist er“, sagte Julie und grinste.
Freitag, 5. Februar
Entschlossen zielte Julie und schoss. Libby, die schon fertig mit ihrer Trainingseinheit war, beobachtete sie zusammen mit Kyle und nickte anerkennend, als Julie auch fertig war.
„Nicht schlecht“, sagte Kyle, während Julie ihre Waffe sicherte und das Magazin herausnahm.
„Danke“, erwiderte sie verhalten.
„Doch, wirklich. Dafür, dass du in England noch nie eine Waffe in der Hand hattest, machst du das echt gut.“
Julie lächelte. „Danke. Lieb von dir.“
„Sehen wir uns später?“
Unsicher blickte Julie zu Libby, die sich ganz unbeteiligt gab. „Ja, vielleicht.“
„In Sam’s Inn unten in Quantico kann man gut was trinken gehen.“
„Okay. Wir werden sehen.“
„Meld dich einfach.“
Julie nickte Kyle zu, der zu seinen Freunden ging. Libby wartete kurz, bis Julie sie eingeholt hatte, und machte sich dann auf dem Weg zum Ausgang des Schießstandes.
„Ich muss nicht gehen“, sagte Julie, während sie die Tür aufstieß und die beiden ins Freie traten. Es war immer noch bewölkt und kühl, deshalb zog Libby ihre Sweatjacke fester um den Körper und verschränkte die Arme vor der Brust. Ein kalter Wind wehte ihr um den Kopf.
„Doch, mach ruhig.” Libby sah keine Veranlassung, dass Julie den Abend unbedingt mit ihr verbringen sollte. Die beiden liefen die Stufen hinab, um auf den Weg zu den Unterkünften zu gelangen, als Libbys Blick die Gestalt eines Mannes streifte, der am Fuß der Treppe stand und die Hände in seinen Jackentaschen vergraben hatte. Erst glaubte sie an Einbildung, aber dann schaute sie noch einmal genauer hin und blieb wie angewurzelt stehen.
Es war Owen. Er hatte sie bereits bemerkt und lächelte, während Libby nicht wusste, wie sie reagieren sollte. Jetzt hatte sie schon Wahnvorstellungen.
Nun blieb auch Julie stehen. „Was ist los?“
Als Libby nichts erwiderte, folgte sie ihrem Blick und lachte kurz. „Ich glaub, ich spinne.“
Owen löste sich aus seiner Starre und ging langsam auf die beiden zu. „Hey.“
Libby schluckte und musterte ihn erneut. Er wirkte fremd in der dicken Winterjacke. An seinem Gürtel fiel ihr eine unbekannte Dienstmarke auf.
Als Julie zu Libby blickte, lachte sie erneut. „Ist da einer zu Hause bei dir?“
„Überraschung“, sagte Owen und blieb vor Libby stehen.
In diesem Moment begriff sie, dass das keine Einbildung war und rannte die drei Stufen hinab auf ihn zu, um ihm um den Hals zu fallen. Sie umarmte ihn so stürmisch, dass er kurz ins Taumeln geriet, aber dann erwiderte er ihre Umarmung fest. Einen Arm hielt er um ihre Taille geschlungen, während er die andere Hand auf ihren Kopf gelegt hatte und über ihr Haar strich.
Libby konnte es nicht fassen. Ihn jetzt wirklich zu spüren, machte es echt. Plötzlich kam auch die Freude. Ein Zittern überlief sie und Tränen stiegen ihr in die Augen, dann schloss sie die Augen und hoffte, ihn nie wieder loslassen zu müssen.
Owen schwieg, während er sie im Arm hielt und sie versuchte, nicht die Fassung zu verlieren. Erst, als sie sich langsam von ihm löste, sah er sie mit einem sanften Lächeln an und sagte: „Ich habe mich so darauf gefreut, dich zu sehen.“
„Du hättest ja mal was sagen können! Was machst du hier? Und was ist das?“ Libby tippte mit den Fingern auf seine Dienstmarke.
„Hier.“ Owen nahm sie ab und drückte sie Libby in die Hand. Washington Metropolitan Police Department. Ungläubig sah Libby ihn an.
„Ist das deine oder wie?“
Er nickte grinsend. „Ich bin seit Anfang der Woche hier.“
„Wie, du bist hier? In Washington?“
„Ja, ich bin jetzt Detective beim MPDC. Ich habe eine Wohnung in Arlington. Am Wochenende bin ich umgezogen.“
Libbys Augen wurden immer größer. „Du bist was?“
Jetzt lachte Owen. „Ich bin hierher gezogen. Ich habe beim SJPD gekündigt und eine Stelle als Detective hier in Washington bekommen.“
Libby war fassungslos. Sie wusste nicht, was sie erwidern wollte, sondern starrte nur wieder auf die Dienstmarke in ihrer Hand.
„Ich wollte die ganze Woche schon herkommen, aber es war immer schon so spät, als ich aus dem Büro gekommen bin, in meiner Wohnung funktioniert noch nichts wirklich und der Verkehr stadtauswärts über den Freeway ist mörderisch. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, deshalb habe ich es leider jetzt erst geschafft. Aber ich wollte dich überraschen, Libby. Deshalb habe ich dir nichts gesagt. Ich wusste nicht, ob es klappt und ich wollte nicht, dass du enttäuscht bist, wenn nicht …“
Sprachlos sah sie ihn an und schüttelte den Kopf. Sie suchte nach Worten und gestikulierte hilflos, dann sagte sie: „Warum hast du das gemacht?“
Owen legte seine Hand auf ihre, in der sie seine Dienstmarke hielt. „Deinetwegen natürlich.“
Dazu fiel ihr nichts ein. Ihre Lippen bebten und ihr schossen Tränen in die Augen. Wortlos fiel sie ihm erneut um den Hals und schloss ihn fest in die Arme. Zwar schaffte sie es jetzt nicht mehr, die Tränen zurückzuhalten, aber das war ihr gleich.
Beruhigend strich Owen ihr über den Rücken. „Tut mir leid. Ich hatte mir deine Reaktion etwas anders vorgestellt … Ich wollte dich nicht erschrecken.“
Libby lachte unter Tränen. „Du bist vollkommen verrückt, Owen Young! Was hast du dir dabei gedacht?“
„Selten hat sich etwas so gut angefühlt“, erwiderte er achselzuckend. Libby ließ ihn kurz los, aber dann zögerte sie nicht länger und drückte ihm einen Kuss auf die Lippen. Owen grinste und griff nach ihrer Hand, während er ihren Kuss nur zu gern erwiderte.
Libby war so außer sich, dass noch mehr Tränen kamen. Unwillig wischte sie sie weg und rang nach Luft. „Tut mir leid, das sieht total bescheuert aus … aber ich freue mich so.“
Owen lächelte. „Ich weiß. Schon gut.“
„Ihr seid der Hammer“, sagte Julie von hinten. „So etwas habe ich ja noch nie gesehen.“
„Du musst Julie sein“, sagte Owen.
„Eilt mir mein Ruf voraus?“
Er lachte kurz. „So ungefähr. Nein, Spaß beiseite – Libby hat mir letztens geschrieben, dass sie dich um deine Locken beneidet. Du musstest es sein. Außerdem hört man deinen Akzent.“
„Ja, das höre ich hier dauernd.“
„Ich mag ihn.“
Julie grinste und sagte dann: „Ich bin froh, dass du da bist, Owen. Libby hatte wirklich Liebeskummer deinetwegen.“
„Ach so?“
„Du bist so gnadenlos“, sagte Libby zu Julie, bevor sie sich Owen wieder zuwandte. „Ich dachte ja, ich kriege dich irgendwie aus dem Kopf, wenn ich erst hier bin. Viel zu tun und so … Aber es hat nicht geklappt. Ich musste die ganze Zeit an dich denken und habe versucht, nicht zu bereuen, dass ich hergekommen bin.“
„Ach du liebe Güte. Hätte ich das gewusst …“
„Du bist total verrückt, Owen. Dass du das wirklich gemacht hast!“
Er zuckte mit den Schultern. „Mir ging es ähnlich wie dir. Ich saß in San José und habe mich für die geniale Idee beglückwünscht, dich selbst im Eilverfahren nach Quantico zu schicken … Ich hatte auch überlegt, dich noch um ein Date zu bitten, habe das dann aber auch für keine gute Idee gehalten. Doch als wir uns an deinem letzten Tag gesehen haben, dachte ich, dass ich wirklich einen Fehler mache, wenn ich dich gehen lasse. Andere Departments haben auch schöne Jobs, dachte ich … und tatsächlich haben sie in Washington gerade einen Detective gesucht.“
„Und offensichtlich hast du genau diesen Job bekommen.“
„Ja, unter anderem wegen unseres gemeinsamen Falles. Ich hatte einfach totales Glück. Das habe ich in den vergangenen vier Wochen gemacht – mich beworben, gekündigt, den Umzug durchgezogen. Und ich wollte dich hier überraschen.“
„Das ist dir auch gelungen!“
Er lächelte und sah ehrlich fröhlich dabei aus. Das zu sehen, machte Libby glücklich. Ohnehin fühlte sie sich gerade so gut wie lange nicht mehr.
Sie wandte sich an Julie. „Wenn du heute Abend mit Kyle weggehen willst, mach das. Ich habe jetzt auch eine Verabredung, glaube ich …“ Grinsend blickte sie zu Owen.
„Klar, mache ich. Wir sehen uns ja bestimmt auch noch mal“, sagte Julie zu Owen.
„Sicher. Ich freue mich drauf.“
Julie winkte und machte sich eilig auf den Weg zu ihrem Zimmer. Verlegen blieb Libby neben Owen stehen und gab ihm seine Dienstmarke zurück, dann sah sie ihn nachdenklich an und lächelte zaghaft.
„Dass du das einfach gemacht hast.“
Owen zuckte mit den Schultern, als wäre nichts dabei. „Ich musste. Da war etwas zwischen uns, das haben wir beide gespürt. Ich glaube, wir wollten es uns nur nicht eingestehen, weil du hierher wolltest.“
Libby nickte. „Ich hätte das nie von dir verlangt.“
„Ich weiß, aber ich wollte es einfach. Überleg mal, wie großartig das ist – Detective in Washington. Ich arbeite jetzt in der Nähe des Capitols. Ich habe es noch keine Sekunde bereut.“
„Ich kann das trotzdem nicht fassen.“
„Ich wusste, das hat alles nur eine Chance, wenn ich das einfach tue. Ich habe noch nie für jemanden empfunden wie für dich und deshalb wusste ich, dass ich es bereue, wenn ich dich ziehen lasse.“
„Danke …“ Erneut umarmte Libby ihn und küsste ihn anschließend. Sie legte die Arme auf seine Schultern, schloss die Augen und schenkte ihm einen tiefen Kuss. Hinter ihnen wurde Gejohle laut, einige andere Rekruten kamen gerade vom Schießstand und hatten sie entdeckt. Libby machte nur eine Handbewegung, um ihnen zu signalisieren, dass sie bloß verschwinden sollten, aber Owen ließ sie trotzdem los und sagte: „Das ist nicht der richtige Ort, ich will nicht, dass du dir irgendwas anhören musst.“
Sie nickte bloß und fragte: „Wie bist du überhaupt durch den Checkpoint gekommen?“
„Meine Dienstmarke ist ziemlich nützlich …“ Er grinste.
„Scheint so.“
„Ich weiß, wenn wir uns sehen wollen, muss ich herkommen, aber das ist kein Problem.“
„Wenn du das sagst.“
„Jetzt bin ich bloß noch eine Autostunde von dir entfernt. Das ist ja nichts.“
„Also … wir könnten auch in Quantico was trinken gehen, wenn du möchtest. Oder wir gehen hier spazieren … oder auf Julies und mein Zimmer. Sie wird ja gleich weg sein.“
„Entscheide du. Mir reicht es gerade völlig, in deiner Nähe zu sein.“
Libby strahlte und griff nach seiner Hand. „Am liebsten wäre ich gerade allein mit dir. Wer weiß, wen wir noch alles sehen, wenn wir nach Quantico gehen.“
„Ganz wie du magst.“
Libby nickte und ging voran zu den Unterkünften. Owen folgte ihr und seufzte, während er seinen Blick über alles schweifen ließ.
„Das hätte ich auch gern gemacht“, murmelte er.
„Sag das nicht. Sechs Meilen durch den Wald rennen ist nicht so lustig, wie es sich anhört.“
„Ich weiß. Das hätte ich trotzdem in Kauf genommen.“
„Es wäre auch toll, wenn du jetzt dabei wärst.“
„Ich bin trotzdem in der Nähe. Wir können uns immer sehen. Und wenn du erst mal fertig mit der Academy bist, sehen wir weiter.“
„Na, du hast dir ja schon Gedanken gemacht …“
„Ach, irgendwie sind die Pferde mit mir durchgegangen. Ich will dich nicht bedrängen, vergiss das nicht.“
„Tust du nicht. Alles gut.“
Owen lächelte und hielt ihr die Tür auf, als sie die Unterkünfte erreicht hatten. Libby bedankte sich bei ihm und ging voraus zu ihrem Zimmer. Unterwegs begegneten ihnen noch mehrere Rekruten und Julie, die gerade das Zimmer verlassen hatte.
Überrascht blieb sie stehen. „Oh. Da seid ihr ja.“
„Ich dachte, wir bleiben hier … in Quantico würde uns jeder sehen und lästern“, sagte Libby.
„Ja, kann sein. Na ja, ich bin jetzt erst mal eine Weile weg. Seid schön brav.“
Julie grinste breit, fing sich aber trotzdem einen Stoß von Libby ein und ergriff lachend die Flucht.
Kopfschüttelnd blickte Owen ihr hinterher. „Deine englische Freundin hat eine ganz schön große Klappe.“
„Mitunter schon, aber sie ist super. Ich genieße jede Minute mit ihr hier. Wir waren noch nie so lang zusammen – klar, bis jetzt hat sie am anderen Ende der Welt gewohnt.“
Sie hatten das Zimmer erreicht und Libby schloss die Tür auf. Vor dem Betreten schaute sie sich noch einmal skeptisch um, aber es war niemand zu sehen. Diesmal ließ sie Owen den Vortritt, der das schlichte Zweibettzimmer neugierig in Augenschein nahm.
„Gemütlich habt ihr es hier“, fand er.
Libby lächelte. „Ja, es ist ganz schön. Dass Julie hier ist, macht die Sache natürlich noch besser. Schau dich um, such dir einen Platz … besonders gastfreundlich ist es natürlich nicht, eigentlich dürfen wir ja keinen Besuch kriegen.“ Achselzuckend setzte sie sich auf ihr Bett und Owen nahm neben ihr Platz.
„Das passt schon. Ich weiß ja, wie das hier läuft. Mir ist gerade wichtig, dass ich bei dir bin – nichts sonst.“
Gerührt sah Libby ihn an. „So etwas hat noch nie jemand für mich getan.“
„Ich muss zugeben, dass die Westküste mir jetzt schon fehlt … Ich mag das Lebensgefühl in Kalifornien. Hier an der Ostküste ist es ja ganz anders und in Washington sowieso. Was für eine respekteinflößende, saubere Stadt.“
„Von dort aus wird das ganze Land gesteuert. Das merkt man.“
Owen nickte. „Es gefällt mir schon irgendwie. Polizist in Washington zu sein ist natürlich noch mal was ganz anderes als in San José … aber ich wollte dir einfach folgen. Ich habe kurz überlegt, ob das nicht verrückt ist, aber ich musste immer an dich denken. Es ging einfach nicht. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten – und seit du mir das Leben gerettet hast, bin ich dir verfallen“, gestand er lachend.
„Oh, erinner mich nicht daran.“
„Tut mir leid. Mir war jedenfalls danach, was Verrücktes zu tun. Bis jetzt war es goldrichtig.“
Libby sah ihn gerührt an. „Kieran hätte das nicht gemacht.“
„Wie alt war er noch mal?“
„So alt wie ich. Er hatte gerade Geburtstag, er ist jetzt fünfundzwanzig.“
Owen machte eine wegwerfende Handbewegung. „Ach … in dem Alter glaubt man als Mann auch noch, man könnte jede haben. Da will man sich noch nicht festlegen. Aber nach der Trennung von meiner Verlobten und meinem dreißigsten Geburtstag habe ich anders darüber gedacht. Und mit dir …“ Er zögerte kurz. „Ich fand dich schon ziemlich süß, als wir uns das erste Mal gesehen haben.“
„Ach, deshalb wolltest du, dass ich mit dir zusammen die Ermittlungen führe“, neckte Libby ihn nicht ganz ernst gemeint.
„Nein, ach Quatsch. Ich habe deine Hilfe wirklich gebraucht. Aber dass du dann so tolle Arbeit geleistet hast und so taff an die Sache rangegangen bist, hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe mir immer eine Partnerin gewünscht, die hinter meiner Arbeit steht, aber du liebst diesen Beruf selbst. Du bist so zielstrebig und gehst deinen Weg, das finde ich toll.“
„Kieran war das zu viel …“
„Der weiß auch nicht, was ihm entgeht“, sagte Owen achselzuckend. Libby rückte näher an ihn heran, legte eine Hand auf seine Wange und küsste ihn erneut. Owen legte einen Arm um sie und zog sie näher an sich heran. Sie küssten sich leidenschaftlich, was Libby sehr genoss.
„Bin ich froh, hier zu sein“, sagte Owen schließlich.
„Und ich erst.“
„Du konzentrierst dich aber trotzdem bitte auf deine Ausbildung hier! Das ist wichtig.“
„Ja, schon klar …“
„Ich bin jetzt in der Nähe, aber ich werde einen Teufel tun und dich ablenken.“
Libby lächelte. „Du bist süß.“
„Das ist mein Ernst. Ich schicke dich doch nicht den ganzen Weg nach Quantico und folge dir noch, damit du dann auf einmal Flausen im Kopf hast.