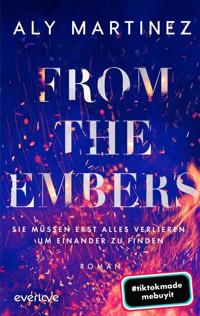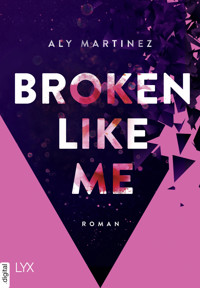
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Darkest Sunrise
- Sprache: Deutsch
Herzzerreißend, emotional und unfassbar romantisch
Vor zehn Jahren ist Charlotte das Schlimmste passiert, was einer Mutter passieren kann: Sie hat ihr Kind verloren, weil sie eine Sekunde lang nicht aufmerksam war. Noch heute wird die junge Ärztin von ihrer Trauer und ihren Schuldgefühlen erdrückt. Die Gegenwart von Kindern erträgt sie kaum, weshalb sie in ihrer Praxis für Pneumologie nur Erwachsene behandelt. Als sie eines Tages Porter Reese kennenlernt, geschieht etwas, mit dem sie nicht mehr gerechnet hätte: Sie fühlt. Etwas Aufregendes, Kribbelndes. Hoffnung. Doch was er ihr verschweigt: Porter ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern, und sein Sohn ist dringend auf ihre Hilfe angewiesen ...
"Mit Abstand der beste Roman, den ich 2017 gelesen habe!" Brittainy C. Cherry
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchProlog123456789101112131415161718192021222324252627Die AutorinAly Martinez bei LYX.digitalImpressumALY MARTINEZ
Broken Like Me
Roman
Ins Deutsche übertragen von Michaela Link
Zu diesem Buch
Vor zehn Jahren ist Charlotte das Schlimmste passiert, was einer Mutter passieren kann: Sie hat ihr Kind verloren, weil sie eine Sekunde lang nicht aufmerksam war. Noch heute wird die junge Ärztin von ihrer Trauer und ihren Schuldgefühlen erdrückt. Die Gegenwart von Kindern erträgt sie kaum, weshalb sie in ihrer Praxis für Pneumologie nur Erwachsene behandelt. Als sie eines Tages Porter Reese kennenlernt, geschieht etwas, womit sie nicht mehr gerechnet hätte: Sie fühlt. Etwas Aufregendes, Kribbelndes. Hoffnung. Doch was er ihr verschweigt: Porter ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern, und sein Sohn ist dringend auf ihre Hilfe angewiesen …
Prolog
Charlotte
Stock und Stein bricht das Bein, nur Worte bringen niemals Pein.
Wer immer diesen Spruch geprägt hat, ist ein schamloser Lügner. Worte sind oft die schärfsten Waffen und können die mächtigsten Emotionen auslösen, die ein Mensch nur empfinden kann.
»Sie sind schwanger«, waren nicht die Worte, die ich hören wollte, als ich meine Stelle an der Uniklinik antrat.
Natürlich war mir bekannt, wie die Fortpflanzung funktioniert, aber ein One-Night-Stand in betrunkenem Zustand mit einem Mann, den ich genau eine Stunde zuvor kennengelernt hatte, sollte nicht mit einem zerrissenen Kondom enden und einem Kind in meinem Bauch.
»Es ist ein Junge«, verkündete der Arzt, als er mir neun Monate später dieses blutverschmierte wunderschöne Bündel auf die Brust legte.
Ich bezweifelte, dass sein gegurgeltes Heulen überhaupt als ein Wort durchgehen konnte, aber dieser Laut veränderte mein ganzes Leben. Ein einziger Blick in diese grauen unsteten Augen, und ich war keine Frau mehr, die widerwillig ein Baby bekommen hatte. Ich war Mutter im wahrsten Sinne des Wortes.
Mit Leib und Seele. Auf immer und ewig.
»Lucas«, flüsterte ich, als ich die ganzen siebeneinhalb Pfund dieses kleinen Jungen im Arm hielt. Ihn würde ich von nun an für immer beschützen. Ich wusste bis ins tiefste Innere, dass es nichts gab, was ich nicht für ihn tun würde. Aber im Laufe der Jahre sollte ich noch häufig die Erfahrung machen, dass ich nicht alles unter Kontrolle hatte.
»Ihr Sohn wird irgendwann eine Herztransplantation benötigen«, sagte der Arzt, als wir nach einer langen Nacht voller Sorge in der Notaufnahme im Sprechzimmer des Kardiologen saßen. In dem Moment hätte ich Lucas meins geben können, denn nach diesen Worten fühlte es sich so an, als sei mir das Herz direkt aus der Brust gerissen worden. Ich war mir vollends darüber im Klaren, dass nicht jedes Kind vollkommen gesund sein konnte. Aber er war mein Kind. Er war in meinem Körper gewachsen aus nicht mehr als einer Ansammlung sich teilender Zellen, und er war zu einem unglaublichen winzigen Menschen herangereift, der eines Tages seinen eigenen Weg durch diese verrückte Welt gehen würde.
Zehn Finger, zehn Zehen. Mein rabenschwarzes Haar. Das Kinn mit dem Grübchen seines Vaters. Dieses Baby war von etwas, was ich niemals wollte, zu dem Einzigen geworden, das ich brauchte. Ich weigerte mich zu akzeptieren, dass er krank sein könnte.
Nachdem der Arzt gegangen war, sah Brady mich durch den Raum hinweg an, unser Sohn geborgen an seiner Brust, und bestürmte mich mit weiteren Worten.
»Sie können ihn gesund machen, nicht wahr?«
Aber es war meine Antwort, die mich am tiefsten verletzte.
»Nein.«
Ich wusste zu viel über Lucas’ Diagnose, um zu glauben, dass irgendjemand ihn gesund machen konnte. Eines Tages, wahrscheinlich noch vor seinem achtzehnten Geburtstag, würde sein schwaches Herz versagen und ich hilflos zusehen müssen, wie der einzige Sinn meines Lebens ums Überleben kämpfte. Man würde ihn auf eine meilenlange Warteliste setzen, und für uns würde die qualvolle – und moralisch fragwürdige – Aufgabe beginnen, darauf zu warten, dass irgendjemand starb, damit unser Kind leben konnte.
Wissen war in dieser Situation nicht Macht. Ich hätte alles darum gegeben, nicht zu wissen, was die Worte des Arztes in ihrer vollen Tragweite bedeuteten.
Hunderte von Menschen auf dieser Warteliste würden sterben, bevor sie jemals ein passendes Organ fanden. Und dabei waren nicht einmal diejenigen mitgerechnet, die auf dem OP-Tisch oder aber nur Stunden nach erfolgreicher Operation sterben würden, weil ihr Körper das verpflanzte Organ abgestoßen hatte. An der Uniklinik waren wir stolz auf die Anzahl der Menschen, die wir retteten. Aber dies war mein Sohn. Er hatte nur ein einziges Leben. Ich konnte nicht riskieren, dass er es verlor.
Dass ich ihn verlor.
Trotz meiner tiefen Bekümmerung versuchte ich, mich optimistisch zu geben. Ich täuschte ein Lächeln vor, tat so, als akzeptierte ich die ermutigenden Worte unserer Freunde und Verwandten, und es gelang mir sogar, ein paar aufmunternde Worte an Brady zu richten. Er hingegen machte sich nicht die Mühe, mich zu ermuntern. Eine solche Beziehung hatten wir nicht. Tatsächlich hatten wir, in bekleidetem Zustand, wenig gemeinsam. Doch nach Lucas’ Geburt hatte sich zwischen uns eine Art Freundschaft entwickelt. Und mit der Aussicht auf eine Zukunft, in der wir die Hälfte der Zeit in Krankenhäusern verbringen würden, wuchs diese Bindung.
Das heißt, bis eines Tages, sechs Monate später, ein einziges, harmloses Wort uns alle zerstörte.
Stock und Stein bricht das Bein, nur Worte bringen niemals Pein.
Alles Lüge.
Silben und Buchstaben mögen nicht greifbar sein, aber sie können dein ganzes Leben schneller zerstören als die Kugel aus einer Waffe.
Ein einziges Wort.
Das war alles, was es brauchte, um meinen Himmel zu verdunkeln.
»Scht«, gurrte ich und griff in den Kindersportwagen, um ihm den Schnuller, der an einem blau-weiß gepunkteten Band mit seinem Monogramm hing, wieder in den Mund zu stecken.
Er hatte eine schlechte Nacht gehabt. Das Leben im Alter von sechs Monaten schien unerträglich zu sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, was für eine Qual eine All-you-can-eat-Milchbar und eine Schar von Leuten darstellten, die auf jede deiner Launen reagierten – auch wenn besagte Launen lediglich darin bestanden, ebenjene Leute vollzukötzeln oder vollzupinkeln.
Es war der erste Herbstmorgen, aber über Atlanta hing immer noch die drückende Sommerluft. Zwischen klinischen Kontrolluntersuchungen und Lucas’ nicht vorhandenem Schlafrhythmus blieb ich nur mit Mühe bei Bewusstsein. Mein Sohn liebte es, sich im Freien aufzuhalten, und ich freute mich, dass es ihn schläfrig machte, auch wenn er noch so sehr dagegen ankämpfte. Also hatte ich ihn in den unverschämt teuren Sportkinderwagen gesetzt, den Bradys Mutter mir zur Babyparty geschenkt hatte, und in der Hoffnung auf ein Morgennickerchen mit ihm einen Spaziergang durch den heimischen Park gemacht.
Der idyllische Spielplatz, der weniger als eine halbe Meile von unserem Haus entfernt lag, war einer meiner Lieblingsplätze. Deshalb machte ich jeden Tag einen fünfzehnminütigen Umweg dorthin, wenn ich zur Uni ging. Es machte mir Freude, den Kindern beim Spielen zuzusehen, und ich stellte mir vor, wie es sein würde, wenn Lucas alt genug dafür war. Bilder von ihm, wie er über das Klettergerüst flitzte, um einer Horde kichernder kleiner Mädchen zu entfliehen, huschten durch meinen Kopf und brachten mich zum Lächeln. Würde er gesellig sein wie ich? Oder still und zurückhaltend wie Brady? Oder krank in einem Klinikbett, wo er auf ein Herz wartete, das vielleicht niemals kam? Ich verdrängte alle diese Gedanken, als mich der verzweifelte Schrei einer Frau wie angewurzelt zum Stehen brachte.
»Hilfe!«
Ein einziges Wort.
Ich trat auf die Bremse des Kinderwagens und wirbelte zu ihr herum. Es schnürte mir die Kehle zu, als sie ein schlaffes Kleinkind vom Boden hochhob.
Adrenalin schoss durch meine Adern, und instinktiv rannte ich die letzten Meter zu ihr hin.
»Er atmet nicht!«, rief sie und drückte mir verzweifelt ihr lebloses Kind in die Arme.
»Wählen Sie den Notruf«, befahl ich. Mein Puls beschleunigte sich, während ich den kleinen Körper auf einen Picknicktisch legte und Jahre der Ausbildung wild durcheinander durch meinen Kopf fluteten. »Was ist passiert?«, fragte ich und drückte seinen Kopf nach hinten, um seine Atemwege zu überprüfen. Sie waren frei, aber es gab keinen Luftstrom hindurch. Das Kind atmete nicht.
»Ich … ich weiß es nicht«, stammelte sie. »Er ist einfach hingefallen … Oh Gott! Er atmet nicht!«
»Beruhigen Sie sich«, fuhr ich Sie an. Wenngleich ich mir nicht ganz sicher war, wem die Aufforderung eigentlich galt. Es war mein erster Notfall, und obwohl ich in Erster Hilfe verdammt viel besser war als jeder andere in diesem Park, hätte ich in ihrer Situation jemand Qualifizierteren gewollt, wenn es um Lucas gegangen wäre.
Aber von den Müttern, die sich um uns scharten, bot keine einzige Hilfe an, daher war ich auf mich allein gestellt. Also machte ich mich mit dem Herz in der Hose an die Arbeit und betete, dass es reichen würde.
Nach wenigen Minuten entfuhr ein schwacher Schrei den blauen Lippen des Jungen.
Das erleichterte Schluchzen seiner Mutter würde ich nie mehr vergessen. Es kam aus tiefster Seele.
»Oh Gott!«, schrie sie, und ihre Hände zitterten, als sie sich über seinen Körper beugte, um sein Gesicht an ihren Hals zu drücken.
Er schrie lauter, und ich rückte ein Stück von ihm ab, damit er Platz hatte. Ich konnte den Blick nicht losreißen von dem Wunder dieses Kindes, das Minuten zuvor nichts als ein scheinbar lebloser Körper gewesen war. Jetzt klammerte er sich seiner Mutter an den Hals.
Mit bebendem Kinn und brennenden Tränen in den Augen lächelte ich vor mich hin. Ich hatte meine liebe Not gehabt. Es war schwer genug, die Balance zwischen der anstrengenden Ausbildung an der Klinik und den Selbstzweifeln als ledige Mutter zu wahren. Die Zwölfstundentage, nach denen ich zu Hause noch sechs Stunden lang weiter lernen musste, brachten mich rasch ans Ende meiner Kräfte. Ich hatte sogar schon darüber nachgedacht, einige Jahre zu pausieren, bis Lucas ein wenig älter sein würde.
Als die Sanitäter kamen, sonnte ich mich in dem Wissen, dass all die harte Arbeit und Opfer einem kleinen Jungen die Chance zum Überleben verschafft hatten. In diesem Moment wurde mir wieder bewusst, warum ich überhaupt hatte Ärztin werden wollen.
Pablo Picasso hat einmal gesagt: »Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken.«
Seit dem zarten Alter von sieben Jahren war mir klar, dass Heilen meine Gabe war. Das Mädchen von nebenan hatte sich das Knie aufgeschürft, und bevor ihre Mom zu Hilfe kam, hatte ich ihr bereits das Bein verarztet. Es war an der Zeit, dass ich meine Gabe denjenigen schenkte, die sie brauchten.
»Danke«, rief mir die erschöpfte Mutter zu, als ich mich zurückzog, voll von wiedererwachter Entschlossenheit.
Ich nickte nur und legte die Hand auf mein rasendes Herz, mit dem Gefühl, als müsste ich mich eigentlich bei ihr bedanken.
Als sie hinter der Reihe von Sanitätern und Neugierigen verschwand, drehte ich mich um und kehrte zurück zu Lucas’ Kinderwagen.
Nur um weniger als eine Sekunde später jäh innezuhalten.
Er war nicht da.
Ich schaute mich um und nahm an, dass ich mich in dem Chaos vertan hatte. Aber Sekunden später wurde es mir klar: Irgendetwas stimmte nicht.
Etwas war so schiefgelaufen, dass meine Welt aus den Fugen geriet.
»Lucas!«, rief ich, als würde mein sechs Monate alter Sohn mir antworten.
Er tat es nicht.
Niemand antwortete mir.
Mir sträubten sich die Nackenhaare, und mein Puls schoss in die Höhe. Die Welt bewegte sich in Zeitlupe um mich herum, während ich im Kreis herumwirbelte. Mir schwirrte der Kopf von all den Möglichkeiten, wo er sein könnte. Aber selbst in diesem entsetzlichen Moment wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass ich ihn genau dort zurückgelassen hatte, sicher angeschnallt in seinem Kinderwagen, nur wenige Meter entfernt.
»Lucas!«, brüllte ich, und meine Angst wuchs ins Unermessliche.
Mit hektischen Bewegungen rannte ich zu der sich langsam zerstreuenden Menschenmenge.
Ich hielt eine Frau am Arm fest, bevor sie an mir vorbeigehen konnte. »Haben Sie meinen Sohn gesehen?«
Sie schaute mich erschrocken an, schüttelte aber den Kopf.
Ich drängelte mich zur nächsten Frau. »Haben Sie meinen Sohn gesehen?«
Auch sie schüttelte den Kopf, und so hastete ich weiter, hielt Menschen fest und betete darum, dass endlich jemand nickte.
»Grüner Sportkinderwagen. Dunkelblauer Bezug?«
Ein weiteres Kopfschütteln.
Meine Sicht verschwamm, und meine Kehle brannte, aber ich lief immer weiter.
Er war da. Irgendwo. Er musste da sein.
Das Herz pochte mir gegen die Rippen, als mich ein weiterer Adrenalinstoß und die Befürchtung, dass dies hier alles wirklich geschah, niederschmetterten.
»Lucas!«, schrie ich.
Meine Gedanken überschlugen sich, und ich verlor fast den Verstand. Ich rannte zu dem ersten Sportkinderwagen, den ich sah. Er war rosa mit weißen Punkten, aber vielleicht saß er doch darin.
»Hey!«, brüllte eine Frau, als ich die Decke von ihrem Baby riss.
Ihrem Baby. Nicht meinem.
»Lucas!«
Galle verätzte mir die Kehle. Mit jeder Sekunde, die verstrich, wuchs mein Entsetzen. Ich raufte mir die Haare, als die lähmende Ohnmacht ihre Krallen in mich schlug und drohte mich in die Knie zu zwingen. Ich schaffte es, mich auf den Beinen zu halten.
Für ihn würde ich alles tun.
»Lucas!« Diesmal blieb mir die Luft weg, und eine Woge des Zitterns überkam mich.
Ein einziges Wort.
Bei ihr hatte es funktioniert. Bei dieser anderen Frau. Als sie voller Verzweiflung befürchtete, ihren Sohn zu verlieren, hatte ich ihn ihr zurückgegeben.
Irgendjemand sollte das jetzt für mich tun.
Irgendjemand musste es tun.
»Hilfe!«, schrie ich aus Leibeskräften.
Ein einziges Wort.
Und dann verfiel meine Welt in Dunkelheit.
1
Porter
»Daddy?«
Ja, dachte ich, aber ich war zu schlaftrunken, um auch nur ein Wort herauszubringen. Es war Wochen her, seit ich wirklich Ruhe gefunden hatte. Mit der Arbeit und den Kindern war ich über die Maßen erschöpft.
»Daddy?«
Ich bin hier, mein Schatz.
»Daddy!«, brüllte sie.
Ich fuhr im Bett hoch und schaute mich verschlafen im Zimmer um.
Sie stand an der Tür, ihr langes kastanienbraunes Haar stand ihr wirr um den Kopf, und ihr albernes Hello-Kitty-Nachthemd, in dem sie die ganze Woche unbedingt jede Nacht hatte schlafen wollen, streifte über das Parkett.
»Was ist los, Hannah?«, fragte ich und rieb mir mit den Handballen den Schlaf aus den Augen.
»Travis kriegt keine Luft.«
Vier Worte, die mein Albtraum waren und mich in der Realität verfolgten.
Ich schleuderte die Decke zur Seite und flog aus dem Bett. Mit nackten Füßen trampelte ich über den Boden und rannte durch den Flur zu seinem Zimmer.
Hannah hatte vor einigen Wochen begonnen, bei ihm zu übernachten. Ihr großer Bruder tat so, als sei es eine außergewöhnlich grausame Art der Folter, aber insgeheim freute er sich meiner Meinung nach über die Gesellschaft.
Und obwohl sie dreieinhalb war, beruhigte es mich unendlich, wenn in Nächten wie diesen jemand in seiner Nähe war.
Ich stieß die Tür weit auf, vorsichtig darauf bedacht, nicht das Minecraft-Poster zu zerreißen, das wir am Tag zuvor aufgehängt hatten, und eilte zu seinem Bett. Es war leer.
»Trav?«, rief ich.
Es war Hannah, die antwortete. »Er ist im Bad.«
Ich trat eine Legokiste aus dem Weg und öffnete die untere Schublade seines Nachttischs, um seinen Zerstäuber herauszuholen. Plötzlich kullerte eine Lawine leerer Gatorade-Flaschen aus dem oberen Etagenbett.
Ich eilte aus dem Raum, ein Funken Stolz durchfuhr mich. Das war mein Junge. Höllisch krank, seit einer Woche ans Bett gefesselt, aber er hatte es irgendwie geschafft, die Energie aufzubringen, aus seinem Zimmer ein Geheimversteck zu machen.
»Hey«, flüsterte ich, als ich um die Ecke ins Badezimmer trat. Bei seinem Anblick verkrampfte sich mir der Magen. Das dünne Kerlchen hockte auf dem Badewannenrand, die Schultern hochgezogen, die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt. Er war schweißnass und bleich. Sein Rücken krümmte sich unter tiefen gequälten Atemzügen, die es nicht bis in die Lungen schafften.
»Bitte … nein«, keuchte er.
Ich wusste, worum er bat, aber ich war nicht in der Lage, ihm irgendetwas zu versprechen.
»Scht, ich bin bei dir.« Ich rieb sein kurz geschorenes Haar und tat mein Bestes, Gelassenheit vorzutäuschen, während ich mich hektisch daranmachte, seinen Apparat aufzubauen.
Er hatte die ganze Woche Antibiotika bekommen, aber die Entzündung in seinen Lungen wollte diesmal nicht weichen. Vor Monaten war Travis’ Zerstäuber nicht mehr gewesen als ein teurer Briefbeschwerer, auf dem sich Staub sammelte. Aber im Laufe der letzten Wochen war es so schlimm geworden, dass wir einen weiteren Zerstäuber für sein Zimmer hatten kaufen müssen.
Ich fand es schon schlimm, als er keinen Tag ohne mindestens eine Atembehandlung überstanden hatte, aber jetzt waren es bereits drei.
Mein Sohn war elf. Er sollte draußen Fußball spielen und auch mal Mist bauen, sollte den Mädchen, die er mochte, Streiche spielen – und nicht um drei Uhr morgens aufwachen und ums Überleben kämpfen. Und so wie das Unvermeidliche seinen Lauf nahm und er immer weiter abbaute, wuchs meine Angst, ihn eines Tages zu verlieren.
In seinen Lungen rasselte es, als er so heftig an dem Mundstück saugte, dass das Röcheln durchs ganze Haus zu hören sein musste.
Als der Zerstäuber dröhnend in Betrieb ging, erfüllte das vertraute Brummen den Raum.
»Beruhige dich, und versuche zu atmen«, flüsterte ich. Es brach mir das Herz, als ich ihm das Mundstück zwischen die Lippen schob und er seine bleiche zittrige Hand hob, um es festzuhalten. Jesus! Das war ein schlimmer Anfall.
Ich sank auf die kalten Bodenfliesen zu seinen Füßen, gelähmt vor Angst, und legte ihm einen Arm übers Bein. Mein Sohn war ein Kämpfer, daher war ich mir nicht sicher, ob meine Anwesenheit ihm half, aber für mich wirkte die Berührung Wunder.
Ich passte meinen Atem dem seinen an, und binnen Minuten war ich benommen. Es war mir unbegreiflich, wie er sich noch aufrecht halten konnte.
Bitte, Gott. So oft, wie ich im Laufe der letzten drei Jahre mit dem Herrn um Travis’ Gesundheit gefeilscht hatte, hätte ich als Priester durchgehen können.
Mein Brustkorb fühlte sich an wie in einen Schraubstock eingezwängt. Die Atembehandlung half nicht. Zumindest nicht schnell genug. Eine Welle des Grauens wogte durch meinen Magen. Er würde mich hassen. Aber ich war der Vater; es war meine Aufgabe, die harten Entscheidungen zu treffen – selbst wenn sie mich umbrachten. Sein Schmerz und sein Kampf tobten auch durch meine Adern. Dies war nicht nur sein Kampf. Er betraf uns alle. Wenn ihm jemals etwas zustoßen sollte, hätte ich für den Rest meines Lebens ein Loch in meiner Seele.
Ich hatte ihm versprochen, mich um ihn zu kümmern. Ich hatte ihm nicht versprochen, dass ich dabei sein Freund sein würde. »Hannah, kannst du Daddys Handy holen?«
»Nein!«, keuchte Travis.
Ich schloss die Augen und lehnte den Kopf an seine Schulter. »Kumpel, es tut mir leid.«
»Ich … werde … nicht … hingehen«, stieß er nach Atem ringend hervor.
Ich schluckte heftig, um die übermächtigen Gefühle zu unterdrücken. Ich musste stark genug für uns alle sein – auch wenn es mir das Herz in tausend Stücke zerriss.
Ich wollte das nicht noch einmal durchmachen.
Aber ich konnte es auch nicht vermeiden.
»Du musst hingehen, Trav.«
Mit wackligen Beinen sprang er auf die Füße, aber er fand kein Gleichgewicht und kippte nach vorn.
Ich sprang auf und hielt ihn an der Taille fest, bevor er mit dem Kopf gegen den Waschtisch schlug. Der Zerstäuber fiel klappernd zu Boden und dröhnte brummend weiter, während Trav sich gegen mich wehrte.
Seine Bewegungen waren träge und seine Hände langsam, aber so zielsicher, wie jeder Schlag mich traf, hätte er genauso gut ein Meisterboxer sein können. Gott wusste, dass ich nichts gegen einen Knock-out hätte, wenn es ihn nur beruhigte.
»Es tut mir leid«, murmelte ich und zog ihn an meine Brust.
»Ich hasse dich«, rief er und weigerte sich aufzugeben.
Er hasste mich nicht. Travis liebte mich. Ich wusste das so sicher, wie ich wusste, dass der Himmel blau war. Aber wenn er ein Ventil für seinen Zorn brauchte, stellte ich mich jedes Mal gern zur Verfügung.
Ich drückte ihn sanft. »Es tut mir leid.«
Er erwiderte meine Umarmung nicht, aber das brauchte er auch nicht. Ich brauchte nur eines, nämlich dass er weiteratmete.
Als Hannah mit meinem Handy zurückkam, führte ich Travis zur Toilette, damit er sich auf den Deckel setzte.
Wie erwartet weinte er. Ich konnte ihm keinen Vorwurf machen. Verdammt, mir war ebenfalls nach Weinen zumute.
Es war nicht fair, nichts von alledem war fair.
Ich hob das Telefon ans Ohr, nachdem ich gewählt hatte. Als es klingelte, beugte ich mich vor, hob das Plastikröhrchen vom Boden auf und gab es meinem Sohn zurück. »Inhaliere zu Ende, dann fahren wir ins Krankenhaus.«
Er funkelte mich auf eine präpubertäre Art an, die in Kindern angelegt zu sein scheint, aber er war zu schwach, um es mir richtig aus der Hand zu reißen.
Ein schläfriges »Hallo?« kam durch die Leitung.
»Hallo, Mom. Kannst du zum Krankenhaus kommen, um Hannah mitzunehmen?«
Ihr Bett quietschte, als sie vermutlich hinauskletterte. »Wie schlimm ist es?« Ich schaute Travis an und beobachtete, wie er bei jedem Atemzug bebte. Er wich meinem Blick aus, aber er hörte genau, was ich sagte.
»Hannah, bleib bei deinem Bruder«, befahl ich und verließ das Badezimmer.
Ich beantwortete ihre Frage erst, als ich in meinem Zimmer war. Ich ging direkt zu meinem Kleiderschrank, schlüpfte in Hemd und Jeans und zog ein Paar Sneakers an.
»Ziemlich schlimm.«
»Oh Gott«, flüsterte sie. »Ja. Okay. Ich bin schon unterwegs. Beeil dich, aber fahr vorsichtig.«
Dann holte ich mein Portemonnaie und meine Schlüssel von der Kommode. Ich schloss die Augen und kniff mir in den Nasenrücken. »Ja. Du auch.«
Mit einem tiefen Atemzug, von dem ich mir eine Linderung des hohlen Schmerzes erhoffte, den ich wahrscheinlich nie mehr loswerden würde, öffnete ich die Augen.
Catherine starrte mich an.
Ich war mir nicht sicher, warum ich dieses Bild auf meiner Kommode hatte stehen lassen. Ich hatte mir gesagt, ich täte es für die Kinder. Damit sie das Gefühl haben konnten, sie sei immer noch Teil unseres Lebens, obwohl wir jetzt nur noch zu dritt waren.
Ich nahm das Foto in die Hand. Sie lächelte in die Kamera, in ihren Augen das Schimmern ungeweinter Tränen, und Travis war eingewickelt in seine Wickeldecke, erst ein paar Stunden alt, geborgen in ihrer Armbeuge. Ich zeichnete mit den Fingern über sein dunkles unbändiges Haar, als könne ich es kämmen, aber mein Blick driftete zu seiner Mutter. Sie war seit drei Jahren tot, und so viel hatte sich seitdem geändert.
Sie hätte gewusst, was sie mit Travis machen sollte. Wie sie ihm Linderung verschaffen konnte. Vielleicht nicht physisch, aber emotional. Ich erinnerte mich an das erste Mal, als er einen Anfall hatte. Ich war durchs Haus gerannt und hatte den Notruf gewählt, hektisch, während sie gelassen neben ihm gesessen, ihm den Rücken massiert und beruhigende Worte ins Ohr geflüstert hatte. Sie litt Qualen, aber für ihn riss sie sich zusammen. Ich habe über drei Jahre gebraucht, um diese Fähigkeit zu erlangen. Sie war immer so gut darin gewesen, seine Stimmung zu deuten und ihm klarzumachen, dass er seine Medikamente nehmen musste. Wenn er etwas gebraucht hatte, hatte sie es instinktiv gewusst. Zu sehen, wie die beiden miteinander harmonierten, war mir oft als der schönste Anblick überhaupt vorgekommen.
Sie hatte nicht gezweifelt. Nicht geschwankt. Sie war ein Fels in der Brandung gewesen.
Ich war nicht wie Catherine.
Ich war schwach.
Und erschöpft.
Und so verdammt voller Angst.
Aber selbst wenn es mich umbrachte, ich würde für ihn da sein. Und das würde auch immer so sein.
Nein. Ich war ganz und gar nicht wie Catherine.
Als ich hörte, wie er den Zerstäuber ausschaltete, stellte ich das Foto zurück auf die Kommode, sah meiner Frau direkt in die Augen und flüsterte: »Verdammt, ich hasse dich so sehr.«
2
Charlotte
»Ich werde sie sofort hereinschicken, Mr Clark«, sagte ich und trat rückwärts aus der Tür, ein breites Lächeln auf meinen Lippen.
Es war falsch – sowohl das Versprechen als auch das Lächeln. Ich war erschöpft. Ich war seit fast vierundzwanzig Stunden im Krankenhaus, und das Schlafen auf zwei Rollstühlen war genauso erholsam gewesen, wie es sich anhörte.
»He, Denise«, rief ich und schlenderte zum Schwesternzimmer hinüber. Meine müden Füße schmerzten bei jedem Schritt. »Mr Clark braucht jemanden, der ihm ins Bad hilft.«
Sie schaute stirnrunzelnd vom Computerbildschirm auf. »Sie haben wohl den Verstand verloren.«
Ich zwang mich zu einem Grinsen, legte mein Klemmbrett auf den Schreibtisch und ließ mich dann auf den Stuhl neben ihr fallen. Gähnend band ich mir mein zerzaustes Haar zu einem Pferdeschwanz.
Ich brauchte einen Friseurtermin. Falsch. Ich brauchte eine Dusche, eine Massage, eine Mahlzeit, die nicht in der Mikrowelle zubereitet wurde, ein wochenlanges Date mit den Innenseiten meiner Augenlider und dann einen Friseurtermin.
Bei meinem Dienstplan war es wahrscheinlicher, einem Einhorn zu begegnen.
»Tut mir leid«, murmelte ich vor dem nächsten Gähnen.
Sie verdrehte so heftig die Augen, dass ihre Netzhaut nicht mehr zu sehen war. »Wenn ich noch einmal in sein Zimmer gehe, braucht er jemanden, der ihm seine Hände wieder annäht.« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Bei den alten Knackern mit Demenz kann ich es ja noch verstehen. Die können nichts dafür. Aber dieser Kerl ist vierzig und hat nichts als ein schweres Asthma, das auf zwei Schachteln Zigaretten am Tag zurückzuführen ist. Sein Verstand dagegen ist ganz in Ordnung, soweit er Gebrauch davon macht.« Sie hielt inne, schaute wieder auf ihren Computer und murmelte: »Das wird vielleicht nicht mehr so sein nach der Gehirnerschütterung, wenn er mir noch einmal an den Hintern grapscht.«
Es klang wie ein Scherz, daher reagierte ich mit einem Kichern und hoffte, dass es echt klang.
Dann starrte ich auf meine Armbanduhr.
Eine Stunde.
Der Minutenzeiger hatte mich endgültig eingeholt.
Als ich den Anruf bekommen hatte, dass Mr Clark eingewiesen worden sei, hatte ich irgendwie gehofft, ich würde mich verzetteln und jedes Zeitgefühl verlieren.
Aber sosehr ich es auch versuchte, ich würde niemals in der Lage sein, diesen Tag zu vergessen.
Da ich nichts mehr zu feiern hatte, diente dieser Tag nur als Erinnerung, dass ich ein weiteres Jahr in der Dunkelheit überlebt hatte, die mir nach ihm geblieben war.
»Hören Sie … ich, ähm«, sagte ich zögernd. »Ich muss gehen. Können Sie bitte dafür sorgen, dass jemand ihm hilft?«
Mit einer dramatischen Geste griff sie sich an die Brust. »Lieber Gott, steht der Weltuntergang bevor?« Sie schaute sich im Schwesternzimmer um und stellte die Frage an alle und niemanden: »Hat Dr. Mills gerade wirklich gesagt, sie muss gehen? Bin ich noch auf dieser Erde?.« Sie hob die Hände gen Himmel und frohlockte: »Gelobt sei Jesus Christus, der Herr ist an meiner Seite!«
»Haha«, gab ich todernst zurück.
Okay. Ich arbeitete viel. So viel, dass sich am Krankenhaus hartnäckig das Gerücht hielt, ich sei ein Vampir und brauche keinen Schlaf, um zu überleben. Zu meinem letzten Geburtstag hatten die Patienten alle zusammengelegt und mir eine lebensgroße Pappfigur von Ian Somerhalder geschenkt. Anscheinend spielte er in einer Fernsehserie einen Vampir. Aber da ich keinen Fernseher besaß, hatte ich den Witz nicht verstanden.
Tagsüber behandelte ich meine Patienten in meiner Praxis am anderen Ende der Stadt, und die Nächte verbrachte ich nur allzu oft im Krankenhaus. Ich gehörte zu den wenigen Lungenspezialisten, die jederzeit zur Verfügung standen, wenn einer ihrer Patienten stationär aufgenommen wurde. Ich will nicht sagen, dass ich den Bereitschaftsärzten nicht vertraute. Sie waren durchaus fähig. (Bis auf Blighton. Dem würde ich nicht einmal meinen Goldfisch anvertrauen, und ich besaß nicht mal einen.) Meine Patienten verließen sich auf mich, und mein Seelenfrieden hing von der Gewissheit ab, dass sie alle die bestmögliche Behandlung bekamen, die ich ihnen bieten konnte. Wenn das bedeutete, dass ich ihnen vierundzwanzig Stunden – und das sieben Tage die Woche zur Verfügung stand, dann sollte das eben so sein. Außerdem gab es in meinem Leben nicht viele andere Dinge.
Das Aufregendste, was mir im letzten Jahr außerhalb der Arbeit widerfahren war, war das Blind Date gewesen, das meine beste Freundin mir mit dem Sohn ihres Friseurs verschafft hatte. Sein Name war Hal, und er war Steuerberater. Und nicht gerade ein sexy Typ. Ich rede von der kahlköpfigen, langweiligen Sorte, die ein Kugelschreiberetui in der Brusttasche trägt. Nach der Hälfte des Abendessens hatte ich mich aus dem Badezimmerfenster davongestohlen, und am Montag darauf hatte Rita sich jemand Neues suchen müssen, der ihre Haaransätze färbte. Glücklicherweise hatte sie ihre Lektion anscheinend gelernt und nicht wieder den Versuch unternommen, mich mit jemandem zu verkuppeln.
Ich schaute erneut auf meine Armbanduhr.
Neunundfünfzig Minuten.
Nachdem ich überlegt hatte, ins Labor für Infektionskrankheiten zu gehen, um zu schauen, ob sich dort eine gefürchtete, aber heilbare Krankheit finden ließ, gab ich schließlich auf und erhob mich. Es ging kein Weg dran vorbei. Und je eher ich auftauchte, umso eher konnte ich gehen und den ganzen Tag für ein weiteres Jahr hinter mir lassen.
»Wir sehen uns morgen, Denise.«
Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass sie sich bekreuzigte, als sie rief: »Einen schönen Abend, Dr. Mills!«
Während ich auf den Aufzug wartete, drohten meine Nerven bereits Amok zu laufen.
Ich konnte es schaffen. Es war nicht das erste Mal. Ich musste mich nur zeigen. Ein Lächeln aufsetzen. Einige Umarmungen über mich ergehen lassen. Und dann zusehen, dass ich wieder wegkam.
Um ein weiteres Mal am Boden zerstört zu sein. Alles ganz einfach.
Ich stöhnte und drückte den Knopf für das Parkhaus.
»Charlotte, warte!«, rief Greg und versuchte, sich zu mir in den Aufzug zu schieben. Es gelang ihm, den Oberkörper hineinzubekommen, bevor die Türen sich schlossen. »Scheiße!«, rief er, als der Aufzug sich mit ihm zwischen den Türen wie ein Akkordeon immer wieder öffnete und schloss.
Ich hätte ihm behilflich sein können, indem ich den Knopf drückte, der die Tür öffnete, aber ich tat nichts dergleichen. Es war das Beste an Unterhaltung, was ich an diesem Tag bekommen würde.
Also verschränkte ich die Arme vor der Brust und versuchte nicht, mein Grinsen zu unterdrücken, während er weiter mit dem Aufzug kämpfte.
»Verflucht«, knurrte er.
Als die Türen endlich aufgingen, fiel er förmlich in die Kabine und knallte gegen die Wand.
Ich verkniff mir das Lachen und brachte mühsam hervor: »Bist du okay?«
»Ist das jetzt dein Ernst?«, fragte er pikiert und rückte seinen Kittel gerade.
»Du … ähm« – ich räusperte mich und gab mir Mühe, ernsthaft zu klingen, bevor ich weitersprach – »solltest das vielleicht der Verwaltung melden. Ein echtes Sicherheitsrisiko.«
Er kniff die Augen zusammen, und mein Lächeln brach sich Bahn.
Nichts machte mir mehr Freude, als Greg Laughlin zu ärgern. Das war nicht immer so gewesen. Greg und ich waren seit dem Studium eng befreundet. Er war klug, gut aussehend und sogar auf seine verschrobene Weise witzig. Wenn ich damals auch nur das geringste Interesse an Männern gehabt hätte, hätte ich es vielleicht erwogen, mit ihm auszugehen. Glücklicherweise war mir das erspart geblieben.
Er hatte noch während unserer Facharztausbildung unsere gemeinsame Freundin und jetzige Praxismanagerin Rita geheiratet. Greg und ich hatten uns beide auf Lungenheilkunde spezialisiert, und als wir fertig waren, verstand es sich von selbst, gemeinsam eine Privatpraxis zu eröffnen. Er war ein guter Arzt, aber wie sich herausstellte, als Ehemann ein absoluter Mistkerl.
Anfang der Woche hatte ich herausgefunden, dass er mit meiner Oberschwester schlief. So viel zum Thema Peinlichkeit. Rita war am Boden zerstört, meine Krankenschwester hatte gekündigt, und die einzige Möglichkeit, mich irgendwie an meinem Partner zu rächen, waren die fehlgesteuerten Türen eines Aufzugs.
»Freut mich, dass du das genossen hast«, sagte er bissig und fuhr sich mit den Fingern durch sein dünner werdendes braunes Haar.
»Oh, das habe ich tatsächlich.« Ich lachte.
»Ich habe dir den ganzen Tag SMS geschickt.«
»Ich weiß. Ich bin dir den ganzen Tag ausgewichen.«
Seine Lippen verzogen sich ungläubig. »Du kannst mir nicht ausweichen.«
»Ähm … ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das kann. Immerhin habe ich es den ganzen Tag lang getan.«
Der Aufzug hielt in der Tiefgarage, und ich stieg aus – und er tat das Gleiche, was nicht weiter verwunderlich war.
»Ist es wegen Rita?«, fragte er ungläubig. »Immer noch?«
Ich blieb stehen und drehte mich langsam zu ihm um. »Ähm … du hast meine beste Freundin betrogen. Mit meiner Krankenschwester. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine gesetzliche Bestimmung gibt, wie lange ich deswegen sauer sein darf.« Ich deutete mit dem Zeigefinger in seine Richtung. »Vor allem, wenn man bedenkt, dass es erst eine Woche her ist.«
Sein Kopf schnellte hoch. »Meine Güte, du bist heute aber reizbar.«
Ich drehte mich um und brüllte über meine Schulter: »Gewöhn dich dran!«, und meine Stimme hallte von den Betondecken wider.
»Ich wollte sichergehen, dass du dieses Wochenende zum Frühjahrsfest kommst.«
Ich blieb jäh stehen und wirbelte wieder herum. »Was?«
»Das Frühjahrsfest«, wiederholte er bedeutungsvoll.
»Ja. Ich weiß, was du gesagt hast. Aber was meinst du mit dieses Wochenende?«
Jedes verdammte Jahr bestanden Rita und Greg darauf, all unsere Patienten und deren Familien zu einer Frühjahrsparty einzuladen. Es war eine nette Geste, aber Rita übertrieb es meistens. Schminken, Hüpfburgen, Jahrmarktspiele.
Das bedeutete: Kinder. Kinder. Kinder.
Was wiederum bedeutete, dass ich es um jeden Preis mied.
»Ich … ich dachte, das sei Ende des Monats?« Ich erinnerte mich daran, weil ich bewusst vier Tage Urlaub genommen hatte, um auf keinen Fall dorthin gehen zu müssen.
»Nein. Wir mussten es vorverlegen, weil es am Veranstaltungsort an dem geplanten Wochenende Bauarbeiten gibt. So viel ich weiß, hat Rita aber immer noch ihre liebe Not, einen Caterer zu finden.«
Ich blinzelte und tat mein Bestes, eine ausdruckslose Miene zu bewahren, um mir die Angst nicht anmerken zu lassen, die unweigerlich in mir aufstieg. »Ich schaffe es nicht.«
»Oh, komm schon, Char. Wir haben darum gebeten, dass das ganze Personal aufkreuzt. Da kannst du nicht kneifen. Sie nennen dich bereits die Eiskönigin.«
Mein Rücken wurde steif wie ein Stock, und mir klappte der Mund auf. »Sie nennen mich die Eiskönigin?«
Er wippte auf Zehen und Fersen, während er sich reumütig den Nacken kratzte. »Tatsächlich haben sie noch schlimmere Ausdrücke, aber Eiskönigin ist der einzige Spitzname, der nicht von mir stammt.«
»Zur Hölle, Greg!«
»Reg dich nicht auf. Es ist nur ein Scherz unter den Angestellten.«
Ich funkelte ihn an. »Ich bin ihr Boss.«
»Genau. Und genau deshalb musst du bei dem Fest dabei sein.« Ein arrogantes Grinsen umspielte seine Mundwinkel. »Hör zu, komm einfach für ein Weilchen vorbei, und zeig dich. Sei nett zu den Patienten und den Angestellten. Und solltest du zufällig in deinem neuen, warmen und liebenden und überhaupt nicht eisigen Herzen eine Regung verspüren, wenn du dort bist, könntest du vielleicht Rita überreden, mich wieder nach Hause zu lassen.«
Ich blickte ihn noch zorniger an. »Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe ihr gestern Nacht Schritt für Schritt Anweisungen gemailt, wie sie dich kastrieren kann.«
Er grinste. »Du vergisst, dass ich bei deiner chirurgischen Ausbildung dabei war. Mit deinen Anweisungen kann sie mich schlimmstenfalls glatt rasieren.« Er zeigte vielsagend auf seinen Hosenreißverschluss.
Ich hob die Hand, um das Gespräch zu beenden. »Weißt du was? Ich habe genug davon, über deine Hoden zu reden. Ich werde anderswo erwartet.«
Er zog ungläubig eine Augenbraue hoch. »Wohin gehst du denn? Ich dachte, du hättest mittwochs keine Sprechstunde.«
»Ich habe ein Leben außerhalb der Arbeit, weißt du.«
»Pfff … klar.« Sein Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen, und er stopfte die Hände in seine Kitteltaschen. »Aber im Ernst. Wohin willst du?«
So sauer ich auf Greg war, weil er ein ehebrecherischer Mistkerl war, der meine Freundin verletzt und mich eine verdammt gute Krankenschwester mit leicht fragwürdiger Moral gekostet hatte, war er immer noch mein Freund. Und die Eiskönigin des North-Point-Lungeninstituts zu sein bedeutete, dass ich davon nicht viele hatte.
Also entschied ich mich für Aufrichtigkeit.
»Es ist der siebte März«, flüsterte ich.
»Der siebte Mär…« Er hatte den Satz noch nicht beendet, als Erkenntnis in seine Augen trat. »Oh Gott, Charlotte. Es tut mir so leid.« Sein Ausdruck wurde weicher, und er trat einen Schritt auf mich zu, das Gesicht voller Reue. »Es tut mir so lei…«
»Ist schon gut«, murmelte ich, um ihm aus der Patsche zu helfen. Aber es war nur eine weitere Lüge. Am siebten März war nichts gut. »Ich muss gehen, bevor ich zu spät komme.«
Er nickte verlegen. »Okay. Ja. Geh. Mach, dass du wegkommst.«
Ich stand noch einige Sekunden lang da und wartete darauf, dass die Erde bebte. Oder sich der Boden unter mir auftat, der dann das Parkhaus verschluckte. Aber als nichts dergleichen geschah, zwang ich mich, zu meinem Wagen zu gehen.
Und dann fuhr ich mit einem unheilbaren Schmerz in der Brust zu meiner ganz persönlichen Hölle.
3
Porter
»Nein. Warte … ich will nur …« Das Telefon immer noch ans Ohr gepresst, ließ ich den Kopf hängen. »Ja, ich bleibe dran.«
Oh Gott … würde dieser Tag niemals enden?
Nach einer schlaflosen Nacht im Krankenhaus – mit Travis – hatte ich mein Auto mit einem Platten vorgefunden. Deshalb war ich nicht rechtzeitig zu dem Besichtigungstermin mit dem Inspektor vom Gewerbeaufsichtsamt gekommen. Der dann vier Verstöße entdeckt hatte, von denen mein Lieferant schwor, sie seien nicht seine Schuld. Es würde mindestens eine Woche dauern, alles wieder vorschriftsmäßig hinzubekommen. Wahrscheinlich war es sogar notwendig, eine, wenn nicht beide Tiefkühltruhen auszutauschen.
Mehr Zeit. Mehr Geld. Wenn das so weiterging, würde es an ein Wunder grenzen, wenn wir rechtzeitig eröffnen konnten.
Es war drei Jahre her, dass mein Bruder und ich uns gemeinsam selbstständig gemacht hatten, dabei hatte ich inzwischen vollkommen vergessen, was für ein Albtraum es ist, ein neues Restaurant zu eröffnen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich damals verzweifelt eine Ablenkung gesucht hatte. Damals befand ich mich in einer kapitalen Lebenskrise. Ich war von einem arbeitssüchtigen Investmentbanker buchstäblich über Nacht zum alleinerziehenden Vater zweier Kinder geworden. Hannah war damals erst sechs Monate alt, Travis war schon acht gewesen. Zu beobachten, wie mein Sohn vor Trauer fast zugrunde ging, war mehr, als ich ertragen konnte. In den folgenden Wochen ließ er seinen Zorn an allem und jedem aus, was ihm in den Weg kam. Und das vor allem an mir. Ich konnte ihm keinen Vorwurf machen; ich war selbst verdammt wütend auf das Universum.
Aber mir wurde klar, dass sich etwas ändern musste. Ich konnte nicht weiter zur Arbeit gehen und Sechzigstundenwochen abreißen und Tagesmütter und Babysitter einsetzen, um mit dem Loch fertigzuwerden, das Catherine hinterlassen hatte.
Das Ganze zu überstehen würde nur gemeinsam gelingen.
Ich war alles, was sie noch hatten.
Sie waren alles, was ich noch hatte.