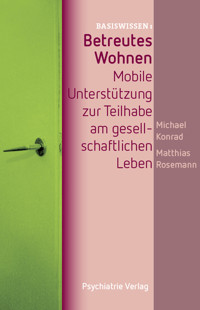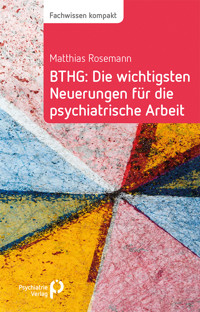
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fachwissen
- Sprache: Deutsch
Wegweiser durch das neue Teilhaberecht Durch das BTHG werden die Selbstbestimmungsrechte und Ansprüche auf Unterstützung von Menschen mit Behinderungen gestärkt. Alle psychiatrischen Leistungserbringer und Kostenträger müssen sich neu aufstellen und die anspruchsberechtigten Bürger und ihre Angehörigen müssen ihre Rechte kennenlernen. In diesem hochaktuellen Buch werden zentrale Begriffe wie Assistenz, Selbstbestimmung und Teilhabe erklärt und die neuen Vorschriften für die Teilhabeplanung zusammengeführt. Parallel werden die wichtigsten Paragrafen zitiert, damit man die neuen Teilhaberechte nicht nur versteht, sondern auch durchsetzen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Rosemann, M. A., ist Psychologe und Soziologe und Geschäftsführer der Träger gGmbH in Berlin. Er ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde und Vorstandsmitglied der Aktion Psychisch Kranke e.V.
Zusammen mit Dr.Michael Konrad hat er 2017 das Handbuch »Selbstbestimmtes Wohnen – Mobile Unterstützung bei der Lebensführung« im Psychiatrie Verlag veröffentlicht, das ebenfalls schon die Neuerungen des BTHG berücksichtigt.
Matthias Rosemann
BTHG: Die wichtigsten Neuerungen für die psychiatrische Arbeit
Fachwissen kompakt
1. Auflage 2018, Nachauflage 2019
ISBN Print 978-3-88414-698-9
ISBN PDF 978-3-88414-920-1
ISBN ePub 978-3-88414-927-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Psychiatrie Verlag, Köln 2018
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Umschlagkonzeption und -gestaltung: GRAFIKSCHMITZ, Köln, unter Verwendung eines Fotos von .marqs/photocase.de
Lektorat: Karin Koch, Köln
Cover
Titel
Über den Autor
Impressum
Einige Worte vorweg
Ein großer Kompromiss oder: Wie das BTHG entstand und zu verstehen ist
Der Auftrag
Die Spannungspole
Partizipatives Verfahren
Formales
Inkrafttreten
Grundsätzliches
Der Behinderungsbegriff
Vorrangregelungen
Leistungsgruppen
Antragsleistung
Träger der Eingliederungshilfe
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Anrechnung von Einkommen und Vermögen
Folgen für die psychiatrische Arbeit
Der Kern des BTHG: Die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen
Teilhabeplanung
Gesamtplanverfahren
Wunsch- und Wahlrecht
Entscheidung über die Leistung
Folgen für die psychiatrische Arbeit
Eingliederungshilfe, soziale Teilhabe und Assistenzleistungen
Soziale Teilhabe
Assistenzleistungen
Instrumente der Bedarfsermittlung
Anspruchsvoraussetzungen für die Eingliederungshilfe
Folgen für die psychiatrische Arbeit
Definitionen von Wohnraum
Folgen für die psychiatrische Arbeit
Abgrenzung Eingliederungshilfe und Pflege
Stationäre Leistungen der Pflegeversicherung
Ambulante Leistungen der Pflegeversicherung
Leistungen der Hilfe zur Pflege
Folgen für die psychiatrische Arbeit
Neue Wege zur Arbeit
Andere Leistungsanbieter
Budget für Arbeit
Modellprojekte nach §11 SGB IX
Folgen für die psychiatrische Arbeit
Vertragsrecht
Rahmenverträge
Wirtschaftlicher Vergleich und Vergütung der Mitarbeitenden
Öffnungsklausel und Erprobungen
Folgen für die psychiatrische Arbeit
Umsetzung, Begleitung, Forschungsprojekte
Schluss und Ausblick
Literatur
Einige Worte vorweg
Das vorliegende Buch ist als kompakte Einführung in eine der wichtigsten Reformen unseres Systems sozialer Leistungen gedacht, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) greift tief in alle Regelungen zur Teilhabe und Rehabilitation ein. Es geht weit über eine Reform der Eingliederungshilfe hinaus.
Es handelt sich bei dieser Einführung nicht um einen sozialrechtlichen Kommentar, sondern um die Darstellung der Veränderungen, die der Gesetzgeber möglich macht. Im Mittelpunkt des BTHG steht die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Daher müssen wir die Aufgaben betrachten, die sich daraus nun für viele Akteure im Feld der sozialen Arbeit ergeben. Dabei werde ich mich in dieser Einführung auf die für die psychiatrische Arbeit wesentlichen Aspekte beschränken. Die Analyse ist daher nicht vollständig, sondern konzentriert sich auf ausgewählte, für die psychiatrische soziale Arbeit relevante Themen. Nichts finden wird man über die Veränderungen im Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, auch nichts über die Leistungen zur Teilhabe an Bildung. Auch andere Themen, wie z.B. die neuen Rechtsvorschriften zur Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation werden nicht berührt. Diese Themen sind von großer Wichtigkeit, sprengen aber den gesetzten Rahmen.
Bei der Auswahl der Themen und der Bearbeitung verschiedener Aspekte hat mir die lebendige Auseinandersetzung mit Dr.Michael Konrad geholfen, dem ich an dieser Stelle für seine Diskussionsfreude danken möchte. Ohne ihn und unsere früheren gemeinsamen Buchprojekte zum ambulant betreuten Wohnen wäre dieses Buch wohl nicht entstanden. Er hat mich ermutigt und unterstützt, diesen Weg zu gehen.
Ich möchte nun die Lesenden ermutigen, sich den Veränderungen, die durch das BTHG gefordert werden, zu stellen und sie mitzugestalten. Nur wer die Rahmenbedingungen kennt, kann die ihnen innewohnenden Möglichkeiten ausschöpfen. Und die sind nicht so klein, wie vielfach befürchtet wurde.
Matthias Rosemann
Noch ein Tipp: Auch wenn im Text einige Paragrafen zitiert werden, ist doch zu empfehlen, den jeweils aktuellen Gesetzestext noch einmal nachzulesen. Das SGB IX wird ständig nachgebessert und verändert. Zudem werden hier oft nur kleine Ausschnitte zitiert. An der direkten Lektüre der einzelnen Vorschriften und der sie ergänzenden Paragrafen kommt also eigentlich kein Akteur vorbei. Am einfachsten geht das im Internet. Auf der Seite https://dejure.org/gesetze/SGB_IX ist nicht nur die aktuelle Fassung zu finden, man kann auch zum Teil zwischen alter und neuer Fassung hin- und herswitchen.
Das BTHG, das alle diese Änderungen angestoßen hat, finden Sie unter http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen
Ein großer Kompromiss oder: Wie das BTHG entstand und zu verstehen ist
Das »Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen« (Bundesteilhabegesetz – BTHG) vom 23. Dezember 2016 hat eine lange Vorgeschichte, deren Kenntnis zum Verständnis seiner Ziele und Werte beiträgt. Die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister (ASMK), in der sich die für Arbeit und Soziales zuständigen Ministerinnen und Minister sowie Senatorinnen und Senatoren regelmäßig treffen, hatte schon im Jahr 2007 die Reform der Eingliederungshilfe angeregt. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden über Jahre hinweg Vorschläge für die notwendigen Reformen erarbeitet. Ein erster Zwischenschritt war ein Grundlagenpapier aus dem Frühjahr 2012. Im später sogenannten Fiskalpakt wurde zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern beschlossen, in der folgenden Legislaturperiode ein neues Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten und gleichzeitig die Kommunen mit mehreren Milliarden Euro zu entlasten.
Der Auftrag
Im Koalitionsvertrag zur 18. Wahlperiode finden sich unter dem Stichwort »Eingliederungshilfe reformieren – Modernes Teilhaberecht entwickeln« folgende Aussagen:
Absprache der Regierungsparteien
»Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für mehr Inklusion brauchen einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen erarbeiten. Dabei werden wir die Einführung eines Bundesteilhabegeldes prüfen. Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen ›Fürsorgesystem‹ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger institutionszentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt werden. Wir werden das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände werden von Anfang an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess beteiligt.« (CDU u.a. 2013, S. 111) Zugleich wurde aber auch formuliert, dass durch die Reform keine neue Ausgabendynamik entstehen dürfe.
Jede dieser Koalitionsabsprachen stellt ein Programm dar. So bedeutet z.B. der Satz »die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren«, dass die fachliche Leistung der Eingliederungshilfe von den Leistungen der Unterhaltssicherung, also den Kosten der Lebensführung und der Unterkunft, getrennt werden soll. Bisher waren für den überwiegenden Teil der Menschen mit Behinderungen fachliche Leistungen nur zugänglich, wenn sie an den Ort zogen, an dem diese Hilfen angeboten wurde, also z.B. in ein Heim. Dadurch entstand eine Verknüpfung von fachlicher Leistung mit dem Ort des Lebens, beide konnten nicht getrennt voneinander in Anspruch genommen werden. Auch die Zunahme von ambulanten Leistungen hat bisher nicht oder nur wenig zum Rückgang stationärer Angebote beigetragen, allerdings in vielen Regionen aufgezeigt, dass auch umfängliche Hilfen ambulant, d.h. ohne Verknüpfung mit Unterkunft und Verpflegung, erbracht werden können.
Die Trennung der Fachleistungen und der Unterhaltsleistungen hat Konsequenzen für die Abrechnung der Leistungen. In einer stationären Einrichtung (Heim) werden alle Kosten aus der Eingliederungshilfe finanziert. Die Trennung beider Leistungen zieht somit auch eine fiskalische Fragen nach sich: Wer bezahlt was für wen? Auch diese Frage wird uns später noch beschäftigen.
In den Formulierungen des Koalitionsvertrags wird eine zweite wesentliche Wurzel des BTHG deutlich: die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Das »Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen« (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) vom 13.12.2006 wurde am 03.05.2008 von der Bundesrepublik ratifiziert. Differenzierte Informationen dazu finden sich auf den Seiten des Deutschen Instituts für Menschenrechte: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=467. Damit hat sich Deutschland verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen Rechtsgebieten vollständig umzusetzen. Über den Stand der Umsetzung ist gegenüber dem zuständigen Ausschuss zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) regelmäßig zu berichten.
Die Spannungspole
In der politischen Debatte stand das Ziel »Sicherung des Rechts auf Selbstbestimmung« stets dem zweiten Ziel »keine neue Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe« gegenüber. Die Kosten der Eingliederungshilfe waren in den Bundesländern in den vergangenen zwanzig Jahren dramatisch gestiegen, was vor allem der wachsenden Zahl der Bürgerinnen und Bürger mit entsprechendem Rechtsanspruch geschuldet war. Insofern stand während der Entwicklung des BTHG immer die zentrale Frage im Raum, welche Mehrkosten eine Reform mit sich bringt und von wem (Bund, Länder, Kommunen, andere Leistungsträger) diese zu tragen sind.
Partizipatives Verfahren
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sorgte frühzeitig für eine umfassende und systematische Beteiligung aller wesentlichen Akteure an der Entwicklung des Gesetzentwurfs. Es machte deutlich, dass nicht nur eine Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, 6. Kapitel) beabsichtigt sei, sondern auch eine Reform des SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, das die zentralen Vorschriften für Rehabilitationsleistungen enthält. Insofern waren von dem Gesetzesvorhaben auch alle Leistungsträger, die Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe zu erbringen haben unmittelbar in ihren Interessen berührt und entsprechend engagiert.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass das BTHG einen Ausgleich von sehr vielen und verschiedenen, gar gegensätzlichen Interessen herstellen musste, erschließt sich seine kompromisshafte Ausgestaltung besser. Die Interessen der verschiedenen Leistungsträger (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherungen, Jobcenter, Pflegekassen, Bund, Länder, Kommunen u.a.) liegen oft weit auseinander. Jeder Leistungsträger klärt zunächst, ob er zuständig ist und weist Aufgaben gern anderen Leistungsträgern zu. Jeder Zweig unseres Systems sozialer Leistungen wacht sorgfältig darüber, nicht durch neue gesetzliche Regelungen finanziell überfordert zu werden. Insbesondere die Frage, für welche Leistungen der Bund aufkommt und welche Leistungen die Länder tragen müssen, stellte im Gesetzgebungsverfahren eine wesentliche Ebene der Auseinandersetzungen dar. So kommt z.B. der Bund für die Kosten der Unterkunft eines Sozialhilfeempfängers auf, d.h. er erstattet diese Ausgaben den Ländern und diese wiederum den Kommunen. Die oben schon erwähnte Komplettfinanzierung eines Heims als Leistung der Eingliederungshilfe führt somit bei der Überführung der Eingliederungshilfe in ein fachlich ausgerichtetes Leistungsgesetz zu einer Folgefrage: Welche finanziellen Aufwendungen sind Aufgaben welcher Sozialleistungsträger?
Auch auf der Seite der Leistungserbringer standen die vielen verschiedenen Verbände mit ihren Positionen im Gesetzgebungsverfahren vor vielfältigen Herausforderungen, denn die Anliegen von Menschen mit Behinderungen sind keineswegs einheitlich und weichen darüber hinaus auch häufig von den Interessen der Leistungserbringer ab. Für beide treten die Wohlfahrtsverbände ein. Sie waren infolgedessen zu differenzierten Abwägungen gezwungen. Diese wurden nur scheinbar dadurch leichter, dass das Gesetz die Rechte der Leistungsberechtigten eindeutig stärkt und die Beteiligung der Leistungserbringer an den Planungsverfahren nicht zwingend vorsieht. Genau das wünschten sich die Leistungserbringer aber.
Neu und für das Verfahren und vor allem für das Ergebnis bedeutsam aber war die systematische Einbeziehung der Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen. Die Zahl dieser Verbände ist groß. Wer sich davon einen Eindruck verschaffen möchte, dem sei empfohlen, sich auf den Seiten der BRK-Allianz (www.brk-allianz.de), des Deutschen Behindertenrates (www.deutscher-behindertenrat.de) und der BAG Selbsthilfe (www.bag-selbsthilfe.de) über die Verbände zu informieren. Für das psychiatrische Arbeitsfeld ist nicht ohne Folgen, dass diese Selbsthilfeverbände mehrheitlich Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen vertreten. Auch in der Sprache des Gesetzes schlägt sich dieser Schwerpunkt nieder, wie später etwa noch an der Einführung von Begriffen wie »Assistenz« deutlich werden wird.
Das BMAS hatte alle Akteure eingeladen, sich an den Vorbereitungen des BTHG aktiv zu beteiligen. Im Rahmen einer AG Bundesteilhabegesetz wurden nahezu alle Themen und Aspekte unter wesentlicher Beteiligung der Verbände von Menschen mit Behinderungen diskutiert (alle Sitzungen der AG sind hier dokumentiert: https://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM/DE/AS/Umsetzung_BTHG/Sitzungen/Sitzungen.html;jsessionid=C880BC925086D9BBF4DC7599CCEF14A0.2_cid345?nn=9964332). Dass viele dieser Verbände am Ende über das Ergebnis tief enttäuscht waren, soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Die Beteiligung von Menschen mit Behinderung hatte aber ihre Wirkung: Durchgängig stärkt das BTHG die Rechte von Menschen mit Behinderungen gegenüber den Leistungsträgern und den Leistungserbringern – soweit und solange sie in der Lage sind, ihre Rechte selbstbewusst zu vertreten.
Bei Vorlage des ersten Arbeitsentwurfes aus dem BMAS zu Jahresbeginn 2016 zeigte sich, dass nicht wenige Themen zu Besorgnissen bei verschiedenen Akteuren führten. Die Abgrenzung der Eingliederungshilfe von anderen Leistungen, insbesondere von den Leistungen der Pflege bedurfte umfangreicher Beratungen im Bundestag und Bundesrat. Auch die Frage, wann Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen bei Leistungen mit ihrem eigenen Vermögen und Einkommen herangezogen werden, war sehr umstritten. Andere Themen, wie etwa die systematische Ausrichtung der fachlichen Leistungen am individuellen Bedarf der anspruchsberechtigten Menschen traten demgegenüber im öffentlichen Diskurs in den Hintergrund, markieren aber einen Paradigmenwechsel, auf den viele Leistungserbringer und -empfänger jahrelang hingearbeitet haben.
Formales
Das BTHG ist ein Artikelgesetz. Das bedeutet, das Bundesteilhabegesetz wird in einigen Jahren verschwunden sein, da es ein Gesetz ist, das mit insgesamt 27 Artikeln »nur« andere Gesetze ändert. Jeder Artikel beginnt mit den Worten »Das Gesetz … wird wie folgt geändert«. Diese Veränderungsvorschriften sind jedoch so umfassend, dass einige Gesetze, vor allem die Vorschriften zur Sozialhilfe (SGB XII) und das Recht der Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX) mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten neu gefasst sein werden. Wir sprechen also bei den Neuregelungen immer über die Neuregelungen in diesen Gesetzen, die peu à peu eintreten werden. Das macht alles etwas unübersichtlich. Deshalb werde ich in diesem Text die neuen Regelungen im SGB IX ab dem Jahr 2020 mit dem Begriff »SGB IX neu« (neue Fassung) bezeichnen und oft angeben, ab wann diese Fassung gilt. Gleiches gilt für das SGB XII, also die Sozialhilfe, das auch in vielen Schritten immer wieder neu gefasst wird.