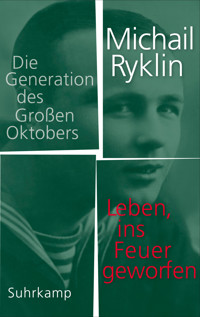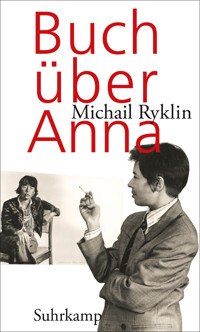
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Karfreitag 2008 verließ Anna Altschuk ihre Charlottenburger Wohnung. Drei Wochen später wurde sie tot aus der Spree geborgen. Bis heute glauben viele Menschen in Russland, dass die Künstlerin von orthodoxen Fanatikern umgebracht wurde. Wenige Jahre zuvor stand sie in Moskau wegen Verletzung religiöser Gefühle vor Gericht und war einer Hetzkampagne ausgesetzt. Wochen vor ihrem Tod hatte sie Morddrohungen im Internet gefunden. Der Philosoph Michail Ryklin versucht, Leben und Sterben Anna Altschuks, mit der er fast 35 Jahre verheiratet war, bis zu dem Tag ihres Verschwindens nachzuzeichnen. Die Spätzeit der Sowjetunion, die turbulenten 90er Jahre, die das Paar nach Frankreich, in die USA, nach Großbritannien und Deutschland führte, und die mit dem Machtantritt Putins beginnende »Eiszeit« bilden den zeithistorischen Hintergrund des Buches. Einfühlsam zeichnet Ryklin das Porträt einer sensiblen, von Selbstzweifeln gepeinigten Frau, die als Lyrikerin, Künstlerin, Feministin auf der Suche war. Er gibt Einblicke in die unabhängige Künstlerszene der Perestroika und macht begreifbar, wie ein Epochenbruch sich im persönlichen Leben auswirken kann: als Euphorie einer nie gekannten Freiheit und − ihre andere, dunkle Seite − als Zustand der Einsamkeit und Entwurzelung. Mit großer Offenheit erzählt er die Geschichte einer Ehe: auch ein persönlicher Überlebensbericht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Am Karfreitag 2008 verließ Anna Altschuk ihre Charlottenburger Wohnung. Drei Wochen später wurde sie tot aus der Spree geborgen. Bis heute glauben viele Menschen in Russland, dass die Künstlerin von orthodoxen Fanatikern umgebracht wurde. Wenige Jahre zuvor stand sie in Moskau wegen Verletzung religiöser Gefühle vor Gericht und war einer Hetzkampagne ausgesetzt. Wochen vor ihrem Tod hatte sie Morddrohungen im Internet gefunden.
Der Philosoph Michail Ryklin versucht, Leben und Sterben Anna Altschuks, mit der er fast 35 Jahre verheiratet war, bis zu dem Tag ihres Verschwindens nachzuzeichnen. Die Spätzeit der Sowjetunion, die turbulenten neunziger Jahre, die das Paar nach Frankreich, in die USA, nach Großbritannien und Deutschland führte, und die mit dem Machtantritt Putins beginnende „Eiszeit“ bilden den zeithistorischen Hintergrund des Buches.
Einfühlsam zeichnet Ryklin das Porträt einer sensiblen, von Selbstzweifeln gepeinigten Frau, die als Lyrikerin, Künstlerin, Feministin auf der Suche war. Er gibt Einblicke in die unabhängige Künstlerszene der Perestroika und macht begreifbar, wie ein Epochenbruch sich im persönlichen Leben auswirken kann: als Euphorie einer nie gekannten Freiheit und – ihre andere, dunkle Seite – als Zustand der Einsamkeit und Entwurzelung. Mit großer Offenheit erzählt er die Geschichte einer Ehe: auch ein persönlicher Überlebensbericht.
Michail Ryklin, 1948 in Leningrad geboren, Philosoph und Autor zahlreicher zeitdiagnostischer Bücher und Artikel über Russland, Gastprofessor an diversen Universitäten in Europa und den USA. 2007 erhielt er den „Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung“ für seinen Essay Mit dem Recht des Stärkeren. Russische Kultur in Zeiten der „gelenkten Demokratie“ (es 2006). 2008 erschien Kommunismus als Religion. Die Intellektuellen und die Oktoberrevolution. Ryklin lebt in Berlin und Moskau.
Anna Altschuk am Bücherregal
Michail Ryklin Buch über Anna
Aus dem Russischen von Gabriele Leupold
Suhrkamp Verlag
Die Originalausgabe erschien 2013 u. d. T. Pristan’ Dionisa. Kniga Anny
im Verlag Logos, Moskau.
Der Eindeutigkeit halber werden die russischen Namen und Titel
in den bibliographischen Angaben der Fußnoten, abweichend vom
Haupttext, in der wissenschaftlichen Umschrift wiedergegeben.
Der Autor dankt dem Hamburger Institut für Sozialforschung
und namentlich Jan Philipp Reemtsma für die langjährige
Unterstützung seiner Arbeit.
Die Übersetzerin bedankt sich für die Unterstützung ihrer Arbeit
durch den Deutschen Übersetzerfonds. e.V.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Georgy Kisewalter,
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-73752-1
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
9
I
Tod in Berlin
15
II
»Meine Zeit, mein Tier …«
63
Ein Dieb in unserem Haus
63
Die »Satanistin«
74
Der gestrauchelte Mineur
82
III
Porträt vor dem Hintergrund der Zeit
93
»Goldstück«
93
Aufstand gegen Ödipus
108
Liebe: In Träumen und im Wachzustand
125
»Über dem Sonnenlicht leben«
131
Politik im Spiegel der Träume
145
»Lieber Genrich«
150
»Ein Engelskind«
158
Die Freundin
163
IV
Berlin – Moskau – Berlin
185
»Berliner Euphorie«
185
»Kein Herz, nein …«
219
Epilog
253
»Der Hafen des Dionysos«
253
Postskriptum
273
Amarcord
273
Anhang
281
Anna Altschuk Notizen von der Anklagebank
283
Michail Ryklin »Verbotene Kunst« oder Ein Prozess der Sieger (fünf Jahre später)
314
»Pussy Riot« oder Die radikale Geste (acht Jahre später)
319
Bildnachweis
332
Buch über Anna
offen die tor
flügel ins blau – glaub – go(tt)
wärts
wo ist, dionysos,
dein hafen?
Anna Altschuk
Anna Altschuk mit Hut
Vorwort
Dieses Buch wurde in Etappen geschrieben.
Anfang 2009, ein Jahr nach Anna Altschuks Tod, hatte ich nur einen Berg von Entwürfen, Kommentaren und einzelnen Passagen, eine Struktur zeichnete sich noch nicht ab.
Das Buch entstand, Absatz für Absatz, zwischen Januar und Herbst 2011, Ende November war es praktisch fertig. Für die letzten paar Seiten fehlte mir dann über Monate die Kraft.
Nach und nach verwischen sich die Spuren eines aus dem Leben gegangenen Menschen. Anfangs bringt man es nicht übers Herz, seine Sachen anzurühren, selbst banalste Gegenstände wegzuwerfen erscheint als Frevel. Unmerklich jedoch fordert die Zeit ihr Recht: Dies oder jenes wird den Verwandten übergeben, geht ans Rote Kreuz, wird aufgetragen oder verschwindet einfach – die Spuren verblassen und sind nur noch mit Mühe lesbar.
Es bleibt das Archiv, das für die Zukunft bewahrt werden soll.
Diesen Sommer war ich nach sieben Jahren zum erstenmal wieder einen Monat lang auf der Datscha. Das Haus hatte leergestanden, die Zeit war quasi stehengeblieben, und die Spuren von Anjas Leben, an anderen Orten schon ausgelöscht, hatten sich unberührt erhalten. Der moosbewachsene Feldstein am Eingang, hergeschafft in den achtziger Jahren, der Zeit von Anjas Begeisterung für die japanische Ästhetik, drei Blumenstauden, von ihr selbst gesetzt, die Kleider, die sie bei der Gartenarbeit trug, ihr Zimmer im ersten Stock.
Auf der Datscha, zwischen diesen Spuren merkte ich plötzlich: Jetzt werden sich die letzten Seiten ohne Mühe schreiben lassen.
Während der Arbeit fragte ich mich zum ersten Mal: Für wen ist das Buch eigentlich gedacht? Bis dahin hatte ich geschrieben, ohne mir darüber Gedanken zu machen, wer und wie zahlreich die Leser sind und was ihr Interesse weckt. Diesmal sah ich beim Schreiben nicht anonyme Leser, sondern die Freunde, die Anna Altschuk gut kannten, von ihrem Tod schockiert waren und aufrichtig erfahren wollten, wie ihr Leben tatsächlich zu Ende ging.
Warum ich mich an die Freunde wende, ist nicht schwer zu verstehen.
In Russland hatte die Freiheit der Kunst, für die Anna Altschuk kämpfte, in den Jahren seit ihrem Tod eine Niederlage nach der anderen erfahren. 2013 stellt sich die Situation noch hoffnungsloser dar als vor zehn Jahren, als Annas »Leidensweg« erst begann. In einem Land, in dem die Homophobie hochkocht, in dem das Gesetz ausschließlich die »Gefühle der Gläubigen« schützt und man für ein »Punk-Gebet«, nach einem Ausdruck von Präsident Putin, »zwei Jährchen« kriegt, kann mein Buch, wenn es nicht auf aggressive Ablehnung stößt, bestenfalls mit Verdrängung und Totschweigen rechnen.
In Deutschland, wo das Schicksal meiner Frau eine unerwartete Medienresonanz fand und eine Welle des Mitgefühls von Hunderten unbekannter Menschen auslöste, kann man sich Leser vorstellen; in meiner Heimat aber hat sich ihre mögliche Zahl durch die Umstände auf einen kleinen Kreis reduziert – den der Freunde.
Bisher habe ich über Themen gearbeitet, die nicht direkt mein eigenes Leben betrafen. Das Buch über Anna wurde niedergeschrieben als bereits fertig Vorhandenes, wie ein Traum oder eine als geschlossen anzusehende Welt, wie sie von Halluzinogenen hervorgerufen wird. Akademisch geschult, sträubte ich mich nach Kräften gegen die verführerische Anziehung des Unmittelbaren, des Spontanen und anderer Erscheinungsformen der Trauerarbeit, bis ich ihrem Druck schließlich nachgab. Dies ist ein Buch über eine dem eigenen Leben entrissene Zeit, ein Text in zwei Stimmen, ohne dass die erste einem für die Erzählung zuständigen Autor gehören würde; hier mischt sich ständig die Stimme jener ein, die nach der Logik des faktisch Geschehenen verstummt sein, Gegenstand der Erzählung hätte werden müssen, deren Leben auf den Buchseiten aber auf paradoxe Weise andauert, indem sie sich selbst sucht, außerhalb der Zeit. Die vielen Begebenheiten eines fremden Lebens hätte ich mir in all seinen Einzelheiten niemals vergegenwärtigen können ohne Annas Träume und Gedichte, ohne ihre Deutung der eigenen transgressiven Erfahrung. Ohne ihre Hoffnung, am Ende des Wegs den »Hafen des Dionysos« zu erblicken.
Während der Arbeit begriff ich, warum Warlam Schalamow, der seine Erzählungen aus Kolyma al fresco schrieb, an seinen Texten prinzipiell nichts mehr änderte, sie nicht mehr umschrieb: Die spontane Arbeit des Gedächtnisses unterscheidet sich radikal von der Gestaltung eines literarischen Werks, sie offenbart sich in kurzen Eruptionen, von denen keine erneuert, reproduziert werden kann.
Schwer zu sagen, wovon der Abschluss der Trauerarbeit abhängt, von der Zeit oder vom Schreiben, und ob sie überhaupt abschließbar ist. Die Last wird leichter, aber man trägt sie weiter.
Jedenfalls ist der therapeutische Effekt des Schreibens, wenn man ihn erreicht, nur ein eingeschränkter.
Doch wie verzweifelt die Lage auch sei, die Welt hinter dem »Rubikon«, jenseits des »Hafens des Dionysos« existiert nach eigenen Gesetzen. Sie gibt die Hoffnung und die Kraft, zu Ende zu schreiben.
Moskau, August 2013
Anna Altschuk sitzend
I Tod in Berlin
19. März 2008. Früher Morgen im Berliner Flughafen Tegel. Verschlafene Passagiere trinken Kaffee aus Pappbechern.
Wir fliegen so früh, weil der Südwestrundfunk mich in eine Sendung gebeten hat, die um zehn Uhr beginnt.
In Stuttgart holt uns eine junge Frau vom Touristenbüro mit dem Auto ab, und während ich im Sender mit dem Moderator Wolfgang Heim spreche, zeigt sie Anna die Stadt.
Dann erwartet uns eine einstündige Fahrt nach Gschwend, wo am Abend mein Auftritt im »bilderhaus«, dem örtlichen Kulturverein, stattfinden soll.
Wir wohnen im »Romantikhotel Schassberger am Ebnisee«, einem kleinen, halbfamiliären Hotel, und Anna Altschuk und ich haben aus irgendeinem Grund das »Hochzeitszimmer« bekommen, das offensichtlich für Frischvermählte gedacht war. Als ich meiner Frau ins Russische übersetze, wie unser Zimmer heißt, lacht sie nervös auf. Das Zimmer ist gemütlich, sogar elegant: in Pastelltönen gehalten, die Sessel weiß bezogen, schwere Gardinen vor den Fenstern, Seeblick.
Als wir 1975 heirateten, machten wir keine Hochzeitsreise im klassischen Sinn, wir fuhren einfach für eine Woche zu Verwandten nach Leningrad; wenn wir die vorletzte Nacht in Annas Leben wie Jungvermählte in einem Hochzeitszimmer verbrachten, scheint sich der Kreis unseres gemeinsamen Lebens auf sonderbare Weise zu schließen.
Ich denke, Anna hatte das Symbolische der Situation genau erfasst.
Der Auftritt im »bilderhaus« verlief, wie solche Veranstaltungen über Russland üblicherweise verlaufen: am Beispiel der Ausstellung »Achtung, Religion!« ging es zum wiederholten Mal um die Unterstützung, die der Staat dem orthodoxen Fundamentalismus gewährt. Ich schloss mit den Worten: »Russland wird auf jeden Fall ein demokratisches Land werden, schade nur, wenn das ohne die Unterstützung Europas geschieht« – wofür ich Applaus erntete.
Nach dem Auftritt kamen zwei alte Damen, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, zu uns und erzählten, dass während der Veranstaltung ein sonderbarer Unbekannter (in diesem Klub kannten die Leute einander fast alle) im Saal gewesen sei; er sprach mit – wie sie meinten, slawischem – Akzent, benahm sich aggressiv, empörte sich lautstark, und als man, um ihn zu besänftigen, fragte, wer er sei, stellte er sich als unser Personenschutz vor.
Natürlich haben wir nie Personenschutz gehabt.
Die Bühne war hell erleuchtet, sodass ich die hinteren Reihen nicht erkennen konnte. Aber den Mitarbeiterinnen kam dieser Typ gefährlich vor, sie wiederholten mehrfach »Seien Sie vorsichtig!«. Ich nahm die Sache scherzhaft auf: »Das Schlimmste kann man über mich im Internet lesen.« Und Anna, der das Gespräch übersetzt wurde, lachte und sagte: Mit erbosten Leuten kann man uns nicht in Erstaunen versetzen, wir haben die letzten Jahre in Moskau ganz andere Dinge gesehen.
Nach unserer Rückkehr ins Hochzeitszimmer liebten wir uns wie »Jungvermählte«; einer flüchtigen Bemerkung Anjas am nächsten Morgen entnahm ich, dass sie sich an nichts erinnerte. Ich zuckte innerlich zusammen.
Vor dem Frühstück badeten wir im Swimmingpool und freuten uns an den blauen Lichtreflexen, die an der gläsernen Decke spielten. Dann fuhr uns die Künstlerin Brigitte Marquardt in ihrem Auto nach Stuttgart, wir liefen den ganzen Tag durch Ausstellungen, und schließlich nahm sie uns mit in ihr Atelier, um uns ihre Arbeiten zu zeigen. In einem Café im Stadtzentrum aßen wir zu Mittag.
Auf der Rückreise war ich so müde, dass ich auf dem Stuttgarter Flughafen meinen Schal verlor und in Berlin die Wollmütze.
Am 21. März wachten wir gegen Mittag auf. Ich schaltete einen Moskauer Radiosender ein: ein Interview mit einem Soziologen, den ich als gebildeten Menschen und guten Übersetzer kannte; jetzt sang er ein Loblied auf Stalin, verlangte die Einführung einer religiös-patriotischen Erziehung an den Schulen und schimpfte auf die Demokraten.
Zugegeben, wir hatten uns an solche »Überraschungen« gewöhnt, aber die Stimmung hoben sie nicht.
Vor dem Frühstück fing Anna plötzlich damit an, wie schlecht sie sich vor einer Woche auf der Buchmesse in Leipzig gefühlt habe, wie schlecht es ihr überhaupt gehe. Bis dahin hatte sie die kurze Reise gelobt, alles hatte ihr gefallen, und jetzt … Meine Laune ging in den Keller, und während des Frühstücks schwieg ich gekränkt.
Dann sprach Anna plötzlich von zwei Frauen, die den Kontakt zu ihr gesucht hätten, sie habe sie zurückgestoßen, und heute tue es ihr sehr leid. In den letzten Monaten bekam das, was sie sagte, überhaupt etwas Neues, rätselhaft Endgültiges, als ob sie einen Punkt setzen, Bilanz ziehen wollte. »Wir werden auch in einem Jahr in Berlin leben …« – »Nein, du wirst in Berlin leben«.
Und nun, nach der Erwähnung der beiden Frauen, sagte Anja, dass sie sich an keine weiteren Handlungen erinnere, die ihr heute leid täten, dass sie im Leben niemanden gehasst habe … Ich fuhr aus der Haut: »Du hasst mich!« Sie zuckte zusammen, wie von einem Stromstoß getroffen, ihr Gesicht verzog sich wie nach einem schweren Schlag. Danach sprachen wir wenig.
Wir brauchten eine Überdecke für unser Bett und fuhren zum »Zillehof« in die Fasanenstraße, wir hatten auf diesem Trödelmarkt schon oft für wenig Geld alle möglichen Kleinigkeiten gekauft. Dass Karfreitag war und alle Geschäfte geschlossen hatten, wussten wir nicht.
Auf der Rückfahrt im Doppeldeckerbus blieb Anna unten sitzen. Als ich zum Aussteigen herunterkam, fiel mir auf, dass sie wie ein Spatz zusammengekauert hockte, sehr angespannt, als wollte sie eine Entscheidung treffen. Nicht zum ersten Mal in diesen Wochen hatte ich ein ungutes Vorgefühl.
Zu Hause stürzte sie zum Telefon und rief zwei Freundinnen an, um sich zu verabreden. Aber die eine litt nach ihrer Strahlentherapie an Fieber, die andere hatte Grippe. Ich saß auf dem Ledersofa im Wohnzimmer und hörte aufmerksam zu. Die letzten Wochen verfolgte ich Anna ständig mit dem dritten Auge, einem Organ, das sich unweigerlich meldet, wenn das Verhalten deiner Nächsten plötzlich unberechenbar wird. Das Gespräch schien mir ganz unverdächtig – mit der einen Freundin verabredete sich Anna für den übernächsten Tag, mit der anderen für Anfang der kommenden Woche.
Dann machte sie sich ein paar Minuten im Flur zu schaffen, kam wieder herein und erklärte, sie werde zu »Kaiser’s« gehen und etwas zu essen einkaufen, außerdem hätten wir kein Waschpulver mehr.
Als nach Anja gesucht wurde, zerbrachen sich die Journalisten den Kopf darüber, wohin denn »diese sonderbare Russin« am Karfreitag gegangen sein könnte – es war ja alles zu; russische Journalisten stellten sich vor, sie sei in einen nahe gelegenen russischen Laden gegangen, denn das orthodoxe Osterfest lag später.
In Wirklichkeit war alles ganz simpel: Wir lebten das erste Jahr in Deutschland, waren spät in der Nacht aus Stuttgart zurückgekommen, völlig übermüdet, und weder sie noch ich hatten überhaupt begriffen, dass Feiertag war und alles ringsum geschlossen.
An dieser scheinbaren Kleinigkeit lässt sich ablesen, in welchem inneren Zustand wir uns befanden.
Den Satz »Ich gehe zu ›Kaiser’s‹ Waschpulver kaufen« sprach sie vollkommen natürlich aus, er weckte bei mir keinen Verdacht.
Ich blieb auf dem Sofa sitzen und las. Dass es ihre letzten Worte gewesen waren, kam mir erst drei Wochen später zu Bewusstsein.
Die drei Stunden nach Anjas Weggehen war ich in mein Buch vertieft.
Ich wunderte mich nicht – Anja hatte in Berlin viele Freunde, die ich zum Teil gar nicht kannte: Vielleicht war sie zu ihnen gegangen, wie sie es schon ab und zu getan hatte.
Ich schrak erst auf, als ich merkte: sie hatte ihr Handy dagelassen, und auf dem Küchentisch lagen ein paar nachlässig zerknüllte Zehneuroscheine.
Ich begann überall anzurufen – sie war nirgends.
Verzweifelt rannte ich hinunter zum S-Bahnhof vor unserem Haus. Das Wetter war entsetzlich, Schneeregen, starker Wind; in meinem Kopf trudelte aus irgendeinem Grund Puschkins »Alles war Nacht und Wirbelsturm«1. Ich stand lange auf dem Bahnsteig, und als ich schließlich vor Kälte schlotterte, ging ich nach Hause, um mich aufzuwärmen. Ich lief um den Lietzensee, versuchte Anna im Finstern, beim trüben Licht der wenigen Laternen auszumachen und dabei die unerträgliche Spannung loszuwerden oder wenigstens ein klein wenig abzubauen.
Dann wieder der Bahnsteig, wieder der Lietzenseepark, vier Stunden rannte ich hin und her.
Warum habe ich nicht gleich die Polizei gerufen? Erstens aus tief sitzendem Misstrauen gegenüber Vertretern des Staates, Menschen in Uniform – ihre Hilfe nimmt man als gelernter Sowjetbürger nur im Extremfall in Anspruch. Zweitens war niemand da, mit dem ich mich hätte beraten können – ausgerechnet an diesem Tag war keiner meiner nächsten Freunde in Berlin. Und drittens hoffte ich natürlich auf ein Wunder: Vielleicht würde Anja ja plötzlich doch noch auftauchen, sich von selbst wieder materialisieren.
Gegen 23 Uhr rief ich die Polizei an. Ich kam nicht gleich durch. Am anderen Ende schien man wenig begeistert von dem späten Anrufer, man bat mich, persönlich auf dem Revier zu erscheinen. Es kostete mich einige Mühe zu erklären, dass ich Ausländer bin und mich schlecht auskenne, dass ich gar nicht weiß, wo sie eigentlich sitzen. Schließlich gab die Stimme nach und erklärte sich bereit, eine Streife zu schicken, notierte meine Adresse und bereitete mich darauf vor, dass es dauern könne.
Um Mitternacht erschienen zwei Polizisten bei mir, ein Mann und eine Frau. Sie waren munterer Stimmung, sogar etwas zu Späßen aufgelegt. »Vielleicht zieht sich Ihre Frau jetzt gerade ein Bierchen rein und amüsiert sich, und morgen früh taucht sie gesund und munter wieder auf«, trösteten sie mich schon beim Hereinkommen. Ich weiß nicht, ob es für solche Fälle besondere Instruktionen gibt oder ob das ihre spontane Äußerung war, aber ich glaube, mein niedergeschlagenes Gesicht überzeugte sie, dass der Fall anders lag: Irgendwelche Ehefrauen mögen sich vielleicht jetzt gerade in einer Bierbar vergnügen, aber bestimmt nicht meine. Das hat sie nie getan, versicherte ich, ihr Verschwinden muss man ernst nehmen, sehr ernst.
Schließlich wirkte das Mantra. Sie baten mich um Annas Ausweis und erstellten ein Protokoll über das Verschwinden der russischen Staatsbürgerin Michaltschuk Anna Aleksandrowna, geboren 1955 im Gebiet Sachalin …
Die ganze Nacht tat ich kein Auge zu. Der Organismus besitzt für Extremsituationen eine eiserne Reserve, dank deren er Belastungen, die unter gewöhnlichen Umständen unvorstellbar sind, scheinbar widerspruchslos aushalten kann.
Am Morgen schleppte ich mich ins Polizeirevier zum nahen Kaiserdamm. Man ließ mich nicht hinein; über die Gegensprechanlage informierte mich eine schrecklich ferne und gleichgültige Stimme: Ja, man wisse Bescheid, die Meldung über das Verschwinden meiner Frau sei aufgenommen, aber vor Dienstag (und es war Samstag!) könne man sich mit der Suche nicht befassen, man habe wenig Mitarbeiter, und auch diese seien heute – natürlich, wegen der Feiertage – nicht im Dienst.
Drei Tage: eine Ewigkeit!
Jetzt begriff ich endgültig: Die Polizei, nicht nur die beiden Beamten von gestern, nahm Annas Verschwinden als Routinefall, als gewöhnliches Vorkommnis, mit dem man sich wegen der Osterfeiertage (und auch, wie ich später erfuhr, gemäß den Dienstvorschriften, wonach nur beim Verschwinden von Kindern sofort gehandelt werden muss) nicht befassen kann.
Ich wählte die Handynummer von Sylvia Sasse, der Direktorin des Instituts für Slawistik der Humboldt-Universität: Sie war geschockt, bot mir an, sofort einen Brief mit Erklärungen zum möglichen politischen und religiösen Hintergrund von Anna Altschuks Verschwinden zu schreiben, den sie selbst zur Polizei tragen würde. Wir riefen J. W. an, meine Hilfskraft an der Universität, er war mit seinen Eltern in den Urlaub Richtung Schweiz unterwegs; als sie erfuhren, was geschehen war, kehrten sie um, kamen nach Berlin und halfen mir bis zum Abend. J. saß an meinem Computer und tippte einen vertraulichen Brief an die Polizei; darin ging es um die religiös motivierten Angriffe auf meine Frau in Moskau und um die Drohungen, die wir von Fundamentalisten erhalten hatten. Sylvia redigierte den Brief und brachte ihn zur Polizei mit der dringenden Bitte, sich dieses besonderen Falles unverzüglich anzunehmen.
Das Schwungrad der Ermittlung begann sich schneller zu drehen. Jetzt bekam ich regelmäßig Besuch von Kriminalbeamten – stets paarweise, ein Mann und eine Frau, und für kurze Zeit schien sich auch der Staatsschutz eingeschaltet zu haben. Sie befragten mich zu meiner Frau, ob sie zurechnungsfähig war, ob sie sich in psychiatrischer Behandlung befand, mit wem sie vor dem Weggehen gesprochen hatte, ob es Selbstmordversuche gab. Ich machte kein Geheimnis aus ihrer depressiven Stimmung, besonders in den letzten Monaten, bat aber dringend um Beachtung der besonderen Umstände und daraus abzuleitender alternativer Szenarien. Ganz unabhängig von der politischen Verfolgung war das sinnvoll: Wenn aus depressiven Verstimmungen automatisch der Suizid folgte, dann würde diese Epidemie allein in Europa sofort ein gutes Drittel der Bevölkerung dahinraffen.
Außerdem hat, wie mir heute klar ist, eine Entführung einen wichtigen psychologischen Vorzug vor jedem anderen Ausgang – denn nur in diesem Fall ist der dir nahestehende Mensch vielleicht noch am Leben. Darum klammern sich verzweifelte Angehörige unwillkürlich daran.
Die Argumente für eine mögliche Entführung oder Rache seitens religiöser Fanatiker überzeugten die Mitarbeiter vom Staatsschutz nicht, umso weniger, als wir in Berlin keine Drohanrufe bekommen hatten. Mit dem Fall von Anna Altschuks Verschwinden befasste sich die Vermisstenstelle der Berliner Kriminalpolizei. Ihr Leiter, Kriminalhauptkommissar N. G. (später bat er, falls ich darüber schreiben würde, seinen Namen nicht zu nennen), besuchte mich einige Male zu Hause. Er war ein großer, hagerer, etwas phlegmatischer Mann in dunkelgrünem Dienstpullover. Er sprach leise, sein Äußeres war unauffällig – solche Leute erkennt man auch nach dem zweiten oder dritten Treffen nicht auf der Straße. Seit mehr als zwanzig Jahren sei er mit der Suche nach Vermissten befasst, in dieser Zeit habe er so allerlei gesehen und sei zu dem Schluss gekommen, dass es im Verhalten potenzieller Selbstmörder (Anna ordnete er von Anfang an in diese Kategorie ein, und ich habe diese Sicherheit nie erschüttern können) keinerlei Logik gebe. Jemand erklärt, er gehe ein Bier trinken (das klingt banal, aber die Deutschen müssen, wenn sie anschaulich sein wollen, unbedingt ihr Nationalgetränk erwähnen), und in Wirklichkeit nimmt er sich ein Hotelzimmer und erhängt sich. Kürzlich haben die Mitarbeiter seiner Dienststelle die Leiche eines Mannes gefunden, der vor gut einem Monat verschwand; der Körper war in der Spree an einem Baumknorren hängengeblieben und lange nicht aufgetaucht. Die Angehörigen versicherten unterdessen, dass der Vermisste Feinde habe, und führten die Ermittlung auf eine falsche Spur (eine leicht durchschaubare Andeutung, dass ich anders handeln möge). Auf seine Bitte gab ich ihm Zahnbürste und Kamm, den russischen Inlandspass und das Mobiltelefon von Anna.
Ich war tatverdächtig, und das Haus stand, wie mir anschließend klar wurde, unter Beobachtung, aber mir in meinem damaligen Zustand ernsthaft vorzustellen, dass man mich des Verschwindenlassens meines nächsten Menschen verdächtigt, war vollkommen unmöglich.
Ich erfuhr all das fast ein Jahr später, als ich N. G.s Berichte über unsere Gespräche in der Sache Anna Michaltschuk las; ein Bekannter, ein prominenter Anwalt, hatte das Dossier bei der Staatsanwaltschaft bestellt und für mich kopiert.
Am Donnerstag, den 27.03.2008 wurde Dr. Rykline in der Wohnung durch KHK G[…] aufgesucht und befragt. Er erklärte noch ausführlicher als bisher, dass seine Frau in Berlin unter schubweise auftretenden Depressionen leide. Die dazu führenden Ursachen zählte er auf. Er hatte zum Arztbesuch geraten, seine Frau wollte das nicht, zum einen war sie der Meinung, ein russisch sprechender Psychiater/ Analythiker sei in Berlin nicht vorhanden, zum anderen hätte sie keine Zeit dafür. Dazu gab er an, dass seine Frau viel am PC gearbeitet hätte für die Tätigkeit am Inst. f. Slawistik […]
Auf Frage erklärte er, dass seit dem Verschwinden keine Lösegeld- oder anderweitige Forderungen eingegangen seien. Auch geheimnisvolle, angsteinflössende Anrufe gebe es nicht.
[…]
Dr. R. glaubt nach wie vor, dass man durchaus seiner Vermutung nachgehen solle, dass seine Frau auch entführt worden sein könne. Um die Hintergründe besser verstehen zu können, überlies er eine seiner Taschenbuchausgaben seines Buches ›Mit dem Recht des Stärkeren‹2.
Beim Verlassen der Wohnung fiel auf, dass in der Küche viele Tabletten, kyrillisch beschriftet, auf der Arbeitsfläche standen. Darauf angesprochen, erklärte Dr. R., das seien keine Medikamente, sondern Mineralien und Vergleichbares.
[…] Als ich im Treppenhaus stand, klingelte es in der Wohnung Dr. Rykline’s. Es kam eine ältere Frau hoch, die auf Frage angab, spontan engagiert worden zu sein um in der Wohnung für Ordnung zu sorgen. Sie kam zum ersten Mal. So hielt ich die Personalien nicht fest.3
Während für den Studenten Raskolnikow, der die alte Wucherin und ihre Schwester erschlug, das Spiel mit dem Untersuchungsrichter Porfirij Petrowitsch voller verborgener Nuancen und Unausgesprochenem und vom Ermittler unbemerkt aufgestellten Fallen steckte, war in meinen Gesprächen mit N. G. alles prosaisch: die Putzfrau, die Zahnbürste, Nahrungszusätze. Im Umgang mit ihm konnte ich mir, im Gegensatz zu den poetischen Ergüssen von Dostojewskijs Figuren, den Luxus der Prosa leisten.
Übrigens geht eine Beobachtung aus Verbrechen und Strafe über das Katz-und-Maus-Spiel des Untersuchungsrichters mit Raskolnikow hinaus und hat direkten Bezug zu meiner Geschichte: »Jenen allgemeinen Fall, jenen Fall, von dem alle juristischen Formen und Regeln abgeleitet sind, von dem sie aber auch ausgehen, um in Büchern aufgezeichnet zu werden – den gibt es überhaupt nicht, eben aus dem Grund, weil jede Tat […] sich, sobald 〈sie〉 in der Wirklichkeit geschieht, in einen absoluten Einzelfall verwandelt; […] in einen, der sich mit keinem der bereits vorgefallenen vergleichen lässt.«4
Je mehr N. G. aus der Schule plauderte, umso stärker spürte ich das Singuläre meines »absoluten Einzelfalls«; für meinen Gesprächspartner gab es nichts Neues unter der Sonne, für mich aber war alles neu: die Reaktion der Menschen, das Wetter, die Bodenlosigkeit, die sich vor ein, zwei, drei Tagen, vor einer Woche aufgetan hatte …
Eine Woche später, am 28. März, gab die Berliner Polizei die Nachricht vom Verschwinden der Bürgerin der Russischen Föderation Anna Aleksandrowna Michaltschuk an die Presse – ein Ereignis, das einem Vulkanausbruch gleichkam.
Vor der Tür meines Universitätsbüros in der Dorotheenstraße drängten sich die Journalisten. Es waren Reporter, die sich mit Verbrechen und Gerichtssachen befassten, für mich eine neue Sorte von Profischreibern. Sie schienen einander gut zu kennen und hatten eine eigene Auffassung von Konkurrenz: Die einen warnten vor der Heimtücke der anderen, besonders die Reporter der BILD-Zeitung bekamen von den Kollegen ihr Fett ab. Ich erinnerte mich mit Bitterkeit an die Worte Andy Warhols: »In Zukunft kann jeder Mensch für 15 Minuten Berühmtheit erlangen.« Jetzt war ich es, der wider Willen zu dieser Berühmtheit kam, wobei ich allerdings das Gegenteil dessen erlebte, was der amerikanische Popkünstler jedem Sterblichen wünschte. Die Journalisten, die mich früher interviewten und zu meinen Büchern oder zu politischen Ereignissen befragten, hatten eine vergleichbare Ausbildung wie ich und redeten in derselben Sprache. Jetzt aber richtete sich das intensive, invasive und schamlose Interesse auf einen intimen, labilen, empfindlichen Bereich; ich fühlte mich unsicher, vor allem aber hatte ich Angst, mit einem falschen Wort den letzten Funken Hoffnung zu zerstören.
Den Reportern konnte ich auch zu Hause nicht entrinnen: Sie gaben sich die Klinke in die Hand, einzeln und in Gruppen. Ich hätte mich am liebsten in eine Ecke verkrochen, um allein zu bleiben mit meinem Schmerz, aber diese Leute hatten einen Trumpf in der Tasche – das Versprechen, Annas Photo in die Zeitung zu setzen. Bei der Millionenauflage der BILD-Zeitung bedeutete das eine rettende Möglichkeit: Vielleicht würde jemand meine Frau erkennen und helfen, sie zu finden! Ich weiß nicht mehr, wie viele Interviews ich gegeben habe in diesen wenigen Tagen; ich versuchte, soweit es in meinen Kräften stand, niemanden abzuweisen, schon gar nicht die Berliner Lokalberichterstatter.
Die wichtigste Frage der Pressevertreter – was war mit meiner Frau geschehen, was war der Grund für ihr Verschwinden – konnte ich damals, von schüchternen Mutmaßungen über eine mögliche Entführung, eine Rache, einen Unfall, eine Kurzschlusshandlung abgesehen, nicht beantworten. Dass meine Frau in Moskau vor Gericht stand und freigesprochen wurde, hatten sie dem Internet entnommen. Ich erzählte den Journalisten von den Drohungen per Telefon und im russischen Netz und versuchte ihnen zu erklären, dass Anna Altschuk eine politische Rolle spielte, ohne es zu wollen, dass diese Rolle ihr von den Umständen aufgezwungen wurde. »Meine Frau«, sagte ich immer wieder, »war vor allem Lyrikerin, Künstlerin, Kunstkritikerin.«
Die Massenpresse hat ihre eigene Leserschaft und ihre eigene Sprache, und es wäre naiv zu erwarten, dass es auf dem Weg zum großen Publikum ohne wesentliche Vereinfachungen abgeht. Anna wurde zur »Putin-Kritikerin«, zur »Kreml-Kritikerin«, zur »Kritikerin der russischen Macht«; ein Journalist der New York Times brachte ihr Verschwinden mit dem Mord an Anna Politkowskaja und der Vergiftung von Aleksandr Litwinenko5 in Verbindung. Am ausführlichsten reagierte der Berliner Tagesspiegel. Zwei Journalisten informierten über die Einschaltung des deutschen Staatsschutzes, der allerdings kein politisches Motiv entdecken konnte. »›Das Paar ist mit dem russischen Staat aneinandergeraten. Die Entführung aus politischen als auch aus finanziellen Motiven heraus ist aber unwahrscheinlich‹, heißt es intern beim Landeskriminalamt. … Aufgrund ihrer Erfahrungen in Russland hätten die beiden zudem bemerkt, wenn sie hier ausspioniert worden wären, sagte ein Ermittler.«6 Was soll man dazu sagen? Die Polizei hat unsere Erfahrung mit der äußeren Überwachung deutlich überschätzt; wer nicht speziell geschult ist, wird wohl kaum in der Lage sein, eine Beschattung wahrzunehmen.
Der BILD-Zeitung fiel nichts Besseres ein, als »Nackt-Künstlerin verschollen!« und »Nackt-Künstlerin im Lietzensee versenkt?« zu titeln. Das Blatt scheute sich auch nicht, seine Artikel mit Arbeiten von Anna zu illustrieren, die aus dem Internet heruntergeladen wurden. »›Ich habe keine vernünftige Erklärung für ihr Verschwinden‹, sagt ihr Mann Michail Ryklin zu BILD.«7 Sie berichteten von den Polizeitauchern, den Leichenspürhunden und achtzig Mitarbeitern der Polizei, die am 28. März 2008 die Umgebung des Lietzensees und die nahe gelegenen Schrebergärten durchkämmten.
Die Suche blieb ergebnislos.
Die meisten russischen Zeitungen versäumten nicht zu erwähnen, dass wir »im schicken Bezirk Charlottenburg« wohnen – als wäre klarzustellen, dass nicht hoffnungslose Armut die Russin zu diesem Schritt getrieben hatte. Wichtig war vielmehr der Hinweis, dass sich die Kritiker der russischen Macht im Westen nicht schlecht einrichteten.
Der nachdenklichste Artikel stammt von dem Deutschland-Korrespondenten der Nowaja Gaseta Sergej Solowkin und trägt den Titel »Philosophische Suchaktion. Die Polizei weiß nicht, wie die Ehefrau des Philosophen in Berlin verschwinden konnte«. Solowkin rief mich aus München an und befragte außerdem einige Berliner Bekannte. Kein einziger fand die Version der Polizei vom Selbstmord überzeugend. Eine der Gesprächspartnerinnen erzählte dem Journalisten, ihres Wissens sei Anna zum Katholizismus übergetreten und habe Zuflucht in einem Kloster für Arme gefunden. Doch auch in diesem Fall verlangt das Gesetz, den neuen Aufenthaltsort binnen dreier Tage bei den Behörden zu melden.8
Skeptisch gegenüber der Version des Selbstmords »dieser sonderbaren Russin«, wie die Polizei sie jetzt nannte, war auch die Berliner Psychoanalytikerin Eugenia Graf. Ihre Vorstellung von den Handlungen, die das gewaltsame Beenden des Lebens begleiten, widersprechen sichtlich dem, was N. G. mir einschärfen wollte: »In jeder, selbst der gewöhnlichsten Situation hinterlässt ein Mensch, der mit dem Leben abschließen will, unbedingt ein Zeichen. Sogar ein Selbstmord unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen äußeren Auslösern wird nicht spurlos begangen. Irgendein Signal wird immer hinterlassen.«
Ich weiß nicht, ob das für alle Selbstmörder gilt, aber in Anjas Fall hatte Frau Graf recht – sie hinterließ eine Vielzahl von Zeichen und chiffrierten Botschaften.
Doch zum damaligen Zeitpunkt hatte die Ermittlung keine heiße Spur, nicht einmal einen Hinweis, dem sie nachgehen konnte. Obwohl Anjas Photo in allen sich bietenden Berliner und überregionalen Zeitungen erschien, gab es niemanden, der sie erkannt und auf eine richtige Fährte geführt hätte. N. G. informierte mich vom Anruf eines deutschen Notars aus Portugal, dem beim Ausführen seines Hundes im Grunewald eine in Lumpen gehüllte unglückliche Frau aufgefallen sei, die meiner Frau sehr ähnlich sehe; ein anderer Anrufer habe sie am Steuer gesehen.
Aber Anja fuhr nicht Auto, und im Wald hätte sie ohne Nahrung und ein Dach über dem Kopf wohl kaum eine Woche leben können.
In unserem Bezirk hingen Dutzende Vermisstenanzeigen mit zwei Farbphotos von Anna aus (mit und ohne Brille), auf denen die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bat, doch niemand reagierte. Dabei sind die Deutschen bekannt für ihre Beobachtungsgabe, die Aufmerksamkeit für kleinste Details und ihren analytischen Scharfsinn. Natürlich spielten die Ostertage und das extrem schlechte Wetter am 21. März eine Rolle, doch das Fehlen jedes Anhaltspunktes in dieser Sache erstaunte sogar einen so erfahrenen Ermittler wie N. G.
Lange Zeit in völliger Ungewissheit über das Schicksal eines nahen Menschen zu leben ist unerträglich. Der Autor des Satzes »Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende« hat vermutlich einen ähnlichen Verlust erlebt. In der traumatisierten Person entsteht das Gefühl einer völligen Entfremdung von ihrer Umgebung, sie schaut auf die Dinge wie aus einer anderen Welt. Um den Lietzensee trabten Menschen; der eine dressierte seinen Hund, die anderen machten Gymnastik, gingen spazieren oder unterhielten sich.
Alles sah aus wie immer; doch es fehlte der Sinn des Ganzen, das Leben zeigte sich mir einfach so, krude, zusammenhanglos, ohne Hintergrund, ohne Halt: ein zudringliches Gefühl, das abzuschütteln mir nicht gelang.
Drei Wochen lang beherrschte die polizeiliche Ermittlung meinen Alltag; die Gewöhnung an die Leere, die sich immer weiter auftat und den Rest des Lebens zu verschlingen drohte. Ich scheute zurück vor den Aufrufen mit Anjas Photo, die an den Ladenfenstern und Häuserwänden klebten; zuzuschauen, wie Polizeitaucher mit Hunden im See nach ihrem Körper suchten, überstieg meine Kräfte.
Und was sagen über die Wohnung, in der jeder Gegenstand an sie erinnerte? Über die Straße, in der jedes Haus das gemeinsam Gesehene spiegelte? Wie den »eigenen« Teil abtrennen? Wie all das neu sehen, ohne die Unterstützung ihres Blicks? (Wie sehr er Teil meiner selbst geworden war, hatte ich gar nicht bemerkt.)
Direkt vor unserem Haus – die Straße war sehr schmal – parkte ein Jeep. Ich stellte mir vor, wie leicht es für ein paar kräftige Kerle war, die zarte Anja hineinzustoßen.
Tag um Tag spielte ich Anrufbeantworter, sagte den erschütterten Menschen – Verwandten, Freunden, Bekannten – unzählige Male dasselbe: Die Suche dauert an, bisher gibt es nicht die geringste Spur. Die Stimmen im Hörer begannen zu zittern, wurden schwach, gingen in Flüstern über. Bei Gesprächen mit Moskau verdoppelte sich die Stimme, jedes Wort warf ein Echo zurück, als ob ich neben dem Gesprächspartner mit noch jemand spräche.
Fast niemand von denen, die anriefen, Mails oder Briefe schrieben, hielt einen Selbstmord für möglich. Sie erwähnten kürzliche Treffen, Gespräche und Briefwechsel; nicht die leiseste Andeutung einer Depression, geschweige denn einer Verzweiflung, die Anja zum Beenden ihres Lebens hätte treiben können. Und auch ich konnte sie in dieser Überzeugung offenbar nicht erschüttern – ich hätte ja selbst so gern daran geglaubt.
Damals entwickelte ich spontan eine Hierarchie der traumatischen Zustände, abgestuft nach dem Grad ihrer Unerträglichkeit für die Überlebenden. An der Spitze steht, mit großem Abstand, das spurlose Verschwinden. In Berlin machen solche Fälle, laut N. G., nicht mehr als fünf Prozent aus (darunter Menschen, vor allem misshandelte Frauen, die strenggenommen nicht unter diese Kategorie fallen; sie ändern einfach ihre Identität und beginnen ein Leben unter neuem Namen). Dann folgt der Suizid, der bei den Nahestehenden zwangsläufig ein Schuldgefühl auslöst. N. G. widerholte wie ein Mantra: Man darf den Grund nicht bei sich, in den eigenen Handlungen gegenüber dem Hand an sich legenden Menschen suchen.
Ein guter Rat. Wenn er mir auch hätte sagen können, wie man ihn befolgt!
Ein Mord scheint mir leichter zu ertragen, weil es einen Akteur gibt, den mutmaßlichen Träger der Schuld, selbst wenn es nicht gelingt, ihn zu finden. Mit einem Unfall und einem natürlichen Tod kann man sich – obwohl auch sie keine geringe seelische Belastungsprobe bedeuten – leichter abfinden.
Im Herbst 2002 hatten wir gemeinsam zu meditieren begonnen. Ich war gewöhnt, mich darin als Anfänger zu sehen, als Schüler ohne besondere Erfolge, und hatte nicht erwartet, dass mir unter extremen Umständen, wenn auch nur für kurze Zeit, jene Fähigkeit der Selbsttranszendierung zuwachsen könnte, von deren Existenz ich zwar wusste, jedoch nicht ahnte, dass ich schon darüber verfüge. In der zweiten Nacht nach Anjas Verschwinden hatte ich ein Erlebnis, das ich dieser Praxis verdanke. Bis ins einzelne anschaulich, in über allen Zweifel erhabenen Bildern, sah ich mich selbst und Anna als – auf die enge Körperhülle zur Verständigung nicht angewiesene – leuchtende Lichtformen, die willkürlich ihre Konfiguration änderten, ineinander übergingen und sich jenseits der Sprache verständigten. Es war ein kurzer Zustand der vollkommen unerwarteten Glückseligkeit, der mir in einem Moment zuteilwurde, in dem ich vom Leben, so schien es, nichts als tiefste Verzweiflung mehr zu erwarten hatte.
Trotz jahrelangen Meditierens war diese Vision für mich eine absolute Überraschung. Und obwohl es nicht gelang, sie rein zu bewahren, begleitet mich ein Abglanz des damals Gesehenen bis heute und macht es – neben anderem – möglich, dieses Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, wie ich die kommenden Bewährungsproben überstanden hätte, wenn nicht jene Nacht gewesen wäre, in der mein von Anjas getrenntes Leben in den Hintergrund trat und ich unserer niemals abreißenden Verbindung auf einer essentiellen Ebene innewurde.
Gerettet haben mich auch die Freunde. Fast jeden Abend verbrachte ich in jenen Tagen bei G. und K. und erzählte ihnen die Geschichte unserer Beziehung und die besonders schweren letzten dreieinhalb Monate des Berliner Lebens. Die Möglichkeit, das Unglück zu übersetzen, in Worte zu fassen, wenn auch in unzusammenhängende, pathetische, noch dazu in einer fremden Sprache gesprochene, brachte Erleichterung. Dank dieser Gespräche konnte ich den Essay »Im brennenden Haus«9 schreiben – mein erster, unvollkommener Versuch, das Geschehene zu begreifen.
Doch die Gespräche allein hätten zu seiner Niederschrift nicht ausgereicht. Es gab noch ein weiteres Ereignis.
Drei Wochen nach Anjas Verschwinden, am frühen Morgen des 11. April, standen auf der Schwelle unserer Wohnung N. G. und ein weiterer Vertreter der Polizei von, soweit ich verstand, einer anderen Abteilung, B. B. Dass die Uhr und die im Wasser bis zur Unkenntlichkeit aufgequollenen Sachen auf den Schwarzweiß-Photos meiner Frau gehörten, konnte ich noch bezweifeln, doch als ich den Trauring sah, den Anna dreiunddreißig Jahre getragen hatte (der gleiche wie meiner, nur ein wenig kleiner; derselbe Feingehalt, der Stempel desselben Juweliers), sagte ich mir (das war das Allerschwerste) und dann auch ihnen: »Ja, wahrscheinlich ist sie das!« Während ich mich umzog, um mit ihnen zum Unterschreiben des Protokolls zu fahren, schauten die Ermittler, offensichtlich erfahrene Leute, die schon so einiges gesehen hatten, dass die Tür nur angelehnt blieb – wer weiß, was Menschen in einem solchem Zustand alles mit sich machen.
In der Keithstraße, am Sitz der Berliner Kriminalpolizei, zeigte man mir noch weitere Sachen, darunter das aufgeweichte, halb zerfallene Bild Manjushris, des Inbegriffs der Weisheit und des Mitgefühls, das sich in der Innentasche von Anjas Mantel gefunden hatte. In den anderen Taschen, sagten mir die Beamten, waren Steine. Sie rieten mir ab, die Photos der Leiche anzuschauen, die sie gemacht hatten, aber ich bat doch darum, sie mir zu zeigen. Bei allen ungeheuerlichen Veränderungen, die ihr Flora und Fauna der Spree in diesen drei Wochen beigebracht hatten, war das der Körper meiner Frau. Ich unterschrieb das Protokoll der Identifizierung.
Vor dem Einschlafen schaltete ich, wie gewöhnlich, Inforadio vom RBB ein, den einzigen Sender, der spät nachts nicht Musik sendet, darum schläft man dazu leichter ein. Die Nachrichten begannen damit, dass im Zentrum Berlins, in der Mühlendammschleuse, der Körper der vor drei Wochen verschwundenen russischen Künstlerin Anna Altschuk, der bekannten »Putin-Kritikerin«, gefunden wurde. Das war einer der unangenehmsten Momente – das Eindringen der Massenmedien in etwas, das noch vor kurzem als mein privates Leben erschien. Der Schatten des Geschehenen war in drei Wochen so gewachsen, dass er mich ganz zudeckte, selbst im Moment des Einschlafens.
Am selben Tag erschien im Tagesspiegel ein Artikel von Caroline Fetscher, die wir persönlich kannten. Darin wurde Anna Altschuk, eine »eher schüchterne, schmale Frau«, als Opfer von Nationalisten und religiösen Fundamentalisten dargestellt. Die Strafverfolgung habe sie wahrscheinlich tiefer verstört, als sie selbst und ihre Freunde es wahrnehmen konnten, und habe zum tragischen Ausgang geführt. Der Suizid der Künstlerin habe einen politischen Hintergrund. »›Auch wenn sie Hand an sich gelegt hat‹, sagt eine Freundin aus Berlin, ›hat doch die politische Lage in Russland diese Künstlerin auf dem Gewissen.‹«10
Den Versuch einer psychologischen Erklärung unternahm in der Jüdischen Allgemeinen Tobias Kühn. Er hatte auch mit Berliner Freundinnen meiner Frau gesprochen. In ihrer Beschreibung war sie eine kleine, zarte, sehr kommunikative Frau, die periodisch depressive Anwandlungen hatte. In Berlin litt sie darunter, dass sie, weil des Deutschen nicht mächtig, nicht auf ihrem gewohnten Niveau kommunizieren konnte. »›Wir haben deutlich gespürt, dass es ihr schlecht ging‹, sagten sie. ›Aber dass es Depressionen waren, die man klinisch hätte behandeln müssen, ahnten wir nicht.‹«11 Hinter jeder verzweifelten Geste steht eine Vielzahl von Gründen, schloss der Journalist, und nicht alle werden wir erfahren können. Eins jedoch stehe fest: Für das Beenden ihres Lebens hat die »kafkaeske« Erfahrung des Prozesses um die Ausstellung »Achtung, Religion!«, die antisemitische Atmosphäre im Gerichtssaal und die auf den vor Gericht erhobenen Vorwurf der Lästerung erfolgte Ächtung durch die Moskauer Kunstszene starken Einfluss gehabt.
Auch für Spiegel Online blieben offene Fragen: »Klar, es war Selbstmord, der Suizid einer offenbar labilen Frau, die ihren Mann ins Ausland begleitet hatte, die nur Russisch und Englisch sprach, sich womöglich in Deutschland isoliert fühlte und in einem depressiven Schub Hand an sich legte. So war es – und so war es auch nicht.«12
Für die Polizei gab es von Beginn an keinen Zweifel, dass Anna Altschuk sich umgebracht hatte. Eine erste Inspektion der Leiche bekräftigte diese Hypothese. Alternative Szenarien wurden schon vor der Obduktion und der toxikologischen Expertise ausgeschlossen. Es gibt keinerlei politischen, religiösen oder kriminellen Hintergrund, versicherten die Vertreter der Polizei.
Die regierungsnahe Presse in Russland sah es genauso.
Die russischsprachige Emigranten- und die oppositionelle russische Presse waren, anders als die deutsche, unschlüssig, was Anna Altschuk bewogen haben mochte, aus dem Leben zu scheiden. Die Mehrzahl der von dem erwähnten Sergej Solowkin befragten Berliner Freunde meiner Frau glaubte nicht, dass sie Selbstmord begangen habe. Warum, fragten sie, fällt ihr Verschwinden genau auf den Jahrestag der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an mich? Ist nicht, symbolisch genug, der 21. März der Internationale Tag der Poesie? Die Spree fließt von Ost nach West. Was hat Anna genötigt, quer durch Berlin zu fahren und sich im Ostteil der Stadt in den Fluss zu werfen, wenn es von unserer Charlottenburger Wohnung nur ein Katzensprung dorthin ist? Warum gab es keinen Abschiedsbrief? Wie kann es sein, dass sich ganze drei Wochen, noch dazu bei einer solchen Resonanz in den Massenmedien, kein einziger Zeuge des Geschehens gemeldet hat?
All diese Fragen lassen sich nicht einfach mit dem Verweis auf die bekannte Neigung der Russen zu Verschwörungsszenarien abtun – dieselbe Meinung äußerten auch deutsche Leserbriefschreiber.
Die Reaktionen im russischsprachigen Internet waren sehr vielfältig.
Strenggläubige Orthodoxe hassten die »Satanistin« noch immer und sahen in ihrem Tod eine Strafe Gottes. »Die Ausstellung ›Achtung, Religion!‹ hat sich bei Anna Altschuk gemeldet«, »Der Lohn der Gotteslästerung«, »Der Tod Anna Michaltschuks (Altschuks) ist auf jeden Fall Grund zur FREUDE« – von solchen Überschriften wimmelten ihre Websites und Blogs. Der Glaube ist für diese Leute Synonym des Aberglaubens geblieben, Gott ein Werkzeug zur Verwirklichung ihrer eigenen, ziemlich primitiven Rachephantasien.
Eine besondere Spinnerin versuchte sogar, sich den »Absturz« ihres Rechners damit zu erklären, dass sie im Netz vom Tod Anna Altschuks las; das habe Gott missfallen, weshalb Er aus Rache ihren Computer »fast zu Schrott gemacht« habe. Also stand die Todesursache fest: »Vergeltung, nun, das, was heiliger Zorn genannt wird«. Die Gewissheit, dass »Michaltschuk unmittelbar an der Verhöhnung orthodoxer Heiligtümer beteiligt« war (das Gericht hatte nicht so erkannt, doch was interessiert den Abergläubischen irgendein Richterspruch!), hindert die »tief Gläubigen« nicht daran, philiströs zu bemerken, dass die »Satanistin« in einem »guten«, »schicken«, »elitären« Berliner Bezirk wohnte. Auch ihnen ist banaler Neid nicht fremd.
Ein gewisser Herr Subkow erklärte in seinem Blog, warum man über Anna Altschuks Tod froh sein müsse, »vor allem ihre Anhänger froh sein müssen«: »Wenn es Selbstmord war, wie die Berliner Polizei behauptet, ist das doch für eine überzeugte Ketzerin das würdigste Ende. Eine freie Frau hat ihr Leben selbst gewählt – und ihr Ende selbst gewählt, ohne auf ›Gottes Willen‹ zu vertrauen, an den sie per definitionem nicht glauben konnte. […] Wenn es aber die Rache ist für die Ausstellung im ›Sacharow-Museum‹, noch besser! Es bedeutet, man hasst euch. Es bedeutet, man fürchtet euch. Es bedeutet, ihr seid eine Macht!
Allerdings gibt es noch eine dritte Variante. Ein zufälliger Tod. Sie ist auf einer Bananenschale ausgerutscht, in den Fluss gefallen, hat Wasser geschluckt und ist ertrunken. Da allerdings habe ich für die Ketzer keinen Trost. Wenn es so ist, dann gibt es einen Zufall (oder ›Gottes Wille‹, das ist egal), und das heißt, es gibt etwas, das ihr, Leute, nicht vorhersehen könnt.«13
Was soll man dazu sagen?
Anna Altschuk war keine Ketzerin, wie sie die zynische und infantile Phantasie dieses Herrn ausmalt. Sie hielt sich nicht, wie Kirillow aus Dostojewskis Bösen Geistern, eine Pistole an den Kopf, um Gott herauszufordern und damit die im Journalistenmilieu modische These zu illustrieren.
Aber nicht alle Blogger sahen bei Anjas Tod die Hand eines rächenden Demiurgen am Werk. Ebenso wie in Europa, vermuteten manche dahinter auch irdischere Motive. »Anna Altschuk ist tot«, schrieb Lunina. »Ich zweifele keinen Augenblick daran, dass sie umgebracht wurde. Vielleicht vom Geheimdienst? Na schön, ich bin paranoid. Aber andererseits, wie geht es dort zu, in diesem Amt? Wenn es so ist wie überall – dann gibt es unterschiedliche Abteilungen, Konkurrenz zwischen ihnen, einen Plan, Projekte, Bonuspunkte am Jahresende. Also – warum nicht? Technisch ist die Operation nicht schwierig, und sie sorgt für Wirbel … Und dazu noch – allen, die den Mund aufmachen, jeder unzufriedenen Opposition, den Intellektuellen ist das ein Fingerzeig. Aber das ist entsetzlich. Eine schreckliche Vorstellung«.14
Einen halben Monat nach Auffinden der Leiche, am 26. April, als sich der Sturm um den Tod meiner Frau zu legen schien, die Version der Polizei schon von niemandem mehr in Zweifel gezogen und alternative Szenarien entschieden als konspirologisch verworfen waren, brachte der Berliner Kurier einen von drei Autoren unterzeichneten Artikel mit dem langen und spektakulären Titel »Der Fall Anna Mikhalchuk: Das Todes-Rätsel von Berlin. Protokoll einer verpfuschten Ermittlung: Wie starb die Putin-Kritikerin wirklich?«
Er begann mit einem Porträt von mir. »Michail Ryklin, ein zierlicher Mann mit eindringlichem Blick, wirkt angespannt. Während er mit leiser Stimme redet, dreht er nervös an seinem goldenen Ehering und schaut wiederholt auf die Wanduhr […] Der 60-jährige russische Philosoph wartet an diesem Morgen auf die Polizei. […] ›Hoffentlich wissen sie jetzt mehr‹, sagt er leise.
Er konnte auch nicht begreifen, dass die Berliner Ermittlungsbehörden im Prozess der Ermittlung einen fatalen Fehler begingen. Er führte dazu, dass bezüglich der Todesursache seiner Frau schon keine Gewissheit mehr zu erlangen sein wird. ›Nach Lage der Dinge bleibt einer der spektakulärsten Todesfälle der letzten Jahre unaufgeklärt, weil ein Staatsanwalt eine verhängnisvolle Fehlentscheidung traf.‹«15
Das Blatt behauptete, die Obduktion habe das gewünschte Resultat nicht erbringen können, weil sie zuspät vorgenommen wurde – der Zustand der Leiche ließ es nicht zu, die Todesursache zweifelsfrei festzustellen. Vor der Obduktion hatte der Körper eine ganze Woche im Seziersaal gelegen. Die Ermittlung hatte es nicht einmal stutzig gemacht, dass in den Taschen der Toten Steine gefunden wurden, sie ging davon aus, dass sie sie selbst eingesteckt hatte. »Dass es auch ganz anders gewesen sein könnte, offenbarte die routinemäßige Obduktion einige Tage später. Denn da entdeckten die Mediziner Verletzungen am Körper der Toten, die von einem Angriff herrühren könnten. Genau ließ sich das jedoch nicht mehr feststellen – ebenso wenig wie die Frage, ob Anna Mikhalchuk bereits tot war, als sie ins Wasser fiel, oder noch lebte. Es war schlicht zu viel Zeit verstrichen, nur eine sofortige Obduktion nach Auffinden der Leiche hätte Klarheit bringen können […] Nun sind Spekulationen und Verschwörungs-Theorien wieder Tür und Tor geöffnet.«16
Die auf derselben Seite angeführte Stellungnahme von »Dr. Mark Benecke […], Deutschlands berühmtestem Kriminalbiologen«, klang ebenfalls eindeutig: Wasserleichen müssen so schnell wie möglich obduziert werden, weil der Zersetzungsprozess selbst in der Kühlhalle fortschreitet.
Auf die Entlarvung durch den Berliner Kurier reagierte sofort der Christdemokrat Peter Trapp, der Vorsitzende des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. Er nannte die Verschleppung der Obduktion einen »Skandal« und fügte hinzu, dass er nicht verstehe, wie das in einem Fall, der so viel Resonanz gefunden hatte, möglich war. »Wenn eine bekannte russische Dissidentin in Berlin stirbt, ist Eile geboten. Und wenn sie dazu mit Steinen in den Jackentaschen in der Spree liegt, müssen alle Alarmglocken klingeln.«17
Kurz, alles war verworrener und schlimmer, als es der Polizei angenehm sein konnte. Nach der Veröffentlichung im Berliner Kurier rief mich Kommissar B. B. an (seine Abteilung wurde, soweit ich verstehe, nach der Auffindung des Leichnams eingeschaltet). Er war empört, dass sich irgendwelche erbärmlichen Dilettanten – er meinte die Journalisten, die Autoren des Artikels – in seinen Kompetenzbereich einmischten und sich erdreisteten, die Ermittlungsergebnisse anzufechten. »In ihrem Blut war ja der Doxylamin-Wert beinahe 20fach erhöht«, schrie er in den Hörer.
Allerdings musste auch B. B. wissen, dass das abschließende Urteil über die Todesursache nicht bei der Polizei liegt, sondern bei den Gerichtsmedizinern, und offenbar waren gerade über sie die Informationen hinsichtlich der Ermittlungspanne in die Presse durchgesickert.
Der Sprecher der Berliner Justizsenatorin, der von dem Skandal erfahren hatte, ein junger Franzose, lud mich zu sich ein. Er zeigte mir vertraulich – denn die Ermittlungen dauerten an – Auszüge aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten, aus denen folgte, dass die Pathologen ein Verschulden Dritter nicht vollkommen ausschließen können, und fragte mich, welche Ansprüche ich an die Ermittler habe. Ich sagte, ich wüsste doch gern, welche Stoffe genau im But meiner Frau gefunden wurden. Er notierte diesen Wunsch, doch er blieb unerfüllt. Beiläufig erzählte er, dass sein Bruder vor nicht allzu langer Zeit Selbstmord begangen und die Familie seine Gründe dafür nicht verstanden habe. Kurz, er signalisierte mir wie N. G., dass man den Grund solcher Handlungen nicht bei sich suchen solle – sie werden im Affekt begangen, der prinzipiell nicht entschlüsselbar ist.