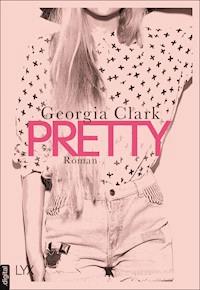9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: dtv bold
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
»Aufrichtig und sexy.« Publishers Weekly Lacey ist 25, als sie erfährt, dass sie aufgrund einer BRCA1-Mutation mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs erkranken wird. Nun steht sie vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie abwarten und das Risiko eingehen oder eine Brustamputation durchführen lassen? Gemeinsam mit ihren besten Freundinnen setzt sie eine Liste mit Dingen auf, die sie unbedingt noch erleben will, bevor sie sich (möglicherweise) für die OP entscheidet: Aktfotos machen lassen, sich oben ohne sonnen, einen Dreier haben und mit einer Frau schlafen. Und mit jedem Punkt, den sie von ihrer Liste streicht, kommt Lacey nicht nur ihrer Entscheidung näher, sondern verliebt sich: in zwei Männer, eine Frau und sich selbst …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Ähnliche
Über das Buch
Lacey lebt in New York, arbeitet in der Modebranche und gründet nebenher ein Start-Up. Sie hat ihre Ziele klar vor Augen und tut alles, um diese zu erreichen. Bis sie positiv auf die BRCA1-Genmutation getestet wird. Was soll sie jetzt tun? Abwarten oder den radikalsten aller Schritte tun und eine präventive Brustamputation durchführen lassen?
Doch nicht nur die Sorgen, entweder an Krebs zu sterben oder ihre Brüste zu verlieren, verlangen Lacey alles ab: Wie soll sie etwa ihrer Schwester von der Diagnose erzählen? Wie mit ihrer besten Freundin umgehen – die sich zwar bemüht, aber niemals verstehen wird, wie Lacey sich fühlt?
Um irgendwo anzufangen, setzt sie eine Liste mit Dingen auf, die die Weiblichkeit und ihre Brüste feiern. Und mit jedem Punkt, den sie von ihrer Liste streicht, kommt Lacey nicht nur ihrer Entscheidung näher, sondern verliebt sich: in zwei Männer, eine Frau und sich selbst …
Für Nicki-Peeam m-i-c
teil eins
januar
1.
Ich habe einen schlimmen Bad-Nipple-Day. Heute früh noch plättete ein neuer BH meine kleinen Rosenknöspchen in die schiere Nichtexistenz. Und jetzt, am Nachmittag, sind sie klar und deutlich durch mein Oberteil zu sehen wie zwei kecke Sitcom-Stars. Was mir exakt zehn Minuten vor unserem wöchentlichen Team-Meeting auffällt, als es schon zu spät ist, mir einen Schal um den Hals zu werfen. Stattdessen beuge ich mich langsam und unauffällig nach vorne, damit der Stoff meines Oberteils nicht ganz so offensiv an meinem Busen klebt. Doch meine Nippel lassen sich nicht zum Schweigen bringen.
Natürlich ist mir klar, dass Nippel frei sein können und sollten. Wir haben schließlich alle welche – warum sie also verleugnen? Das Argument, sie wären eine »Ablenkung am Arbeitsplatz«, ist definitiv Victim-Blaming, während »Anstand« sich einfach nur abartig verklemmt anhört. Aber so naiv bin ich nicht. Schließlich wurde ich durch ein kurzes, aber vernichtendes Stirnrunzeln einer der einflussreichsten Moderedakteurinnen unseres Unternehmens, Eloise Cunningham-Bell, auf die unerhörten Vorkommnisse in meiner Brustregion aufmerksam gemacht. Der Ausdruck von Missbilligung in ihren Augen war alle Information, die ich brauchte: Nippel sind bei Hoffmann House nicht gern gesehen. Alle wissen, dass ich seit meiner Anfangszeit als Praktikantin auf einen Job in Eloise’ Team scharf bin. Daher kann sich auch jeder ausrechnen, wer hier das Sagen über meine Nippel hat. Oh nein, nicht ich.
Als Mitglied der Chefriege hat Eloise sich zu ihresgleichen gesellt, die um einen absurd weitläufigen Konferenztisch sitzen. Der buchstäbliche Führungszirkel des Unternehmens. Ich habe mich zu denen gesellt, die die Wände des Raums säumen. Auf ein ungeübtes Auge mögen wir Wandsäumer tadellos gestylt und gesellschaftlich relevant wirken. Doch die Wahrheit ist: Wir sind die Assistenten. Die Handlanger. Der Bodensatz.
Die Redakteure des Führungszirkels sehen aus wie der Casting-Aufruf für »diverse fröhliche Brooklyn-Bewohner«. Ihre Expertise reicht von Jugendkultur über Lifestyle bis hin zu Männermode und Innenarchitektur. Sie sind ständig unterwegs und jetten entweder nach oder kommen gerade zurück aus London oder Mailand, Tokio oder Berlin. Ich komme gerade aus der Cafeteria unten im Erdgeschoss, wo ich einen kurzen und wenig berauschenden Flirt mit einem ziemlich traurigen Grünkohlsalat hatte.
Die Chefriege redet. Die Assistenten lauschen. Und ich übe mich weiter im Buckeln.
Das Meeting geht ungefähr eine Stunde. Als es vorbei ist und alle sich erheben, finde ich mich beim Hinausgehen unerwarteterweise im Gleichschritt neben Eloise wieder. Ich bin nach wie vor eingeschüchtert, doch ich zwinge mich zu sprechen: »Hey.« Ich lächle mein einnehmendstes Lächeln. »Ich habe mich gefragt, ob Sie die Berichte bekommen haben, die ich Ihnen letzte Woche gemailt habe?«
Sie mustert mich mit der kühlen, undurchdringlichen Schönheit einer nordischen Königin. »Habe ich.«
Ich habe keine Antwort parat. »Super ! Ich fände es toll, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte. Oder Feedback. Sie dürfen sie gerne verwenden …«
»Ich bin spät dran«, unterbricht sie mich und schreitet voran.
Sie dürfen sie gerne verwenden. Was Dümmeres ist mir nicht eingefallen. Ich lasse mich auf meinen Schreibtischsessel in unserem Großraumbüro plumpsen und unterdrücke ein Stöhnen. Eloise hat es gar nicht nötig, meine Berichte zu verwenden. Ihre Arbeit ist erstklassig. Ihr Geschmack ist erstklassig. Sie ist wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu einem unfassbar glamourösen Event wie der Privatvorführung einer neuen Kollektion, um sich mit einem Glas Champagner bei einer angeregten Konversation sehen zu lassen. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Oh, stimmt, damit ich irgendwann aufhören kann, mich hier auf Provisionsbasis durchzuschlagen. Damit ich etwas wirklich Kreatives, etwas Erfüllendes tun kann. Damit ich auch herumreisen kann. Damit ich einen Arbeitsplatz zugewiesen bekomme, der groß genug ist, um so etwas wie eine Tür zu verdienen. Eine eigene Tür ! Ja, das ist mein persönlicher Heiliger Gral.
Mein Handy klingelt, und ich ducke mich hinter die Trennwand meiner Bürobox, um ranzugehen. »Ja, hier Lacey.«
»Lacey Whitman?«, ertönt eine autoritäre Stimme.
»Ja?«
»Hier ist Dr. Fitzpatrick vom Midtown Medical. Ich rufe an, weil Sie Ihren letzten Termin nicht wahrgenommen haben.«
Apropos Termin, mein Sechzehn-Uhr-Termin schiebt die schwere Glastür zum Großraumbüro auf und klopft den Schnee von ihrem Mantelkragen. Sie schenkt unserer Empfangsdame ein Lächeln und macht einen Witz, den ich nicht hören kann. »Es tut mir leid, Doktor …« Sein Name fällt mir nicht mehr ein, also wiederhole ich nur trottelig: »Doktor. Hier war die Hölle los. Mit ›hier‹ meine ich bei der Arbeit. Ich bin bei der Arbeit.«
»Wann können Sie vorbeikommen, damit wir uns über den Befund Ihres Pap-Abstrichs unterhalten?« Doktor Doktor ist hartnäckig.
»Unterhalten?« Ein Hauch von Besorgnis, nur ein klitzekleiner, schnüffelt mir um die Füße herum. Ich trete ihn beiseite. »Können wir das nicht übers Telefon machen?«
»Wir geben unsere Testergebnisse nicht telefonisch heraus, Miss Whitman. Sie werden schon persönlich vorbeikommen müssen. Wann passt es Ihnen?«
Der Sechzehn-Uhr-Termin fängt meinen Blick auf und bedenkt mich mit einem kleinen unbeholfenen Winken. Ich zeige auf das Handy und forme stumm: Einen Moment. »Es tut mir leid, ich habe diese Woche wirklich keine Zeit.«
Später werde ich mich an diesen Nachmittag als den letzten Tag zurückerinnern. Und damit meine ich nicht, den letzten Tag, an dem ich frei und glücklich war und das perfekte Leben hatte. Zeigt mir einen zufriedenen fünfundzwanzigjährigen Menschen in New York, und ich zeige euch einen insgeheim unglücklichen Lügner oder einen verblendeten glücklichen Narren. Nein, es war der letzte Tag, an dem ich das Gefühl hatte, meine Zukunft unter Kontrolle zu haben. Es war der letzte Tag, an dem ich noch daran geglaubt hatte, dass man nur eine festgeschriebene Menge an Problemen zugeteilt bekommt. Es war der letzte Tag meines kleinen Lebens.
Doktor Doktor holt seufzend Luft. »Miss Whitman, Sie wurden positiv auf die BRCA1-Genmutation getestet.«
Die Worte landen in meinem Kopf, und zwar mit der präzisen Klarheit von Vanillepudding, der gegen eine Wand klatscht. Ich komme nicht mehr aus dem Blinzeln heraus. »Was?«
»Ich habe Ihnen für morgen einen Termin bei einer genetischen Beraterin gemacht, um Ihre Optionen durchzusprechen.«
»Meine Optionen? Ich dachte, wir reden hier von meinem Pap-Abstrich?«
Papierrascheln. Seine Stimme ist schroff. »Sie haben sich nach dem besten Zeitrahmen für eine Mammografie erkundigt. Wir sprachen über einen Test, der dabei helfen könnte, diesen Zeitrahmen festzulegen. Erinnern Sie sich noch daran?«
Blut, das in eine Ampulle blubbert. Ich riss noch einen Witz über Vampire. »Ja.«
»Wissen Sie, was das bedeutet? Begreifen Sie die Implikationen?«
Ich habe Mühe, mich auf seine Worte zu konzentrieren. »Aber ich bin doch wegen eines Abstrichs gekommen … Nur so eine Routinesache … eine ganz normale …« Mir geht die Luft aus. Ich blicke starr vor mich hin, atme durch die Nase.
»Miss Whitman? Sind Sie noch da?«
• • •
Ich empfange meinen Sechzehn-Uhr-Termin: die Kreativdirektorin von Target. Da stehe ich also, in einem der kleinen lichtgefluteten Konferenzräume, und präsentiere die nächste Herbstsaison mit dem irrwitzigen Ernst einer Talkshow-Moderatorin. »Der Trend zu Tweed als organisch anmutender Basis hält unvermindert an, während die Nachfrage nach Hosenanzügen sich verläuft.« Meine Stimme klingt unnatürlich laut. »Ob es nun eher Loungewear wird? Oder doch Sportswear? Also, ich persönlich bin gespannt auf Shearling. Außerdem glaube ich, dass wir eine Neuinterpretation des Schultercapes sehen könnten.«
Ich lache zu angestrengt bei den Witzen meiner Klientin. Pflichte viel zu eifrig ihren Ansichten bei. Ich fühle mich wie betrunken. Unter Drogen, traumwandelnd, gespalten. Eine Version von mir sagt meinen Text auf – besser gesagt, eine bizarre, dadaistische Darbietung meines Texts –, während eine andere Version hinter den Kulissen herumrennt, unfähig, den Bühneneingang zu finden.
Als die Show vorüber ist, habe ich einen verpassten Anruf von Vivian auf meinem Handy. Ihre schnelle, süffisante Stimme ertönt auf der Mailbox: »Hey, Süße, mein Flieger wurde wegen des Wetters nach Newark umgeleitet, also komme ich ein klein wenig später. New Jersey, yay! Zieh dir doch noch mal die neuesten Download-Zahlen rein … hoffentlich können wir sie heute Abend allen um die Ohren hauen.«
Die Party, die hatte ich ganz vergessen. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, was ich an meinem Schulball in der achten Klasse trug – bis hin zu den Socken (Leopardenprint mit Spitzenrüschen) –, aber ich hatte die Hoffmann-House-Winterparty vergessen. Die natürlich heute Abend steigt.
Ich denke nicht an … die Sache. Es ist kein bewusster Verdrängungsprozess. Es kommt mir nur vor wie etwas, vor dem ich davonlaufen kann – also tue ich es. Ich mache mich mit den neuesten Berichten der Moderedakteure vertraut, blättere die Women’s Wear Daily durch und versuche, es auf die Gästeliste für ein paar Fashion-Week-Partys zu schaffen, indem ich einige flirtende Mails an diverse Pressesprecher verschicke. Kurz vor sieben angle ich mein Tag-und-Nacht-kompatibles Schminktäschchen aus der untersten Schreibtischschublade.
In der pastellgrau gefliesten Toilette ist es kühl und leer. Ich reihe meine Beautyprodukte auf dem Marmorsims unter dem Spiegel auf, ein Ritual, das ich immer beruhigend fand: Volumenmascara, dunkelrosa Lipliner, Rouge. Meine Hände zittern. Ein Schwall Übelkeit überkommt mich. Über der Kloschüssel kauernd halte ich mir das Haar zurück, bereit für das Überraschungscomeback meines traurigen Grünkohlsalats. Doch mein Körper weigert sich, sich zu übergeben, und verlegt sich stattdessen auf ein leichtes Zittern und allgemeines Unwohlsein.
Grauenhaft ist das Wort, zu dem mich mein Spiegelbild spontan inspiriert. Mein Haar, das ich seit meinem Umzug nach New York vor drei Jahren gewissenhaft und penibel zu einem silbrigen Weißblond bleiche, lässt mich so fahl ausschauen wie die nächtlichen Zombiebeleuchtung eines U-Bahn-Waggons.
Eine Erinnerung ploppt auf meinem Handy auf: 19:00 Uhr: LASS ALLES STEHEN UND LIEGEN und mach dich sofort für die Party bereit. Nein, nicht in fünf Minuten. JETZT.
Ich habe ein paar Kleider für besondere Events in der Garderobe gebunkert. Heute Abend brauche ich eine knallige Ganzkörperrüstung, um mich zu schützen – Romance Was Born, das elektrisierend-extrovertierte australische Label, bekannt für seine hochgradig auffälligen High-Fashion-Kreationen. Meine Kundin bei Saks hat mir das Kleid zu Weihnachten geschenkt (ein Musterstück – aber ich will mich gar nicht beschweren): Chiffon, bodenlang, ein runder, im Nacken geknöpfter Rückenausschnitt, Dreiviertelärmel. Der Saum ist in ein gelb-rotes Farbenfeuer getaucht, das in einem tropischen Vogelfeder-Print verschmilzt. Schillernde Grün- und Blautöne lösen sich nach oben hin in einem beinahe reinweißen Oberteil auf. In Kombination mit meinem getreuen schwarzen Fedora-Hut und einer ordentlichen Ladung Kriegsbemalung im Gesicht werde ich aussehen wie alle anderen auf der Hoffmann-House-Party.
Unsterblich.
2.
Schon seit achtundvierzig Jahren schmeißt Patricia Hoffman die Hoffman-House-Winterparty Mitte Januar. Das Datum soll sicherstellen, dass die Gästeliste nicht von New Yorks Weihnachtsfeiermarathon im überfrachteten Dezember beeinträchtigt wird. Oder, wie es seit jeher in der Einladung lautet: Keine Entschuldigungen, keine Ausreden. Alles andere geht. Zum 40. Jubiläum des Unternehmens wurden Fotografien aus vier Jahrzehnten des alljährlichen Events in einem schweren Bildband versammelt, den ich in der elften Klasse bei einem Schulausflug nach Chicago in einem Museumsshop entdeckte. In den Siebzigerjahren verschmähten bleistiftdünne Models mit Zahnlücken dicke, fette Krabbencocktails, während sie von langhaarigen Musikern angebaggert wurden, denen die Träume von Utopia aus den ungewaschenen, aufgeknöpften Hemden waberten. In den Achtzigern wurde alles glänzend, schrill und scharf: Sicherheitsnadeln, Discokugeln, Schulterpolster, an denen man sich beinahe schon die Finger aufschneiden konnte. In den Neunzigern dominierten gebleichte Zähne, Jeans und noch mehr Jeans, aufgebauschte Mähnen und Bodysuits. Die Nullerjahre wiederum waren völlig bizarr: Timberlands mit Absätzen, enge Plüschjogginganzüge, bis zur Unkenntlichkeit weggezupfte Augenbrauen (die Nullerjahre waren einfach nur zutiefst peinlich). Aber abgesehen von der Tatsache, dass Augenbrauen wieder buschig sein dürfen, ist es irgendwie schwierig, das jetzige Jahrzehnt auf den Punkt zu bringen. Immerhin stecken wir noch mittendrin.
Ich brauchte damals Wochen, um das Geld für diesen Hoffman-House-Bildband zusammenzusparen, doch es waren ebendiese Bilder, die in mir den Wunsch – nein, den Drang – weckten, bei New Yorks ältestem und angesehenstem Wortführer in Sachen Trends zu landen. Hoffman House war der absolute Dreh- und Angelpunkt – von SoHo, von Mode im Allgemeinen, von allem, was Buntley, mein Heimatkaff in Illinois, nicht war.
Als Mitglied des Junior-Verkaufsteams bei Hoffman House verkaufe ich zwei Dinge: Das Erste ist ein Online-Abo-Service mit den aktuellen Reports der verschiedenen Hoffman-House-Redakteure wie meiner allerbesten Freundin Eloise. Die meisten Leute, die in der Modebranche oder irgendeinem anderen Bereich arbeiten, in dem es um Stil geht, müssen bezüglich der neusten weltweiten Trends up to date bleiben, doch normalerweise sind sie an ihre Schreibtisch gekettet und nicht in der Lage, sich selbstständig auf dem Laufenden zu halten. Der Online-Service besteht aus einem täglichen Newsletter mit Inspirationen, Analysen und Meinungen: »Die essenziellen Infos, um am Puls der Zeit und damit Ihrer Branche zu bleiben.« Das Zweite, was ich verkaufe, sind Trendbücher. Einzelne Verlage rund um die Welt stellen saisonale Bücher zusammen, zwei pro Jahr – Frühling/Sommer und Herbst/Winter.
Große, schöne Bücher waren es also, die mich nach New York brachten. Auf ihren Hochglanzseiten, genauso wie im Großteil dieser Stadt, ist kein Platz für Unsicherheiten.
Trendbücher sind das kleine schmutzige Geheimnis im Business. Wer glaubt, dass Victoria’s Secret oder L’Oréal selbst mit ihren neuesten Looks, Farben und Trends aufwarten, irrt sich. Sämtliche große Namen in der Branche kaufen Trendbücher, und noch Tausende mehr abonnieren den Online-Service. Jedes Buch kostet zwischen zwei- und sechstausend Dollar, während die Beiträge für den Online-Service sich auf bis zu fünfzehntausend Dollar belaufen können. Ich bekomme fünfzehn Prozent Provision auf jedes Buch und fünf Prozent auf jedes abgeschlossene Online-Abo.
Als ich mir also den Luxus gönne und in ein Taxi steige, das mich zum berühmten Pembly Hotel bringen soll, liegt das daran, dass ich mich wie eine triumphierende Siegerin fühlen sollte. Ich stehe auf der Gästeliste des Events, das mir am meisten bedeutet. Doch als ich die Wagentür zuschlage, muss ich gegen das übermächtige Gefühl ankämpfen, dass ich in der Falle sitze, dass das Wasser hereinströmt und unaufhaltsam steigt.
Wir geraten in den totalen Verkehrskollaps. Der Fahrer flucht und drückt auf die Hupe – wieder und immer wieder. Wir kommen nicht vom Fleck.
Dr. Fitzpatricks Worte echoen in meinem Kopf: Ich habe Ihnen für morgen einen Termin bei einer genetischen Beraterin gemacht, um Ihre Optionen durchzusprechen. Sofort muss ich an ein fensterloses Wartezimmer mit schlechten Landschaftsbildern und das kollektive Gefühl von Angst denken.
Das Wasser gurgelt an meinen Waden hoch, über die Sitze, fast bis zum Taxameter. Mir geht die Luft aus.
Ein Krankenhausbett. Maschinen, die unentwegt piepen. Das Weinen eines Mannes.
Noch ein Hupen. Und noch eins.
»Können Sie das bitte lassen?« Ich kann mich nicht mehr beherrschen. »Wir kommen so auch nicht weiter.«
Er brummt etwas Unverständliches. Als wir am Hotel eintreffen – die Fahrt hat fünfzehn Minuten länger gedauert, als sie sollte –, vergesse ich beinahe zu zahlen. In einem Anflug von Erleichterung springe ich aus dem Wagen und schnappe nach Luft.
»Lacey!«, quietschen die Praktikantinnen. »Du siehst großartig aus.«
»Hi, ihr Süßen!« Ich verteile Luftküsse neben die Wangen der Mädchen, die den Einlass machen. Alle drei sprühen förmlich vor Promifieber. »Mir gefällt, was ich da sehe«, füge ich hinzu, wobei ich mit meinem Zeigefinger einen Kreis um ihre Outfits vollführe: schmale, fließende Spaghettiträgerkleider, Federkronen, grobe Oversize-Strickjacken. Und obwohl ich damit beschäftigt bin, ein köchelndes Gefühl von Panik unter Verschluss zu halten, speichere ich ganz automatisch die Stichpunkte ab: Kate Moss, Neunziger. Mögliches Comeback? Sie kichern und gackern aufgeregt, und es ist kaum zu glauben, dass das vor über vier Jahren ich war, die hier stand, mit der Gästeliste in der Hand, fest entschlossen, es selbst drauf zu schaffen. Und hier bin ich jetzt – und habe morgen einen Termin im New York Cancer Care Center …
»Wo geht’s zur Bar !«, rufe ich halb keuchend an niemand Bestimmtes gerichtet. Während ich durch das Meer epilierter, hochglanzpolierter Körper schwimme, kann ich Marihuana, schwere Parfums und nassen Pelz riechen. Und schon stehe ich an der Theke, klopfe auf den von unten beleuchteten Glastresen und bestelle ein Glas Weißwein mit einer Stimme, die zu gepresst ist, zu laut, nicht meine … Jemand tippt mir auf die Schulter, und ich wirble herum. Vivian hat die Augen zusammengekniffen. »Hey.«
Der Anblick von Vivian Lei Chang hat umgehend eine beruhigende Wirkung auf mich. Und das nicht nur, weil sie wie immer makellos gekleidet ist: Seidentunika, Lederhose, geometrische goldene Halskette, hochhackige Ankleboots. Auch nicht, weil sie, wie immer, ihre von gewölbten Augenbrauen begleitete Ich-regle-das-schon-Aura verströmt. Es liegt vielmehr daran, dass Vivian Teil meines normalen, geregelten Lebens ist – älter, weiser und so schön und tough wie eine Ninja-Nixe am Bug eines Schiffes.
»Hey!« Meine Umarmung hat eher schon was Überfallartiges, und ich bekomme ein paar Strähnen ihres schwarzen Haars in den Mund.
Sie löst sich aus meinem Griff. Ihre scharfen Augen verengen sich noch mehr. »Was ist passiert?«
Neben meinem Ellbogen taucht das bestellte Weinglas auf. »Nichts.« Ich fange an zu trinken und schaffe es irgendwie nicht, aufzuhören, bis ich das komplette Glas geleert habe – das Ganze, ohne den Blickkontakt zu ihr abreißen zu lassen. Selbst in meinem zerrütteten Zustand ist mir klar, dass das superschräg ist. »Alles blendend.«
»Okaaay.« Vivians Blick schwenkt auf der Suche nach Hinweisen erst von meinem Glas zu mir, dann zu dem halben Quadratmeter Raum um mich herum. »Du benimmst dich reichlich seltsam.«
»Findest du?« Mein Lachen ist das einer Geistesgestörten. Meine Hände flappen um mich herum wie eine losgerissene Plane. »Ich habe auf dem Weg hierher ein Eichhörnchen gesehen … das ein Stück Pizza gegessen hat … im Schnee. Schneepizza? Ich meine, was wollen sie sich als Nächstes ausdenken?« Ich bin ein außer Kontrolle geratener Zug. Ich lache weiter, dann höre ich abrupt auf. »Wie war es an der Westküste?«
Die Arbeit ist Vivians persönliche Katzenminze – sie kann einfach nicht widerstehen. Während sie von den Treffen berichtet, die sie im Namen von uns beiden absolviert hat (Stippvisite bei unserem außergewöhnlich talentierten Techniker Brock im Silicon Valley; zwei Investoren-Mittagessen – einer davon fast schon vielversprechend, der andere definitiv schmierig), steuere ich sie unauffällig in eine dunkle Ecke, wobei ich ein stummes Siehst toll aus und Bin gleich wieder da nach dem anderen in Richtung der Kunden und Kollegen forme, an denen wir vorbeikommen. Ich konzentriere mich darauf, meinen Atem zu kontrollieren und möglichst zu verstehen, was Vivian mir da erzählt.
»Wir sind auf dem richtigen Weg«, schließt sie. »Ich bin zuversichtlich.« Sie mustert prüfend die Anwesenden im Raum. Ich starre derweil in die Leere mit dem entrückten Blick von jemandem, der gerade eine Nachricht aus dem Jenseits erhält.
Ist es eigentlich möglich, etwas gleichzeitig zu wissen und nicht zu wissen? Denn als ich damals den Multi-Gentest machte – eine Art genetisches All-you-can-test-Buffet –, gab es da diesen winzigen marienkäfergroßen Teil in mir, der wusste, dass dieses Ergebnis durchaus eine Möglichkeit war. Nur nicht unbedingt eine Wahrscheinlichkeit. Ganz bestimmt keine Wahrscheinlichkeit. Ich machte den Test, so wie ich einen HIV-Test mache: um mir meinen gesundheitlichen Freibrief bestätigen zu lassen. Nicht, damit man ihn mir in der Luft zerreißt. Ich war mehr als nur zuversichtlich. Ich war geradezu vermessen.
»Vivian …« Ich drehe mich in demselben Moment zur ihr um, in dem sie »Tom Bacon« sagt. Ein Mann in hellblauem Anzug, der wie ein Sechzigerjahre-Astronaut aussieht und auf eine Handvoll ähnlich geleckter Typen in maßgeschneiderten Outfits einspricht. »Er ist Partner bei River Wolf.«
»Die Wagniskapitalgesellschaft?«
»Ja, aber er ist auch ein Business Angel, Geldgeber und Unternehmer in einem. Und der reichste Mann im Raum.« Vivians Blick brennt förmlich eine Zielscheibe in Tom Bacons blonden Haarschopf. »Er könnte uns an Ort und Stelle einen Scheck über eine Viertelmillion ausstellen.«
»Du meinst Dollar? Amerikanische Dollar?«
Vivian lächelt nicht einmal, so fokussiert ist sie. »Er kommt mit seinem persönlichen Startkapital als Investor in der Vorgründungsphase an Bord, River Wolf übernimmt die darauffolgende A-Runden-Finanzierung. Das ist eine gute Strategie. Eine exzellente Strategie.«
Das ist meine Strategie: Ich stehe hier, in diesem Raum, weil ich sowohl ambitioniert als auch vorsichtig bin. Ich gehe jährlich zur Vorsorgeuntersuchung, weil ich geglaubt habe, dass sich eine gute Gesundheit, genauso wie Geld und Respekt, verdienen ließe.
»Lace?« Viv schnipst mit ihren Fingern vor meinem Gesicht. »Ich habe gefragt, ob es für dich okay wäre, Tom hier zu pitchen?«
Ich nicke, während ich versuche, bei der Sache zu bleiben. »Patricia steht dahinter. Außerdem hat ihr Flieger wegen des Schneesturms sowieso Verspätung.«
Patricia Hoffman, Namensgeberin der Party und meine Chefin, war nach Paris gereist, um die Coco-Chanel-Retrospektive im Musée des Arts Décoratifs zu sehen, da sie nicht in den Staaten gastieren würde. Es ist das erste Jahr, dass sie ihre eigene Party verpassen wird.
Vivian strafft ihre Schultern. »Exzellent.«
Erst da trifft mich die Erkenntnis: Wir sind keine drei Meter von der Möglichkeit entfernt, dass die App, an der wir seit acht Monaten arbeiten, Wirklichkeit wird. Ich bin zweigleisig gefahren, um auf Nummer sicher zu gehen: entweder eine Redaktionsstelle bei Hoffman House oder die App. Tief drin habe ich immer geglaubt, ich würde zuerst die Stelle als Redakteurin ergattern. Ich habe mich wohl geirrt. Das ist der Moment, in dem Clean Clothes, die App, von der Vivian sich sicher ist, dass sie uns eine Villa in den Hamptons verschaffen wird, ein richtiges Unternehmen werden könnte.
Scheiße.
Vivian wirft mir ein Lächeln zu. »Bereit?«
Nein, kein bisschen, nicht jetzt, bitte nicht jetzt. »Immer doch.«
Es fühlt sich an wie die Zusage zu einer Runde Russisches Roulette.
Vivian dabei zuzuschauen, wie sie sich an einen Kreis von Leuten heranpirscht, in den sie einbrechen will, ist eine meisterhafte Lektion im Networken. Alles steht und fällt mit dem ersten Lächeln: souverän und sympathisch, ohne kokett oder schüchtern zu sein. Vivian benutzt ihren Sex-Appeal mehr wie ein Mann denn eine Frau. Nie ein Trumpf oder ein verzweifelter Einsatz, mehr eine angeborene Lässigkeit. Beiläufig, aber doch nicht von der Hand zu weisen. Wir schlüpfen besonders mühelos in den Kreis, da Tom Vivian wiedererkennt – weil Vivian einfach jeden kennt. »Vivian Chang. Wann war doch gleich das letzte Mal, dass wir …?«
»Vor zwei Jahren, Demo Day bei YC. Sie haben einen Scheck für die Afro-Haarpflegefirma meiner Freundin Birdie ausgestellt.«
»Das stimmt.« Tom nickt. »Was eine sehr weise Entscheidung war.«
»Und Sie werden sich nie wieder selbst Sheabutter kaufen müssen.«
Die Männer kichern. Tom wendet sich an die Runde. »Vivian war ganz früh bei Snapp dabei, diesem Start-up, das vor ein paar Jahren von Pinterest aufgekauft wurde.«
Vivian neigt den Kopf, um huldvoll das implizierte Lob anzunehmen. Ganz früh bei einem Start-up dabei zu sein – Teil des Teams im ersten Jahr seines Bestehens – bringt einem genauso viel Anerkennung ein, als wäre es die eigene Idee gewesen. Sie zeigt auf mich. »Meine Herren, darf ich vorstellen, das ist Lacey Whitman, eine Vertriebs- und Trendkollegin hier bei Hoffman House und Partnerin im Gründungsteam meines neuen Unternehmens.«
»Ihres ersten Unternehmens«, stellt Tom klar.
»Meines ersten Unternehmens«, bestätigt Vivian.
Tom richtet seinen durchdringenden Blick auf mich. »Fantastisch.« Er schüttelt kräftig meine Hand und stellt uns dann den anderen Männern vor, deren Namen augenblicklich aus meinem umnebelten Kopf verschwinden. Bis auf einen. Der letzte Typ. Elan Behzadi. Gleichermaßen berühmt dafür, ein talentierter Modedesigner wie auch ein launisches Arschloch zu sein, und zwar auf eine Art, mit der man nur als Mann durchkommt. Er ist Iraner, hat eine normale Statur, einen leichten Bartschatten, dunkle Augen. Sein Blick bleibt cool, unbeeindruckt, während ich von dieser Begegnung gleichzeitig fasziniert und überfordert bin. Ich bin dem allem momentan nicht gewachsen, und das Wasser steigt wieder.
»… Millennials und die Generation Z sind in Sachen Mode zunehmend auf der Suche nach Fair-Trade-Produkten.« Wie kann es bloß sein, dass Vivian schon eine gute halbe Minute von unserem Pitch abgespult hat? Ich habe sie noch nicht mal anfangen gehört. »Outfits, die im Trend liegen und moralisch unbedenklich sind. Sie wollen personalisierte Aufmerksamkeit und authentische Beratung, ohne den Komfortbereich ihres Smartphones zu verlassen. Clean Clothes ist da, um dieses Problem zu lösen.« Vivian sieht zu mir. Mein Stichwort.
Ich habe die Genmutation. Ich wurde positiv getestet. Mein Mund ist wie zugekleistert. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll.
Vivian blinzelt unmerklich und fährt mit meinem Text fort. »Die Kunden kreieren ein Style-Profil, ähnlich wie bei Pinterest oder Instagram, indem sie selbst Bilder machen oder welche speichern, die ihnen gefallen: Street-Style, Promi-Outfits, ihr eigener neuester Look. Unsere Stylisten stellen daraufhin ein fünfteiliges Outfit ausschließlich aus ökologisch vertretbaren Fair-Trade-Unternehmen zusammen – Klamotten, in denen man gut aussieht und sich gut fühlt.«
Vivian schaut wieder zu mir, und es ist dieser zweite Blick – fragend, beinahe schon prüfend –, der mir eine heiße Welle von Scham beschert.
Vivian redet weiter: »Meine Herren, ich bin sicher, Sie wissen, dass der Umsatz der Damenbekleidungsindustrie alleine auf sechshunderteinundzwanzig Milliarden Dollar geschätzt wird, ganz zu schweigen von Herren- und Kinderkleidung sowie Brautmode. Clean Clothes wird bis zum Jahresende ein Milliardengeschäft sein.«
Die Männer nicken. Selbst ich kann sehen, dass es gut läuft. Du kannst später noch zusammenbrechen. Du kannst später zusammenklappen. Reiß dich zusammen. Konzentrier dich.
Als Tom Vivian dieses Mal anspricht, tut er es mit dem Ernst, den Männer normalerweise für ihre Geschlechtsgenossen reservieren. »Sie arbeiten also mit Partnerlinks?«
Sie nickt. »Die Kunden erhalten jeden Monat ein eigens auf sie zugeschnittenes fünfteiliges Outfit.«
»Also bekommen sie das Produkt selbst zugesandt?«, will Tom wissen. »Fünf Kleidungsstücke?«
»Nein«, erwidert Vivian. »Für den Moment ist es nur ein virtueller Look. Die Nutzer zahlen nichts, bis sie sich entscheiden, die Teile zu kaufen, die wir für sie zusammengestellt haben. Was sie ganz einfach tun können, indem sie die Links unserer verpartnerten Online-Händler anklicken. Die Art von Abo-Modell, das Ihnen vorschwebt, haben wir für die Zeit im Blick, nachdem wir uns vergrößert haben.«
»Wie sehen Ihre Zahlen aus?«
»Wirklich vielversprechend. Wir laufen seit letztem Herbst im Stealth-Mode und haben knapp fünftausend Downloads. Davon haben achtzig Prozent der Nutzer uns an einen Freund weiterempfohlen.«
Die vertrauten Worte hören sich in meinen Ohren wie Kauderwelsch an. Ich begegne Elans Blick. Seine Augen wirken jetzt tiefer und sind plötzlich voll und ganz auf mich gerichtet. Als würde er mich wiedererkennen. Wir sind uns nie begegnet. Hitze strömt durch mich hindurch wie eine unberechenbare, unaufhaltsame Flut. Mein Herz wummert viel zu laut in meinen Ohren.
Tom ist voll und ganz auf Vivian fokussiert. »Wie haben Sie vor zu vergrößern? Einen Algorithmus entwickeln, um den Kunden Produkte zuzuteilen, die ihnen gefallen?«
Sie schüttelt den Kopf. »Es ist wichtig, dass wir immer einen Menschen hinter der Kulisse haben – das ist quasi unsere Spezialzutat.« Vivian dreht sich mit einem fröhlichen Lächeln und einem gut getarnten Was-zur-Hölle?-Blick zu mir herum. »Lacey wird unser Team von Stylisten ausbilden und anleiten.« Obwohl ich ihr ansehen kann, dass es ihr widerstrebt fortzufahren, macht sie weiter: »Sie verfügt über eine Art ziemlich beeindruckender Superkraft. Lacey kann Ihnen ganz exakt sagen, was Sie zu egal welchem anstehenden Anlass tragen wollen. Was auch der Grund ist, warum sie so perfekt zu Clean Clothes passt: Stil plus Intuition.«
Tom Bacon, der Mann aus Geld, wendet sich nun mir zu. »Also gut. Ich heirate im September in den Hamptons, und ich habe keinen blassen Schimmer, was ich anziehen soll. Peter ist am Durchdrehen – er selbst hat seinen Smoking schon seit der Highschool ausgesucht. Nur zu, geben Sie Ihr Schlechtestes, Lacey Whitman.«
Schweiß tritt mir auf die Stirn. Der Raum ist auf einmal verschwommen, schwankend. Ich runzle angestrengt die Stirn, während ich versuche, den Sinn seiner Frage zu begreifen, und Zeit schinde, indem ich so tue, als würde ich übertrieben aufmerksam sein Outfit mustern. »Wer …?«, setze ich an. »Was für Designer mögen Sie?«
Tom kratz sich am Kinn. »Tom Ford: guter, starker Name. Die Briten wissen, was sie tun. Und ja nichts von diesem untalentierten Stümper Elan Behzadi.«
Alle lachen, bis auf Elan und mich. Über seine Schulter hinweg, etwa sechs, sieben Meter entfernt, erblicke ich Eloise Cunningham-Bell. Eine unwillkommene Woge von Vertrautheit.
Sie hat mich nicht gesehen. Sie kann mich nicht sehen.
Mein Herz hämmert gegen meinen Brustkorb. Ich bin dabei, den Halt zu verlieren. Die Musik ist zu laut, mein BH ist zu eng, meine Schuhe drücken. Meine Hand liegt auf meiner Brust, presst sich gegen das weiche Fleisch. Erschrocken reiße ich sie weg. Der Anflug eines Lächelns zuckt um Elans Mundwinkel. Er weiß, dass ich dabei bin, die Fassung zu verlieren, und er findet es witzig. »September.« Ich lecke mir über die Lippen. »Eine Septemberhochzeit.« Eine Septemberhochzeit. Das klingt schön. Ich habe nie viel über Hochzeiten nachgedacht – meine Hochzeit –, doch jetzt werde ich womöglich nie die Gelegenheit dazu bekommen, denn meine Gene haben mir eine Zielscheibe mitten auf die Stirn gemalt. »Glühwürmchen in Einmachgläsern und … Girlanden … mit kleinen weißen Lichtern …« Meine Diagnose setzt mich einer irrsinnig hohen Wahrscheinlichkeit von Brust- und Eierstockkrebs aus – Krebsarten, die Frauen töten, die bereits Hunderte, Tausende, Millionen von Frauen getötet haben. Frauen wie … »Leinen … Stoffe … die … atmen …« Doch ich kann nicht atmen, weil es mich nicht hätte treffen sollen. Aber es hat mich getroffen: mich. Ich werde Krebs kriegen. Es liegt in meiner gottverdammten DNA. Die Wahrheit schnürt mir die Kehle zu, und meine Beine knicken beinahe unter mir weg.
»Lacey?« Vivians Stimme ist schroff.
»Vivianne Westwoods Slim-Fit-Sommeranzug«, presse ich hervor. Die perfekte Antwort, aber ich kann nicht mehr. Ich bin durch. »Entschuldigen Sie mich.« Die Menschenmenge um mich herum erdrückt mich, raubt mir die Luft, während ich vergeblich nach dem Ausgang suche.
3.
»Steph ist nicht da.« Der Typ, der mir die Tür geöffnet hat, deutet in das Loft. »Du kannst aber gerne warten.«
Normalerweise würde ich ihm sagen, dass ich selbstverständlich warten und überhaupt tun darf, was mir beliebt, weil ich nämlich mal hier gewohnt habe. Ich gehöre quasi zum Originalinventar. Doch stattdessen hocke ich mich steif auf das alte Sofa. Es ist nicht so gemütlich, wie ich es in Erinnerung hatte.
Der Junge steht unsicher herum. »Ich bin übrigens Cooper.«
»Lacey.« Ich reiche ihm nicht die Hand.
Der Junge, Cooper, trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck: The Future is Female Ejaculation. Er ist in meinem Alter, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht einen Tick größer, mit ungepflegtem sandblondem Haar und rahmenloser Brille. Er ist das menschliche Pendant zu einer Reklamestofftasche.
»Ich mag dein Kleid«, wagt er sich vor. »Sehr … modern.«
Modern? Ist das eine versteckte Art, mir mitzuteilen, dass ich affig ausschaue? Oder ist Cooper ein Zeitreisender aus den Zwanzigerjahren und fragt mich gleich, ob wir einen kleinen Spaziergang durch den Garten unternehmen wollen? Mir fällt keine Erwiderung ein.
Er wahrt weiterhin eine gesunde Distanz, als er fragt: »Alles in Ordnung bei dir?«
Ich nicke.
»Weil du irgendwie aussiehst, als ob …«
Mein Kopf schnellt wütend hoch. »Als ob was?«
Er öffnet den Mund. Ich verenge die Augen zu Schlitzen. Er ändert seine Taktik. »Willst du was trinken?«
Ich verschränke die Arme fest vor meiner Brust. »Ich habe heute eine ziemlich unschöne Nachricht erhalten.«
»Das tut mir leid.« Cooper lässt sich auf der Kante des Sofatischs nieder. »Willst du darüber reden?«
»Nein.«
»Okay.« Er kling so … liebenswürdig. »Dann also einen Drink? Ich hab Whiskey. In meinem Zimmer.«
Das Loft ist noch genauso chaotisch wie seit dem Auszug der letzten Mitbewohnerin, doch es scheinen mehr gerahmte Bilder an den abblätternden Wänden zu hängen. Über dem Stromschalter in der Küche klebt noch immer eine krakelige Notiz: Schalt mich nicht aus, ich kontrolliere den Kühlschrank. Und wenn die Heizung läuft, klingt es, als würde jemand im Keller gefangen gehalten. Der gemütliche Dauerzustand von Unordnung fühlt sich heimelig an, obwohl Astoria Queens seit über einem Jahr nicht mehr mein Heim ist. Als ich letztes Jahr von meiner Einstiegsposition zur Junior-Verkäuferin befördert wurde, zog ich in ein popelig kleines Studio im verhipsterten Williamsburg (nicht annähernd in Flussnähe). Ich konnte es mir zwar kaum leisten, aber es fühlte sich einfach erwachsen an. Steph, meine ehemalige Mitbewohnerin, ersetzte mich durch eine Reihe heißer Heteromädels, in die sie sich eine nach der anderen verknallte und die ihr alle, eine nach der anderen, ihr großes lesbisches Herz brachen. Der Neue ist also ein cleverer Schachzug. Er hat sogar echte Möbel – einen Schreibtisch, ein Regal. Weit entfernt von der Ansammlung von Holzpaletten und Straßenfundstücken, die mir als Einrichtung herhalten mussten, als ich frisch in die Stadt gezogen war. Über seinem Bett hängt eine gerahmte, signierte Schwarz-Weiß-Fotografie. Ein New Yorker U-Bahn-Waggon. Anhand des Graffitos tippe ich auf Achtzigerjahre. Vier Menschen, die Seite an Seite sitzen: eine Dragqueen, eine ältere Latina, eine schwarze Teenagerin mit Cornrows und ein Geschäftsmann im billigen Anzug. Sie blicken alle vor sich hin, gelangweilt und entspannt, wobei ihre Schultern sich behaglich berühren. Es ist intim, ein bisschen lustig und unglaublich menschlich. Die Schlafzimmerwände hat Cooper in einem klaren, hellen Blau gestrichen. Ich würde es ein Winterpastell nennen – frisch und beruhigend zugleich. Überhaupt hat der ganze Raum eine beruhigende Wirkung. Ich lasse mich auf sein ordentlich gemachtes Futonbett sinken. »Es ist immer so schräg, wieder in dem Zimmer zu sein.«
»Wie oft bist du denn ›wieder in dem Zimmer‹?« Cooper sammelt ein paar Klamotten vom Boden auf.
Auf seinem Bett liegt ein aufgeschlagenes Taschenbuch, einer dieser New-Age-mäßigen Ratgeber, geschrieben von einem Mönch mit einem beseelten Lächeln. Die Kunst, glücklich zu sein. Meistens. »Ist das gut?«
Er zieht eine Flasche Marker’s Mark aus dem extrem überfüllten Bücherregal und gießt uns zwei Whiskey ein – einen in ein Schnapsglas, einen in eine California-Bears-Footballtasse. »Es ist interessant.«
Ich streife meine High Heels ab und ziehe meine Knie an die Brust. Gestern haben diese Schuhe mich noch glücklich gemacht. Gestern fühlt sich so weit weg an. »Bist du unglücklich, Cooper-neuer-Mitbewohner?«
»Nein.« Er reicht mir das Schnapsglas und macht es sich in einem dieser absurd großen, schwarzen Schreibtischsessel bequem. »Nein, im Großen und Ganzen nicht. Ich dachte nur, es könnte nützlich sein zu hören, was die Buddhisten zu sagen haben.«
»Auf die Buddhisten.« Ich hebe mein Glas. »Ich hoffe nur, ich kehre nicht als irgendwas Ekliges wieder.«
Er neigt neugierig den Kopf. Sein T-Shirt ist alt und weich, und ich wünschte, ich würde auch etwas so Gemütliches tragen. Wir trinken. Ich schließe die Augen. Fermentierte Getreidemaische schmeckt immer noch nach zu Hause. Nach einem anderen Leben. Nach Pick-ups, billiger Limo und Highschoolpartys am Lagerfeuer, wo alles und nichts passierte.
Cooper beugt sich mit verschränkten Händen nach vorne. »Also, was ist dir heute passiert?« Er klingt aufrichtig besorgt.
Ich begegne seinem Blick, ohne meine Angst zu verbergen. Es ist das erste Mal, dass ich ihm richtig in die Augen schaue.
Vielleicht sollte ich es ihm sagen. Vielleicht will ich es ihm sagen?
Er blickt nicht weg.
Die Wohnungstür fällt knallend zu. »Lace?« Es ist Steph.
Ich blinzle und rufe: »Ich bin hier !«
Sie taucht in der Tür auf, die Wangen gerötet von der Kälte, und blickt verwirrt zwischen mir und Cooper hin und her. »Ich habe deine Nachricht bekommen. Was ist los?«
• • •
Wir hocken im Schneidersitz auf Stephs Bett, und ich erzähle ihr von Dr. Fitzpatricks Anruf.
Steph Malam ist eine gute Zuhörerin, vielleicht wegen all dieser kätzchenhaften Mitbewohnerinnen, die sich bei ihr schon das heterosexuelle Herz ausgeschüttet haben. Sie ist indischstämmige Engländerin, was mit einem schicken britischen Blimey, guvvner !-Akzent und einer schier unendlichen Geduld für ungebildete Amerikaner einhergeht, die keine Ahnung von Geschichte oder Geografie haben (»Ja, ich kann dunkle Haut haben und Britin sein: Tatsächlich gibt es ungefähr eineinhalb Millionen von uns«). Standardoutfit: Indie-Band-T-Shirt, roter Lippenstift, Nasenring. Sie hätte ganz gern, dass man sie für ein bisschen tough und abgebrüht hält, aber ihre riesigen schokobraunen Augen füllen sich schon mit Tränen, wenn sie auch nur an YouTube-Videos von zu ihren Haustieren heimkehrenden Soldaten oder ihre transsexuellen Kinder akzeptierenden Eltern denkt. Sie ist ganz schlecht, was Geld, Mädchen und Pünktlichkeit betrifft, und so konfliktscheu, dass sie im Restaurant lieber jedes irrtümlich falsch servierte Gericht aufisst, als es zurückgehen zu lassen (»Ich will nicht, dass der Kellner sich schlecht fühlt, und im Ernst, Lace, diese geschmorten Hühnerhälse sind echt lecker«). Sie bringt mich zum Lachen und hat ein Herz von der Größe eines Sonnensystems. Sie ist meine beste Freundin, auch wenn wir das nie offiziell gemacht haben.
Ich erkläre ihr, was ich weiß: dass jeder über BRCA1- und BRCA2-Gene verfügt. Wenn sie funktionieren, halten sie Krebszellen davon ab, sich zu bilden. Das Problem ist, wenn sie kaputt sind, wenn sie so weit mutiert sind, dass sie ihren Job nicht erledigen können. Dann bist du am Arsch. Du hättest bessere Chancen damit, deine Schlüssel in der Wohnungstür stecken zu lassen und darauf zu hoffen, dass die Diebe dich übersehen – und zwar für den Rest deines Lebens. Denn das ist es, was es ist: ein kaputtes Schloss gegen einen praktisch zwangsläufigen Einbruch.
Meine ehemalige Mitbewohnerin nimmt meine Hände und drückt sie ganz feste. »Das muss ein Riesenschock gewesen sein.«
»Ja, so riesig, dass ich wie so eine Geistesgestörte von der Hoffman-House-Party abgehauen bin. Gott, ich hoffe nur, niemand hat mich gesehen.«
»Und wenn schon, das ist egal.« Steph schaut mich an. »Wie fühlst du dich?«
»Ich weiß nicht.« Ich reibe mir die Stirn. »Ich habe keine Ahnung.«
»Das ist in Ordnung.« Sie drückt meine Schultern. »Eins nach dem anderen, morgen ist auch noch ein Tag.«
»Ich habe einen Termin«, erwidere ich ausweichend. »Morgen. Bei einer genetischen Beraterin in einem Krebszentrum in Nord-Manhattan.
Steph reagiert auf das Wort Krebs, als hätte ich etwas unfassbar Gemeines gesagt: mit einem heftigen Schock, den sie zu verdauen versucht, ohne deswegen die Fassung zu verlieren. »Wow. Okay. Das klingt …« Ich denke, sie sagt gleich schrecklich. Sie entscheidet sich für »gut«. Sie bindet ihren Bob zu einem winzigen, stummeligen Pferdeschwanz zusammen, was sie immer tut, wenn sie nervös ist. »Und was heißt das alles? Also, falls du ein erhöhtes Risiko hast, was …?«
»Ich schätze mal, das erfahre ich morgen.« Ich rolle mich vom Bett und gehe zum Bücherregal auf der anderen Seite des Zimmers.
»Was ist das durchschnittliche Risiko für die meisten Frauen? So was wie fünf Prozent?«
Dreizehn. »Ich weiß nicht genau.« Ich ziehe ein Buch aus einem der Stapel auf ihrem Schreibtisch hervor: Angst vorm Fliegen. »Das wollte ich schon immer mal lesen. Kann ich es mir borgen?«
Steph schweigt. Als ich mich umdrehe, starrt sie auf ihr Smartphone. »Das Lebenszeitrisiko von Brustkrebs bei BRCA1-Trägerinnen kann bis zu …«
»Hoch! Ja, ich weiß, es ist echt beschissen hoch.« Ich klinge wütend und mildere sofort meinen Tonfall. »Das ist nicht der Moment für Dr.-Google-induzierte Hysterie, Stephanie.«
»Ich bin auf einer total seriösen Seite«, sagt sie.
»Einfach nur nicht jetzt, okay? Nicht heute. Hast du keinen Whiskey da? Komm, wir betrinken uns.«
»Ich versuche doch nur zu verstehen, was das alles bedeutet«, erwidert sie beinahe flehentlich.
»Nun, dafür wird es noch haufenweise Zeit geben.« Ich blicke mich auf der Suche nach einer Flasche mit was Braunem drin um. »DNA, du weißt schon. Gibt nicht unbedingt eine Heilung dafür.«
»Oh Gott.« Steph hebt die Hand an den Mund.
»Ich wollte damit nicht …« Ich atme schwer aus »Mir geht’s gut. Im Moment geht es mir absolut blendend.«
»Aber …« Ihre Augen zucken zu ihrem Smartphone.
»Steph! Themenwechsel.« Ich schnipse schnell mit den Fingern auf der Suche nach irgendwas, buchstäblich irgendwas. »Barista-Mädchen. Die eine, in die du verschossen bist. Irgendwelche Fortschritte?«
»Barista?« Sie kann ihre Augen nicht davon abhalten, immer wieder zu ihrem Handy zu wandern.
»Café am Eck. Pferdetattoo. Sie hat dir einen Latte macchiato aufs Haus spendiert.« Jetzt bin ich es, die fleht.
»Ähm … ja, ich … bin neulich hin und …« Sie schüttelt den Kopf. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Mein Magen zieht sich zusammen. »Lace, ich kann nicht. Ich muss wissen, was das bedeutet.«
»Herrje, Steph! Es geht nicht um dich!« Sofort bereue ich es. »Es tut mir leid. Entschuldige.«
»Ist schon okay. Lass es raus. Deine Gefühle sind absolut berechtigt.« Sie kommt auf mich zu, die Arme zu einer Umarmung ausgestreckt.
Ich weiche zurück, werfe eine Lampe um. Gelbes Licht wippt über die Wände. »Scheiße. Es ist schon spät. Ich sollte gehen.«
»Lace!«
Ich haste durch das Loft zurück, stoße hektisch die Arme in meine Mantelärmel, wickle den Schal zu eng um meinen Hals. Steph ist hinter mir, ruft mir nach, damit ich warte, bitte warte. Sie erwischt mich, als ich gerade die Wohnungstür öffne. »Wir werden das durchstehen, Lace.« Ihre Stimme ist weinerlich und hoch. »Was auch immer passiert, wir werden es durchstehen.«
Ich reiße mich los. Die wenigen Zentimeter zwischen uns sind eine Kluft. »Das hier passiert aber nicht dir, Steph.«
4.
Die Leute sagen immer, dass eine ordentliche Mütze voll Schlaf die beste Medizin sei, dass am nächsten Morgen alles anders aussehe. Diese »Leute« sind dreckige Lügner, die bloßgestellt und auf der Stelle bestraft gehören. Ich schlafe weder gut noch durch. Gegen drei Uhr nehme ich eine Schlaftablette und verfalle in einen erstickenden Albtraum, in dem ich mich in eine Werwölfin verwandle und Elan Behzadi immer wieder versucht, mich in einer Modenschau unterzubringen. Mein Wecker geht um sechs Uhr los. Draußen ist es noch dunkel, als ich mich in mein winziges Badezimmer schleppe. Die Tatsache, dass ich vor und nach meinem Spinning-Kurs dusche, ist etwas, das nur Steph über mich weiß, und heute früh bin ich fest entschlossen, meinen Hintern aufs Rad zu schwingen. Ich habe volle Kontrolle über meinen Körper, ich bin seine Herrin. An vier Morgen die Woche jage ich ihn durch die Hölle, und er belohnt mich dafür, indem er mich anstandslos in Jeans der Größe 36 passen lässt. Heißes Wasser prasselt auf meine Haut. Ich schöpfe einen Klecks Rosen-Bergamotte-Zuckerpeeling aus dem Tiegel und verreibe es in sanften kreisförmigen Bewegungen um meine Brüste. Meine Fingerspitzen fahren über die schwachen Dehnungsstreifen und die Schar kleiner Sommersprossen. Jede Brust liegt bequem in einem meiner Handteller und wiegt kaum mehr als ein kleines Vögelchen.
Meine Oberweite ließ sich damals ganz schön lange bitten. Ich war neun, bis es zu einer Entwicklung kam, die einen Tagebucheintrag wert war, und fast dreizehn, bis ein kritisches Volumen einen echten BH rechtfertigen konnte. Ich lechzte danach, den ollen Sport-BH, den ich von meiner Schwester weitergereicht bekommen hatte, in die Tonne zu treten, doch die Frage war, wie. Zu der Zeit war mein Vater eher schon so etwas wie ein Special-Guest-Star als ein Mitglied der Stammbesetzung, und meine Schwester verbrachte ihre Freizeit vornehmlich damit, Morrisey zu hören und alles und jeden zu hassen. Ich hatte angefangen, mir mit Babysitten was dazuzuverdienen, was ich heimlich tat, da meine beiden Familienmitglieder sich nicht zu schade waren, sich meine Ersparnisse »auszuborgen«. Ich bin das einzige Mädchen, das ich kenne, das sich ihren ersten BH alleine kaufen musste. Ich erzählte der Verkäuferin, meine Mom wäre noch in der Kundentoilette. Die Dame brachte mir vier bügellose BHs in verschiedenen Größen, und ich probierte sie alle mit der Gewissenhaftigkeit einer Wissenschaftlerin an. Ich kaufte den billigsten und zählte die Summe am abblätternden beigen Verkaufstresen auf den Cent genau ab.
Die Verkäuferin, die in regelmäßigen Abständen den Laden nach meiner abwesenden Mutter absuchte, bedachte mich mit einem prüfenden Blick, als sie mir die Plastiktüte rüberreichte. »Ist das dein erster BH?« Ihre Ohrringe hatten die Form von kleinen Katzengesichtern.
Ich nickte peinlich berührt.
Sie schürzte die Lippen, wobei der matte malvenfarbene Lippenstift sich in den Fältchen um ihren Mund verästelte. »Männer denken manchmal nicht mit dem Kopf. Sie denken mehr mir ihrem …« Sie senkte finster den Blick auf ihren Schritt. Meine Verlegenheit steigerte sich schlagartig zu heißer Scham. »Du musst immer das hier benutzen«, sie tippte sich an die unter einer Wolke aus orangem Haar versteckte Schläfe, »wenn es um das hier geht.« Wieder deutete sie auf ihren Schritt-Penis.
»Ja, Ma’am«, erwiderte ich ganz automatisch, während ich gleichzeitig ein nicht konfessionsgebundenes Stoßgebet um meine sofortige Exekution zum Himmel schickte.
Sie nickte zufrieden und wandte sich ab, um sich um die nächste Kundin zu kümmern.
Meine Jugend war voller solcher Momente: gut gemeinte, wenn auch wirre Puzzles aus Ratschlägen von einem losen Netzwerk älterer Damen, die sich zusammen zu einem nur schwer verständlichen Bild des Frauseins fügten. Ich brauchte »Damenbinden« für die Tage, wenn »die Rote Tante kommt«; ich könnte womöglich »Bedürfnisse« haben, aber es sei am besten, »ihnen nicht nachzugeben«. Anstatt mir beizubringen, meine Weiblichkeit mit offenen Armen willkommen zu heißen, lautete die Botschaft: Ignoriere sie, und vielleicht geht sie vorüber. Im Großen und Ganzen war alles, was mit Sex, meinem Körper oder meiner Existenz als Frau zu tun hatte, mysteriös bis schambehaftet, und je weniger ich darüber nachdenken, geschweige denn irgendwas dahingehend unternehmen musste, desto besser. Ich war unglaublich dankbar, als meine Brüste ihr Wachstum bei 70B einstellten. Die Mädels hängen weder, noch sind sie erbsengroß und stellen somit keine meiner fünf Hauptproblemzonen dar. (Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich habe, aber sagen wir mal so: Meine Hüften lügen nicht und halten in keinem Outfit die Klappe.) Meine Nippel haben die dezente Größe von Cranberrys und meine Brustwarzenvorhöfe (wer hat sich das Wort eigentlich ausgedacht?) die Farbe reifer Sommerpfirsiche. Mit dem richtigen Push-up-BH kriege ich ein passables Dekolleté hin. Mein Ex-Freund an der Uni nannte sie »artig und fein«. Ein stilles Erfolgsduo, das nun unerwarteterweise zu den Stars der Show avanciert ist. Und zwar aus den denkbar falschesten Gründen.
Der süße Rosenduft vermengt sich mit dem Dampf. Ich hole tief Luft und stoße sie wieder aus, wobei ich bis vier zähle. Dann wiederhole ich es noch einmal. Zum ersten Mal seit Dr. Fitzpatricks Anruf verspüre ich so etwas wie Wohlsein. Erlösung. Ja, sogar Hoffnung. Eine Perspektive. Ich habe keinen Krebs. Womöglich kriege ich nie welchen. Ich bin fünfundzwanzig, ich bin jung. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Die absurd hohen Statistiken, die Steph im Netz gefunden hat, bezeichnen das Lebenszeitrisiko. Die Wahrscheinlichkeit, in meinem Alter Krebs zu kriegen, liegt viel, viel niedriger. Das hier ist kein Todesurteil – ganz und gar nicht. Vielleicht verlege ich meinen Termin heute Nachmittag einfach. Es ist durchaus möglich, dass meine Panik eine kleine Überreaktion …
Und da spüre ich es. Dort, auf der linken Seite, auf der Unterseite.
Ein Knoten.
Alles bleibt stehen.
Ich drücke hinein, umkreise ihn wieder und wieder, doch es ist und bleibt ein Knoten. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich taste meine Brüste immer mal wieder ab, aber ich bin mir nie ganz sicher, wonach ich eigentlich suchen soll, und meistens endet es damit, dass ich ein verirrtes Härchen rauszupfe oder, gelegentlich, masturbiere. Es könnte ein Lymphknoten sein oder eine Zyste, oder ES KÖNNTE EIN GOTTVERDAMMTER TUMOR SEIN! Ich knalle den Wasserregler so fest runter, dass meine Hand schmerzt. Als ich aus der Dusche steige, trifft mein Fuß auf die Badematte und schlittert nach vorne weg. Ich rudere auf den rutschigen Fliesen rückwärts und lande unsanft auf meinem Hintern. Ein fieser Schmerz schießt mein Steißbein empor. Ich weiß nicht, ob ich dankbar oder traurig bin, dass niemand da ist, um das hier mitanzusehen.
• • •
Als ich im Midtown Medical eintreffe, humple ich immer noch. Meine hysterische Darbietung einer im Dachstuhl gefangenen Taube überzeugt die Arzthelferin, mich dazwischenzuquetschen, um Dr. Fitzpatrick mein keckes neues Knötchen zu zeigen. Ehrlich gesagt, verspüre ich selbst meinem Friseur gegenüber mehr Loyalität als meinem Frauenarzt. Dr. Fitzpatrick ist ein klassischer weißhaariger Patriarch, der höchstwahrscheinlich Hirschgeweihe als adäquaten Wandschmuck betrachtet und diverse uneheliche Kinder rund um den Globus geparkt hat, aber er akzeptiert meine Krankenversicherung und seine Praxis befindet sich in der Nähe meiner Arbeit.
Nachdem er meine Brüste grob zwei Sekunden abgetastet hat, meint er, er könne nichts mit Sicherheit sagen, aber er werde versuchen, mir einen Termin für eine kurative Mammografie und eine Ultraschalluntersuchung gleich nach meinem genetischen Beratungsgespräch heute Nachmittag zu besorgen. Eine kurative Mammografie sei etwas anderes als ein Mammografie-Screening, kurativ heiße, sie suchen nach was Bestimmtem. Ich habe keine Ahnung, ob meine Versicherung das bezahlt, oder was sie überhaupt bezahlt. Als ich von schierer Angst gepackt losheule, sagt er: »Na, na, das bringt jetzt doch auch nichts.« Und schiebt noch hinterher, dass die Arzthelferin sich um die Terminvergabe kümmern werde. Wow, ich hatte ja keine Ahnung, dass gleich so viel Mitgefühl in einen greisen Körper passt.
Bei Hoffman House hängen meine Kollegen und Kolleginnen mit Sandwiches bewaffnet und schlimm verkatert an ihren Schreibtischen. Mit meinen geröteten Augen und der verschmierten Wimperntusche füge ich mich absolut ins Bild. Die Praktikantinnen zwitschern um mich herum wie Dornröschens tierische Disney-Freunde, überschütten mich mit telefonischen Mitteilungen und neuestem Tratsch, verlangen Anweisungen, benötigen Aufmerksamkeit. Scheint so, als hätte niemand gestern meinen panischen Abgang von der Party bemerkt. Ich sollte erleichtert sein, aber in mir ist kein Platz für andere Gefühle und Gedanken als jenen, der in rot leuchtenden Großbuchstaben in meinem Kopf schrillt: KREBS. KREBS. DU HAST KREBS! Ich muss mich dazu zwingen, die Stelle nicht zu berühren, die ich jetzt so oft angetatscht habe, dass sie entweder blau anlaufen wird oder glänzt wie ein Messingknauf. Der Anblick meines Schreibtischs, so ordentlich und optimistisch, lässt die Tränenströme beinahe wieder losbrechen. Schwarzweiße Automatenfotos von Steph und mir bei irgendeinem Event, auf dem wir dämliche Grimassen schneiden, liegen neben meinem VIP-Pass für die Alexander-McQueen-Retrospektive im Metropolitan Museum of Art. Dann ist da noch mein kupferner Bleistiftspitzer in der Form des Eiffelturms. Die Einladung zum dritten Geburtstag meiner Nichte. Neben meiner Tastatur ein Paisley-Stoffmuster – so klein, so unschuldig. Eine perfekte Metapher für meine kleine, unschuldige Vergangenheit, damals, als das einzige Ziel darin bestand, Spaß zu haben, sich mit Steph zu betrinken und zu lachen. Und auch wenn ich weiß, dass ich die Geschichte beschönige und das Leben nicht so leicht war, war es das doch. War es wirklich.
Eine heisere Stimme … Honig auf gesplittertem Glas: »Lacey?« Patricia Hoffman steht an meinem Schreibtisch.
Oh nein.
Patricia Hoffman ist auf tausenderlei Arten großartig, was bei mir eine berauschende Mischung aus Loyalität, Bewunderung und Furcht hervorruft. Dank ihrer Passion für Schönheits-OPs, Liebhaber, die nicht zu alt wären, um mich zu daten, und Perücken habe ich nie ganz rauskriegen können, wie alt sie wirklich ist. Sie war viermal verheiratet, besitzt zwei Stadthäuser in New York – eins in Upper Manhattan, eins ins Lower Manhattan –, und man erzählt sich, dass Paul Simon einst einen Song über sie geschrieben hat. Eine klassisch extrovertierte Persönlichkeit mit dem Elan einer Erstsemesterin, der Kultiviertheit alten Adels und der Garderobe einer Kostümbildnerin. Normalerweise freue ich mich über unser gelegentliches kurzes Geplänkel. Doch heute ist nichts normal.
»P… Patricia. Hi. Wie war’s in Paris?«
»Ach, das Übliche.« Sie nimmt ihre goldene Cat-Eye-Brille ab. »Haufenweise Knaben mit albernen Schnurrbärten, die mir billigen Champagner unterjubeln wollten und versuchten, mich in ihre winzigen französischen Betten zu kriegen.«
Mein Stichwort für eine flotte Erwiderung à la: »Ich sehe schon, Sie sind mit Emirates geflogen«, aber ich muss mir solche Mühe geben, nicht vor meiner Chefin loszuflennen, dass ich kein Wort rauskriege.
Sie zieht ein Paar altrosa Lederhandschuhe aus und enthüllt ihre manikürten Fingernägel in der Farbe reifer Pflaumen. »Wie war die Party? Ich bin untröstlich, dass ich sie verpasst habe!«
»Die Party war …« Mir fällt kein einziges attraktives Adjektiv oder Bild ein. Zu meinem eigenen Entsetzen verlege ich mich auf: »… nett.«
»Nett?« Patricia starrt mich mit einem Ausdruck tiefster Verwirrung an. Dann Schrecken. Der sich zu Besorgnis abmildert. Mit ihrer ungekünstelten Stimme fragt sie: »Lacey, ist mit Ihnen alles in Ordnung?«
Ich nicke hastig und setze rasch ein Lächeln auf, das ungefähr genauso überzeugend ist wie ein Toupet.
Ihre Stirn verzieht sich zu einem Runzeln. Sie legt eine Hand auf meine Schulter. »Kommen Sie in mein Büro. Wir lassen uns von den Kätzchen« – die sie dienstfertig umschmeichelnden Praktikantinnen – »einen Cappuccino vom Le Coucou holen.«
Und während der erbärmliche, der bedürftige Teil von mir die Hacken in Patricia Hoffmans Schaffellteppich graben und ihr absolut alles erzählen will, schiebt ein anderer, mächtigerer Teil diesem Drang einen Riegel vor. Es war bereits extrem nett von meiner Chefin, meine Arbeit an Clean Clothes nach Feierabend zu unterstützen – höchstwahrscheinlich, weil ich angedeutet hatte, dass ich, falls wir je eine Finanzierung an Land ziehen, meinen Job hier nicht kündigen würde. Ich wollte sie nicht enttäuschen oder unnötig beunruhigen: So viele Start-ups … nun ja, sie kommen nicht über den Start hinaus. Aber um ehrlich zu sein, irgendwas an Patricias Großzügigkeit war mir immer latent unangenehm. Ich bin kein Sozialfall. Ich will niemandem eine Last sein oder Mitleid erwecken. Außerdem will ich Patricia keinerlei Anlass geben, zu glauben, ich würde nicht genau dorthin gehören, wo ich bin. Ich zaubere das ambitionierte Strahlen einer aufstrebenden, zugezogenen New Yorkerin auf mein Gesicht. »Danke, aber ich möchte das wilde Networking-Wirrwarr von gestern Abend aufarbeiten. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist … Sie wissen schon.«
Ihr Lächeln kehrt mit sichtlicher Erleichterung wieder. »Ja, wer rastet, der rostet.«
Es war die richtige Reaktion. Ich erwidere das Lächeln. »Nein, bloß nicht rosten.«
5.
Ich verbringe den Tag damit, auf die Zeitanzeige zu starren, die auf sechzehn Uhr hinzählt. Selbst die Jahreszeiten vergehen schneller. Gegenüber von meinem Schreibtisch hängt ein Poster, das mit dicker, fetter Typo fragt: WHO IS AFRAID OF NOW? Oh, also ich weiß, wer Angst vor dem Jetzt hat!
Vivian und Steph rufen mehrfach an, doch ich lasse sie in die endlosen Weiten meiner Mailbox umleiten. Die Vorstellung, mit einer der beiden über den gestrigen Abend zu reden, fühlt sich ungefähr so verlockend an wie eine Analspiegelung.
Um exakt halb vier melde ich mich ab und murmle irgendwas von einem Kaffee-mit-Kunden-Termin Richtung Empfangsdame. Der Schnee von gestern Nacht wird bereits grau und matschig. Ich nehme die U-Bahn nach Nordmanhattan.
Ich bin davon ausgegangen, das New York Cancer Care Center sei eine Einrichtung für Beratungsgespräche und Sorry-du-bist-am-Arsch-Betreuung. Ich bin nicht darauf vorbereitet, dass es auch ein Zentrum für akute Krebsbehandlungen ist. Die Frau in der Schlange vor mir hat einen komplett kahlen Kopf. Meine innere Reaktion ist mir selbst peinlich: Ich finde es grauenvoll. Als sie am Empfangstresen fertig ist, wird mir bewusst, dass ich einen unnatürlich großen Abstand zu ihr eingehalten habe.
Ich konnte Krankenhäuser noch nie leiden. Man kann getrost sagen, dass ich sie abgrundtief hasse. Aus Gründen, über die ich nicht wirklich nachdenken will.
Ich werde angewiesen, auf einem der makellosen petrolgrünen Sofas Platz zu nehmen, bis ich drankomme. Alles hier sieht neu, sauber und teuer aus, was in mir abermals Sorgen bezüglich meiner Versicherung und der Kostenübernahme weckt. Mir ist klar, dass ich den Anruf vor mir herschiebe, und mir ist klar, dass das feige ist. Doch allein die Vorstellung macht alles viel zu real.
Ein banges Gefühl zupft unentwegt an mir. Ich sage mir selbst, dass es nur ein Beratungsgespräch ist, dass hier nichts Schlimmes passieren wird. Aber mein Körper will nichts davon hören und reagiert stattdessen, als müsste ich gleich eine Einzelpräsentation vor der gesamten Belegschaft halten. Mein Herz wummert laut in meinen Ohren.
Eine trashige Frauenzeitschrift zeigt ein makabres Karussell grinsender gephotoshoppter Fratzen. Eine Frau mit dem Körperfettanteil eines Haargummis beugt sich über einen an ein Bett gefesselten Typen mit enthaarter Brust. Seine Augen sind auf eine Art zusammengekniffen, die entweder auf Begehren oder Mordlust schließen lassen. Die Schlagzeile brüllt mir entgegen: ENTFESSELN SIE IHRE FANTASIEN! DER SEX, DEN SIE SCHON IMMER HABEN WOLLTEN. Die Brüste der Haargummifrau quellen aus dem schwarzen Spitzen-BH wie zwei überreife Melonen mit Fluchtabsichten.
Sie ist der Inbegriff von sexy.
Brüste sind sexy. Alle mögen sie. Titten anglotzen ist eine der großen amerikanischen Freizeitbeschäftigungen, so wie Baseball oder gelegentlicher Rassismus. Babys mögen Brüste. Männer mögen Möpse. Ich mag meine. Aber ich habe mich definitiv noch nie über einen an ein Bett gefesselten Typen gebeugt, um ihn mit einem Paar aufmüpfiger Cantaloupe-Melonen zu überrollen. Ist es das, was ich tun sollte, angesichts der Tatsache, dass eine meiner Optionen … nun ja …?
»Lacey Whitman?«
Eine Frau in knöchellangem Rock, beigefarbenem Rollkragenpulli und einer, wie ich stark vermute, selbst gestrickten Weste hält ein Klemmbrett in den Händen. Ein züchtiger Bob, offenes Gesicht, ein paar Pfunde zu viel. Bin ich etwa in den Kaninchenbau gefallen und direkt wieder in Illinois gelandet? Sie verströmt den Dunst von Kuchenverkauf und Tupperware, und falls sie jemals ihre sexuellen Fantasien entfesselt hat, so wette ich, dass sie gebuttertes britisches Hefegebäck und ein nettes kleines Nickerchen beinhalten. Sie heißt Judy-Ann McMallow, und sie ist meine humangenetische Beraterin.
Judy-Anns Büro duftet nach heißen Zimtschnecken, und zwar in der Version eines billigen Lufterfrischers. Diverse Lampen bemühen sich um eine Atmosphäre von »Behaglichkeit«, doch sie können nicht die Tatsache übertünchen, dass es ein Büro ist, in dem Menschen schlechte Nachrichten bekommen. Sage und schreibe drei Taschentuchspender befinden sich in Griffweite. Ich hocke mich auf die Kante eines kleinen, weichen Sofas, während sie sich für eine Unordnung entschuldigt, die ich nirgends ausmachen kann. Einen Tee? Gerne. Sie hat eine Kanne Kamillentee bereitstehen. Judy-Ann spricht mit mir in einem Tonfall, der dazu angedacht ist, mich zu beruhigen, und obgleich er das nicht unbedingt schafft, so hat es doch den Effekt, dass ich sie nachahme. Ich war immer schon ein bisschen wie ein Chamäleon – in der Lage, mit allen möglichen Menschen zu verkehren, von Milliardärsmackern bis hin zu Farmern der vierten Generation, indem ich beinahe automatisch ihre Eigenheiten und Sprechmuster imitiere. Als Judy-Ann also in einem mitleidstriefenden Halbgeflüster loslegt, erwische ich mich dabei, wie ich in gleicher Weise antworte.
»Also, Lacey, wie geht es Ihnen?«
»Mir geht’s gut, Judy-Ann. Mir geht’s gut.«
»Schön. Nun, was wissen Sie bisher?«
»Ich weiß, dass ich positiv auf die BRCA1-Genmutation getestet wurde, und ich begreife das Risiko, dem ich dadurch ausgesetzt bin.«
»Mhm.« Ein angemessener Blick beflissenen Mitgefühls. »Ja, das ist hart. Ich entnehme Ihrer Akte, dass Sie vor dem Test nie eine genetische Beratung in Anspruch genommen haben. Stimmt das?«
»Ja«, antworte ich. »Mein Arzt hat mich nicht über die Möglichkeit aufgeklärt.«
Tatsächlich ist das eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass ich meinem Arzt gesagt habe, dass ich bereits bei einem Humangenetiker gewesen war, dass, ja, ich die Risiken verstünde. Ich war vollauf davon überzeugt gewesen, dass der Test negativ ausfallen würde. Vorab zu einer genetischen Beratung zu gehen erschien mir völlig überflüssig – nur ein weiterer Trick des Gesundheitssystems, mir meine bereits kümmerlichen Gehaltsschecks aus der Tasche zu ziehen. Ich machte mir mehr Sorgen darum, ob meine Krankenversicherung die Kosten für den Test übernehmen würde, als um das Ergebnis.
»Und wie fühlen Sie sich im Moment?«, erkundigt sich Judy-Ann.
Ich tue so, als würde ich über die Frage nachdenken, und antworte in ihrem affektierten Halbflüstern. »Ich habe Angst, an Brustkrebs zu sterben, Judy-Ann.«
Ihre Lippen verziehen sich zu einem teilnahmsvollen Lächeln, doch ihre Augen mustern mich prüfend und ziehen ihre eigenen Schlüsse. »Möchten Sie darüber reden?«
Über meine Angst zu sterben? Mit Ihnen, einer wildfremden Frau? Mein Nachahmungstrick verpufft. Ich starre auf meine Schuhe. »Vielleicht später.«
Sie notiert sich etwas. »Lassen Sie uns über Ihre Familiengeschichte sprechen.«
Obwohl ich ahnte, dass dieser Teil kommen würde, zuckt mein Fuß auf dem Teppich. »Klar. Dauert nicht lange.« Ich erkläre, dass meine Großeltern väterlicherseits in Florida leben, immer noch wohlauf sind und keine Krankheitsgeschichte mit Krebs haben. Wir stehen uns nicht nahe. »Sie finden, Abtreibung ist schlimmer als Pädophilie, von der sie auch nur aufgrund der Existenz schwuler Männer wissen. Das Letzte, was ich von meinem Dad gehört habe, ist, dass er als Perlentaucher auf Tahiti arbeitete. Er ist ein Freigeist, will sagen, katastrophaler Vater. Keine Tanten, keine Onkel. Meine Großeltern mütterlicherseits verunglückten in den Siebzigern während ihres Urlaubs bei einem Autounfall in Rom, doch wenigstens starben sie, während sie taten, was sie am meisten liebten – nämlich betrunken Auto fahren. Ich habe eine ältere Schwester, Mara, dreißig Jahre. Sie lebt oben im Norden, mit ihrer Tochter, Storm, die definitiv das normalste Familienmitglied ist. Und nur damit die Maßstäbe klar sind: Storms bester Freund ist ein unsichtbares Pferd namens Bottom.«
Judy-Ann nimmt das alles völlig unbeeindruckt auf. »Irgendwelche Krebsvorerkrankungen bei Ihrer Schwester?«
Ich schüttle den Kopf. »Meine Schwester ist …« Wie soll ich das bloß in Worte fassen – eine ergebene Dienerin der Kombucha-Gottheit? »… nicht unbedingt ein Fan westlicher Medizin. Gentests inklusive.«
»Wenn ein Geschwister positiv auf BRCA1 getestet wurde, besteht die fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Geschwister ebenfalls die Genmutation tragen«, erklärt Judy-Ann. »Wie fühlen Sie sich bei dem Gedanken, Ihrer Schwester von dem Ergebnis zu erzählen?«