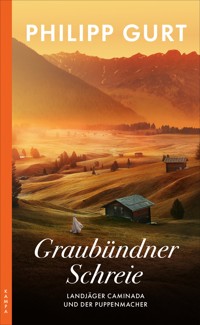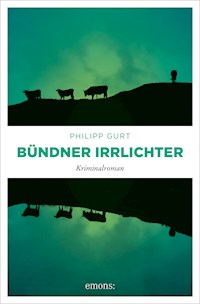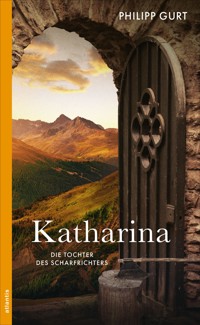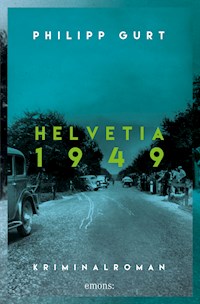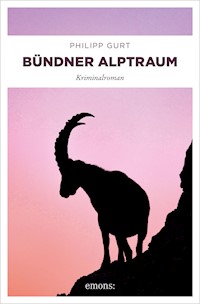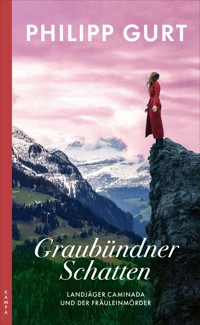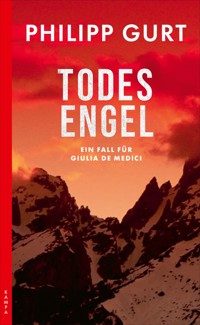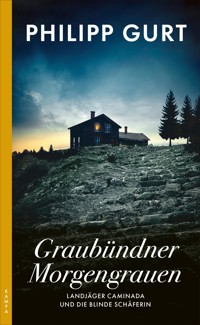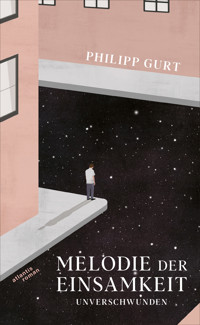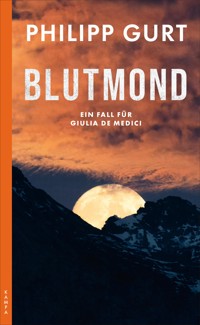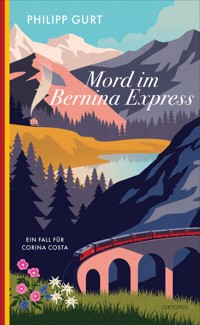12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn die Wahrheit tödlich ist. Giulia de Medici, Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, erhält ein anonymes Schreiben, das ihr den Atem stocken lässt. Darin wird ein unvorstellbares Verbrechen angekündigt – und das Opfer sieht Giulia zum Verwechseln ähnlich. Giulia muss tief in menschliche Abgründe eintauchen, um einen erschütternden Fall zu lösen. Ein packender Kriminalroman vor der phantastischen Kulisse der Bündner Berglandschaft – ein Lesevergnügen der ganz besonderen Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Philipp Gurt wurde 1968 als siebtes von acht Kindern in eine Bergbauernfamilie in Graubünden geboren. Er wuchs in verschiedenen Kinderheimen auf. Früh begann er mit dem Schreiben. Dreizehn seiner Bücher wurden bisher veröffentlicht, darunter auch mehrere CH-Bestseller. 2017 erhielt er den Schweizer Autorenpreis. Er lebt in Chur im Kanton Graubünden.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die «LChoice»-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Montage aus Ulrike Steinbrenner/photocase.de, lisa runnels/Pixabay.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-581-7
Komplett überarbeitete Neuausgabe
Die Originalausgabe erschien 2015 unter gleichem Titel
bei der Literaricum GmbH.
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für
Nicole DeckMichael MattisNesa VrugicChristian Keck
Berge sind dafür erschaffen, den Himmel zu durchsteigen – zu atmen, frei zu sein wie der Steinadler im Wind –, um sich inmitten ihrer Herrlichkeit zu verwandeln, als würde das Herz neu geboren.
Philipp Gurt
Prolog
Das Maiensäss lag idyllisch am Rande einer Waldlichtung, umrahmt von alten tiefgrünen Tannen und Birken mit hellem Blätterkleid.
Blut tropfte.
Es war später Nachmittag.
Der Sommer liess seit Wochen auf sich warten. War immer kurz davor, sich endlich zu entfalten, doch er kam nicht – steckte wie ein Niesen in der Nase fest. Stattdessen wehte immer wieder Nieselregen in dichten Schleiern um die Tannen. Der Nordwind rauschte in den höchsten Zweigen wie die Wellen eines Luftmeeres, die darin brandeten. Nebelschwaden hingen träge in den windgeschützten Bergflanken fest, als wären sie schon immer da gewesen.
Rauch stieg aus dem Kamin des Maiensäss empor, an dessen beschlagenen Fenstern Regentropfen kleine Rinnsale bildeten. Ein halb offener Fensterladen knarrte leise im Wind. Das Licht im Innern, das mattgelb die Fenster erhellte, ging aus.
Das Blut tropfte weiter, als hätte jemand einen alten quietschenden Wasserhahn nicht zur Gänze zugedreht.
Schwere, dicke Tropfen fielen wie dunkelrote Bomben und zerplatzten beim Aufprall. Das Spritzmuster saugte sich im heimelig wirkenden Holzboden fest und bildete so eine Spur bis hin zu einem dunklen Geländewagen, der vor der Haustüre parkiert war.
Mit hektischen, kurzen Bewegungen versuchten nun Hände, in Gummihandschuhen steckend, die Flecken aufzuwischen. Zwecklos – da war noch mehr. Viel mehr.
Eilige Schritte drangen durchs Häuschen. Die hölzerne Eingangstür fiel ins Schloss. Abdrücke von Männerbergschuhen blieben auf dem durchweichten Boden des Vorplatzes haften.
Eine Heckklappe schnappte dumpf zu. Scheinwerfer blendeten im diffusen Tageslicht auf, dass der feine Regen in den Lichtkegeln silbern leuchtend glänzte, als bestünde er aus Tausenden von Sternschnuppen.
Der schwere Wagen verschwand zwischen den Bäumen. Der kräftige Motor wurde stetig leiser, bis nur noch einzelne Geräuschfetzen aus dem nebligen Wald drangen, ehe er gänzlich verstummte.
Auf der Lichtung vor dem Maiensäss kehrte wieder Ruhe ein. Unter den mächtigen Tannen, deren Stämme vom vielen Regen dunkel und nass ummantelt waren, wuchs üppiger Farn. Ein Fliegenpilz hob sich kräftig rot von dem allgegenwärtig triefenden moosigen Grün ab. Ein Reh beäugte scheu die Lichtung, ehe es zaghafte Schritte in die Wiese wagte. Immer wieder hob es elfenhaft seinen Kopf, um mit den kugelrunden braunen Augen ängstlich zum Haus zu blicken, als hätte sich das Geschehen von eben in ihnen gespiegelt.
Dann schreckte es auf, als hätte ein Schuss die angespannte Stille zerrissen. Mit kraftvollen Sprüngen entschwand es zurück in das Dickicht.
Die hereinbrechende Nacht legte sich bald wie ein schwarzes Tuch des Vergessens über die Szenerie. Nur der Mond tauchte zwischen Nebelschleiern hindurch alles in ein gespenstisch blassblaues Licht. Der halb offene Fensterladen knarrte wieder leise im trägen Wind. Irgendwo in den Bäumen krächzte heiser ein Käuzchen, ein Fuchs streifte neugierig umher, und ein Igel raschelte im Unterholz.
1
Freitag, 8. Juli
«Ach ja? Ich bin dir zu anstrengend? Dann hättest du dir besser eine Ökotante angelacht. Am besten eine von der Sorte, die auf einem Schaf durch die Gegend reitet und im Gemüsebeet vor dem Haus Biotomaten hochzieht. Eine, die in Latzhosen die volle Schubkarre zum Kompost fährt und so dichte Augenbrauen trägt, als hätte sie eine Lawinenverbauung unterhalb der Stirn. Oder erwartest du etwa, dass ich dir ein Paar Socken stricke? Weisst du eigentlich, Ernesto, dass du null Ahnung hast, wie man die Glut einer Frau zum Lodern bringt? Weisst du das? Lieber schweigst du wie immer und blickst mich dabei an, als wärst du ein Napoleonfisch mit einer Sozialphobie. Doch ich bin mir sicher, du weisst, dass du deshalb der Verlierertyp von Mann bist – es gibt eben auch erfolgreiche Verlierer. Egal, was rege ich mich überhaupt auf, du bist ja leider unfähig, etwas daran zu ändern. Nur vergiss nicht, das Beste an dir, Ernesto, das bin ich, auch wenn du es nicht begriffen hast.»
Während sie ihm diese und weitere Worte wie faule Eier an den Kopf schleuderte, lief sie an ihm vorbei, ohne ihn dabei zu beachten, so als stünde sie alleine im Halbdunkel einer Theaterbühne und führte vor vollen Zuschauerrängen ein dramatisches Stück auf, das am Ende von tosendem Beifall bedacht würde.
Wie hasste er sie in solchen Momenten. Wenn sie, einer Göttin gleich, mit Zornesröte auf den Wangen, als unumstössliches Mahnmal dafür, dass sie zweifelsohne alleine im Recht war, durchs Haus schritt mit gehässigen, penetrant kleinen Stiletto-Schritten, als trüge sie einen Kimono – doch ihr rotes Kleid reichte nicht weiter als eine Handbreit übers Knie.
In der hellen Wohnküche mit Kochinsel aus geschliffenem weissen Marmor, der glänzte, als wäre er nass, liess sie ihren verbalen Tiraden weiterhin Raum, als wären diese ein Kunstflugzeug, das sich kreisend durch den Himmel schraubte.
Im Grunde genommen war es immer das Gleiche: Natascha ging es einzig und allein nur darum, ihm aufzuzeigen, dass er sich nicht entscheiden konnte.
Wutschnaubend zog sie vor ihm stehend eine schmale Schublade auf. Demonstrativ klaubte sie einen Erdbeerkaugummi aus der Packung, die Jeannette gehörte.
Als müsste er eine Billardkugel schlucken – er stellte sich dabei immer die schwarze Acht vor –, würgte er seine Wut zusammen mit dem Unverständnis darüber hinunter, dass ein Mensch einen anderen so absolut verurteilen und jegliche Selbstkritik von sich weisen konnte. Dabei wäre es so einfach – beide hatten sie zumindest einen gemeinsamen Fehler: eine verhängnisvolle Affäre; nicht Liebe, denn dieses Wort wurde schon genug strapaziert in der Welt und dafür musste er zu oft diese schwarze Acht schlucken. Nein, was es auch sein mochte, Liebe war es nicht – wenngleich so kraftvoll.
«Natascha, es ist nicht einfach für mich, es ist doch auch das Haus von Jeannette. Verstehe bitte, hier ist es tabu.»
«Fängst du wieder mit dem Gejammer an von dem reuigen, treuherzigen Ehemann?» Erst blickte sie auf ihre gepflegten Fingernägel, als müsste sie diese der Vollständigkeit halber zählen, dann auf ihn, ein Zeichen dafür, dass der laute Teil der Auseinandersetzung bald enden würde. «Oh Gott, Ernesto, oder soll ich besser Prinz Valium von Schnarchhausen sagen? Du bist ja so ein Langweiler. Weisst du das? Ich lebe, und ich will weiterleben, ich bin jung, und das Leben hat noch nie auf jemanden gewartet – auf Verlierertypen schon gar nicht. Ich versaue mir doch nicht die besten Jahre mit dir. Schau mich an! Nenn mir einen Typen, der nicht verrückt nach mir werden würde … und du? Du zauderst, bis der Zauber endgültig entzaubert ist.» Der Rest ihrer Worte rückte in den Hintergrund, wurde leise und verwaschen, als würde er durch einen starken Wind von ihren Lippen gerissen.
Ernesto Pünchera blickte sie aus seinen dunklen, vierzig Jahre alten Augen an, sah, wie sich ihre wunderschönen glänzenden Lippen nunmehr lautlos bewegten.
Er wusste, weder jetzt noch später würde es hilfreich sein, ihr etwas zu entgegnen. Natascha kannte nur eine Welt – die ihrige. Sie war eine aussergewöhnliche, charismatische junge Frau, die ihren Weg nicht aus den Augen liess. Seit Beginn ihrer Beziehung hatte sie, ohne Worte zu gebrauchen, seltsame Liebesbeweise von ihm verlangt. Ja, sie forderte ihn ständig damit heraus. Wollte seit einigen Monaten seine endgültige Entscheidung herbeiführen. Sie war oft anstrengend – doch genauso aufregend wirkte sie auf ihn. Sein Leben hatte bis zu dem Moment, als sie es betrat, aus geordneter Alltäglichkeit bestanden. Spötter hätten es strukturierte Langeweile genannt. Er war der Typ, der Korrektheit und Zuverlässigkeit in all ihren Facetten verinnerlicht hatte; etwas, das seine Geschäftspartner an ihm schätzten und das ihm selbst Sicherheit bot. Jeannette, seine Frau, lachte ihn deswegen manchmal liebevoll aus. Wie damals, als er die «Südostschweiz» zum zweiten Mal innert einer Woche doppelt im Briefkasten vorfand und Letztere mit einem Kommentar ins Medienhaus zurückschickte. Nicht wegen dem Wert des Blattes, nein, weil er es so für korrekt hielt.
Natascha war das Gegenteil von ihm. Ihre ersten Begegnungen waren, als würde ein tropischer Sturm aufs Festland treffen. Natascha sprühte vor Ideen, war wie ein neugieriges Leuchtfeuer inmitten der Nacht, wollte alles ausprobieren und brachte ihn mit ihrem bissigen Humor zum Lachen, aber auch oft zum Nachdenken.
Jeannette war, abgesehen von ihrem Humor, wiederum völlig anders als Natascha. Nicht nur vom Äusseren. Sie war blond und, liebevoll gesagt, vollschlank. Sie war geduldig und anpassungsfähig. Mit ihr konnte er reden und lachen. Ihren speziellen Humor hatte er seit dem ersten Date gemocht, genauso wie ihren französischen Akzent, der trotz der vielen Jahre in der Deutschschweiz immer noch dezent mitschwang und ihrer Stimme eine erfrischende Leichtigkeit verlieh, als sässen sie gemeinsam in einem Café an der Côte d’Azur. Sogar wenn sie wütend war, was äusserst selten der Fall war, fühlte sich ihre Stimme dabei höchstens an, als wäre sie ein nach Lavendel duftender Schaumstoffhammer.
Sie hatten sich für ihr erstes Date damals eine kleine Bar in der Churer Altstadt ausgesucht. Obwohl er fünf Minuten früher hinging – er hatte Angst, zu spät zu kommen –, sass sie bereits dort und hatte einen Latte macchiato vor sich stehen. Die Woche zuvor hatten sie einige Male geschäftlich telefoniert, da hatte er sie mit etwas unsicherer Stimme eingeladen. Am nächsten Tag erst hatte sie Ja gesagt. Sie würde bei ihrem ersten Treffen einen hellblauen Rollkragenpullover tragen, erwähnte sie so nebenbei, dazu einen dunklen Rock und einen beigen Mantel. Mehr wusste er nicht von ihr. Es war ihre zauberhafte Stimme gewesen, die ihn damals all seinen Mut aufbringen liess, sodass er über seinen Schatten sprang und sie einlud.
Da um sechzehn Uhr kaum Gäste in der Bar anwesend waren, hatte er sie sofort erkannt. Innerlich aufgeregt, nach aussen wie immer ruhig wirkend, nahm er neben ihr Platz.
Das Erste, was sie ihm nach der Begrüssung sagte, war, dass ihre Mutter sich etwas verspätet habe, jedoch auch gleich kommen werde, damit sie ihn umgehend mit ihr bekannt machen könne, man wisse ja nie, was so eine erste Begegnung auslöse.
Sein irritierter Blick brachte sie dazu, herzlich zu lachen. Als er das Ganze als Witz erkannte, lachte er ebenfalls, wenn auch etwas verlegen.
Das war vor mehr als zehn Jahren gewesen, an einem diesigen Tag im November.
«Was, Ernesto? Hast du auch gerade ein Raumschiff gesehen?» Natascha stand breitbeinig in der Küche, hatte ihre Hände in die Taille gestemmt und blies sich wütend eine schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht.
Er wusste, unter dem Kleid trug sie nichts ausser ihrem Parfüm. Silhouettenhaft dezent zeichneten sich ihre sportlichen Körperformen darunter ab. Das Kleid war raffiniert geschnitten: über das Knie, elegant, leicht wie ein Sommerrock, Taille und Brust eng anliegend und rückenfrei. Kurz liess er seinen Blick über ihre zarten Schultern gleiten – es war der Teil an ihr, den er am meisten mochte. Wenn sie mit etwas beschäftigt war und er von hinten an sie herantrat, dann küsste er immer ihre Schultern. Vielleicht liebte er diese deshalb, weil sie so verletzlich aussahen. Ihre zarte, makellose Haut spannte sich über ihrem Schlüsselbein wie feines Pergament über das zerbrechliche Gestänge eines Papierdrachens. Beinahe ängstlich berührte er sie jeweils. Seine Lippen und Fingerspitzen schienen ihm am ehesten dazu geeignet zu sein, diese verletzbaren Stellen zu liebkosen.
Jetzt aber stand sie wie eine lodernde Fackel wutentbrannt vor ihm. Ihr Körper war angespannt, als stünde nicht sie, sondern ein wild gewordener Stier ihm gegenüber, der drohend mit den Hufen scharrte. Ihre wohlgeformten üppigen Brüste hoben und senkten sich in der Aufregung etwas schneller.
«Captain James Tiberius Kirk an Erde …» Sie salutierte zu diesen Worten. Meist machte sie sich lustig über ihn, wenn er ihr nicht sogleich Antwort gab. Schon wieder riss sie ihn aus seinen Gedanken.
Was sollte er ihr antworten, was sie nicht schon längst wusste? Auch wenn ihr Treffen, hier in seinem grosszügigen Haus in Chur, offiziell rein geschäftlich war, fühlte er sich unwohl, eingeengt – umgeben von Jeannettes Handschrift, die ihm in diesem Moment allgegenwärtig sein Fehlverhalten vor Augen hielt: In der Küche neben dem Spülbecken stand ihre Handcrèmetube, die sie ständig benutzte, im Wohnzimmer lag fein säuberlich zusammengefaltet die Schafwolldecke, mit der sie sich am Abend beim Lesen zudeckte, und Natascha kaute frech Jeannettes Erdbeerkaugummi, dabei wusste sie ganz genau, dass er dies nicht schätzte.
Vor einigen Jahren hatte Jeannette mit leuchtenden Augen bei einem Glas Rotwein davon geschwärmt, Kunstmalerin werden zu wollen. Seither nahm sie privaten Malunterricht. Ein Resultat davon hing seit dem 1. Mai vor einem Jahr, seinem Geburtstag, im Wohnzimmer. Wie Jeannette es sich vorgestellt hatte, war es eine sinnliche Komposition aus Farben geworden. Bunt und frisch hob es sich süffisant von der Wand über der weissen Ledersitzgruppe ab. Ein überdimensionaler, farbdurchtränkter Frauenmund – derjenige von Natascha, wie Ernesto wusste.
Die beiden Frauen hatten sich vor vier Jahren an einer Veranstaltung im Kulturforum in Chur kennengelernt. Natascha Felder war dort als Marketing- und Kommunikationsverantwortliche sowie temporär als Kuratorin tätig gewesen. Mit ihrem jungen Team hatte sie einen ganz besonderen Kulturanlass zu weit beachtetem Erfolg geführt. Sie schaffte es, Bilder aus der Belle Epoque und Multimediakunst so zu vereinen, dass sich der Blickwinkel für beides verschob und es damit neu gesehen werden musste. Eine interaktive Licht- und Toninstallation führte die Gäste durch die Räume, die dazu passende App musste jeder beim Eintritt auf sein Smartphone laden.
Jeannette, die sich über die letzten Jahre immer mehr für Kunst interessierte, kam danach völlig begeistert nach Hause. Wochenlang redete sie nur von dem Anlass und von Natascha Felder. Ernesto hatte sich alle Mühe gegeben, interessiert zu wirken, hörte ihr geduldig zu, so wie sie ihm, wenn er von der Jagd berichtete.
Die beiden Frauen hielten Kontakt, und als ein Jahr später Ernestos fünfzigjährige Assistentin Berta Stegmaier völlig unerwartet verstarb, brachte Jeannette die damals erst sechsundzwanzigjährige Natascha Felder ins Spiel. Für ihn war klar, sie war zu jung für diesen Job, trotz des hervorragenden Leistungsausweises. Doch Jeannette hielt dagegen, da ein völlig neuer Markenauftritt ihrer Firma, der Charn Switzerland AG, der von Ernesto schon geraume Zeit auf die lange Bank geschoben worden war, dringend anstand. Ihre Firma war zwar die grösste unter den Fleischveredlern in Graubünden, doch die Marke als solche war ein wenig in die Jahre gekommen. Die Umsätze hielten sich zwar im grünen Bereich, aber es konnten keine zusätzlichen Marktanteile oder gar neue Märkte gewonnen werden. Typisch für ihn; wenn etwas funktionierte, wagte er keine Anpassungen oder Veränderungen vorzunehmen, auch wenn sie der Verbesserung gedient hätten. Seine sehr pragmatische Lebenseinstellung liess die sonst erfolgreiche Firma ein wenig altbacken wirken. Sein Verhältnis zu den fast achtzig Angestellten war eher freundschaftlich, weniger wie das eines Vorgesetzten. Viele seiner langjährigen Mitarbeiter mochten ihn so, wie er tickte, einige wünschten sich dennoch etwas frischeren Wind für die Firma, doch als Person war er äusserst beliebt.
Der Wechsel von Berta Stegmaier, die schon seinem Vater als junge Assistentin gedient hatte, hin zu einer Natascha Felder verunsicherte ihn. Deshalb konnte er sich für Jeannettes Idee auch nicht begeistern. Doch sie liess ihrerseits und auf ihre Art nicht locker. Als Mitglied des Verwaltungsrates und in der Rolle der beratenden Ehefrau setzte sie sich weiter dafür ein.
Dann, eines Abends, sass Natascha Felder unerwartet bei ihnen zu Hause beim Nachtessen – Jeannette hatte sie, ohne ihn zu fragen, eingeladen.
Jeannette hatte noch die hellgrüne Kochschürze umgebunden, als sie mit erwartungsfrohen Augen ihm und Natascha die schön angerichteten Teller servierte, ehe sie sich selbst setzte. Ernesto fühlte sich überrumpelt, ass aber ohne es sich anmerken zu lassen sein Lieblingsmenu: Rehschnitzel an einer Pilzrahmsauce mit Spätzle und Rotkraut, einen halben Zimtapfel und einen in Rotwein eingelegten Birnenschnitz.
Hell klirrte das Besteck beim Essen, während der Small Talk der drei wie ein Rinnsal dahinplätscherte, das kurz vor dem Austrocknen stand.
Natascha trug an jenem Abend einen weissen, eng anliegenden, dünnen Rollkragenpullover, der ihren dunklen Teint verstärkt zur Geltung brachte. Ihre tiefschwarzen Haare glänzten gepflegt, ihr formschöner Mund war dezent und dennoch verführerisch mit Lipgloss geschminkt. Ihre wohlgeformten Brüste waren unmöglich zu übersehen, doch Ernesto hütete sich, auch nur einen Blick direkt auf Nataschas körperliche Vorzüge zu werfen. Krampfhaft hielt er mit ihr beim Sprechen deshalb Augenkontakt, was sich aber als die noch grössere Versuchung entpuppte.
Nach dem Dessert, sie sassen bei einem Glas Rotwein im Wohnzimmer, schaltete Jeannette das Homecinema ein.
Ernesto wunderte sich.
Surrend senkte sich der Beamer aus der Decke, die Leinwand rollte sich elektrisch vor ihnen herab. Natascha Felder nahm ihr MacBook aus der Tasche und startete die PowerPoint-Präsentation – ihr Konzept für den zukünftigen Werbeauftritt der Charn Switzerland AG.
Ernesto sass mit einem Glas Amarone in seinem ledernen Lieblingssessel. Vor seinem inneren Auge blieb das Bild von Natascha haften, als wäre es ein Bildschirmschoner. Neben ihm stand Jeannette, ihre Hand lag dabei liebevoll, aber auch in Erwartungshaltung schwer auf seiner Schulter. Im Augenwinkel nahm er ihr Siegerlächeln wahr, als die ersten Folien auf die Leinwand projiziert wurden.
Nach wenigen Ausführungen von Natascha wusste Ernesto bereits, sie war die Richtige. Das passte einfach. Er vermochte seine Begeisterung kaum zu unterdrücken. Triumphierend, mit einem sanften Lächeln auf den Lippen, schenkte Jeannette ihm Wein nach.
Ein Jahr später schlief Ernesto zum ersten Mal mit Natascha Felder. Sein schlechtes Gewissen, es wirklich getan zu haben, liess ihn danach tagelang wie ein geprügelter Hund durch den Alltag kriechen. Neben diesem Gefühl des unglaublichen Verrats an seiner Ehe machte sich diese lebendige Aufregung in ihm breit, die er in der Nähe von Natascha verspürte. Er wusste, es war absolut falsch, was er getan hatte, widersprach völlig seinen Wertvorstellungen, hatte ihn deshalb wie ein Erdbeben durchgerüttelt. Aber warum tat er so etwas? Jeannette war ja eine angenehme Ehefrau. Nie hatte er sie bis dahin betrogen, er war nicht einmal in die Nähe eines Betruges gekommen. Ausserdem war er nicht der Typ, der von sich aus flirten würde. Gott bewahre! Das Verfluchte an dem Ganzen war, dass er Jeannette keine Teilschuld für seine Affäre geben konnte. Wenn sie doch nur ein Drache von Ehefrau wäre oder ihn vernachlässigt hätte. Dann wäre sein schlechtes Gewissen wenigstens etwas beruhigt.
Dennoch, wenn er am heutigen Tag zwischen beiden hätte wählen müssen, er könnte sich nicht entscheiden. Sie waren so verschieden, und so verschieden, wie sie waren, ergaben sie gemeinsam seine neue Welt.
Wenn Jeannette ihn nach dem Warum dieser Affäre fragen würde – gottlob wusste sie nichts davon –, er könnte ihr keine verständliche Antwort darauf geben. Natascha Felder, seine mittlerweile neunundzwanzigjährige persönliche Assistentin, mit der er seit zwei Jahren eine Affäre hatte, war wie eine Sucht. Sie als Ganzes. Nicht der Sex. Mit Jeannette war dieser schöner – alles war eigentlich schöner oder vielmehr harmonischer mit ihr. Vielleicht war genau das der Grund – dieses Zuviel an Harmonie, das ihn zunehmend zu erdrücken drohte. Das liebe Lächeln seiner Frau am Sonntagmorgen auf der Terrasse ihres Hauses in der Bondastrasse, wenn sie im warmen Sonnenschein eines Julimorgens den Frühstückskaffee einschenkte wie in einem der kitschigen Werbespots von Jacobs Kaffee «Krönung». Oder ihr liebes Schmunzeln, wenn er voller Stolz im September mit einem erlegten Hirsch im Anhänger vor die Garage fuhr und mit seinen Jagdkameraden aufs Jagdglück anstiess. Dann kam sie die geschwungene Treppe im Garten herunter und stand freudig neben ihm – dabei wusste er so gut wie sie, dass sie genauso viel Desinteresse an dem Hirsch hatte wie er an ihren Bildern, von denen er nicht einmal die Hälfte richtig aufhängen könnte. Hätte er sie auf die Probe gestellt und am Abend gefragt, wie viele Enden sein Hirsch gehabt hatte, sie hätte nicht mal gewusst, dass das Tier ein Geweih trug. Er hätte genauso gut mit einer Giraffe im Anhänger vors Haus fahren können, sie hätte den Unterschied nicht bemerkt, weil ihr Blick bei seiner Leidenschaft ins Leere ging.
Doch wenn sie mit einem neuen Bild, das sie irgendwo bei einer Auktion im Ausland erworben hatte, freudestrahlend nach Hause kam, dann schien sie ihm niemals glücklicher zu sein. Vorsichtig luden sie jeweils das wie ein Atomreaktor dick eingepackte Bild aus Jeannettes hellblauem Audi SQ5. Feierlich, wie bei einer Zeremonie, enthüllte Jeannette ihre Neuerwerbung dann am Abend nach einem guten Essen, als würde sie in der Öffentlichkeit ein Denkmal einweihen. Bevor es losging, prostete sie ihm mit einem Glas Champagner zu. Immer wieder blickte sie ihn an, damit er ja nichts versäumte, dabei lächelte sie ihm zu, sodass sich ihre süssen Lachfältchen bildeten. Er stand konzentriert da, um den Aha-Moment nicht zu verpassen, wenn das Kunstwerk zur Gänze enthüllt war. Jeannettes Augen suchten die seinen erneut, um ihre Begeisterung mit ihm teilen zu können. Jetzt war der Moment gekommen, in welchem Ernesto ein glaubhaftes Erstaunen auf sein Gesicht zaubern musste. Er stellte sich deshalb den kapitalsten Hirsch dazu vor, wie dieser entspannt in Schussweite vor ihm auf einer idyllischen Wiese äste. Päng! Wooooow!
Für Natascha hingegen waren Harmonie und Langeweile Fremdwörter. Sie war wie der zügige Fahrtwind im Gesicht, der Regen im Sturm, die Hitze in der Wüste, das Eis auf dem Berggipfel – das Feuer im Herzen eines von Harmonie durchtränkten Mannes, dessen Pulsfrequenz nur auf der Jagd über einhundert stieg. Sie war intensiv – war wie ein Magnet. Sie schraubte ihn hoch in den Himmel und liess ihn immer wieder in die Hölle stürzen. Er war süchtig, süchtig nach ihren Gefühlswelten, nach dem Gegenteil von geordneter Harmonie, und dennoch brauchte er Jeannette genauso zum Leben. Im Gegenteil, seit er Natascha kannte, fügte er sich immer wieder dankbar in diese Jacobs- Krönung-Momente ein, im Wissen, schon morgen mit Natascha wieder durchzustarten.
Seit Natascha bewusst geworden war, dass er Jeannette genauso wie sie brauchte, spielte sie Katz und Maus mit seinen Gefühlen, liess ihn emotional immer wieder fallen, zog ihn dann erneut mit ihrem Charisma wie einen trägen Fisch an Land und hauchte ihm Leben ein, damit er neue Kraft für den nächsten Sturzflug hatte. So gesehen hatte sie recht. Er war kein Mann mehr, vielleicht auch nie einer gewesen, denn er konnte keine Entscheidung fällen. Er trieb dahin wie ein Stück Treibholz, dessen Weg der Fluss bestimmte, der wiederum von den beiden Frauen gespeist wurde.
Was nach diesem erneuten Streit nun geschehen würde, wusste er aus Erfahrung. Natascha würde ihm ab sofort die kalte Schulter zeigen, ihm im Büro die Geschäftsberichte so auf den Tisch legen, wie es eine freundliche Assistentin tat, die nicht mit dem Inhaber der Firma schlief. Dabei würde sie ihn unterschwellig spüren lassen, auf was er nun zu verzichten hatte. Ihr Parfüm würde wie eine Versuchung in seinem Büro schweben, während sie beim Hinausgehen ihre Hüfte dezent hin und her wippen liesse. Auf seine SMS bekäme er keine Antwort mehr.
Nach jedem Streit schwor er sich deshalb – diesmal aber würde er die Gelegenheit dazu nutzen –, die Affäre so wortlos enden zu lassen, wie sie begonnen hatte. Natascha hatte ihn nämlich eines Tages einfach so geküsst, dass er vor Schreck dabei beinahe seine und die ihrige Zunge verschluckt hätte. So hatte alles angefangen. Natürlich gingen Wochen zuvor erst Blicke, kleine Gesten von ihr aus, die er lange versuchte zu ignorieren, bis ihr Gesicht vor dem Einschlafen das Letzte und beim morgendlichen Erwachen das Erste war, das er sah. Zwangsläufige geschäftliche Begegnungen, wie Gespräche und Businesslunch, rissen ständig an seinen Grenzen.
Bevor sie in sein Leben kam, wusste er gar nichts von einer anderen Welt. Er hatte sich arrangiert, so eingepackt in Watte. Alles hatte sich in geordneten Bahnen abgespielt. Morgens ging er zur Arbeit, abends kam er heim, im Herbst auf die Jagd, alle vier Wochen in den Kegelclub in Untervaz. In den Ferien gingen sie auf Sardinien wandern, im Winter fuhren sie Ski. Zu Silvester und Neujahr kam immer die Schwester von Jeannette aus Straßburg mit ihrem Mann, einem französischen Banker, und sie assen Fondue Chinoise. Fabrice langweilte ihn mit seinen Bankgeschäften beinahe zu Tode, während Lisette und Jeannette stundenlang über Kunst redeten und dabei Tee tranken. Auch diese Tage gingen vorbei.
Wenn er dieses Leben als Ton hätte beschreiben müssen, dann wäre es die meiste Zeit im Jahr ein gleichbleibendes G gewesen, das sich nur in der Jagdsaison für drei Wochen in ein hohes C verwandelte. Seit er aber Natascha kannte, fuhr er auf der Tonleiter Achterbahn.
Wegen des erneuten Streits nahm er sich ein weiteres Mal vor, für immer zurück in sein altes Leben zu kehren. Doch irgendwann würde sie wieder gewinnen – wie jedes Mal, dann, wenn der Alltag wieder zu lange spurlos an ihm vorüberging. Er würde sich zwangsläufig entschuldigen, ihr zerknirscht recht geben, damit sie wieder in seinen Armen lag, so lange, bis er endlich etwas dagegen unternehmen konnte.
Eine unglaubliche Wut begann sich in seinem Innersten zu formen und nahm langsam ein hässliches Gesicht an.
Ernesto erschrak fürchterlich darüber, dann lächelte er.
2
Ein paar Wochen zuvor, Mitte Mai
Seine schmutzigen Finger zählten zitternd ein weiteres Mal das Geld.
Sechsunddreissig Franken?
Er konnte sich kaum konzentrieren. Vier und wie viel fehlten zu einhundert? Mehr als fünfzig? Sechzig? Verdammt, es reichte sowieso nicht.
Seine Schmerzen nahmen stündlich zu. Eine seltsame Unruhe übermannte ihn, ergriff mehr und mehr Besitz von ihm. Sein rechtes Auge zuckte unrhythmisch, als hätte er einen nervösen Tick. Er schwitzte und fror gleichzeitig. Vergebens suchte sein überdrehtes Hirn nach einer Lösung, wie ein Flüstern in einer lärmenden Kneipe wollte es sich Gehör verschaffen. Mehr als sechzig Franken waren so viel wie eine Million, wenn man beides nicht hatte, doch einfacher aufzutreiben. Die Zeit lief aber gegen ihn. Je länger es dauerte, umso weniger Möglichkeiten standen ihm zur Verfügung. Er musste sofort handeln.
Am frühen Morgen hatte er es erst mit Schnorren versucht. Doch sein Zustand war mittlerweile zu offensichtlich, schreckte die Passanten ab. Sie blickten ihn an, als fehle ihm nur noch die Klapper wie im Mittelalter, als die Pest in Chur grassierte. Seine rot geränderten Augen sassen in tiefen, dunklen Höhlen, das Haar hing ungepflegt in Strähnen bis auf die Schultern. Die bleichen Gesichtszüge waren krankhaft mager, die Wangen kantig eingefallen, die Zähne gelblich und das mit gerademal vierundzwanzig Jahren.
In der Villa Kunterbunt, in der er seit zwei Jahren untergeschlüpft war, gab es auch nichts zu holen. Einzig Gulliver, der Holländer, und dessen gehörloser Hund waren am Mittag da gewesen. Angetrunken hatte Gulliver ihm eine halbe Flasche Roten hingestreckt. Die hatte er sogleich in einem Zug geleert. Es hätte ebenso Wasser sein können, sein Zustand wurde deswegen kein bisschen besser. Danach hatte er eine gefühlte Ewigkeit in der schäbigen Bude, die jemand während eines LSD-Trips Villa Kunterbunt getauft hatte, nur darauf gewartet, dass vielleicht jemand der anderen von der Gasse zurückkam. Doch weder Mo, Stieger, Liza, Geissenpeter, Tirza, Angel oder Sabi tauchten auf. Study sowieso, wenn überhaupt, erst nach siebzehn Uhr, da er tatsächlich vor ein paar Tagen einen Aushilfsjob gefunden hatte.
Das Gesetz der Gasse kannte Mariano zur Genüge. Auch zehn leere Flaschen löschen den Durst nicht. Momentan lief es bei ihnen allen wieder einmal so richtig kolbenfressermässig beschissen, ausser bei Gulliver – dieser konnte mit Alk alleine längere Zeit zufrieden sein.
Study, den sie auch den Professor nannten, weil er der Einzige war, der eine richtige Ausbildung in der Tasche hatte, sagte einmal, sie alle seien wie die Tiere in Afrika während einer Dürreperiode. Lechzten sie doch gemeinsam nach Beute, schwirrten alleine oder in Grüppchen in die Stadt und versuchten, aus ausgepressten Zitronen noch etwas Saft zu gewinnen, um sich danach gegenseitig davon etwas abzuschnorren. Teilen, das war gewissen Gesetzmässigkeiten unterworfen. Niemals würde einer von ihnen etwas teilen, wenn er auf Entzug war. Niemals. Aber stehlen. Egal wem und was, und wenn es der Herzschrittmacher der eigenen Mutter wäre, wenn er beim Verkauf nur das nötige Geld für den Stoff erzielen würde, so wäre es in diesem Moment mehr als nur okay. Lebensmittel hingegen waren das, was meist gut teilbar war, oder mal eine Hose oder Jacke, auch Schuhe wechselten hin und wieder den Besitzer.
Vor zwei Wochen erst, es war ein träger Sonntagnachmittag Anfang Mai gewesen, sassen einige auf den gammeligen Teppichen, andere lagen auf den schmutzigen Matratzen des von den Behörden zum Abbruch freigegebenen Hauses. Die Stadt Chur duldete sie dennoch weiter stillschweigend in der Villa Kunterbunt, da sich ein grüner Politiker im Jahr zuvor dafür eingesetzt hatte, dass das alte Haus am Lindenquai vorerst nicht abgerissen würde, bis eine sozialverträgliche Lösung für die Bewohner gefunden wäre. Was das denn auch immer für den Einzelnen in der Villa Kunterbunt zu bedeuten hatte.
An jenem besagten Sonntagnachmittag hatten sie genug Stoff, dafür seit Tagen kein Geld mehr fürs Essen. Gulliver, der Holländer, seine Augen klein von der Wirkung der Wasserpfeife, hatte sich träge aufgerafft.
Er war der Älteste unter ihnen – wahrscheinlich Mitte fünfzig. Seine hellbraunen gekrausten Haare reichten bis zu den Schultern. Er trug einen witzig zerzausten Bart. Ein oberer Schneidezahn fehlte. In diese Öffnung steckte er meist seine Zigarette, was beim Sprechen lustig wirkte, er aber praktisch fand. Ausser ein Mal, da döste er im Suff weg, bis die Glut beinahe die Lippen erreichte. Völlig verstört schreckte er im Rausch hoch, wusste erst gar nicht recht, was er da Glühendes mit den Händen aus dem Gesicht schlug, und fluchte lauthals auf Holländisch.
Gezwungenermassen schwirrte Gulliver also aus, denn Hund musste raus.
Er hiess einfach nur Hund. Da er nichts hörte, musste man zuerst in sein Blickfeld treten und gestikulieren, damit er reagierte, falls er überhaupt Lust dazu verspürte. Hund war eine Mischung aus Hirtenhund und Golden Retriever und trug ein weisses Fell. Gulliver meinte öfters, es sei ein Segen, dass Hund nichts höre, darum sei dieser auch so relaxt. Gulliver wusste viele Geschichten zu erzählen, auch über Hund, sodass lange, trübe Winternachmittage mit ein bisschen Marihuana und ein paar Flaschen Rotwein im Nu durchgestanden waren. Als Hund ein Welpe war, fanden die beiden zusammen. In Amsterdam auf dem Strassenstrich war dieser ihm mitten in die Arme gelaufen, einen Tag nachdem sich Gulliver bei einer Tschechin den Tripper geholt hatte, wie er später schmerzhaft herausfinden sollte.
Das war’s. Seitdem war der 17. Juni der Geburtstag von Hund, den Gulliver nie vergass zu feiern, im Gegensatz zu seinem. Er war sich ja nicht einmal seines Alters wirklich sicher. Dokumente besass er schon längst keine mehr. Auf seine vielen Leben verteilt, die er schon gelebt hatte – er glaubte felsenfest an Reinkarnation –, spielte ein Ausweisverlust weiss Gott keine grosse Rolle. Gulliver hatte in seinen früheren Leben schon als Fischerjunge in Frankreich gelebt, in Russland war er der Sohn einer Mamochka, die ihn windelweich prügelte, während des Amerikanischen Bürgerkrieges war er Pastor gewesen und das an der Front – vielleicht konnte er deshalb kein Blut sehen. Und nun war er ein Holländer mit einem gehörlosen Hund. Was soll’s? Er hatte schon schlechtere Leben geführt, und weitere würden folgen. Wenn er Glück hätte, als Hanfbauer in den Bündner Bergen mit einer schönen Bäuerin an seiner Seite, die hervorragend kochen konnte.
Vor fünf Jahren, so hatte er in der Villa Kunterbunt erzählt, hatte er für Hund zur Feier des Tages Hundekekse mit reichlich Marihuana darin gebacken. Er war in Holland gewesen und hatte per Zufall eine grosse Menge Stoff gefunden. Immer wieder erzählte er von dieser unglaublichen Menge, meist dann, wenn ihm der Stoff ausgegangen war. Er gab Hund damals eine ordentliche Portion davon ab, doch Hund wurde kein bisschen high deswegen. Hund schien sowieso eine Dauerscheibe zu haben, die sich alle in der Gruppe sehnlichst wünschten. So gesehen war er eine Art Vorbild – ihr Hundeguru, ein Wauwau-Shiva sozusagen.
Hund bellte auch nie, wahrscheinlich weil er gar nicht wusste, wie sich das anhören würde. Wenn andere Köter ihn ankläfften, schaute er auf deren Schnauzen, wie sie sich eifrig bewegten, und nahm es mit einer stoischen Gelassenheit zur Kenntnis, als würde sein Blick dem bellenden Hund sagen: Ja, lass es einfach raus aus dir. Glaub mir, es wird wieder besser …
Vor zwei Wochen also stupste Hund Gulliver ein paarmal mit der feuchten Schnauze ins Gesicht, damit sich dieser erhob. Das verfehlte seine Wirkung nicht, denn damals, als die beiden neu in der WG waren und auf sein Hundezeichen hin niemand mit ihm rausging, kackte er einfach mitten auf den Boden einen riesigen dampfenden Haufen. Grauenhaft zog der Gestank durch ihre Bude, sodass es unweigerlich bei einigen zu Brechreizanfällen führte und sie deshalb zu den verlotterten Fenstern stürzten, als brenne das Haus lichterloh, während Hund sich schon wieder gemütlich im Eck zusammengerollt hatte, nachdem er interessiert kurz an seinem Geschäft geschnuppert hatte. Verwundert registrierte er das plötzliche hektische Treiben der anderen. Sein Blick schien zu fragen: Was ist denn bloss los? Seither reagierten sie alle schnell, wenn Hund mal musste.
Aus gutem Grund verliess deshalb Gulliver an jenem Nachmittag die Villa Kunterbunt, kam aber eine Stunde später freudestrahlend zurück.
Aus einer alten Einkaufstasche zauberte er Zutaten für eine grosse Schüssel voll von Birchermüesli.
Das gab ein Festmahl.
Als der einzige, etwas verbogene, dunkel verfärbte Esslöffel – Sabi hatte bis auf diesen einen alle für ihr Fixer-Besteck verbraucht – die Runde machte, gurrten sie wie zufriedene Tauben im warmen Schlag. Sie leerten brüderlich teilend die Schüssel, bis ihre Bäuche prall gefüllt waren.
Danach wurde die Wasserpfeife Big Martha eingeheizt. Ein Ritual. Sie bestand aus einem Labyrinth aus Schläuchen und hellblauen Glaskörpern mit Wasser darin, ein mit vielen Motiven verziertes Kunstwerk aus Indien. Auch dazu hätte Gulliver eine Geschichte zu erzählen gewusst – eine von seiner dreijährigen Indienreise. Es war das Eindrücklichste, das er je erlebt hatte. Seit dieser Reise waren für ihn auch die Bündner Kühe heilig.
Müde lagen sie danach inmitten des dichten Qualms der Wasserpfeife auf ihren Matratzen, wie zufriedene vollgefressene kleine Buddhas. Hund döste völlig relaxt mittendrin, sein Kopf auf das Bein von Gulliver gelegt. Der Schwarze Afghan, das Beste, was im Moment in Chur an Haschisch zu kriegen war, hatte seine Wirkung nicht verfehlt.
Mariano konnte unmöglich länger warten.
Es schien ihm, als würde der Boden seine Fusssohlen verbrennen, wenn er zu lange auf derselben Stelle stehen blieb. Fast fluchtartig verliess er deshalb das dreistöckige abbruchreife Gebäude, in dem nur in der Wohnstube ein wenig Ordnung herrschte. Sonst lag überall Unrat herum. Im ganzen Gebäude roch es dumpf-säuerlich nach Abfall. Die alten verschimmelten Tapeten hingen in heruntergerissenen Streifen wie Zungen in die Räume, die sanitären Anlagen waren braungelb verdreckt. Der erste Stock war auch für sie nicht mehr bewohnbar. Alle von ihnen litten an Hautproblemen, die wahrscheinlich von den verschmutzten Matratzen herrührten. In der Küche tropfte seit Wochen der quietschende Wasserhahn. Die alten Holzfenster, von denen die gelblich weisse Farbe schichtweise abblätterte, schlossen nicht mehr richtig. Der Autolärm des nahen Obertors rauschte herein, genauso wie die Kälte im Winter einsickerte. In den Wintermonaten diente der alte grüne Kachelofen als einzige Wärmequelle für das gesamte Haus, doch oft froren sie, lagen deshalb in die dicken Decken eingehüllt nahe beieinander. Nicht immer dachten sie nämlich rechtzeitig daran, Holz zu besorgen. So hatten sie nach und nach alles Brennbare durch das gusseiserne Ofentürchen geschoben, inklusive der letzten drei Holzstühle und der alten Bettgestelle.
Als Mariano wenig später in der Bahnhofstrasse Richtung Postplatz hastete, kam ihm ein Wirrwarr von Menschen entgegen: Tausende Gesichter, Beine, Arme, Handtaschen, Regenschirme, Jacken und Hosenbeine. Wie ein Wasserfall ergoss sich die Menschenmasse über ihn und überflutete sein Gehirn derart, dass es sich noch mehr nach der rettenden Dosis Blue Meth sehnte. Er nahm kaum wahr, wie er mit Passanten zusammenstiess, die ihn in der Menge zu spät erblickten. Irritiert schauten sie kurz auf ihre Jacken oder Mäntel, dorthin, wo sie sich berührt hatten, als wäre da etwas zurückgeblieben, das abgestreift werden musste.
Im Stadtpark traf er Tai an, seinen Dealer, einen kleinen, langhaarigen Südamerikaner mit ausgeprägten O-Beinen, eine Mischung aus Indio und Thailänder mit listigen Augen, die sein Innerstes nicht zu verbergen vermochten. Mariano wusste: Wenn auch nur ein Franken fehlte – volle Kohle oder kein Stoff. Das war Tais Gesetz, das Gesetz der Gasse. Ausser er wäre eine Frau, da hätte er vielleicht Sex gegen Blue Meth eintauschen können. Dennoch hoffte er. Tai musste doch sehen, wie übel er auf Entzug war, wie dreckig es ihm bereits jetzt schon ging, wie er sich nur noch schlecht zu orientieren vermochte. All seine Sinne brüllten nach der rettenden Droge, verzehrten sich danach, sie zu rauchen, sehnten sich nach dem Land des Regenbogens.
«Hey, Mariano, sorry, Mann, so ist’s nun mal. Egal, glaub mir, ich kenne jede Geschichte und jeden verdammten Grund, warum das Geld morgen erst da ist und wie ich mich einhundertprozentig darauf verlassen kann, es dann auch zu bekommen. Dennoch, Ware gegen Geld. Sorry, Mann.»
Tai wandte sich einem anderen Käufer zu und schob diesem ein Plastiktütchen mit den blauen Kristallen zu. Ein Zehnerpäcklein, schlappe eintausend Franken wert. Reichte für mindestens dreissig Abschüsse, was diesen geschniegelten Typen betraf. Für Mariano gäbe es höchstens deren fünf.
Mariano atmete schwer, als sein Blick auf die blauen Kristalle fiel. Einen Moment lang hoffte er, dass der Typ in Krawatte, wahrscheinlich einer der Banker, die neuerdings nach dem Zeug verrückt waren und von Koks die Nase voll hatten, Mitleid zeigte und ihm etwas davon abgab. Nicht kostenlos – gegen sein bisschen Geld selbstverständlich, auch wenn das seine Symptome nur etwas zu lindern vermochte. Doch dessen Handy klingelte, er wandte sich ab und ging davon, das Tütchen dabei elegant in die Innentasche des teuren Anzuges gleiten lassend.
«Tai, bitte warte hier, nur noch eine halbe Stunde, ich bring die restliche Kohle sofort. Versprochen.»
«Kommt eh noch einer, Mann.»
Mariano eilte in die Altstadt.
Er hielt Ausschau nach einer geeigneten Handtasche, am besten in der Hand einer betagten Frau. Mittlerweile spielte sein Hirn so verrückt, als wäre es ein Flipperkasten. Da auch heute wieder Nieselregen fiel, waren weniger Passanten in den schmalen Gassen unterwegs als sonst. Ihre Köpfe unter den Regenschirmen versteckt, eilten sie geduckt durchs Nass. Mariano war mittlerweile klitschnass bis auf die Haut. Er fühlte nichts ausser dem unsagbaren Gefühl des Entzugs, das ihn in Stücke zu reissen versuchte. Alle anderen Eindrücke verschwanden im Hintergrund wie ein Flüstern, während ihm gleichzeitig jemand ins Ohr schrie: Blue Meth!
Irgendwann erspähte er unsichere Schritte.
Eine runzlige Hand hielt einen karierten Regenschirm. Die dunkelblaue Farbe der Regenjacke und der graue Faltenrock passten zu dem leicht gebückten Gang der alten Dame. Die Handtasche, die sein Auge bereits wie ein Radar erfasst hatte, hielt sie in ihrem linken Arm – leider eingeschlauft. Das war scheisse, so fiel sie wahrscheinlich zu Boden, wenn er daran riss. Er wollte ihr nicht wehtun, nur das Geld, sein Blue Meth. Jetzt!
Als würde er sogleich erdrückt von den engen Gassen, riss er ihr mit wirren Augen die Handtasche weg und machte dabei wie ein wildes Tier Geräusche, um sie einzuschüchtern. Die Dame wusste gar nicht, wie ihr geschah, fiel ohne Aufschrei auf den harten Pflasterstein, ihre Hüfte brach. Mariano hörte noch jemanden rufen, während er ein paar Gassen weiter in einen Hauseingang flüchtete. Im Kellergewölbe durchwühlten seine Hände hektisch die Tasche. Er riss das Portemonnaie auf, sah Noten, mehr als genug. Glück gehabt, bei den Alten konnte man nie genau wissen, woran man war, seit auch sie Kreditkarten und manchmal sogar Facebook nutzten. Dann verschwand er durch den hinteren Seitenausgang, versuchte dabei krampfhaft, ruhig weiterzugehen, um nicht aufzufallen.
Tai war noch dort. Gott sei Dank.
Er stand im Schutz des schmalen Vordaches der öffentlichen Toilette und rauchte eine Marlboro Gold.
«Verdammt, Mariano, bringst du mir die Bullen im Schlepptau mit, du Vollidiot, so wie du daherrennst?»
«Hier, zwei Hunnis.» Mariano streckte ihm ausser Atem die beiden Hunderternoten zu. «Nein, niemand gefolgt. Will doch nur den Stoff, Mann. Gib her, kannst gleich auch abhauen, Mann!»
Tai verzog missmutig sein Gesicht, drückte ihm widerwillig das Plastiktütchen in die Hand und verschwand zwischen den nassen Stauden und Sträuchern durch den hinteren Ausgang.
Mariano stürzte sich in die stinkende öffentliche Toilette.
Immer noch ausser Atem, setzte er sich neben dem verdreckten Pissoir auf den schäbigen weissen Kachelboden, der übersät war mit dick eingetrockneten Urinspuren. Mit zitternden Händen versuchte er, aus etwas Alufolie und einem Plastikröhrchen das Einwegpfeifchen zu bauen. Mit letzter Konzentration steckte er die kleinen blauen Kristalle hinein. Verzweifelt schrie er dabei mehrmals auf, weil seine Hände nicht mehr richtig gehorchen wollten. Endlich hatte er einige Kristalle in die Öffnung eingebracht. Die Flamme seines Feuerzeugs zuckte unruhig in seinem nervösen Atem, sodass die Kristalle zu wenig heiss wurden, um aufzuglühen. Seine begierigen Augen flackerten vor Verzweiflung, weil es einfach nicht gelingen wollte. Seine Hände zitterten zu sehr. Verzweifelt schrie er wieder und wieder kurz auf, sammelte die letzten Kräfte und bündelte sie auf den einen Moment des Anzündens hin.
Dann endlich der erste, gierige Zug.
Auch den nächsten sog er mit aller Kraft in sich hinein. Eine erlösende Flut ergoss sich tief in seine Lunge, um sich wie ein schöner Schmetterling in seinem Innersten zu entfalten.
Nach zwei weiteren Zügen entschwand er gänzlich, fand sich liegend inmitten einer lichtdurchfluteten Sommerwiese wieder. Der warme, liebliche Blütenduft der farbenfrohen Wiesenblumen umschmeichelte ihn. Über ihm spannte sich der blaue Himmel mit bauschig-kleinen Schönwetterwolken endlos weit dahin. Der laue Föhn streifte über ihn hinweg, liess das hohe Gras, in dem er lag, sich hauchzart wiegen und rauschte in den drei Birken auf, die hinter ihm auf dem einzigen, sanft ansteigenden Hügel standen. Eine Leichtigkeit durchsickerte ihn wie Wasser, das auf Sand gegossen wurde. Langsam begann er zu schweben. Erst unmerklich, so als würde er nicht mehr am Boden liegen, sondern das Wiesengras und die Blumen trügen ihn auf ihren Spitzen. Höher und höher begann er dann zu steigen, breitete dabei seine Arme wie die Flügel eines Vogels aus und schraubte sich langsam, um sich selbst drehend weiter in das Gesicht des Sommers empor. Seine vom Gassenleben übel riechenden Kleider waren einer weissen luftigen Hose samt weissem Hemd gewichen. Seine schulterlangen Haare dufteten nach dem Shampoo aus Kindertagen – einem zartsüssen Orange-Limetten-Duft.
Weiter flog er über die blühende, endlos scheinende Wiese hinweg, durch die glitzernde, kristallklare Bächlein flossen, die munter vor sich hin plätscherten. Über dem kleinen Hügel mit den drei Birken, die ihm so vertraut vorkamen, erfasste ihn ein warmer Aufwind. Dieser ewige Sommer füllte nun sein Innerstes. Dort wo das verletzte, einsame Kind in ihm hauste, das zugleich stark und schwach war und noch immer nach Wärme rief, war nun Licht. Dieses Licht nahm das Kind in ihm auf wie eine väterliche Hand, wärmte es, sodass die vielen Narben zartrosa verblassten und gänzlich verschwanden. Helles, frisches Blut füllte sein klumpig graues Herz, bis es kräftig zu schlagen begann. Jede Körperzelle wurde zu Licht. Sein schulterlanges Haar wehte, seine Augen glänzten entzückt, wie bei einem Kind, das einen Marienkäfer auf der Fingerspitze beobachtet, der soeben in die Luft entschwebt.
Sein Blick schweifte hinunter zum kleinen Hügel – nun rauschten anstelle der drei sogar vier Birken im Einklang des Sommerwindes, die hellgrünen Blätter tanzten wie Tausende hauchdünne Girlanden. Immer wieder erklang dabei ein helles Kinderlachen wie ein frohes Glockenspiel.
Weit in der Ferne, dort wo Horizont und Wiese in einem Strich verschmolzen, hörte er eine Stimme, die rief: «Mariano, mein liebster Mariano, ich bin es, dein Vater. Ich bin hier bei dir. Fühlst du es denn nicht? Hier bin ich, bei dir. Ganz nah, war nie fort. Lass dich umarmen, mein kleiner Mariano.»
Mariano wollte antworten. Anstelle von Worten ertönte erneut das Kinderlachen. Dann hörte er eine goldene Kinderstimme, seine Kinderstimme, rufen: «Papa!»
Tränen der Freude tropften aus Marianos Augen hinunter in die Wiese. Mit jedem neuen Tropfen wuchs eine wunderschöne Blume empor, bis der Hügel mit den vier Birken inmitten eines duftenden Farbenmeers stand. Die warme Stimme des Vaters fühlte er in jeder Blüte, im silberglänzenden Bächlein, im Blau des Himmels und im lauen Föhn. Alles war vergessen, wie nie geschehen, auch die Zeit. Er war hier, ist hier und wird immer hier sein – sein ihn liebender Vater.
Mariano lag in Seitenlage.
Speichel rann aus seinem Mundwinkel und mischte sich mit den alten Urinspuren auf den Kacheln des Bodens. Seine linke Hand umschloss fest das Alupfeifchen, als wäre es sein einziger Schatz. Sein Zeigefinger war verbrannt durch die Hitze. Seine Augenlider flatterten wie zwei ängstliche, eingesperrte kleine Vögel. Er atmete schnell und flach, seine Haut war blass und feucht, als wäre sie aus erkaltetem Wachs.
Einsam und verlassen lag Mariano auf dem kalten Boden, umgeben vom Gestank dieser öffentlichen Toilette, deren einzige WC-Schüssel von Kotspuren übersät und seit Tagen verstopft war.
Auf seiner rechten Schulter trug Mariano eine Tätowierung: ein Engel mit dem Gesicht einer lieblichen jungen Frau. Die Flügel hatte er halb geöffnet, die Arme leicht ausgestreckt, eine glitzernde Träne hing im linken Auge. Mariano wünschte sich nichts sehnlicher, als eines Tages endlich erlöst zu werden, wartete im Stillen auf seinen Engel, der ihn, so am Boden liegend, erblicken würde. Sanft würde dieser zu ihm niederschweben, um sich neben ihn zu knien, dann seine Flügel über ihm ausbreiten, ihn hochheben, um mit ihm gemeinsam in den Himmel zu fliegen.
Das war sein innigster und einziger Wunsch, den er, seitdem er elf Jahre alt war, in seinem verwundeten Herzen trug, dass der Engel käme; sein Engel, einer nur für ihn. Bis jetzt war er noch nicht gekommen. Vielleicht morgen oder in ein paar Tagen oder in einem Jahr. Wer konnte dies schon wissen. Sicher war einzig, dass das Ende kommen würde, wenn nicht ein Wunder geschähe. Doch Wunder, das wusste Mariano, die brauchten viele Menschen – zu viele im Verhältnis zu den verfügbaren Wundern.
Doch heute würde er noch Stunden mit Gesicht und Lippen auf den kalten Kacheln liegen. Irgendwann in der kommenden Nacht, falls ihn niemand zuvor finden würde und die Ambulanz alarmierte, würde er erwachen. Langsam würde er wieder in seinen geschundenen Körper zurückkehren, eingezwängt wie in eine zu kleine, sperrige Rüstung, mit all der Last, die ihm in den Stunden davor die Droge abgenommen hatte.
***
Tai war nach dem Deal sofort in die Altstadt verschwunden. Seit Tagen war er damit beschäftigt, sein bisher grösstes Geschäft aufzuziehen. Jemand hatte ihm etwas ganz Besonderes geboten, in ein paar Wochen vielleicht war es so weit. Dann wäre er saniert.
***
Vor dem Manor in der Bahnhofstrasse spielte ein Strassenmusikant im Schutze einer kleinen Überdachung auf seinem Saxophon. Heiser, melancholisch erklang dessen Blues. Ein tiefer schwarzer Blues, sodass die wenigen Zuhörer, die stehen geblieben waren, sich in den Südstaaten wähnen konnten. In leicht nach vorn gebeugter Haltung gingen Passanten im Nieselregen meist achtlos am Musikanten vorüber. Nur wenige Münzen lagen im offenen Instrumentenkoffer.
Der Mann mit Hut und schwarzer Sonnenbrille lächelte, bevor er zum nächsten Stück ansetzte.
3
Mittwoch, 13. Juli
Chefermittlerin Giulia de Medici hielt die Kopie eines anonymen Schreibens in der Hand. Fassungslos schüttelte sie den Kopf über den Inhalt, sodass das zu einem Pferdeschwanz zurückgebundene schwarze Haar wie ein Springseil hin und her hüpfte.
«Wie krank ist das denn? Meine Lasagne kommt mir gleich hoch. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Oder?»
Vor zwanzig Minuten erst sass sie noch in dem kleinen Restaurant unter dem Bahnhof, in welchem sie und ihre Kollegen zweimal die Woche essen gingen. Als sie der Dringlichkeit wegen bereits während des Essens informiert wurde, hatte sie sofort den noch halb vollen Teller angewidert beiseitegeschoben.
«Echt jetzt? Wann ist dieses Schreiben gekommen?» Sie blickte weiter Oliver Prader vom Erkennungsdienst fragend an, der neben ihrem Schreibtisch im Hansahof stand.
«Vor einer Stunde, als ihr gerade zum Essen unterwegs wart.» Oliver Prader schmunzelte ein wenig gequält.
Falls das Schreiben Tatsachen beinhalten sollte, wären weitere lustig gemeinte Anspielungen nicht mehr angebracht, dachte Giulia. Doch im Moment wollte sie lieber glauben, dass sie einen anonymen Brief in den Händen hielt, dessen Absender einen Psychiater benötigte. Mit solch Gestörten hatten sie es immer wieder zu tun. Trotzdem mussten sie jedem Hinweis nachgehen, und das schienen die Absender solcher Briefe auch zu wissen, darum taten sie es wahrscheinlich.
«Na gut. Gibt bestimmt bessere Jobs, als direkt nach einem Essen, das mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnte, in einer Fleischfabrik zu ermitteln. Das Ganze ist ein Witz, oder? Verarscht ihr mich jetzt wirklich nicht?» Giulia blickte mit ihren dunklen Augen kritisch in die Runde. Die Mienen der anderen verrieten es ihr.
Es war also kein Scherz.
«Hat schon jemand versucht, die Frau zu erreichen? Bitte sagt mir einfach, dass sie erreichbar ist.» So richtig ernst nahm sie die ganze Sache immer noch nicht, schwankte zwischen Selbstironie und Pflichtbewusstsein. Ausgerechnet heute hatte sie die Lasagne gewählt, da diese draussen auf der Menutafel gross mit «frisch zubereitet» angepriesen wurde. In Klammern stand dazu: «Fleisch aus der Region». Genau deshalb hatte sie diese bestellt, denn Tierfabriken waren ihr ein Gräuel und gehörten schon längstens verboten.
«Wir haben es bei ihr auf dem Mobiltelefon und auf ihrem Festanschluss versucht. So auf die Schnelle konnten wir sie nicht erreichen. Ausserdem, bevor ihr nicht in Landquart wart, wollen wir nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Falls das Ganze ein schlechter Scherz sein sollte, könnte es schnell eine rufschädigende Wirkung für die Firma nach sich ziehen. Ehrlich, Giulia, es klingt ja schon abstrus, oder?»
«Da fragst du mich auch noch? Natürlich. Völlig abstrus. Sieht man es mir denn nicht an?» Sie wandte sich erneut Oliver Prader zu. «Ich nehme an, diese Kopie des Schreibens ist für meine Akten?»
Sie drückte ein paarmal auf die Tastatur, der Laserdrucker spuckte ein Titelblatt heraus: «BÜNDNERFLEISCH».
Damit beschriftete sie ein Aktenmäppchen, in das sie sorgsam die Kopie des anonymen Schreibens legte. Die anderen blickten leicht amüsiert auf den Titel.
Giulia de Medici, die neunundzwanzigjährige Bündnerin mit italienischen Wurzeln, zog sich ihren blauen Blazer über, damit sie ihr Waffenhalfter ungesehen darunter tragen konnte, und schnappte sich den Wagenschlüssel.
Sie schaute in die Runde und sagte: «Na, dann wollen wir mal, auf was wartet ihr?»
Obwohl es draussen bewölkt war und leichter Regen fiel, zeigte das Thermometer schwülwarme siebenundzwanzig Grad an.
Drei Beamte der Kantonspolizei Graubünden begleiteten Giulia: Markutt, siebenundvierzig, Sigron, fünfunddreissig, und Oliver Prader vom Erkennungsdienst, der vier Jahre vor seiner Pension stand.
Ein blauer Kastenwagen mit einigen Beamten der Forensik folgte ihnen für den Fall der Fälle, dass sich das anonyme Schreiben tatsächlich als glaubhaft herausstellen würde, denn dann wäre umgehender Handlungsbedarf angezeigt.
Erich Hartmann, ihr aller Chef und Leiter der Kriminalpolizei, hatte dieses Beamtenaufgebot angeordnet. Er nahm den Brief sehr ernst – ernster als alle anderen, wie es schien. Giulia hingegen wäre lieber erst einmal nur zu viert gefahren, das war ihrer Meinung nach schon mehr als genug. Nach einer entsprechenden Lagebeurteilung hätte sie allenfalls die Forensik aufgeboten. Doch da gab es nichts zu diskutieren, Hartmann war der Chef – basta. Zudem hatte er ein untrügliches Gefühl für Verbrechen, auch wenn er eine Krawatte trug. Die Reibereien, die er und sie manchmal hatten, konnten nicht verdecken, dass sie sich gegenseitig respektierten, auch wenn Giulia ihn manchmal unter Kollegen den Poltergeist nannte.
Die Fleischerei Landquart AG war im Industriegebiet angesiedelt. Schon die heruntergekommene Fassade, die dringend einen neuen Anstrich benötigte, wirkte abstossend, als sie auf den schäbigen Vorplatz fuhren.
Ungefähr sechzig Mitarbeiter arbeiteten im Innern, das hatte die Website ihnen zuvor verraten. Genauso wie die Tatsache, dass ausschliesslich eingekauftes Fleisch verarbeitet wurde – es war kein Schlachtbetrieb. In mehreren Kühlhäusern lagerte die Ware, bis die unscheinbaren weissen Lieferwagen sie an Restaurants, Hotels oder Kantinen auslieferten.
Das Erstaunen in der Chefetage war gross, als Giulia ihren Dienstausweis zückte, um ihr Anliegen vorzubringen.
Bei fast jedem Mann flackerte zunächst Freude in den Augen auf, wenn sie höflich fragte, ob sie ihn kurz sprechen dürfe, dann folgte die Irritation, wenn sie ihren Dienstausweis zeigte und sich als Ermittlerin zu erkennen gab. In manchem Gesicht eines Mannes konnte Giulia regelrecht lesen, wie er ihr Äusseres nicht mit dem einer leitenden Kriminalbeamtin in Verbindung bringen konnte. Danach war der ganze Zauber bei den meisten erst einmal weg. Diesen Vorteil wusste sie zu nutzen.
«Sie sind Herr Kalinkowski? CEO Kalinkowski?»
Der Angesprochene nickte.
«Gut. Darf ich Sie kurz sprechen? Mein Name ist de Medici, ich bin leitende Ermittlerin bei der Kantonspolizei Graubünden, und dies hier sind meine Kollegen Sigron, Markutt und Prader. Aufgrund eines Verdachtes müssen wir kurz einen Ihrer Produktionsräume inspizieren. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns jetzt sofort dort hinbringen.»
Sichtlich irritiert führte sie Moritz Kalinkowski in den gewünschten Produktionsraum, beobachtet vom neugierigen Personal.
Giulia hielt sich gegenüber Kalinkowski weiter bewusst bedeckt, obschon er beim Durchlaufen des Gebäudes mehrmals versuchte, weitere Informationen von ihr zu erhalten. Sie wollte erst einen bestimmten Sachverhalt im anonymen Schreiben überprüfen, denn damit stand oder fiel die grundsätzliche Vertrauenswürdigkeit des Dokuments. Wer weiss, vielleicht löste sich gleich alles in Schall und Rauch auf.
Wie im Schreiben vermerkt, führte die beigelegte Beschreibung sie zu einem kleinen Kühlhaus. Darin fanden sie tatsächlich ein Zehnkilopaket gehacktes Rindfleisch, das tiefgefroren hinter einem der Regale versteckt lag. Der Rest der fünfhundert Kilo war, wie im Schreiben erwähnt, bereits vor zwei Tagen, also im Laufe des Montags, ausgeliefert worden. Wahrscheinlich war der Grossteil davon bereits in den Mägen der Kunden verschwunden, was auch die Nachfrage bei Kalinkowski ergab.
Oliver Prader zog sich die blauen Handschuhe über und legte das Fleischpaket in eine Tiefkühlbox, die mittels mobiler Akkus die weitere Kühlung sicherstellte. Zuvor hatte er ein Foto geschossen, dass das Paket Fleisch versteckt in dem kleinen Hohlraum zeigte. Da der Kühlraum durch die vielen Angestellten stark frequentiert wurde, hatte es keinen Sinn, weitere Spuren zu suchen. Fingerabdrücke hingegen würden hoffentlich auf dem Paket zu finden sein.
«Herr Kalinkowski, unter welcher Nummer sind Sie Tag und Nacht erreichbar?»