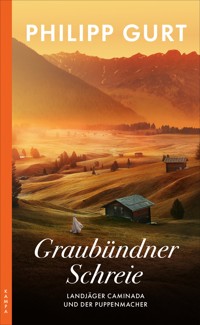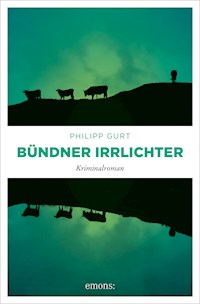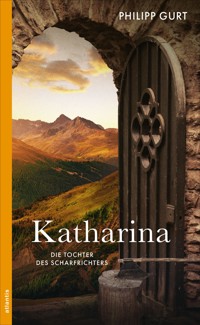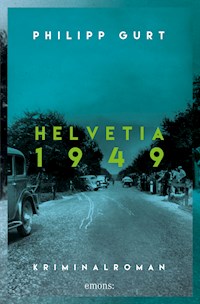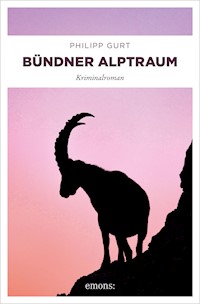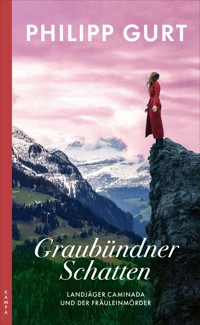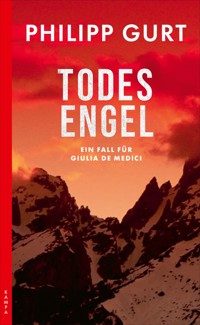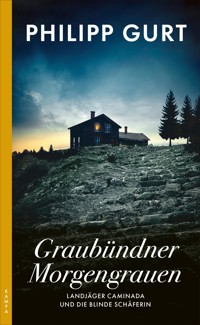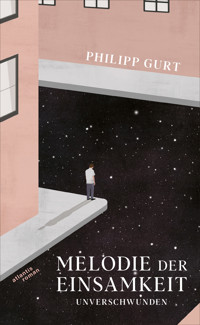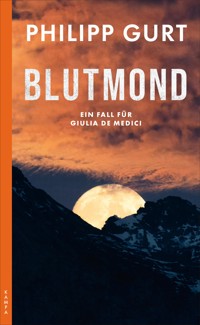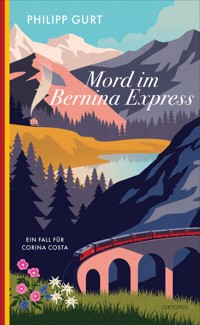16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Landjäger Caminada
- Sprache: Deutsch
Der Hirt der Altsäss, einer Alp hoch auf dem Calanda, liegt tot im Käsekessel. Die Milch ist vom Blut rot verfärbt, der Schrecken groß: Toni wurde erschlagen. Gefunden hat ihn die Sennerin Freya Schwarz, welche die Kuhalp mit ihren beiden Schwestern behirtet. Die drei jungen Frauen stellen sich tagtäglich dem harten Alpleben, doch seit sie die Sennerei führen, wird jede Samstagnacht auf dem Tanzboden gefeiert. Das zieht neben drei rauflustigen Holzknechten auch allerlei Leute aus dem Churer Rheintal an, sodass sogar der Pfarrer davon erfährt und vor dem gottlosen Tun warnt. Bald darauf wird im Schelmentobel unterhalb der Alp seine Leiche gefunden. Landjäger Caminada und sein bester Freund, Erkennungsfunktionär Peter Marugg, werden auf den Berg gerufen, um die Morde aufzuklären. Ihre Ermittlungen gestalten sich schwierig, versetzen sie zehn Jahre zurück ins Jahr 1943, als am Calanda tagelang der größte Waldbrand in der Geschichte der Eidgenossenschaft wütete. Spätestens als ein drittes Opfer gefunden wird, müssen die beiden Männer mit Schaudern erkennen, dass das Böse viele Gesichter trägt und der Berg auch für sie tödliche Gefahren bereithält …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Philipp Gurt
Graubündner Totentanz
Landjäger Caminada und die Sennerin
Kriminalroman
Kampa
Für Pierina Hassler, eine Journalistin mit Verstand, Herz und Biss
Schicke keine Schafe, um den Wolf zu jagen …
Prolog
Eidgenossenschaft zur Zeit des Zweiten Weltkrieges
Eine helle Mädchenstimme sang:
»Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar, der Wald steht still und schweiget, und aus den Wiesen steiget, der weiße Nebel wunderbar …«
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die scheußlichste Kreatur im Schweizerland?
Das helle Klingeln eines Glöckleins warnte vor der Antwort, denn bald schon würde, wenn nicht doch noch ein Wunder geschähe, das vierzehnjährige Meitli, das brave Margritli, tot im dunklen Tannenwald liegen. Auf samtweiches Moos würde sie gebettet sein, ihre himmelblauen Augen ausdruckslos zwischen schwarzen Wipfeln hindurch auf das Sternenmeer gerichtet, als suchten sie einen himmlischen Hoffnungsschimmer, während der herbstliche Nebel über den Wiesen und Feldern vor dem Waldrand schwebte.
Sie hatten nur den einen Spiegel gehabt, einen kleinen, einen für die Weibersleut, wie sie auf dem Hof sagten. Ein einziges Mal hatte er in diesen geblickt, nach Jahren, weil er es endlich erblicken musste. Das war lange her, und der Spiegel war längst zerbrochen, wenngleich das darin Widergespiegelte noch immer wie Scherben in seinem Fleisch steckte.
Das, was ihn aus dem Spiegel und mit nur einem Auge angestarrt hatte, das war noch viel schlimmer gewesen als das, was ihm seine Finger all die Jahre hindurch verraten hatten, wenn er sein Gesicht zaghaft und aus Angst nur in der Dunkelheit betastet hatte.
Wer nicht sterben kann, muss leben!
Wenngleich es schaurig war, so war es doch noch immer er, der diese Beine bewegte, und er war es, der diese Hände zur Schaufel greifen ließ, und es war sein linkes Auge, das ohne Augenlid in die Welt starrte. Dieses Auge blickte noch immer in dieselbe Welt, die ihm jedoch seither so fremd geworden war, und das nicht, weil er alles nur noch in Schwarz- und Weißtönen sah.
Obschon das Grauen damals mitten in der Nacht über die bedauernswerten Menschenseelen gekommen war, verhalf ihm nun ausgerechnet die Dunkelheit dabei, so etwas wie ein Leben im Tod zu führen. Noch immer hörte er in manchen Nächten ihr markerschütterndes Schreien, das Wehklagen, für das es keine Worte gab, weil die Tore zur Hölle weit aufgestoßen worden waren.
Deshalb zog er seit vielen Jahren nur noch in der Düsternis umher wie der knöcherne Sensenmann, der sich in der Dämmerung aus einem trockenen Weizenfeld erhebt, um seine unheilvolle Ernte einzubringen, nachdem die Glut des Tages die Menschen gelähmt hatte. In seinen langen Mantel gehüllt, das Gesicht in die Dunkelheit seiner Kapuze zurückgezogen, schritt er dann einsam durch die Nacht. Schwarz hob sich seine Gestalt in den ruhenden Feldern gegen die im Hintergrund sanft geschwungenen Hügel ab, leise bimmelte warnend das Totenglöcklein bei jedem seiner Schritte – ein Klang, den niemand hören wollte, vor allem nicht die Buben und Mädchen, die spätnachts auf einsamen Feldwegen auf dem Heimweg zu ihren Bauernhöfen waren …
Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen … der Wald steht still und schweiget …
Irgendwann erzählte man auch den Kindern in entfernten Dörfern von dieser grausigen Erscheinung, die in den Nächten wie Gevatter Tod durch die Lande zieht und zur Warnung ein Glöcklein läutet. In diesen Geschichten wurde behauptet, dass ein jeder, der die Kreatur nicht schon aus der Ferne erblickte und das Geläut zu lange überhörte, entweder gleich in seinen Fängen sterben müsse oder, verflucht durch sein böses Omen, eines Morgens einfach tot im Bett läge, das Gesicht zu einer Fratze versteinert. In jedem Fall geschähe aber ein Unglück!
Einige waren ihm schon zum Opfer gefallen: Zum Beispiel die alte Glätterin, Fräulein Steiger, die kaltblütig erschlagen worden war. Bald wusste man auch von anderen Opfern zu berichten, ohne die Namen der unglücklichen Seelen zu kennen, aber eines war dennoch gewiss: Sie alle mussten des Nachts der scheußlichen Kreatur in die Hände gefallen sein, sie alle hatten das warnende Glöcklein überhört.
Was aber niemand ahnte, war, dass diese seltsam anmutende Kreatur in jeder einzelnen Nacht versucht hatte zu leben, so verflucht ihr Dasein auch sein mochte, so schmerzhaft und tief die Splitter im geschundenen Fleisch auch steckten. Er erinnerte sich noch immer ans Leben davor, wenn nach heißen Sommertagen feiner Regen in der Dämmerung auf die warmen Felder und Äcker niederging. Der Schmerz brannte dann schier endlos in ihm, weil alles vorbei und doch noch nicht zu Ende war.
Wer nicht sterben kann, muss leben!
Doch da war noch dieses andere Meitli, das brave Ruthli, nach der er sich täglich sehnte, wenn er in der Dunkelheit hinter Büschen versteckt durch die erhellten Fenster des Herrenhauses blickte und sie beobachtete. Ruthli und deren junge Mutter Marie.
1
Graubünden – Alpsommer 1953
Die verwitterte Holztür der Alphütte stand an jenem Sonntagmorgen im August weit offen. Jemand war soeben auf der Alp Altsäss aus dem gedrungenen Steinbau geflohen; schnelle Schritte, dann Stille.
Das viele Brennholz unter dem Vordach war ordentlich gestapelt. Hinter der wehrhaften Hütte plätscherte munter der Brunnen. Glasklar und kalt sprudelte das Quellwasser und bildete verspielt Luftblasen im steinernen Trog. Die Milchkessel standen seit dem Melken noch immer ungewaschen vor dem Brunnen, fette Fliegen stoben immer wieder hoch.
Die satten Matten rund um die Alp hätten nicht schöner sein können, denn die Sonne war soeben über den im Schatten liegenden Silhouetten der östlichen Berge des Churer Rheintals hochgestiegen und warf nun ihr mildes Licht auf die von Blumen gesprenkelten Anhöhen unterhalb der steinernen Gipfelregionen des fast 3000 Meter hohen Calanda.
Schritte.
Eine junge Frau trat Minuten später summend durch die sperrangelweit offen stehende Tür in die Alphütte. Ihr lang gezogener heller Schrei zerriss die morgendliche Stille am Berg!
Das Geläut der Schellen und Glocken schwebte danach wieder über den Weiden, als wäre der Schrei nie passiert, und die Kühe schnaubten hin und wieder zufrieden beim Grasen, ihre schweren Grinde nickten emsig.
Drei Stunden zuvor, als sich scheu der erste rosa Streifen über den Bergkämmen im Osten zeigte, hatte Zita Schwarz die Tiere einzutreiben geholfen. Die Zusennin lief mit einem Summen auf den Lippen leichtfüßig bergwärts, Richtung Chrüzboden, wo ein Teil des Vehs die Flanken des Calanda punktete, während Freya, ihre ältere Schwester und Sennerin, die Tiere von unterhalb, vom Schluechtbödeli und Sennenstein, hochtrieb. Beide taten dies wie immer auf dieselbe Art und Weise in der Früh: Mit ihren hellen Stimmen sangen sie die einfachen Ruflaute. Dann kamen die Kühe bald angelaufen, mit ihren prall gefüllten Eutern, an denen die Adern fingerdick hervorquollen.
Toni, der schwarzbärtige braungebrannte Melker und Küher, trieb ebenfalls die Tiere ein, schien aber auch an diesem Morgen über Nacht seine Sprache verloren zu haben. Missmutig wie der drahtige Kerl in den frühen Morgenstunden war, und das jeweils so lange, bis die Sonne aufstieg, brummte er höchstens mal vor sich hin. In sich gekehrt, paffte er die geschwungene Pfeife, die in seinem rechten Mundwinkel hing, und schwang seinen Stecken. An diesem Morgen schien der einsilbige Kerl noch verstockter und träger als sonst. Die Sennerin machte deshalb später beim Melken eine spitze Bemerkung darüber:
»Toni, wenn du dich nur noch ein wenig langsamer bewegst, siehst du aus wie ein Gemälde, auf dem ein stinkfauler Hirt zu sehen ist.«
Zita, die wie ihre Schwester knapp über 30 war, kicherte unverhohlen laut, während ihre Hände emsig weiter molken. Toni tat so, als hätte er nichts gehört, gab der Kuh, die er soeben fertig gemolken hatte, aber einen gar gehörig groben Klaps an die Flanke, sodass diese schwerfällig einen Schritt zur Seite trat. Murrend verließ er mit dem beinahe überschwappenden Kessel den Stall. Sein einbeiniger Melkstuhl wackelte dabei an seinem Füdla umgebunden wie der Stachel einer riesigen Biene, während er hinüber zur Alphütte trottete, in der das schwere Kupferkessi am klobigen Schwenkarm aus Eisen über der Feuerstelle hing.
Er kippte das aufschäumende Weiß in den großen Kessel, der sich zunehmend füllte, bevor er sich, zurück im Stall, neben die nächste Kuh hockte, das graublaue Melkkäppi richtete und in gebeugter Haltung weiter molk, als gäbe es keine Worte in seiner Welt.
An diesem Morgen war Toni missmutig darüber, dass der Batzger, der Hirtenbuab Hansli, noch vor dem Käsen mit dem großen Rucksack hinunter ins Dorf, nach Haldenstein, würde gehen müssen, um Besorgungen zu machen, und das an einem Sonntag! Die Sennerin hatte es gestern so beschlossen, weil die Holzknechte das Brot von der Bäckerei Rätz nicht wie versprochen abgeholt hatten. Toni würde daher bis in die späten Nachmittagsstunden das Veh allein behirten müssen, und das stank ihm gehörig. Doch immerhin hatte der Buab beim morgendlichen Eintreiben geholfen und nun beim Melken, denn in der Früh und ein zweites Mal vor dem Abendbrot mussten 68 Tiere von Hand gemolken werden. Die wackere Sennerin Freya Schwarz war daher auf jede helfende Hand angewiesen.
Kessel um Kessel kuhwarme Milch wurde an diesem Sonntagmorgen fürs Käsen ins Kupferkessi geschüttet, während der Morgen zusehends erwachte. Tiefes Muhen durchbrach immer wieder die Melkgeräusche im feuchtwarmen Stall; das rhythmische Zischen, wenn die Milch in das aufschäumende Weiß der Kessel schoss, gemischt mit dem Schlagen der nicht aufgezäumten Kuhschwänze. Es roch nach frischem Kuhfladen und herb nach dampfendem Kuhbrunz, nach warmer Milch und nach der Pfeife vom Toni, der noch immer schwieg wie der mächtige Berg, auf dem sie alle hockten, während der Hansli fröhlich vor sich hin pfiff.
Das hatte seinen Grund, denn der zwölfjährige Hansli wusste, dass er sich auch diesmal für den wöchentlichen Botengang hinunter nach Haldenstein Zeit lassen würde; viel Zeit, sodass ihm noch vor der Rückkehr bestimmt eine neue gute Ausrede dafür in den Sinn käme.
Zita, die Zusennin, hatte längst die Scheite unter dem Kupferkessel entzündet, die sie von der großen Beige an der Hüttenwand genommen und in einem Harass reingetragen hatte. Mehrere hundert Liter Milch mussten nach dem Melken langsam auf die richtige Temperatur fürs Käsen erhitzt werden.
Angrenzend an den einfachen Raum fürs Käsen, dessen Steinmauern brandschwarz vom Ruß waren und in dem das offene Feuer unter dem Kupferkessi züngelte, saßen wenig später alle gemeinsam in der niedrigen Stube am grobschlächtigen Holztisch beim Frühstück. Nach dem z’Morga würde das Käsen weitergehen: Sie mussten im Käsekeller die vielen Laibe mit einer Bürste, die sie in eine Salzlösung tunkten, abreiben und wenden und das weiß Gott weder zum ersten noch zum letzten Mal in diesem Alpsommer.
Es gab wie jeden Morgen Tatsch zum Frühstück, den der Toni eindeutig am besten zubereiten konnte – ein Gemisch aus Mehl, Wasser und Salz, das mit ausgiebig Butter in der gusseisernen Pfanne auf dem Holzherd angebraten wurde. Dazu tranken sie von der frisch gemolkenen Milch. Nur jeden zweiten Tag brühte Freya Zichorienkaffee auf.
Wenn Hansli tags zuvor schön fleißig gewesen war, streute die Sennerin einen gestrichenen Esslöffel Zucker über seinen Tatsch, worauf die Augen des Buben jedes Mal glänzten, so wie an diesem Sonntagmorgen. Toni beäugte, ohne seinen Kopf zu drehen, wie die schöne Sennerin, deren pechschwarzes Haar zu zwei Zöpfen geflochten seitlich aus dem Kopftuch hing, Hansli anlächelte – ein Lächeln, das längst alle Kerle auf dem Berg verrückt machte, und das waren weiß Gott nicht wenige in diesem Alpsommer, der so ganz anders war als alle bisherigen. Und Toni dachte: »Herrgottsack noch mal, wieder wird ein Löffel Zucker für diesen Hirtenbuab vergeudet.«
Zugegeben, der kleine Schlaumeier schien ihm gescheiter zu sein als alle hier oben zusammen. Er arbeitete immer dann am härtesten, wenn ihm jemand zuschaute, der ihn noch nicht durchschaut hatte, dünkte es Toni. Der Junge mit den vielen Sommersprossen im Gesicht und dem braunhaarigen Wuschelkopf beherrschte nämlich zwei Grundsätze wie kein Zweiter: Lerne zu klagen, ohne zu leiden, und was du heute sollst besorgen, das tut ein anderer für dich halt morgen.
Der Küher und Melker war deshalb schon auf Hanslis Ausrede gespannt, welche die Sennerin heute Nachmittag von dem Buab brühwarm, aber mit treuherzigem Augenaufschlag, einmal mehr verzapft bekäme.
Keiner dieser Gedanken fand in dem Moment den Weg aus Tonis Kopf; er schwieg. Dafür hatte zuvor sein Blick deutliche Worte gesprochen, als Freya den Esslöffel Zucker über Hanslis Teller schweben ließ und wie Graupel verteilte, der in den letzten, manchmal kalten Herbsttagen auf die Alpweiden prasselte. So eine verreckte Verschwendung aber auch, dachte Toni.
Als hätte Freya Tonis Gedanken lesen können, zog sie ein Stück Papier aus ihrer Arbeitsschürze und sagte: »Hör mir heute aber ganz gut zu, Hansli«, sie suchte den Blickkontakt und ihre blaugrünen Augen schimmerten dabei geheimnisvoll wie Bergkristalle aus dem gebräunten Gesicht, »Auf diesem Zettel steht alles, was wir brauchen. Vergiss nichts und komm für einmal ja schnurstracks wieder hoch, sonst kannst du morgen den Stall allein ausmisten, denn«, und nun wurde ihr Blick streng, »ich kenne mittlerweile jede faule Ausrede. Selbst die von heute Nachmittag!«
Der Bub lachte schelmisch, als sie ihm durch den Haarschopf wuschelte und mit einem milden Lächeln anfügte: »Wenn du’s aber guat machsch, dann git’s am Abig auch was besonders Feins zum Znacht, gell? Wenn nicht, kannst du beim Einschlafen deinem leeren Magen beim Knurren zuhören und dich auf den Tatsch vom nächsten Morgen freuen. Einen Tatsch oooohne Zucker. Häsch mi verschtanda?«
Nach dem gemeinsamen z’Morga rüstete Zita hinter dem Stall ein paar Zaunpfähle her. Sie spitzte diese mit der Axt ordentlich zu, denn bei der Abrisskante am Sennenstein mussten sie dringend zäunen. Die Trockensteinmauer aus Schiefer hatte an einer Stelle einen Durchbruch, wie die Sennerin heute Morgen in der Dämmerung erkannt hatte. Was genau dort unten passiert war, darüber ließ sich nur rätseln, denn so eine Mauer überdauert normalerweise viele Jahrzehnte. Das Loch war eine Gefahr für Mensch und Vieh.
Nach dem letzten Pfahl wollte Zita zurück ins Älplerstübli, sagen, dass sie nun losziehe, bevor Freya gemeinsam mit dem Toni mit dem Käsen begann, ehe er loszog, um oben in den Hängen das Veh zu behirten.
Rauch kräuselte noch immer aus dem Kamin und löste sich im Sommerblau auf, als Zita die Hütte betrat. Sie wollte ins Stübli gehen, als ihr Blick auf das Kessi fiel. Sie riss erschrocken ihre Augen genauso sperrangelweit auf wie ihren Mund und ihr gellender Schrei flüchtete durch die offene Tür, zerriss die Morgenstille, hallte über die sonnigen Anhöhen bis hoch zu den steinernen Gipfelregionen – ein Schrei durchtränkt vom Grauen.
Die Sennerin eilte aufgeschreckt aus dem Stall, als stände dieser lichterloh in Flammen. Auf dem von den Kuhtschaggen hartgetretenen Vorplatz blickte sie nach links und rechts, dann rannte sie zur offen stehenden Tür der Alphütte und verschwand darin.
Im großen Kupferkessi lag, mit dem Oberkörper über den Rand gebeugt und mit dem Gesicht im Weiß, der Toni. Die dampfende Milch war rot gefärbt von Blut! Neben seinem Kopf zappelte ein fetter Hirschhornkäfer in der Milch, der sich auf die schwimmende Pfeife retten wollte. Tonis mattblaues Melkkäppi saß verrutscht noch immer auf seinem Kopf; sein Hinterkopf war blutig.
Die beiden Frauen packten den Hirt links und rechts an den Oberarmen und zogen ihn aus dem Kessi. Sie legten den leblosen Körper erst auf den Steinboden, dann zogen sie ihn an den Füßen weg vom Feuer. Das nasse Käppi blieb auf dem Boden liegen.
Da war nichts mehr zu machen, mussten sie rasch erkennen; der Toni war tot! Sein dichtes Haar am Hinterkopf war blutig. Er musste mit einem stumpfen Gegenstand bewusstlos oder gleich totgeschlagen worden sein. Das Melkkäppi und sein Haarschopf hatten ihn nicht vor dem Schlag schützen können, denn unter dem Haar verbarg sich eine Platzwunde. Er musste nach dem Schlag vornüber ins Kessi gefallen sein, schlussfolgerten die beiden Berglerinnen. Sie entschieden; die Landjäger mussten her!
Geistesgegenwärtig eilte die Sennerin vor die Hütte. Wer immer dies getan hatte, der war bestimmt bereits auf und davon. Dennoch blickte sie in alle Himmelsrichtungen, während Zita erstarrt vor der Hütte stehen blieb. Doch es war niemand zu sehen. Wer immer dies verbrochen hatte, hatte sich längst aus dem Staub gemacht.
Freya rief mehrmals nach Hansli.
Der kam hinter dem großen Stall hervor. Er war bei den vier Alpschweinen gewesen, hatte die Reste der Molke vom Vortag verfüttert. In dem Heidenlärm, den die Sauen dabei veranstaltet hatten, musste der Bub den Schrei überhört haben.
»Los, Hansli«, sagte Freya ernst, als er mit fragender Miene vor sie trat, »lauf sofort hinunter ins Tal, und das geschwind wie der Wind. Am besten gehst du gleich in Haldenstein zum Restaurant Adler. Klopf dort oder bei der Stini, die vom Krämerladen, die wohnt im gleichen Haus. Sag, jemand soll uns sofort die Landjäger hochschicken.«
Der Junge blickte sie mit großen Augen an. »Ja warum denn? Isch öppis passiart?«
Freya legte ihre blutverschmierte rechte Hand auf seine noch schmalen Schultern. »Ja, etwas gar Schlimmes ist geschehen, jemand hat unseren Toni umgebracht! Er lag im Kupferkessi, mit einem Loch im Grind. Sag das im Dorf, damit die Landjäger wissen, dass sie nicht bloß wegen einer gestohlenen Geiß hier hochkommen müssen.«
Ungläubig starrte Hansli in die kristallklaren Augen der Sennerin und machte keinen Schritt vor lauter Schrecken, denn an ihrem Ernst hatte er erkannt, dass es keine Kalberei war, die sie ihm da soeben erzählt hatte. Das Entsetzen im Gesicht des Buben breitete sich vom offenen Mund ausgehend übers ganze Gesicht aus, als hätte jemand einen Stein in einen schlafenden Weiher geworfen.
Freya gab Hansli einen Stoß, löste damit dessen Starre. »Ja Heilandsack, Buab, jetzt lauf schon, auch wenn der Toni deswegen nicht wieder lebendig wird. Hol im Tal unten die Landjäger!«
Der Buab stolperte los.
»Wart, Hansli! Du hast den alten Rucksack vergessen. Bleib hier stehen, geh nicht in die Alphütte, sonst graust’s dich bis in alle Ewigkeit!« Freya lief zurück in die Hütte, holte den Rucksack und gab ihn Hansli. »Und noch was. Du weißt ja wo wir Schwarz in Chur hausen. Warst ja schon zwei Mal bei uns auf dem Hof auf der Waldlichtung oben am Campodelsweg, als du die Tiere für den Auftrieb holtest. Du erinnerst dich doch noch?«
Er nickte sichtlich verstört. Freya bedauerte jetzt, dass sie zu viel über den Tod von Toni erzählt hatte. Sie hatte dabei regelrecht in den Augen des Buben die Bilder dazu sehen können, die er sich in seiner kindlichen Phantasie gemalt haben musste.
»Bist du sicher, dass du den Weg durch den Fürstenwald zu unserem Hof findest?«, hakte sie nach, weil er nur abwesend genickt und keine Antwort gegeben hatte.
Hansli nickte eilig.
»Sicher?«
»Ja«, kam schüchtern die Antwort.
»Gut. Denn du musst der Rosa ausrichten, dass sie mit dir hochkommen muss. Sag ihr, ihre Schneiderei muss für einmal halt warten. Und erzähl ihr, dass der Toni erschlagen wurde und dass wir jede Hand hier oben gebrauchen, bis uns vom Alpmeister in Haldenstein ein neuer Küher hochgeschickt wird. Betone, dass es ja nur für ein paar Tage sei. So, und jetzt lauf!«
2
In der Nacht zuvor …
Rosa Schwarz lag in ihrem schmalen Bett und schlief tief und fest, als sie von einem Geräusch aufgeschreckt wurde.
Die siebenundzwanzigjährige Kleinbäuerin und Schneiderin war erst vor einer halben Stunde, weit nach Mitternacht, zu Hause angekommen. Der kleine Hof, der sie und ihre beiden Schwestern mit fast allem Lebensnotwendigen versorgte, lag mittig in einer weitflächigen, sanft ansteigenden Waldlichtung im Fürstenwald, der sich wiederum in die Flanken des Fürhörnli ausbreitete. Eine Kirchenglocke hatte in der Ferne vor wenigen Minuten fast entschuldigend verhalten drei Uhr geläutet. Der laue Nachtwind wehte den heiseren Klang von Chur herauf, das 20 Fußminuten entfernt unterhalb im Rheintal lag und spärlich beleuchtet an Berge geschmiegt in der Senke ruhte.
Rosa war Stunden zuvor, wie jeden Samstagnachmittag in diesem Alpsommer, kurz vor 16 Uhr mit dem Drahtesel losgefahren, hinunter nach Haldenstein, auf die andere Talseite. Die Sonne schien, ein warmer Südwind ging. Sie hatte den kleinen Rucksack vom Haken genommen und die schwarzen Sonntagsschuhe sowie das rote Sommerkleid mit weißen Tupfen sorgfältig darin eingepackt. Das todschicke Kleid hatte die gelernte Schneiderin natürlich selbst geschneidert, der neusten Mode der fünfziger Jahre entsprechend. Weil sie so gut schneidern konnte, waren sie und ihre beiden Schwestern an diesen Festen immer am rassigsten angezogen; modern und ein bisschen frivol, sodass die Blicke ihnen sicher waren.
Mit dem Velo sauste Rosa zügig Richtung Haldenstein hinunter, sodass ihr blondes, gewelltes Haar im Fahrtwind wehte. Ihren beigen Arbeitsrock hatte sie unter den Sattel geklemmt. Sie überquerte die überdachte hölzerne Brücke vor dem Dörfli Haldenstein, die den Rhein überschlug, und schob ihr Fahrrad auf dem zu Beginn bereits schmalen Weg den Calanda hoch. Nach zweieinhalb Stunden versteckte sie ihr Gefährt im Gesträuch neben einer knorrigen Lärche und folgte dem Wanderpfad Richtung Tanzboden hoch.
Rosa hatte sich auch diesmal die ganze Woche darauf gefreut, wieder bis in alle Nacht hinein hoch über Chur, unterhalb der Alp Altsäss, mit ihren Schwestern so lange zu tanzen, bis die Füße weh taten. Wieder würde die Tanzmusik aufspielen und an Durst würde auch an diesem Samstag bestimmt keiner lange leiden, geschweige sterben. Denn Durst, da hatte der schöne Fredy, der die Klarinette spielte, schon recht; Durst war verreckter als jedes Heimweh.
Das wöchentliche Tanzbodenfest zog mittlerweile viele Leute an. Weit über 200 Tanzfreudige, die auch an diesem späten Nachmittag den Calanda hoch gingen. Darunter waren auch anständige und wackere Kerle und so manches hübsches Stadtmeitli obendrein, das endlich mal was erleben wollte. Doch unter all das Volk hatten sich auch zwielichtige Gestalten gemischt, die nichts Gutes im Sinn hatten.
Die vier Gebrüder Oswald aus Chur, mit Fredy als Klarinettist, spielten um 19 Uhr bereits so beschwingt auf, dass Rosa schon von Weitem von der Musik angezogen wurde. Beim kleinen Heuschober unterhalb einer kleinen Weide zog sie sich um und sprühte sich Parfüm an die Halsseiten und in den Ausschnitt.
Es ging schon hoch her, als sie gemeinsam mit anderen, die sie auf dem Weg hinauf angetroffen hatte, den Tanzboden betrat. Es roch nach gebratenen Würsten, Lachen ertönte und etliche Paare drehten sich bereits auf der von Holzknechten gezimmerten Tanzfläche, als gäbe es kein Morgen mehr.
Die junge Rosa liebte diese Abende, an denen auch sie den Alltag für Stunden vergessen konnte. Sie traf auf ihre beiden Schwestern, eine jede trug ein auffallendes Kleid und war gar hübsch zurechtgemacht. Rosa tanzte in den nächsten Stunden ausgelassen, trank Wein, aß von den gebratenen Würsten und nahm auch reichlich vom Kartoffelsalat. Bezahlen brauchte sie nicht, denn ihre beiden älteren Schwestern waren zusammen mit dem jungen, geschäftstüchtigen Metzger Ryffel aus Chur die Tätschmeister vor Ort und machten einmal mehr gemeinsam gute Kasse.
Die Handlaternen brannten längst auf dem Tanzboden, als sich Rosa nach Mitternacht mit einem schönen Mann außerhalb des Trubels traf. Der Schein vom Fest schimmerte schwach durch den jungen Dürrwald, während die beschwingte Musik, das Lachen und Gerede zunehmend gedämpfter zu ihnen drang. Rosa hatte den Kerl in den letzten Wochen so richtig zappeln lassen, ehe sie sich nun mit ihm in die sanft ansteigende Bergweide legte, in der es nach Heu roch.
Der Großgewachsene war überraschend zärtlich, fand sie, weil er ihr nicht gleich an die Tüti griff, obschon ihr praller Busen ein regelrechter Hingucker war, und das hielt was er im Kleid versprach. Erst recht in dem neuen Kleid, welches sie geschneidert hatte. Der Mann küsste sanft wiederholt ihre linke Halsseite, als wüsste er wie sehr sie dies erregte. Seit sie sich zuvor mit ihm außerhalb des Festes getroffen hatte, sagte er nichts mehr, das war ihr nur recht, denn von Romantikkram hielt sie gar nichts, denn Worte waren ja so schnell gesprochen und flogen eines Tages mitsamt den schönen Träumen davon, wenn man nicht gehörig aufpasste. Schön fand sie es aber, dass das, was sie nun taten, auf dem Berg geschah; das dunkle Tal weit unter ihnen, der Sternenhimmel über ihnen.
Der Mann ließ sich viel Zeit, war gottlob keiner von der Sorte, die nicht schnell genug zur Sache kommen konnten, so, als hätten sie Angst, dass es sich das auserwählte Fräulein doch noch anders überlegen könnte. Er war wie erhofft anders und obendrein ein ausgesprochen guter Küsser, fand Rosa, und er war gepflegt. Irgendwann glitten seine kräftigen Hände in ihre Bluse, nachdem er mit etwas zittrigen Fingern die obersten beiden Knöpfe endlich geöffnet hatte. Auch dabei ließ er sich Zeit, sodass Rosa beinahe schmunzeln musste, als sie sich beim Gedanken ertappte, dass er nun fordernder werden könnte. Dann waren ihre Brüste entblößt. Seine gebräunten Hände hoben sich über deren hellen Haut ab, ehe er sich mit dem Gesicht über ihre Brust beugte und sie zu liebkosen begann. Zeitgleich strich er mit einer geschmeidigen Handbewegung ihr Kleid hoch und streichelte ihre Schenkelinnenseite, sodass sie ihre Beine etwas abspreizte. Seine Erregung stieg merklich. Er zog ihr Höschen herunter und überkam sie mit seiner geballten Männlichkeit. Auch nach ihrem zweiten glückseligen Aufstöhnen schien er zu ihrer Freude noch immer nicht genug zu haben. Sie fühlte weiter seine lodernde Begierde tief in sich. Immer wieder ging Rosas Blick dabei zum Sternenhimmel empor, ihre Hände umfassten seine breiten Schultern, als hielte sie am Glück fest, während ihre beiden Körper im gemeinsamen Rhythmus wippten.
Später rollte er sich neben sie und zündete die erste der beiden Zigaretten für sie an. So lagen sie nah nebeneinander auf dem Rücken und rauchten; ihre Blicke waren nun gemeinsam zum Firmament gerichtet, und er hielt ihre Hand.
Schweigend blies er einen tiefen Zug in den Himmel, dann drehte er sein Gesicht zu ihr: »Es stimmt, die süßesten Kirschen wachsen zuoberst im Baum, in der Krone.« Er stützte sich auf seinen Ellenbogen auf, schob mit seiner Hand ihre Bluse wieder etwas zur Seite und küsste nochmals zärtlich ihre schneeweißen Brüste, dann hob er seinen Blick zu ihrem Gesicht, verharrte, als suchte er nach Worten, ehe er sich aufsetzte.
Rosa lächelte. »Das hast du nett gesagt.« Sie erhob sich, knöpfte ihre Bluse zu, ihre Zigarette hing zwischen ihren vollen Lippen, während sie ihre Unterhose hochzog, die über dem linken Knöchel gehangen hatte. »So, jetzt müssen wir aber zurück. Muss doch noch mit meinen Schwestern reden, bevor die beiden später wieder auf die Alp hochsteigen.« Sie suchte nach ihrem linken Schuh.
»Sehen wir uns wieder?«, fragte der Mann, der an seinem Gürtel nestelte, dann ihr den Schuh reichte, der in der Weide lag.
»Suche keinen, der mich heiratet, gell?« Sie lachte.
»Ich habe dich eben ausgesprochen gern und einer wie ich kann dich doch gar nicht heiraten.« Er strich sich kurz durch sein sanft gewelltes Haar und knöpfte seine obersten beiden Hemdknöpfe zu.
Rosa schwieg erst, lächelte in die samtene Dunkelheit. »Das mit dem Gernhaben habe ich nun begriffen. Bin nächste Samstagnacht ja auch wieder hier, außer es saicht Katzen vom Himmel, aber mehr versprechen kann ich dir heute nicht.« Sie richtete mit wenigen Handgriffen ihr blondes Haar. »Und wahrscheinlich auch sonst nie. Und für uns beide ist es besser, wenn das hier niemand erfährt.«
Der Mann kam mit seinem Gesicht ihrem ganz nahe. »Stimmt. Aber kein Wunder, verdreht ihr Schwarz-Schönheiten allen Männer den Grind.« Er versuchte sie zärtlich auf die Nasenspitze zu küssen, doch Rosa wich mit einer geschmeidigen Bewegung aus, lächelte dabei keck, nahm seine linke Hand in ihre Rechte und steuerte die Lichter an, die durch den Dürrwald schimmerten. Die Musik wurde mit jedem Schritt lauter, dann trennten sie sich.
Nachdem Rosa im noch immer nicht abklingen wollenden Trubel ein randvoll gefülltes Glas Roten fast in einem Zug leergetrunken und mit ihren beiden älteren Schwestern, der Freya und der Zita, gesprochen hatte, machte sie sich allein auf den Heimweg. Es war zwanzig vor eins in der Nacht, Chur lag weit unter ihr, als sie sich alleine vom Tanzboden entfernte. Sie wusste; nicht wenige schliefen in der Wärme der Sommernacht irgendwo hier oben in einer Weide ihren Rausch aus, oder in dem Heuschober, der am Rand der Weide stand. Der Rotwein war ihr ein wenig in den Kopf gestiegen, doch sie fand wie immer die Stelle, an der sie ihr Velo versteckt hatte. Sie zog sich um; das schöne Kleid kam wieder in den Rucksack, den Arbeitsrock samt Bluse zog sie an. Ebenso wechselte sie die Schuhe.
Auf dem schlechten Weg rumpelte Rosa auf ihrem Damenvelo den Berg hinunter nach Haldenstein und dann auf besseren Straßen über den Rhein den gegenüberliegenden Hang von Chur hoch. Der Steilheit wegen schob sie ihren Göppel durchs mager besiedelte Quartier Ober-Masans, das mit Obsthainen und Weiden durchsetzt war und wo die alten, alleinstehenden Häuser mit Natursteinmauern eingefriedet waren.
Oberhalb des Hangs, nahe am Waldrand des dunklen Fürstenwaldes, lag in die Natur eingebettet die mächtige Nervenheilanstalt. In einigen der vielen Fenster brannte noch Licht, als Rosa auf dem Kiesweg fuhr, der um die schweren Gebäude führte, aus deren Mitte ein großer schwarzer Schlot ragte, wie ein dunkler ermahnender Finger.
Beim Gutshof der Anstalt, der oberhalb direkt am Waldrand des Fürstenwaldes stand, roch es nach dem Heu, das zum Einbringen bereit auf den weitflächigen Weiden lag, die sich seitlich über die Prasserie ausdehnten. Schräg unterhalb lag Chur, mit den vielen Feldern und Wiesen vor der Stadt, die sich bis zum Rhein hin erstreckten. Von der Altstadt sah man von hier oben nichts, die versteckte sich hinter der Flanke, in der wenige, aber meist stattliche Gebäude des Loëquartiers inmitten von viel Grün standen.
Der Forstweg, den Rosa mit dem Fahrrad gut befahren konnte, führte mitten durch den ansteigenden Wald, ein Weg den sie schon so manches Mal bei Dunkelheit gegangen war. Beherzt trat sie in die Pedale. Die dunklen Tannen links und rechts, die ihr als Kind oft Angst eingejagt hatten, wenn sie im Winter von der Schule in Masans allein auf dem Heimweg war, umschlossen sie. Überall hatte sie damals wilde Kerle und Räuber gesehen, die nur auf sie warteten, sie umringten. In ihrem kindlichen Gemüt glaubte sie damals ihr tiefes Lachen zu hören, das schallend aus allen Richtungen kam, wie ein irres Echo. Ein Lachen, das bedeutete, dass sie ihnen nicht entkommen würde.
Einmal, es war kurz vor Allerheiligen gewesen und sie in der zweiten Klasse, da versteckte sie sich in ihrer Not in einem hohlen Baumstamm, der auf dem Boden lag, wie das hohle Bein eines hölzernen Riesen. Sie kauerte darin so lange, bis ihr Vater Ludwig, der Förster war, sie suchen kam. Mit der Laterne in der Hand rief er nach ihr. Sie sah den hellen Schein, hörte seine Stimme, als käme ein rettender Engel durch den Düsterwald geschritten. Sie rannte ihm entgegen und schlang ihre Arme um seine Taille und fühlte sich sofort geborgen. Ihr Vater hatte daraufhin den Docht in der Laterne gelöscht, sie bei der Hand genommen und ihr gesagt:
»Rösali, luag, der dunkle Wald ist der beste Freund eines jeden Menschen.« Worte, die sie damals im ersten Moment nicht verstanden hatte.
Sie setzten sich gemeinsam irgendwo mitten im Wald auf einen Strunk. Noch immer zitterte ihr Herz in ihrer Brust, wie das Näschen eines schnuppernden Hasen.
»Rösali, schau dich um, und Bäume werden von Räubern zu friedfertigen Gesellen«, sagte ihr Vater mit einem warmen Lächeln, das sie fühlte, aber in der Dunkelheit kaum erkannte, auch wenn sich ihre Augen längst an die Umgebung gewöhnt hatten.
»Mein Rösali, du bist doch nie allein im Wald; Füchsli, Dachse, Käuzchen und all das Wild sind hier bei dir, all die Pflanzen und Bäume ebenso. Hör nur genau hin.«
Rosa wusste, für Vater war der Wald wie ein zweites Zuhause. Manchmal schien es ihr, wenn er sie auf einen seiner Rundgänge mitnahm, wenn Mutter Angela wieder mal fort war, dass er zu fast jedem Baum eine Geschichte erzählen konnte und genau wusste, wo welches Tier seine Behausung hatte. Also tat sie es in jener Nacht, wie er es wünschte, und hörte in den unheimlichen Düsterwald.
Sie beruhigte sich an seiner Seite und schon bald hörte Rosa wie der Wald in der Nacht zum Leben erwachte. Die Räuber und wilden Kerle wurden wieder zu friedlichen Bäumen, die wie alte Freunde mit tiefen Stimmen flüsterten: »Rösali, liabs Rösali, heb kai Angscht meh, siehst du, jetzt bist du nicht mehr allein im Wald.«
Ab diesem Tag wurde der dunkle Wald allmählich zu ihrem Freund, vor allem in den Zeiten, wenn ihre Mutter wieder einmal tagelang weg blieb. Und erst recht, als sie vor 16 Jahren nicht wie sonst nach ein paar Tagen wieder heimkehrte. Damals, als ihre Mutter sie mit ihren Schwestern samt Vater für immer im Stich ließ, fand Rosa ebenfalls Trost im Wald.
Dass die Mutter damals für immer fortbleiben würde, das hatte Rosa sofort gewusst, als sie von der Primarschule in Masans heimgekehrt war, denn an diesem Tag war etwas anders als sonst, nur eine Kleinigkeit, aber Rosa wusste sofort um deren unheilvolle Bedeutung.
An diesem Tag hatte sich ihre Mutter, deren Schönheit in jeder einzelnen ihrer Töchter wiederzufinden war, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, wie immer zurecht gemacht, während Vater im Wald war. Wie schon so oft verschwand sie auch diesmal noch bevor er heimkehrte. Doch es war nicht wie immer.
Das war 1937 gewesen, an einem schwülwarmen Dienstagnachmittag im Mai kurz vor halb fünf Uhr. Rosa hatte Mutter um wenige Minuten verpasst, so hatte es Zita ihr später gesagt, die an jenem Tag krank zu Hause das Bett hüten musste. Das Parfüm der Mutter lag noch eine Weile in der Luft, als Rosa ihren Schulranzen in der Küche auf den Boden stellte.
Rosa fragte sich später oft, warum sie der Mutter auf dem Nachhauseweg von der Schule im Fürstenwald nicht begegnet war; sie hätte sie doch sehen müssen, dachte sie in den Tagen danach immer wieder und fragte sich noch lange Zeit, welches die letzte Begegnung war, welches die letzten Worte waren, die sie zusammen gesprochen hatten.
Ihre Schwestern und der Vater dachten, dass Mutter in einigen Tagen einmal mehr heruntergewirtschaftet zurückkäme, so hatte es Vater ihr im Krach mal vorgehalten und dabei mit der Faust auf den Küchentisch geschlagen, sodass das Geschirr hochsprang. Doch Rosa hatte es sofort gewusst, dass sie diesmal nicht wiederkommen würde, denn die kleine gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie, die seit zwei Jahren auf der Kommode in der Stube auf dem gehäkelten Untersetzer stand, war fort. Auf dieser Fotografie, die Mitte der dreißiger Jahre aufgenommen worden war, war Mutter mit allen Kindern abgebildet. Rosa hatte die Hoffnung der anderen nicht zerstören wollen, sagte nichts von ihrer Vorahnung, trug die Angst, was nun auf sie alle zukommen würde, jeden Tag allein mit sich herum.
Vater hatte seit dem Tag nie wieder ein Wort über Mutter gesprochen, als hätte es die wunderschöne Angela Schwarz niemals gegeben. Er fügte sich still in das Gegebene. So war er halt.
Sechs Jahre später, als hätte das Schicksal sich in der Tür geirrt, klopfte 1943 das Elend nochmals bei der Familie Schwarz an, und das sollte noch nicht das Ende sein!
An all das dachte Rosa schon lange nicht mehr zurück, als sie in dieser Sommernacht nach halb drei Uhr endlich an der großen Waldlichtung ankam. Es war ein schöner Abend gewesen auf dem Tanzboden, fand sie, und der schöne Mann hatte sie überrascht – im Guten.
Sie schwebte deshalb noch immer in diesem Glücksgefühl, während sie sich dem Hof näherte. Aus der samtweichen Dunkelheit kam ein großes schwarzes Tier auf sie zugerannt. Barko, ihr kräftiger Hofhund begrüßte sie stürmisch, als wäre sie nicht bloß ein paar Stunden fortgewesen. Sie tätschelte den wackeren Kerl, der ihr bis zum Brunnen vor dem Haus folgte, an dem sie sich ihr Gesicht wusch und ein paar Schlucke trank. Sie hatte keine Lust hinters Haus in das Holzkabäuschen zu gehen, in dem das gegrabene Erdloch war. So hob sie ihren Rock, zog das Höschen runter und biselte am Rand der Weide.
Vor dem Eingang des Hauses entzündete sie mit einem Schwefelstreichholz die Petroleumlampe, denn der alte Hof verfügte weder über fließendes Wasser noch über Strom, was die drei Schwestern gar nicht störte, denn sie waren so aufgewachsen. Mit der Laterne in der Hand ging Rosa zum kleinen Hühnerstall, der gut umzäunt war, denn der Fuchs war schon einige Male ungebeten zu Gast gewesen. Die Hühner schliefen, und Rosa machte die Klappe zu.
Barko verschwand nur widerwillig wieder in seiner Hundehütte, bevor Rosa die Eingangstür des Hauses aufschloss. Der Hund hatte in der Nacht draußen zu sein, um nach dem Rechten zu sehen.
Drinnen stieg Rosa im Lichtschein der Laterne die knarzende Holzstiege zu ihrer Dachkammer empor, zog Schuhe, Strümpfe und den Rock aus und legte sich ins schmale Bett, auf die Rosshaarmatratze. Rosa war angenehm müde vom Erlebten und dem Rotwein und schlief sofort ein.
Die jüngste der Schwarz-Schwestern hatte immer einen gesegneten Schlaf gehabt, doch in dieser Nacht wurde sie nur eine halbe Stunde später aus diesem hochgeschreckt, weil Barko heftig anschlug. Das kam immer wieder mal vor, dann, wenn er einen Fuchs verjagte, der sich an den Hühnerstall heranschlich, doch diesmal hörte sein Bellen abrupt auf. Rosa war es, als hätte sie durch den Schleier des Schlafes davor ein helles Aufjaulen gehört.
Die junge Frau schlug mit einem gähnenden Seufzer das Laken zurück und ging barfüßig und nur mit Höschen und Bluse bekleidet die wenigen Schritte ans Fenster. Ihre Kammer befand sich direkt unterhalb des Dachgiebels. Im Sommer staute sich hier deswegen die Hitze und im Winter hockte die Kälte wie grimmiger Bergnebel im Zimmer, sodass sie sich unter einem Haufen von Decken verkriechen musste. In dieser schwülen Nacht stand der rechte Fensterflügel etwas auf.
Rosa reckte sich schlaftrunken über den Sims und gähnte nochmals. Die nächtliche Luft roch angenehm nach Wald, nach der Weide und den Kräutern, die im großen Garten unter ihr prächtig gediehen. Sie blickte sich um; der Waldrand umschloss pechschwarz die hellere Weide, die sich auf einer Länge von über 200 Metern und einer Breite von 150 Metern erstreckte. Von diesem Fenster aus war nur die rechte Seite einsehbar, die mit dem Gemüsegarten, dem kleinen Kartoffelfeld und dem Hühnerstall, der unter der alten Rotbuche stand.
Sie pfiff nach Barko. Um den Rüden hatte sie sich bisher noch nie gesorgt. Der Hund war äußerst kräftig und mutig für zwei und hielt seit Jahren bis auf den Teufel und das Schicksal alles vom Hof fern, pflegte Freya, Rosas älteste Schwester, stets zu sagen. Doch weder auf den Pfiff noch auf ihr Rufen rührte sich etwas ums Haus, und das war mehr als nur seltsam, fand Rosa. Sie rief wiederholt mit ihrer glockenhellen Stimme nach dem Hund, doch ihre Rufe verstummten erneut ungehört, grad so, als hätte der dunkle Wald sie verschluckt.
Stille.
Schleierhaft hörte Rosa nur den Brunnen auf der Haushinterseite plätschern. Sie wandte sich mit aufsteigender Unruhe vom Fenster ab, schlüpfte in ihren Rock und huschte über die Holzdielen zur Stiege, die wie der gesamte Boden im Haus unter ihren nackten Füßen leise ächzte.
Wegen des WC-Kabäuschens, das außerhalb des Hauses stand und in dessen verwitterten Holztür ein kleines Herz ausgeschnitten war, war sie es seit Kindsbeinen gewohnt im Dunkeln durch den alten Hof zu geistern. Unten in der Küche, in der der alte gusseiserne Herd stand, nahm Rosa die Petroleumlampe vom Tisch und zündete sie mit einem Streichholz an, als sie ein Geräusch von außerhalb aufhorchen ließ. Es hörte sich an, als ginge jemand ums Haus herum und ziehe dabei einen Stock an der Fassade entlang.
Ihre von Sommersprossen gesprenkelte Nase und Wangen lagen im Schattenlichtspiel der Laterne, genauso wie ihre angespannten Gesichtszüge und ihre grünblauen Augen, die im Schein glänzten, wie im Fieber.
Sie hatte sich nicht geirrt, wieder ertönte das Geräusch.
Schnell drehte sie am Rädchen, das den Docht in der Laterne zurückzog, die Flamme erstarb. In der Dunkelheit nahm Rosa erst nach Sekunden die sich heller abhebenden Fenster genauer wahr.
Angestrengt horchte sie in die Stille.
Da war es wieder, dieses Geräusch.
Es kam von der hinteren Hausseite, von dort, wo Barkos Hundehütte stand. Rosa schlich vorsichtig ans Fenster auf der gegenüberliegenden Raumseite, als das Geräusch ihr erneut den Atem stocken ließ. Es kam diesmal aus direkter Nähe, von neben dem Fenster, an dem sie stand! Sie wandte sich schnell ab, drückte sich mit dem Rücken an die kalte Wand.
Angst kroch in ihre Glieder. Türen und Fenster hatte sie bis auf das in ihrer Kammer verschlossen, bevor sie sich ins Bett gelegt hatte. Das zumindest glaubte sie, aber sie war so müde gewesen, dass sie sich nun nicht mehr so sicher war.
Sie schlich auf Zehenspitzen die knarzende Treppe in den zweiten Stock hoch und starrte auf der anderen Seite hinaus, dahin wo auch der Stall für die drei Kühe stand, in dem auch die Schweine und die Ziegen ihren Platz fanden, die nun allesamt zur Sömmerung auf dem Altsäss waren.
Eine gespenstige Ruhe und Regungslosigkeit lagen über allem. Nicht ein Blättchen im großen Nussbaum vor dem Hof wollte sich regen. Rosa dachte angespannt nach, drehte sich bereits vom Fenster weg, als sie einen Schatten im Blickwinkel wahrnahm; eine dunkle Gestalt verschwand soeben direkt unter ihr ums Hauseck Richtung Haustür!
Ihr war sofort bewusst; Barko musste etwas zugestoßen sein, sonst würde draußen sein Bellen die Nacht erschüttern – Böses war somit im Anzug!
Ihre gesamten Bewegungen wurden für einen Moment steif, als wäre ihr Leib eiskalt geworden, während gleichzeitig heiß die Panik in sie fuhr. Wie in einem Albtraum, in dem sie vergeblich wegzurennen versucht, blieb sie wie angewurzelt stehen, obwohl alles in ihr schrie: »Lauf weg, so schnell du kannst, renn um dein Leben!« Doch die Ranken des Bösen umschlangen sie bereits.
»Rosa!«, flüsterte sie sich selbst zu. »Reiß dich zusammen. Hast du verstanden? Reiß – dich – zusammen!«
Sie nahm einige tiefe Atemzüge, die Starre löste sich, dann schlich sie zurück hinunter ins Erdgeschoss. In der Küche öffnete sie so leise wie möglich das alte Küchenfenster, kletterte hinaus und fand sich in der Erde des Kräuterbeets wieder. Sie fand es erstaunlich, dass sie trotz alledem die weiche und warme Erde wahrnahm, die ihre nackten Füße umschlossen. Sie war nicht kopflos aus dem Fenster geklettert, sie hatte einen Plan: Sie musste es über die Weide, in den dunklen Wald schaffen, dann hätte sie eine Chance, denn dort war ja ihr zweites Zuhause. Aber im Haus, da wäre sie jedem ausgeliefert gewesen.
Vorsichtig bewegte Rosa sich deshalb in Richtung der Obstbäume, die den Hof umsäumten, als sie plötzlich Barko am Boden erblickte – ein Spaten lag neben seinem eingeschlagenen Schädel!
In diesem Moment vernahm sie hinter sich ein Geräusch. Sie vermochte einen Schrei nicht gänzlich zu unterdrücken, riss ihren Kopf zurück und sah eine dunkle Gestalt auf sie zulaufen.
Der lähmende Schrecken formierte sich vom Überlebenswillen gesteuert zu Kraft und Schnelligkeit. Wie ein Wiesel rannte Rosa los, verfolgt von dem Angreifer.
Sie flüchtete ans Ende des Kräutergartens, hastete am Zwetschgenbaum und dem WC-Kabäuschen vorbei hinaus in die ruhende Weide. Ein weiterer angstvoller Blick nach hinten sagte ihr, dass es, wenn der Verfolger sie erreichte, für sie enden würde – für immer!
Sie hörte sich auf ihrer Flucht wiederholt kurz angstvoll aufschreien, als käme es von einer anderen Frau, während sie auf das schwarze Band aus Bäumen zu rannte, um davon verschluckt zu werden. Doch der Kerl hinter ihr war unglaublich schnell, holte Meter für Meter auf, während ihre Augen sich am Waldrand festzuhalten schienen. Endlos lange 40 Meter war sie davon noch entfernt, als sie das seltsame Keuchen der Gestalt hinter ihr beinahe im Nacken zu spüren glaubte.
Dann hechtete der Angreifer nach ihr, seine Hand erwischte ihren Rock, krallte sich daran fest, als wollte er ihr damit die Haut vom Leibe ziehen. Rosa ging mit einem Aufschrei zu Boden, strampelte sich mit kräftigen Fußtritten rasch wieder frei, traf dabei den Mann mit ihrem rechten Fuß ins Gesicht und flüchtete weiter, während sich die Gestalt hinter ihr aufrappelte, um ihr weiter zu folgen.
Endlich erreichte Rosa den Wald, in dem sie jeden Baumstamm kannte, doch in der Dunkelheit war das alles nicht so einfach. Die Stauden am Waldrand zerkratzten ihr Gesicht und Arme. Das trockene Unterholz im Wald verriet knackend jeden ihrer Schritte, während sie gezielt ein Versteck aufsuchte; den umgestürzten großen Baum, mit dessen mächtigen Wurzelballen, um den seit Jahren üppig Moos wuchs.
Die Angst fraß sich wie Säure in ihre Knochen, während sie krampfhaft kauernd ihren keuchenden Atem zu bändigen suchte und dabei die rastlosen Schritte der Gestalt ganz in der Nähe hörte.
Rosa traute sich nicht, sich zu bewegen; ein noch so leises Knacken in dieser stillen Nacht würde dem Mann sogleich ihr Versteck verraten. Sie kämpfte mit ihrem Atmen und darum, den unbändigen Fluchtreflex im Zaum zu halten. Der Verfolger kam währenddessen immer näher auf ihr Versteck zu. Dann hörte sie ihn plötzlich nicht mehr. Vorsichtig linste sie in seine Richtung. Er stand regungslos zwischen den Bäumen, die einseitig vom Mondlicht versilbert wurden. Ihr schien es, als starre der Verfolger aus 20 Meter Entfernung in ihre Richtung, als wäre er ein Bluthund, der sie von Weitem bereits gewittert hatte. In diesem Moment bewegte der Mann sich zwei Schritte nach rechts und das Mondlicht fiel auf seine rechte Gesichtshälfte. Als Rosa das sah, umfasste sie mit beiden Händen ihren weit aufgerissenen Mund, denn das was sie schemenhaft erblickte, das war kein Mensch, das war eine Ungestalt der Hölle; eine verzerrte Fratze!
Rosa starrte weiter gebannt aus ihrem Versteck auf die Gestalt, die sich, inmitten der Bäume und vom Zauber des Mondlichtes übergossen, nicht mehr rührte, als hätten sie beide begriffen, was nun geschehen würde.
Dann, die Zeit hatte ihre Berechenbarkeit verloren, hob die Gestalt ihren Kopf, als würde sie den Himmel anstarren, um dort das Zeichen zu erwarten, es endlich tun zu dürfen. Rosa erinnerte dies an ihren Hofhund Barko, der das tat, wenn er Witterung aufgenommen hatte.
Nach einem endlosen Moment des Bangens schritt die Gestalt bedächtig direkt auf sie zu, als würde der Teufel selbst sie zu ihr geleiten! Unsicher, ob die Kreatur sie tatsächlich entdeckt hatte, kauerte sie weiter auf dem Boden. Als er nur wenige Schritte von ihr entfernt war, hörte Rosa ein höhnisches Lachen, ein seltsames Lachen, das sich in Schüben in den Wald ergoss. Die Gestalt warf ihren schweren Grind in den Nacken, ehe sie wieder nach vorn blickte und abrupt verstummte. Im fahlen Mondlicht sah Rosa mit Schaudern nun schemenhaft sein verunstaltetes Gesicht mit der seltsamen Nase und nur einem Auge. Das musste eine Maske sein! Schlagartig erinnerte sie sich … aber das war doch unmöglich!
Langsam richtete die Gestalt den Blick ihres einzigen Auges auf Rosa und war mit drei blitzschnellen Sätzen bei ihr.
Rosa wehrte sich mit dem Mut der Verzweiflung mit Händen und Füßen, nachdem sie auf den Rücken geworfen wurde, doch der Angreifer war viel zu stark. Dessen schweren Beine drückten auf ihre ausgebreiteten Arme, sodass sie nur noch verzweifelt mit den Beinen strampeln konnte. Seine Hände, die sich lederartig anfühlten, umschlossen ihren Hals, drückten ihn zu, so fest, dass sie fühlte, wie ihre Luftröhre beinahe zerquetscht wurde. Von einer nahenden Ohnmacht umnebelt, war sie einen Moment lang wie gelähmt. Ein Lichtschein blendete auf, erhellte die Maske verstörend hell. Dann senkte die Gestalt ihr Gesicht ganz nah zu ihrem und flüsterte ihr ins Ohr:
»Du sollst jetzt mein wahres Gesicht erkennen, denn es wird das Letzte sein in dieser Welt.« Dann zog die Gestalt die Maske langsam hoch!
Wie die schwarze Flut einer für Rosa unverständlichen Wahrheit flossen diese Worte in sie, während ihre Sinne zunehmend schwanden und sie fassungslos in das vom Schein der Lampe erhellte Gesicht über ihr starrte, das ihr den Tod bringen würde.