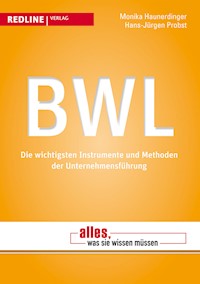
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Alles, was Sie wissen müssen
- Sprache: Deutsch
Das Ziel ist es, mit wenigen, aber den richtigen Instrumenten das Unternehmen zum Erfolg zu führen! Doch welche Instrumente funktionieren wirklich in der Praxis? Dieser Ratgeber präsentiert die betriebswirtschaftlichen "Werkzeuge", die sich in der Praxis bewährt haben. Systematisch beschreiben die Autoren zuverlässige Instrumente und Methoden der Unternehmensführung für die entscheidenden Bereiche und Funktionen in einem Unternehmen wie Management, Personalführung, Vertrieb, Rechnungswesen und andere. - Die wichtigsten Strategien der BWL - Gap-, SWOT- und Break-even-Analyse - Deckungsbeitragsrechnung und Rechnungslegung - Benchmarking, Erfolgsrechnung und vieles mehr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Monika Haunerdinger | Hans-Jürgen Probst
BWL
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2012
© 2012 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die vorherigen Auflagen erschienen im Redline Verlag unter dem Titel BWL leicht gemacht.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Satz: M. Zech, Landsberg am Lech
Druck: Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-86881-359-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-303-8
ISBN E-Book (ePub) 978-3-86414-304-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Was Ihnen dieses Buch bietet
1. Bereich Unternehmensführung/Management
1.1 Visionen, Strategien und Ziele
• Finden Sie Ihren Strategietyp
• Gap-Analyse: Erkennen Sie Ihre strategischen Lücken
• Formulieren Sie ein verständliches Leitbild
• Was sind Unternehmensziele?
1.2 Planungs- und Entscheidungsmethoden
• Verknüpfung von strategischen und operativen Sichtweisen
• Zero-Base-Ansatz: Fangen Sie bei Null an
• SWOT-Analyse: Stärken erkennen, Schwächen beheben
• Szenariotechnik: Was wäre, wenn …?
1.3 Managementtechniken
• Management-by-…-Konzepte: Delegieren oder Ziele setzen?
• Balanced Scorecard: Das Unternehmen mit Kennzahlen steuern
• Benchmarking: Wie machen es andere?
• Risikomanagement: Eisberge sicher umschiffen
• Wertorientierte Unternehmensführung
1.4 Organisation
• Profitcenter-Organisation: Mehr Transparenz im Unternehmen
• Wie Sie Ihre internen Prozesse optimieren
1.5 Projektmanagement
• Projektablauf
• Projektorganisation
• Projektcontrolling: Wann ist ein Projekt erfolgreich?
• 10 Gebote für ein erfolgreiches Projektmanagement
2. Bereich Leistungserstellung
2.1 Beschaffung/Lagerhaltung
• Auch im Einkauf liegt der Gewinn
• Lagern: Nur so viel wie wirklich notwendig
• Fremdvergabe: Was können Externe besser oder billiger?
2.2 Fertigung/Produktion/Dienstleistung
• Produktionsplanung und -steuerung: Effizienz bei niedrigen Kosten
• Qualitätsmanagement: Mehr als Endkontrolle
• Forschung und Entwicklung: Die Zukunft steuern
3. Bereich Finanzierung/Investition
3.1 Finanzierung
• Klassische Außenfinanzierung: Geld von „draußen“
• Die „kreative“ Finanzierung: Was ist neu und sinnvoll?
• Klassische Innenfinanzierung: Geld „aus eigener Kraft“
• Finanzierungsregeln: Die optimale Kapitalstruktur finden
• Die wichtigsten Finanzkennzahlen: Vom Cashflow über die Liquidität bis zum ROI
• Finanzplanung: Die finanzielle Zukunft sichern
• Die 10 häufigsten Fehler bei der Finanzierung
3.2 Investitionen
• Was ist überhaupt eine Investition?
• Welche Basisdaten wichtig sind: Nicht allein die Investitionshöhe ist entscheidend
• Investitionsrechnungen: Mal einfachst rechnen, mal ein wenig Finanzmathematik anwenden
4. Bereich Marketing/Vertrieb
4.1 Marktforschung
• Einflussgrößen auf die Absatzplanung erkennen
• Externe und interne Informationsquellen nutzen
4.2 Marketingstrategien
• Produkt-Markt-Kombinationen: Wie Sie die optimale Kombination finden
• Zielgruppen finden: Marktsegmentierung
• Marktstimulierungsstrategien: Kostenführer oder Qualitätsführer?
• Marktgebietsstrategien: Auf dem Weg zum Global Player?
4.3 Marketing-Mix
• Produktpolitik: Welche Produkte, Leistungen sind Ihre „Stars“?
• Preispolitik: Die Preis-Absatz-Funktion kennen und nutzen
• Kommunikationspolitik: Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit (PR)
• Distributionspolitik: Welcher Weg führt zum Kunden?
4.4 Marketingkennzahlen
• Marktkennzahlen
• Kundenkennzahlen
4.5 Neue Marketingansätze
• Lohnt sich ein Customer Relationship Management (CRM)?
• „One Face to the Customer“: Neue Wege der Kundenbetreuung
• Cross Selling
5. Bereich Personal
5.1 Personalplanung
• Wie Sie Personalbedarfsrechnungen durchführen
• Wie Sie mit Anforderungsprofilen die passenden Mitarbeiter finden
• Personalkosten: Nebenkosten nicht vergessen
5.2 Personalentwicklung
• Beurteilungsgespräche: Feedback und Zielvorgaben
• Personalportfolio: Identifizieren Sie die Leistungsträger des Unternehmens
5.3 Personalführung
• Führungsstile: Für jedes Unternehmen den optimalen finden
• Motivationstechniken: Geld und Anerkennung
• Transparenz durch Personalkennzahlen
• Was ist interessant an der „Work-Life-Balance“ und am Wissensmanagement?
6. Bereich Rechnungswesen/Controlling
6.1 Externes Rechnungswesen
• Grundlagen und ein „Crashkurs“ in Buchführung
• Bilanzanalyse: Was sagt uns die Bilanz über das Unternehmen?
• Neue Ergebnisbegriffe: Was sagt uns ein EBIT?
• Konzernrechnungslegung: Wenn Abschlüsse zusammengefasst werden
• Die Internationale Rechnungslegung ist im Kommen!
6.2 Internes Rechnungswesen/Controlling
• Die Kostenrechnung schafft Transparenz im Unternehmen
• Kalkulationen: Was kosten Ihre Produkte?
• Erfolgsrechnungen: Womit verdienen (oder verlieren) Sie Geld?
• Kunden- und Managementerfolgsrechnung: Einer muss verantwortlich sein
• Break-even-Analyse: Wo liegt die Gewinnschwelle bei Ihren Produkten?
• Planung und Plankostenrechnung: Die Zukunft rechnen
• Moderne Kostenrechnungsmethoden: Das Ziel im Auge haben und Prozesse optimieren
• Controlling: Im Zweifelsfall eine „Korrekturzündung“ veranlassen
7. Über das rein Fachliche hinaus
7.1 Präsentationstechniken: Wie man die Dinge darstellt
• Präsentationsmedien
• Präsentationsablauf
7.2 Kommunikationstechniken: Wie man die Dinge sagt
• Sender-Empfänger-Modell
• Feedbackregeln
• Killerphrasen
7.3 Bewährte Arbeitsmethoden: Wie man die Dinge anpackt
• Kreativitätstechniken
• Networking
Weiterführende Literatur/Linktipps
Stichwortverzeichnis
Vorwort: Was Ihnen dieses Buch bietet
Dieses Buch ist aus der Praxis entstanden und beantwortet die oft gestellte Frage: Was wird im betriebswirtschaftlichen Tagesgeschäft wirklich gebraucht? Was sind die sogenannten Basics, was muss man wissen? Denn betriebswirtschaftliche Inhalte werden vermeintlich immer komplizierter, werden teilweise nur noch von wenigen Spezialisten im Unternehmen verstanden. Und viele sogenannte moderne Instrumente sind gar teure Marketinggags der Beraterbranche, die niemand braucht.
So geht es hier um praxisbewährte BWL-Tools, die quasi den Werkzeugkasten für die Unternehmenssteuerung darstellen. Damit ist es ein Buch auch für diejenigen, denen die klassischen BWL-Bücher zu theoretisch, zu dick und zu trocken sind, und die schnell anwendungsorientierte Inhalte suchen. Wer den jeweiligen state-of-the-art kennen will, kann über moderne Instrumente wie zum Beispiel die Balanced Scorecard oder Stichwörter wie Work-Life-Balance nachlesen. Auf rund 300 Seiten wird alles Wesentliche behandelt, was man heutzutage „im Job“ über Betriebswirtschaftslehre wissen muss.
Für das Buch sind keine Vorkenntnisse notwendig, steigen Sie sofort in die BWL ein!
Wir möchten darauf hinweisen, dass aus Gründen der guten Lesbarkeit auf die Nennung jeweils beider Geschlechterformen verzichtet wurde. Selbstverständlich sind auch immer Mitarbeiterinnen, Geschäftsführerinnen und so weiter gemeint.
Verlag und Autoren wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
1. Bereich Unternehmensführung/Management
Management kann als Institution gesehen werden: der Manager, der Geschäftsführer, der Vorstand und so weiter bis hinunter zum Beispiel zur Bereichsleiterebene; das sind die leitenden Mitarbeiter im Unternehmen. Um die unterschiedlichen Hierarchieebenen im Unternehmen zu kennzeichnen verwendet man auch die Begriffe:
• Topmanagement (Unternehmensleitung, Geschäftsführung, Vorstand)
• Middle(Mittleres)management (z. B. Niederlassungsleiter oder Werksleiter)
• Lower(Unteres)management (z. B. Bereichsleiter, Meister, Abteilungsleiter).
Oder Management wird als Prozess gesehen und umfasst dann alle zur Steuerung des Unternehmens notwendigen Aufgaben: Planung, Organisation, vor allem aber die Führung (der Mitarbeiter).
Die Betriebswirtschaftslehre (BWL) bietet vielfältige Konzepte zur Unternehmensführung, Managementtechniken, traditionelle Instrumente wie auch neuere Ansätze um den Prozess der Unternehmensführung zu unterstützen. Was sich hierbei in der Praxis bewährt hat und zum Basic geworden ist, wird in den folgenden Kapiteln vorgestellt.
1.1 Visionen, Strategien und Ziele
Angenommen, Sie streben eine leitende Stellung in einem Unternehmen an (Vision), dann überlegen Sie sich die beste Strategie hierzu, beispielsweise durch eine zusätzliche Ausbildung zum Master of Business Administration (MBA). Konkret setzen Sie sich dann noch ein Ziel: „In spätestens fünf Jahren möchte ich eine Position im Lowermanagement, zum Beispiel als Bereichsleiter, innehaben.“
In einem Unternehmen läuft dieser Prozess ganz ähnlich ab. Ausgehend von der Unternehmensvision versucht das Management über geeignete Strategien konkrete Ziele zu erreichen.
Von der Unternehmensvision bis hin zum betrieblichen Leistungsprozess
In amerikanisch geprägten Unternehmen spricht man auch von der „mission“, die noch über der Unternehmensvision steht. Diesen englischen Begriff kann man im Deutschen übersetzen mit „Sendung, Auftrag, Berufung“. Festgehalten wird diese in dem sogenannten „mission statement“, einer Art Grundsatzpapier zum besonderen Auftrag des Unternehmens. In der deutschen Unternehmenskultur kommt dieser Begriff nicht gut an, wahrscheinlich weil er an das deutsche Wort „Mission“ erinnert, das eher im religiösen Zusammenhang benutzt wird und im Rahmen der Unternehmensführung unpassend wirkt.
Finden Sie Ihren Strategietyp
Am Anfang jeder unternehmerischen Tätigkeit steht die Unternehmensvision und um diese Wirklichkeit werden zu lassen, benötigt das Unternehmen eine geeignete Strategie. Jedes Unternehmen muss für sich einen Strategietyp herausarbeiten, was letztlich bedeutet, seine Kernkompetenz zu finden: Was können wir am besten beziehungsweise wo sehen wir die größten Chancen erfolgreich zu sein? Liegt die Kernkompetenz des Unternehmens in Produktinnovationen, günstigen Preisen oder besonders guter Qualität?
In der Praxis unterscheidet man im Wesentlichen vier Strategietypen:
• Der Innovator: Dieser Unternehmenstyp setzt strategisch auf neue Produkte und/oder neue Märkte. Forschung und Entwicklung spielen eine große Rolle. Durch die hohen Kosten für Forschung, neue technische Entwicklungen oder Markterschließungskosten sind die Preise relativ hoch. Beispiele: Innovative Telekommunikationsprodukte, innovative Produkte der Unterhaltungsindustrie, neue Medikamente der Pharmaindustrie.
• Der Me-too-Anbieter: Hier wird die Strategie wesentlich durch Nachahmung anderer erfolgreicher Produkte bestimmt. Diese Unternehmen versuchen, den Innovator zu imitieren und ähnliche Produkte in hohen Stückzahlen zu günstigeren Preisen als der Innovator anzubieten. Beispiel: Imitate bekannter Markenprodukte.
• Der Kostenführer: Der Kostenführer versucht, sich über günstigste Preise am Markt zu positionieren. Der Kunde soll überzeugt sein, bei diesem Unternehmen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Diese günstigen Preise werden durch Massenproduktion oder große Kontingente erreicht. Beispiele: Massenspielwaren, Pauschalreisen.
• Der Nischenanbieter: Hier werden Märkte bedient, die für andere Anbieter uninteressant sind. Die Stärke dieser Anbieter liegt in der Individualität, dem Eingehen auf (ausgefallene) Kundenwünsche. Beispiele: Spezialanfertigungen bei Segelyachten oder Automobilen, Anbieter von Spezialreisen.
Mischformen dieser Strategietypen sind eher selten. Allerdings kann ein Innovator durch Ausweitung seiner Produktion und Verteilung seiner Entwicklungskosten auf höhere Stückzahlen auch zu einem Kostenführer werden. Oder der Nischenanbieter erschließt sich ein breiteres Marktpotenzial und entwickelt sich so zum Kostenführer.
Kriterien zur Ermittlung des Strategietyps eines Unternehmens
Tipp: Strategietyp nicht (oft) ändern!
Ein Unternehmen wirkt unglaubwürdig, wenn es seinen Strategietyp ändert. War das Unternehmen etwa gestern noch der preisgünstigste Anbieter für Outdoorbekleidung (Kostenführer), so wird sich das Unternehmen schwer tun, eine neue „teure“ Designer-Outdoorbekleidungsmarke auf dem Markt zu platzieren (Nischenanbieter). Die Kunden erwarten günstige Preise und akzeptieren keinen „Designeraufpreis“. Der Kundenkreis, der höhere Preise bezahlen würde, möchte wiederum nicht mit dieser „Billigmarke“ gesehen werden. Man kann den Strategietyp ändern, zum Beispiel durch Änderung des Produktnamens, aber dies sollte vorsichtig und nicht allzu oft erfolgen.
Gap-Analyse: Erkennen Sie Ihre strategischen Lücken
Gap-Analyse
Diese Darstellung der Gap-Analyse zeigt den Unterschied zwischen dem strategischen Ziel, hier dem Erreichen eines bestimmten Marktanteils, und seiner aktuellen Prognose.
Beispiel: Das strategische Ziel eines Unternehmens der Textilindustrie ist die Erhöhung des Marktanteils um 20 Prozent. Die aktuelle Prognose spricht nicht dafür, dass dieses Ziel erreicht wird. Die Gap-Analyse ist Anlass dafür, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um doch noch das Ziel zu erreichen: Zusätzliche Werbemaßnahmen in Zeitschriften und eine Verstärkung des Vertriebs sollen den gewünschten zusätzlichen Marktanteil doch noch erarbeiten. Kommt die Unternehmensführung aber zu der Einsicht, dass das strategische Ziel selbst mit größten Anstrengungen unerreichbar bleibt, muss letztendlich das Ziel aufgegeben werden und das Unternehmen muss sich beispielsweise mit einer Marktanteilssteigerung von 10 Prozent begnügen.
Strategische Ziele sind häufig recht ehrgeizig aufgestellt und so ergeben sich in der Unternehmenspraxis oft derartige Lücken in der Zielerreichung. Es ist wichtig, sich unternehmensintern dieser strategischen Lücken bewusst zu sein, damit nicht zum Beispiel die Produktion ihre Kapazitäten immer noch auf die erhoffte Absatzsteigerung ausrichtet, die aber nie erreicht werden wird.
Tipp: Von Zeit zu Zeit sollte man eine Gap-Analyse durchführen und überprüfen, ob das Unternehmen nicht dabei ist, sich in seinen strategischen Zielen zu verzetteln.
Formulieren Sie ein verständliches Leitbild
Manche vermuten vielleicht, dass die Beschäftigung mit Leitbildern nur etwas für große Unternehmen ist. Ein Leitbild kann aber auch der Gemüseladen an der Ecke haben: „Ich versorge meine Kunden nur mit hochwertigen Waren.“ Ein Leitbild ist eine schriftlich fixierte Darlegung, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln soll. Es wird ergänzt durch Unternehmenswerte oder, wie man auch sagt, eine Unternehmensphilosophie. Ferner können durch ein Leitbild „Spielregeln“ im Unternehmen festgelegt werden, wie zum Beispiel „Wir lösen Konflikte im gegenseitigen Einvernehmen“.
Ziel ist die Orientierung aller am Unternehmen Beteiligten am Leitbild. Gleichzeitig soll das Leitbild intern motivieren. Nach außen wird es gern als Marketinginstrument benutzt. Es legt fest, wie man in der Öffentlichkeit gesehen werden will.
Zwei Praxisbeispiele für Leitbilder:
Leitbild eines Tourismusunternehmens: Wir möchten, dass unsere Kunden zufrieden und begeistert von ihren Urlaubsreisen zurück nach Hause kommen. Dabei setzen wir uns für einen sozial- und umweltverträglichen Tourismus ein und respektieren die kulturelle Vielfalt der Gastgeberländer. Wir fördern unsere Mitarbeiter und sehen diese als Garant für unseren Unternehmenserfolg.
Leitbild eines Automobilzulieferers: Durch ständige Innovation bleiben wir Partner der Automobilbranche. Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit prägen unsere Produkte. Wir bekennen uns zu einem fairen Umgang mit Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern. Die Erzielung einer angemessenen Rendite darf nicht zu Lasten unserer Umwelt geschehen. Wir sehen uns als Unternehmen fest in der Region verankert, wollen aber Chancen nutzen, die sich dem Unternehmen international bieten.
Die Schaffung von Leitbildern beziehungsweise die Leitbilddiskussion geht mittlerweile weit über den wirtschaftlichen Bereich hinaus. Auch Kommunen, Hochschulen und andere schaffen sich Leitbilder. Allerdings darf es nicht bei schönen Worten bleiben, ein Leitbild muss gelebt werden. Wenn etwa im Leitbild die Umweltfreundlichkeit betont wird, muss sich das Unternehmen auch entsprechend verhalten und wenn, wie es oft so schön in Leitbildern heißt, „der Mitarbeiter das wichtigste Kapital ist“, dann darf im Unternehmen keine „hire-and-fire-Politik“ vorherrschen.
Tipp: Das Leitbild muss auch der Wirklichkeit entsprechen, sonst wird das Unternehmen unglaubwürdig!
Wie wird ein Leitbild erstellt? In der Praxis hat es sich bewährt, quer durch alle Abteilungen eine Projektgruppe zu bilden, die ein Leitbild erarbeitet. Jeder darf einbringen, welche Werte und Grundsätze im Unternehmen in das Leitbild eingehen sollen. Anschließend wird dieser erste Vorschlag für ein Leitbild von jedem Projektmitglied in seiner Abteilung vorgestellt und Änderungswünsche aufgenommen. Dann trifft sich die Projektgruppe erneut und fasst alle Anregungen zusammen. Ergebnis ist dann ein Leitbild, das von allen Mitarbeitern getragen und gelebt wird.
Was sind Unternehmensziele?
Was ist nun ein Unternehmensziel? Als Erstes wird wohl den meisten der Begriff „Gewinn“ einfallen. Der Kapitalgeber eines Unternehmens möchte eine angemessene Verzinsung seines eingesetzten Kapitals erreichen, sonst könnte er sein Geld auch zur Bank bringen. Gewinnerzielung kann ein Unternehmensziel sein, aber nicht bei allen Unternehmen. Es gibt auch nichtgewinnorientierte Unternehmen, diese bezeichnet man auch als Non-Profit-Organisationen (NPO). Dies sind einerseits öffentliche Verwaltungsbetriebe, aber auch private Organisationen wie etwa Vereine, Verbände, Stiftungen und Wohlfahrtsorganisationen. Diese NPOs haben andere Unternehmensziele, beispielsweise die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben (Müllentsorgung, Straßenreinigung) oder ökologische und humanitäre Ziele.
Der Gewinn ist als zentrales Unternehmensziel problematisch. Denn: Ein Gewinn kann mit bilanzpolitischen Mitteln gesteuert werden. Er kann über Jahre niedrig gehalten werden oder bei Bedarf auch einmal in einer Höhe gezeigt werden, die über die tatsächliche Ertragskraft des Unternehmens hinausgeht. So etwas ist beispielsweise über Rückstellungen oder Bewertungsspielräume machbar. Ferner betrachtet ein Gewinn nicht die Rentabilität, also das Verhältnis von Gewinn zum eingesetzten Kapital, sondern ist eine absolute Größe. Einfach gesagt: Ein Gewinn von 100.000 Euro kann „viel oder wenig sein“. Setze ich 100.000 Euro Kapital ein, ist der Gewinn hoch, setze ich 10.000.000 Euro Kapital ein, ist ein Gewinn von 100.000 Euro eine Katastrophe, das Geld hätte sich auf einem Festgeldkonto besser verzinst.
Selbsterhaltungsziele des Unternehmens: Als oberstes Unternehmensziel kann die Selbsterhaltung genannt werden. Jedes Unternehmen ist in erster Linie daran interessiert am Markt zu bestehen. Gewinnerzielung beziehungsweise Rentabilität sind ein Teil davon. Um die Existenz eines Unternehmens zu sichern, müssen im Wesentlichen drei Unternehmensziele erreicht werden:
• Liquidität: Ist ein Unternehmen nicht liquide und kann daher seinen laufenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommen (Gehaltszahlungen, Lieferantenrechnungen etc.), so muss Insolvenz angemeldet werden.
• Rentabilität: Ein Unternehmen muss rentabel arbeiten, das heißt, die Erträge müssen mindestens die Kosten des Unternehmens decken, sonst wird es auf lange Sicht auch illiquide.
• Wachstum: In einer auf Wachstum ausgerichteten Gesamtwirtschaft muss das einzelne Unternehmen zumindest in geringem Umfang mitwachsen, da es sonst Marktanteile verliert und vom Markt gedrängt wird.
Auf Grundlage dieser drei Existenzerhaltungsziele einer Unternehmung können die Unternehmensziele grob in drei Gruppen unterteilt werden:
• Finanzziele (z. B. Liquidität, Cashflow)
• Erfolgsziele (z. B. Gewinn, Rentabilität, Shareholder-Value)
• Leistungsziele (z. B. Marktanteile, Wachstum, Qualitätsziele).
Bei der Formulierung der Unternehmensziele sollten folgende Grundsätze beachten werden:
• Unternehmensziele sollten erreichbar sein. Die Zielvorgaben für die einzelnen Bereiche des Unternehmens sollen realistisch sein, ein bisschen Herausforderung und Ansporn darf aber dabei sein.
• Ein Unternehmensziel muss messbar (quantitativ oder qualitativ) sein. Ein bekannter Satz in diesem Zusammenhang lautet: „If you can’t measure it, you can’t manage it.“ „Was Du nicht messen kannst, kannst Du auch nicht managen“ oder „Was nicht messbar ist, ist nicht beherrschbar“. Unternehmensziele müssen messbar sein, damit die Zielerreichung konkret überprüft werden kann. Also nicht „Wir möchten zufriedene Kunden haben“, sondern „Wir möchten die Kundenzufriedenheit erhöhen. Hierzu wollen wir unseren Stammkundenanteil um 5 Prozent erhöhen und die Beschwerdequote um 25 Prozent senken“.
1.2 Planungs- und Entscheidungsmethoden
Ein gängiges Sprichwort heißt: „Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum.“ Wie in jedem Sprichwort steckt ein klein wenig Wahrheit darin. Die Wahrheit ist, dass man die einmal festgelegte Planung nie genau zu 100 Prozent erreichen wird. Mal liegt man darunter, mal schießt man über das Ziel hinaus. Aber es geht ja auch nicht um exakt 100 Prozent Zielerreichung. Bei der Unternehmensplanung für das nächste Geschäftsjahr etwa geht es darum, sich überhaupt Gedanken über die zukünftigen Entwicklungen zu machen. Ein Geschäftsführer sagte einmal: „Die Erkenntnisse, die während des Planungsprozesses gewonnen werden, sind für mich sogar wichtiger als die Ergebnisse der Planung selbst. Denn im Rahmen der Planung wird das ganze Unternehmen durchleuchtet und die möglichen zukünftigen Entwicklungen durchdacht. Dabei kommt eine Menge über derzeitige Missstände ans Licht, aber auch über die Potenziale, die wir zurzeit noch nicht voll ausgeschöpft haben.“
Die Planung orientiert sich an den Unternehmenszielen. Aber es gibt unterschiedliche Wege und Instrumente, mit denen die Ziele erreicht werden können. Alternativen werden hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit und möglicher Risiken bewertet, um schließlich die Entscheidungen zu treffen, die am ehesten die Unternehmensziele realisieren.
Verknüpfung von strategischen und operativen Sichtweisen
Ein weitverbreiteter Irrtum ist, „strategisch“ mit „langfristig“ und „operativ“ mit „kurzfristig“ zu verwechseln. Es mag oft in die gleiche Richtung gehen, aber strategisch und operativ bezeichnen nicht einen Zeitraum, sondern bestimmte Sichtweisen.
• Strategisch bedeutet, dass heute Maßnahmen ergriffen werden, die auch zukünftig die Existenzsicherung des Unternehmens ermöglichen. Man plant, welche Schritte morgen notwendig sind, damit auch übermorgen das Unternehmen erfolgreich sein wird. Strategisch bedeutet: Die richtigen Dinge tun.
Konkret: Was ist unsere Kernkompetenz? Was will der Markt, morgen, übermorgen? Haben wir die richtigen Produkte? Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Ist der Markt schnelllebig, so muss eventuell auch mal kurzfristig die Unternehmensstrategie geändert werden um am Markt zu bestehen.
• Operativ bedeutet dagegen: Die Dinge richtig tun. Abgeleitet aus der Strategie wird gefragt, was die nächsten Schritte sind. Die Strategie wird in „Maßnahmen übersetzt“, zum Beispiel in den Jahresplan. Operative Maßnahmen können durchaus auch langfristig sein.
Strategische und operative Sichtweisen
Das folgende Praxisbeispiel zeigt die strategische Planung eines Herstellers für Baumaterialien. Ein Strategiepaket wird geschnürt …
Die Inhalte des strategischen Paketes werden konkretisiert
Strategiepaket eines Herstellers für Baumaterialien
Zero-Base-Ansatz: Fangen Sie bei Null an
Beim Zero-Base-Ansatz geht man von der Überlegung aus, dass man ein Unternehmen beziehungsweise die betrieblichen Funktionen (Produktion, Vertrieb, Verwaltung etc.) auf der grünen Wiese neu plant oder das Unternehmen neu errichtet. Die Frage ist, in welchem Ausmaß dann bestimmte Funktionen benötigt würden und wie hoch dann die Kosten des Unternehmens wären. Zero-Base heißt quasi „von Null her anfangen“. Ziel ist die Beantwortung der Fragen: Welche Kosten sind wirklich notwendig? Wie muss die Verwaltung oder der Vertrieb wirklich ausgestattet sein? Geht es auch mit weniger Mitarbeitern oder schlankeren internen Prozessen?
Oft werden doch Kosten wie folgt geplant: Man nimmt den letzten Istwert, schlägt einen Prozentsatz für beispielsweise die Inflation darauf, baut sich ein wenig Reserve ein – und schon hat man den neuen Planansatz. Und dann wundert man sich, dass man den Schlendrian der Vergangenheit fortschreibt und Kostensenkungen überhaupt nicht in Erwägung gezogen werden.
Genau hier setzt das Zero-Base-Denken ein: Wir fangen von vorne an und kümmern uns nicht darum, was in der Vergangenheit war.
Praxisbeispiel Instandhaltung: Bewusstes Ignorieren bestehender Strukturen
Ein gewachsener Betrieb hatte eine Instandhaltungsabteilung, die den Betrieb flächendeckend vom Auswechseln der Glühbirne bis hin zu größeren Umbauten versorgte. In der Abteilung gab es sechs Mitarbeiter. Im Rahmen der Planung rechnete man die Istkosten des laufenden Jahres zum Jahresende hoch, kalkulierte die Tariferhöhung auf die Personalkosten hinzu und ermittelte so die Plankosten des nächsten Jahres. Der Erfolg dieser Methode war, dass die Kosten der Instandhaltung regelmäßig stiegen.
Jetzt kam der Zero-Base-Gedanke ins Spiel: Das Unternehmen wurde gedanklich neu gegründet, es gab demzufolge noch gar keine Abteilung Instandhaltung. So wurde jetzt gefragt: Wie muss diese Abteilung dimensioniert sein? Kann nicht der Hausmeister die Glühbirnen auswechseln, gibt es für die seltenen größeren Reparaturen nicht Spezialfirmen? Geht somit nicht alles auch eine Nummer kleiner? Nach diesen Gedankengängen wurde ein Großteil der Instandhaltungsarbeiten fremd vergeben: Eine erhebliche Kosteneinsparung!
Eine weitere Methode ist das Zero-Base-Budgeting. Es verfolgt den Gedankengang des „Cut off point“. Nach der Jahresplanung wird gedanklich durchgespielt, dass nur ein bestimmter Prozentsatz an Kosten bewilligt wird. Beispiel: Die Planung sieht vor, dass 1.000.000 Euro Budget für eine bestimmte Abteilung zur Verfügung stehen (= 100 Prozent). Jetzt führt man das Gedankenspiel durch, dass die Abteilung mit 80 Prozent des Budgets (= 800.000 Euro) auskommen muss: Welche Reserven gibt es, wo kann gespart werden? Was ist mit 80 Prozent des Budgets noch möglich? Oder man verfolgt den Denkansatz: Auch wenn es schmerzt, auf was kann als Erstes verzichtet werden?
Tipp: Beobachten Sie die Konkurrenz, insbesondere neue Unternehmen auf dem Markt. Wie lösen die manche Funktionen? Welche Unternehmensstruktur haben diese Konkurrenzunternehmen? Neue Unternehmen mussten zwangsläufig mit dem Denken „auf der grünen Wiese“ anfangen und sind unbelastet von der Vergangenheit vorgegangen. Was kann man davon lernen und für das eigene Unternehmen übernehmen?
SWOT-Analyse: Stärken erkennen, Schwächen beheben
Die SWOT-Analyse ist ein beliebtes Instrument der strategischen Unternehmensplanung. Stärken und Schwächen des Unternehmens werden analysiert und die Chancen und Gefahren für das Unternehmen aufgezeigt.
S W O T steht für:
SWOT-Analyse
Im Rahmen der SWOT-Analyse werden die unternehmenseigenen Stärken und Schwächen untersucht. Darüber hinaus müssen zum Beispiel durch Studium der Fachliteratur oder der branchenspezifischen Literatur die Chancen und Gefahren der Branche eingeschätzt werden. Boomt etwa die Branche und kann das Unternehmen diese Chance nutzen? Oder stagnieren die Absatzzahlen und wie kann das Unternehmen dieser Gefahr entgegenwirken?
Es geht darum, einen eventuellen Handlungsbedarf zu erkennen: die eigenen Stärken auszubauen, Schwächen zu bekämpfen, die Chancen auf dem Markt zu nutzen und Gefahren für das Unternehmen rechtzeitig vorherzusehen und ihnen entgegenzuwirken.
Tipp: Die SWOT-Analyse ist vielseitig anwendbar, sowohl für das Unternehmen als Ganzes als auch für jeden einzelnen Unternehmensbereich.
Auch im privaten Bereich ist die SWOT-Analyse einsetzbar, etwa bei der Erstellung einer Bewerbung. Welche Stärken befähigen den Bewerber besonders für die ausgeschriebene Stelle, welche Schwächen müssen „ausgebügelt“ beziehungsweise wo muss das Know-how verbessert werden? Welche Chancen bietet die neue Stelle und welche möglichen Gefahren gibt es, etwa Beeinträchtigungen im privaten Bereich durch den Umzug in eine andere Stadt?
Erstellen Sie einmal für sich selbst ein SWOT-Profil!
Szenariotechnik: Was wäre, wenn …?
Bei der Szenariotechnik geht es um die spannende Frage „Was wäre, wenn …?“. Sich ein Szenario vorzustellen oder zu berechnen heißt, dass man sich Gedanken um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens macht. Was wäre, wenn …
• der wichtigste Kunde Insolvenz anmeldet?
• der Euro um 10 Prozent an Wert gegenüber dem Dollar verliert?
• das Unternehmen international expandieren würde?
• die nächste Tarifrunde eine Lohnsteigerung von 6 Prozent erbringt?
• ein neues Konkurrenzunternehmen 20 Prozent unserer Kunden abwirbt?
Dabei muss ein Unternehmen nicht immer nur die Extremszenarien wie „Welche Auswirkungen hat es, wenn der Umsatz um 30 Prozent sinkt?“ bedenken. Es geht auch darum, sich auszumalen, wie die Unternehmenssituation in drei oder fünf Jahren sein könnte. Ein Unternehmen sollte sich regelmäßig Gedanken um die Entwicklung von Zukunftsbildern, also Szenarien, machen. Wie werden sich die Märkte entwickeln, was werden die Kunden erwarten, welche Risiken könnten von politischen Entscheidungen (Streichung von Subventionen, Steuererhöhungen etc.) ausgehen? Je besser man zukünftige Entwicklungen schon einmal in Gedanken und vielleicht auch in harten Zahlen mit dem Kostenrechner oder dem Controller „durchgespielt“ hat, desto leichter fällt die Reaktion auf Veränderungen. Im besten Falle hat man sich auf die Änderung vorbereitet und rechtzeitig Maßnahmen ergriffen.
In der Praxis werden häufig zwei Extremszenarios erstellt:
• „Best-Case-Szenario“ (Was passiert im günstigsten Fall?) und
• „Worst-Case-Szenario“ (Was tritt im schlimmsten Fall ein?)
Die Zukunft des Unternehmens wird sich dann wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Extremszenarios abspielen. Noch genauer sind die Szenarios, wenn auch hinterfragt wird, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit des „best case“ oder aber des „worst case“ ist. Welche Maßnahmen sind aktuell notwendig, um den „best case“ zu erreichen?
Szenario-Trichter
1.3 Managementtechniken
Seit wann gibt es eigentlich Management? Schon die alten Sumerer erkannten die Notwendigkeit zu wirtschaftlichem Handeln. Das Sicherstellen der ausreichenden Lebensmittelversorgung für eine Gemeinschaft war und ist ein Urproblem der Menschheit. Die Geburtsstunde der Betriebswirtschaftslehre war der Beginn der Arbeitsteilung. Ab dem Zeitpunkt, an dem von einer Gemeinschaft nicht mehr alle Bedürfnisse ihrer Mitglieder gedeckt wurden und sich Spezialisierungen entwickelten (etwa Schuster, Metzger, Schneider) und diese im Laufe der Zeit zu Betrieben und Unternehmen heranwuchsen, war das Unternehmertum geboren und damit die BWL als Unternehmensführungslehre.
In der Antike war eine Hausgemeinschaft sowohl Betrieb als auch Haushalt im heutigen Sinne. Der Hausherr regierte wie ein Befehlshaber über Ehefrau, Kinder und Sklaven. So bezeichnet das altgriechische Wort „oikonomia“ das Wort wirtschaften und meint damit das „managen“ aller Angelegenheiten, die das Haus eines freien Bürgers betreffen.
Über eine vernünftige „Unternehmensführung“ gab es schon damals unterschiedliche Vorstellungen. Cato der Ältere (234 bis 149 v. Chr.) beispielsweise forderte eine strenge Führung der Sklaven durch Angst und Bestrafung. Varro hingegen (116 bis 27 v. Chr.), ein Zeitgenosse Julius Caesars, erkannte schon das Prinzip der Motivation bei der Sklavenhaltung. Er schlug Belohnungen für die Sklaven bei guten Leistungen vor, um deren Leistungsbereitschaft zu steigern. Im Übrigen befürwortete er den schonenden Gebrauch der Sklaven, da sie ja faktische Vermögensgegenstände seien. So empfahl er, bei der Arbeit in fiebrigen Sümpfen eher freie Arbeiter (zum Beispiel freigelassene Sklaven) anzuheuern und die eigenen Sklaven zu schonen.
Management-by-…-Konzepte: Delegieren oder Ziele setzen?
Wie würden Sie ein Unternehmen führen? Sind Sie eher der fürsorgliche Vorgesetzte, der den Mitarbeitern alles vorgibt oder würden Sie Ihren Mitarbeitern auch eigene Entscheidungen zutrauen? Orientieren Sie sich an den Management-by-Techniken, diese sind aus den Erfahrungen von Führungskräften entstanden und gelten als die „Klassiker“ unter den Managementtechniken. Sie sind verständlich und in der Praxis einfach zu handhaben. Die bekanntesten Management-by-Techniken sind:
Im Zusammenhang mit den Managementtechniken darf man auch nicht vergessen, dass Management keine „Einbahnstraße“ ist, das heißt, dass die Managementtechnik nicht nur vom Unternehmer, sondern auch vom Mitarbeiter abhängt. Einen Lehrling wird man kaum im Sinne des Management by Participation sofort zum „Mitunternehmer“ erklären. Hier ist sicher Management by Delegation eine Möglichkeit für den unerfahrenen Mitarbeiter, erste Erfahrungen mit Verantwortung im Unternehmen zu sammeln. Einen langjährigen Vertriebsprofi kann man andererseits je nach gegenseitigem Einverständnis immer mehr in Entscheidungen und unternehmerische Verantwortung einbinden.
Balanced Scorecard: Das Unternehmen mit Kennzahlen steuern
Eine der neueren Entwicklungen in der Unternehmensführung der letzten Jahre ist das Konzept der Balanced Scorecard (BSC). Entwickelt haben dieses Konzept die beiden US-Professoren Kaplan und Norton. Im Mittelpunkt dieses Denkansatzes steht die Vision und Strategie eines Unternehmens. Die Balanced Scorecard soll dabei helfen, diese Visionen und Unternehmensstrategien im täglichen Geschäft umzusetzen. Hierzu werden aus der Vision eines Unternehmens konkrete Strategien und Ziele abgeleitet, deren Erreichen mit konkreten Zielgrößen gemessen werden. Anschließend werden Maßnahmen definiert, die zur Erreichung dieser Unternehmensvision beitragen. Durch die Festlegung von Messgrößen ist es möglich, den Grad der Erreichung der strategischen Ziele eines Unternehmens konkret zu messen. Die Balanced Scorecard ist damit ein strategisches Steuerungssystem.
Balanced Scorecard
Das Spezielle an dem Balanced-Scorecard-Ansatz ist nicht nur dieses Umsetzen von Visionen und Strategien in konkrete Beurteilungsgrößen, sondern auch die Einbeziehung aller Unternehmensbereiche in diese Zielerreichung. Es geht darum, sich nicht nur auf die Finanzzahlen zu konzentrieren, sondern das Unternehmensgeschehen ganzheitlich zu betrachten. „Balanced“ heißt ausgeglichen, im Gleichgewicht, und „Scorecard“ ist eigentlich ein Begriff aus dem Sport, eine „Punktekarte“, auf der die Ergebnisse eines Sportlers aus verschiedenen Spielen oder verschiedenen Sportdisziplinen „gepunktet“, also bewertet, werden. „Balanced Scorecard“ könnte man frei übersetzen mit „in verschiedenen Gebieten gleichmäßig gut sein“.
Die vier Sichtweisen / Perspektiven der Balanced Scorecard sind:
• Finanzwirtschaftliche Perspektive: Dies ist eher die traditionelle Sichtweise, wie sie auch bisher schon im Vordergrund stand. Es geht um die Frage nach den Indikatoren wie beispielsweise Rentabilität, Cashflow oder Shareholder-Value, mit denen die Finanzkraft und Ertragskraft eines Unternehmens beurteilt werden kann. Dies sind die maßgeblichen Kriterien, nach denen die Anteilseigner das Unternehmen beurteilen.
• Kundenperspektive: Dies ist die Sichtweise, die bisher schwerpunktmäßig vom Marketing eines Unternehmens wahrgenommen wurde. Im Ansatz der Balanced Scorecard geht die Kundensicht in die Betrachtung mit ein. Um festzustellen, wie die Kunden das eigene Unternehmen sehen und wie sie die Produkte einschätzen, werden Indikatoren untersucht wie etwa Kundentreue, Stammkundenanteil, Kundenzufriedenheit und Reklamationshäufigkeit.
• Interne Prozessperspektive: Hier wird das Augenmerk auf die internen Prozesse gelegt. Wie effizient laufen die Entscheidungswege? Ist die Organisationsform noch zeitgemäß? Werden Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter gefördert? Wie ist die Vertriebsorganisation aufgebaut? Sind die Produktionsprozesse verbesserungsbedürftig? Ziel ist, die internen Prozesse, wo möglich, zu optimieren.
• Lern- und Entwicklungsperspektive: Diese Perspektive stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Werden die Mitarbeiter regelmäßig weitergebildet? Wird die Personalentwicklung gefördert? Wie hoch ist das Schulungsbudget durchschnittlich pro Mitarbeiter? Sind die Mitarbeiter in der Lage, sich Veränderungsprozessen gut anzupassen, wie etwa an neue Produktionsmethoden und neue technische Anforderungen? Wie unterstützt das Unternehmen die Flexibilität der Mitarbeiter ohne sie zu überfordern? Hintergrund ist die Annahme, dass ein Unternehmen sich besser an Änderungen im Geschäftsumfeld anpassen kann, wenn auch die Mitarbeiter ein hohes Maß an Flexibilität und Veränderungspotenzial mitbringen.
Die vier Perspektiven sind miteinander vernetzt. Wenn das Unternehmen ein gutes Image bei den Kunden hat und die Mitarbeiter zufrieden sind, sind wahrscheinlich auch die Prozesse gut organisiert und das Unternehmen hat gute Finanzergebnisse. Die Betrachtung aus diesen vier Blickwinkeln auf ein Unternehmen soll ein umfassendes Bild des Betriebsgeschehens ermöglichen. Interne wie externe Sichtweisen auf das Unternehmen sind in diese Betrachtung mit eingeschlossen. Wie sehen uns die eigenen Mitarbeiter, wie sehen uns die Inhaber und wie sehen uns die Kunden?
Einbeziehung qualitativer Faktoren





























