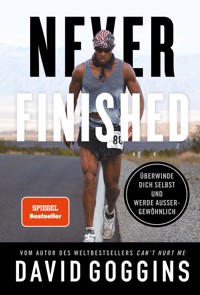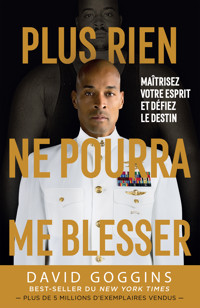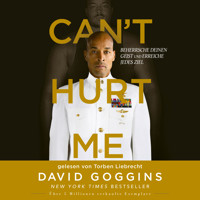
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Für David Goggins war die Kindheit ein Albtraum – Armut, Vorurteile und körperliche Misshandlung verfolgten ihn bis in seine Träume. Doch durch Selbstdisziplin, mentale Stärke und harte Arbeit verwandelte er sich vom depressiven, übergewichtigen Jugendlichen ohne Perspektive in eine Ikone der U.S. Army und einen der Top-Ausdauersportler der Welt. Er ist der Einzige, der je das Elitetraining sowohl zum Navy SEAL als auch U.S. Army Ranger und Air Force Tactical Air Controller bestand, außerdem stellte er zahlreiche Ausdauerrekorde auf. In »Can't Hurt Me« erzählt er seine wahrlich erstaunliche Lebensgeschichte und zeigt, dass die meisten von uns nicht einmal die Hälfte ihres Potenzials ausschöpfen. Goggins bezeichnet dies als 40-Prozent-Regel. Sein herausragendes Beispiel veranschaulicht hingegen, wie es jedem gelingen kann, das zu ändern und Schmerzgrenzen und Ängste zu überwinden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
DAVID GOGGINS
CAN’T HURT ME
Titelseite
DAVID GOGGINS
CAN’T HURT ME
BEHERRSCHE DEINEN GEIST UND ERREICHE JEDES ZIEL
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
16. Auflage 2025
© 2023 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 bei Lioncrest Publishing unter dem Titel Can’t Hurt Me. Copyright © 2018 Goggins Built Not Born, LLC. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Peter Peschke
Redaktion: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Erin Tyler
Umschlagabbildung: © by Loveless Photography
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2460-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2228-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter: www.m-vg.de
Für die unnachgiebige Stimme in meinem Kopf, die mir niemals erlauben wird aufzugeben.
Inhalt
Einleitung
1 Beinahe wäre ich als Zahl in einer Statistik geendet
2 Die Wahrheit tut weh
3 Die unmögliche Aufgabe
4 Seelen nehmen
5 Gepanzerter Geist
6 Es geht nicht um eine Trophäe
7 Die mächtigste aller Waffen
8 Talent ist keine Voraussetzung
9 Außergewöhnlicher unter Außergewöhnlichen
10 Die Kraft des Scheiterns
11 Was wäre, wenn?
Danksagung
Bildnachweis
ÜBer den Autor
WARNING ORDER
EINSATZZEIT: 24/7
EINSATZART: EINZELMISSION
Situation: Sie laufen Gefahr, ein derart bequemes und nachgiebiges Leben zu führen, dass Sie sterben könnten, ohne je Ihr wahres Potenzial erkannt zu haben.
Mission: Sprengen Sie die Fesseln Ihres Geistes. Schütteln Sie die Opfermentalität ein für alle Mal ab. Übernehmen Sie die Verantwortung für sämtliche Bereiche Ihres Lebens. Schaffen Sie für sich ein unzerstörbares Fundament.
Durchführung:
Lesen Sie dieses Buch von Anfang bis Ende. Verinnerlichen Sie die hier vorgestellten Techniken, stellen Sie sich allen zehn Challenges. Repeat. Wiederholung wird Ihren Verstand abhärten.
Wenn Sie Ihren Auftrag nach besten Kräften erledigen, wird es schmerzhaft werden. Bei dieser Mission geht es nicht darum, Ihr Wohlbefinden zu erhöhen. Bei dieser Mission geht es darum, besser zu werden und mehr in der Welt zu bewirken.
Hören Sie nicht auf, wenn Sie müde sind. Hören Sie auf, wenn Sie fertig sind.
Einstufung: Dies ist die Entstehungsgeschichte eines Helden. Der Held sind Sie.
Auf Befehl von: David Goggins
Unterschrift:
Rang und Diensteinheit: Chief, U.S. Navy SEALs, retired
Einleitung
Wissen Sie, wer sie wirklich sind und wozu sie imstande sind?
Ich bin sicher, dass Sie davon überzeugt sind, aber von einer Sache überzeugt zu sein bedeutet nicht, dass es die Wahrheit ist. Etwas nicht wahrhaben zu wollen ist vielmehr die Bestmögliche aller Komfortzonen.
Keine Sorge, Sie sind nicht der Einzige. In jeder Stadt, in jedem Land, überall auf der Welt wandern Millionen von Menschen durch die Straßen, wie Zombies, mit toten Augen, süchtig nach Wohlbefinden. Sie verschreiben sich einer Opfermentalität und kennen ihr wahres Potenzial nicht. Ich weiß das, weil ich ihnen ständig begegne, weil ich ständig von ihnen höre, und weil ich selbst einer von ihnen gewesen bin – so wie Sie.
Ich hatte auch eine verdammt gute Rechtfertigung dafür.
Das Leben hatte es nicht gut mit mir gemeint. Ich wurde schon kaputt geboren. Meine ganze Kindheit über wurde ich erniedrigt, in der Schule wurde ich gequält und man hat mich so oft Nigger genannt, dass ich es längst nicht mehr zählen kann.
Früher waren wir arm, lebten von staatlicher Unterstützung, in einer Sozialwohnung, und meine Depressionen erdrückten mich. Ich gehörte zum Bodensatz der Gesellschaft, meine Zukunftsaussichten waren verdammt düster.
Nur sehr wenige wissen, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein. Ich weiß es. Es ist, als würde man in Treibsand stecken. Das Elend packt dich, zieht dich runter und gibt dich nicht wieder her. Wenn man solch ein Leben lebt, ist man schnell verleitet, sich einfach treiben zu lassen. Immer und immer wieder trifft man die gleichen bequemen Entscheidungen, die einen langsam umbringen.
Die Wahrheit jedoch ist: Wir alle treffen Gewohnheitsentscheidungen, mit denen wir uns selbst im Weg stehen. Ein Phänomen, das so selbstverständlich wie der Sonnenuntergang und so grundlegend wie die Schwerkraft ist. Unser Hirn ist so gepolt, und deshalb ist Motivation auch Bullshit.
Selbst der wohlmeinendste Zuspruch und die besten Selbsthilfe-Tricks sind bestenfalls eine vorübergehende Lösung. Nichts, wodurch unser Hirn neu verkabelt würde. Es wird nicht dazu führen, dass unsere Stimme plötzlich gehört wird, und es wird unser Leben nicht verbessern. Motivation hilft überhaupt niemandem. Das Leben hatte mir schlechte Karten gegeben, aber es waren meine Karten, und nur ich konnte etwas daran ändern.
Also wandte ich mich dem Schmerz zu, verliebte mich in das Leiden, und schließlich wandelte ich mich vom schwächsten Häufchen Elend dieser Erde in den härtesten Mann, den Gott je erschaffen hat – zumindest rede ich mir das ein.
Vermutlich haben Sie eine viel bessere Kindheit erlebt als ich, und womöglich führen Sie auch heute noch ein verdammt annehmliches Leben. Aber ganz egal, wer Sie sind, wer Ihre Eltern sind oder waren, egal, wo Sie wohnen und was Sie beruflich machen, egal, wie viel Geld Sie haben: Vermutlich schöpfen Sie Ihre wahren Kapazitäten nur zu etwa 40 Prozent aus.
Was für ein verdammter Jammer.
Wir alle haben das Potenzial, so viel mehr zu sein.
Vor Jahren war ich eingeladen, an einem Panel des Massachusetts Institute of Technology (MIT) teilzunehmen. Als Schüler hatte ich nie auch nur einen Fuß in einen Vorlesungssaal gesetzt. Ich habe gerade mal so meinen Highschool-Abschluss geschafft, und dennoch saß ich nun in einer der renommiertesten Einrichtungen des Landes, um mit ein paar anderen Leuten über mentale Stärke zu sprechen. Irgendwann sagte ein angesehener MIT-Professor, dass jedem von uns genetische Grenzen gesetzt sind. Unüberwindbare Grenzen. Er sagte, dass es Dinge gäbe, zu denen wir schlicht nicht in der Lage seien – ohne dass unsere mentale Stärke daran etwas ändern könne. Mentale Stärke würde keine Rolle spielen, wenn wir an diese Grenzen gelangen.
Alle Anwesenden schienen seine Sicht der Dinge zu akzeptieren, weil dieser altgediente Emeritus für seine Forschung zum Thema mentale Stärke berühmt war. Das war sein Lebenswerk. Und zugleich war es ein Haufen Bullshit. Ich hatte den Eindruck, dass er die Wissenschaft bemühte, um uns alle aus der Verantwortung zu nehmen.
Bis zu diesem Zeitpunkt war ich still geblieben, weil ich von lauter klugen Menschen umgeben war und mir dumm vorkam, aber jemand aus dem Publikum bemerkte meinen Gesichtsausdruck und fragte, ob ich derselben Meinung wie besagter Professor sei. Und wenn mir jemand eine direkte Frage stellt, scheue ich vor der Antwort nicht zurück.
»Es ist durchaus von Vorteil, die Dinge einfach anzugehen, statt sie nur zu studieren«, sagte ich und wandte mich dann dem Professor zu. »Was Sie da sagen, ist für die meisten Menschen zutreffend, aber nicht für alle. Es wird immer das eine Prozent von uns geben, die willens sind, sich ins Zeug zu legen, um den Wahrscheinlichkeiten zu trotzen.«
Dann erläuterte ich ihm, was ich aus eigener Erfahrung wusste. Dass jeder zu einem völlig neuen Menschen werden und erreichen könne, was sogenannte Experten wie er für unmöglich erklärten, dass es dazu aber eine Menge Mut, Willenskraft und einen gewappneten Geist brauche.
Heraklit, ein im fünften Jahrhundert vor Christus im Altpersischen Reich geborener Philosoph, hatte recht, als er über Männer auf dem Schlachtfeld schrieb: »Von 100 Männern sollten zehn gar nicht dort sein, 80 sind nur Zielscheiben, neun sind die wahren Kämpfer, und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben, denn sie gewinnen die Schlacht. Ah, aber der eine, der eine ist ein Krieger …«
Von dem Moment an, in dem wir unseren ersten Atemzug machen, sind wir der Möglichkeit des Todes ausgesetzt. Und ebenso bietet sich uns die Möglichkeit, zu unserer wahren Größe zu finden und der eine Krieger zu werden. Aber es ist jedem selbst überlassen, sich für die anstehende Schlacht zu rüsten. Nur wir können die Herrschaft über unseren Verstand erringen, und das ist es, was wir tun müssen, um ein mutiges Leben zu führen, voller Errungenschaften, von denen die meisten glauben, dass sie niemals dazu befähigt wären.
Ich bin kein Genie, wie es diese Professoren des MIT sind, aber ich bin dieser eine Krieger. Und die Geschichte, die Sie nun lesen werden, die Geschichte meines erbärmlichen Lebens, wird einen erprobten und bewährten Pfad zur Selbst-Beherrschung aufzeigen. Sie wird Sie dazu befähigen, sich der Realität zu stellen, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, Schmerzen zu überwinden. Sie wird Sie lehren zu lieben, was Sie fürchten, das Scheitern zu genießen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen und herauszufinden, wer Sie wirklich sind.
Der Mensch wandelt sich durch das Lernen, durch seine Gepflogenheiten und durch Geschichten. Im Laufe meiner Geschichte werden Sie erfahren, wozu Körper und Geist imstande sind, wenn wir ihre vollen Kapazitäten ausreizen – und Sie erfahren, wie Ihnen das gelingt. Denn mit dem nötigen Ehrgeiz werden Sie alles, was Ihnen im Weg steht – egal, ob Rassismus, Sexismus, Verletzungen, Scheidung, Depression, Fettleibigkeit, Schicksalsschläge oder Armut –, als Treibstoff für Ihre Metamorphose nutzen können.
Die Schritte, die ich hier darlegen werde, summieren sich zu einem evolutionären Algorithmus, der Grenzen auslöscht, Glanzleistungen ermöglicht und dauerhaften Frieden bringt.
Ich hoffe, dass Sie bereit sind. Es ist an der Zeit, gegen sich selbst in den Krieg zu ziehen.
Kapitel 1
Beinahe wäre ich als Zahl in einer Statistik geendet
Wir fanden unsere Hölle in einer wunderschönen Nachbarschaft. 1981 bot das Städtchen Williamsville die schönsten Immobilien in der Region von Buffalo, New York. Eine begrünte und freundliche Gegend, deren sichere Straßen hübsche Häuser säumten, bewohnt von Vorzeigebürgern. Ärzte und Zahnärzte, Anwälte, leitende Angestellte eines Stahlwerks und Profi-Footballer lebten dort mit ihren hingebungsvollen Ehefrauen und ihren 2,2 Kindern. Die Autos waren neuwertig, die Straßen gekehrt, die Möglichkeiten endlos. Wir reden hier über den lebendigen, atmenden American Dream. Die Hölle, das war ein Eckgrundstück in der Paradise Road.
Dort lebten wir in einem zweigeschossigen, weiß vertäfelten Haus mit vier Schlafzimmern. Vier quadratische Säulen umrahmten eine Veranda, vor der sich der größte und grünste Rasen in ganz Williamsville erstreckte. Nach hinten raus hatten wir einen Gemüsegarten und eine Doppelgarage, in der ein 1962er Rolls Royce Silver Cloud sowie ein 1980er Mercedes 450 SLC standen. In der Auffahrt parkte eine funkelnagelneue schwarze Corvette, Baujahr 1981. Jeder, der in der Paradise Road lebte, rangierte in der Nahrungskette weit oben, und mit Blick auf unsere äußere Erscheinung dachten die meisten unserer Nachbarn, dass wir, die als glücklich und gediegen geltende Familie Goggins, die Spitzenposition einnahmen. Aber eine glänzende Oberfläche reflektiert viel mehr, als dass sie etwas zum Vorschein bringen würde.
Unter der Woche sahen sie uns morgens um sieben zusammen in der Einfahrt stehen. Mein Dad, Trunnis Goggins, war nicht groß, aber er war gut aussehend und hatte die Statur eines Boxers. Er trug maßgeschneiderte Anzüge, hatte ein warmes, offenes Lächeln. Er sah durch und durch so aus wie ein erfolgreicher Geschäftsmann auf dem Weg zur Arbeit. Meine Mutter Jackie war 17 Jahre jünger als er, schlank und wunderschön. Und mein Bruder und ich waren ordentlich frisiert, trugen saubere Jeans und pastellfarbene Hemden der Marke IZOD. Den Rucksack hatten wir auf die Schultern geschnallt, ganz wie die anderen Kids. Die weißen Kids. In unserer Version des Wohlstandsamerikas war jede Einfahrt eine Bühne, auf der einander zugenickt und gewunken wurde, bevor Eltern und Kinder sich auf den Weg zur Arbeit und zur Schule machten. Die Nachbarn sahen, was sie sehen wollten. Niemand schaute allzu genau hin.
Eine gute Sache. Denn in Wahrheit war Familie Goggins gerade erst zurückgekehrt von einer weiteren arbeitsreichen Nachtschicht im Schwarzen-viertel, und wenn Paradise Road die Hölle war, dann lebte ich mit dem Teufel persönlich unter einem Dach. Sobald unsere Nachbarn die Tür hinter sich geschlossen hatten oder um die Ecke gebogen waren, verzog sich das Lächeln meines Vaters zu einer finsteren Grimasse. Er kläffte Befehle und ging ins Haus, um seinen Rausch auszuschlafen, während unsere Arbeit noch nicht getan war. Mein Bruder, Trunnis Jr., und ich mussten zur Schule gefahren werden, und es war die Aufgabe unserer schlaflosen Mutter, das zu tun.
1981 war ich in der ersten Klasse, und ich saß völlig benommen im Unterricht. Nicht, weil mir der Lernstoff schwergefallen wäre – zumindest noch war das nicht der Fall –, sondern weil ich mich nicht wachhalten konnte. Die Arme hatte ich auf dem Pult zu einem bequemen Kissen verschränkt; der Singsang der Stimme meiner Lehrerin war mein Schlaflied, und ihre scharfen Worte – einmal hat sie mich beim Träumen erwischt – waren mir ein unliebsamer Wecker, der einfach nicht aufhörte zu schrillen. Kinder in diesem jungen Alter sind nimmersatte Schwämme. Sprachen und Konzepte nehmen sie in Warp-Geschwindigkeit auf und schaffen sich so ein Fundament, auf das die meisten Menschen Fähigkeiten für das ganze Leben aufbauen, zum Beispiel Lesen und Schreiben und die Grundrechenarten. Da ich nachts aber arbeitete, konnte ich mich morgens meist auf gar nichts konzentrieren, außer darauf wachzubleiben.
Die Pause und der Sportunterricht waren Minenfelder ganz anderer Art. Draußen auf dem Pausenhof fiel es mir noch am leichtesten, bei klarem Verstand zu bleiben. Viel schwerer war das ewige Versteckspiel. Mein Hemd musste ordentlich eingesteckt bleiben. Kurze Hosen kamen nicht infrage. Prellungen und andere Verletzungen waren Alarmsignale, die ich niemanden sehen lassen durfte, denn ich wusste, dass ich mir noch mehr davon einhandeln würde, wenn ich es doch tat. Dennoch wusste ich, dass ich auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer in Sicherheit war, zumindest für eine kleine Weile. Die Schule war der eine Ort, an dem er mich nicht packen konnte, zumindest nicht physisch. Mein Bruder führte in der sechsten Klasse, seinem ersten Jahr an der Middle School, einen ähnlichen Tanz auf. Er musste seine eigenen Wunden verstecken, und er musste versuchen, etwas Schlaf zu kriegen, denn wenn die Schulglocke klingelte, fing das richtige Leben an.
Die Fahrt von Williamsville in den Masten District im Osten Buffalos dauerte etwa eine halbe Stunde, aber zwischen beiden Orten hätte ebenso gut eine ganze Welt liegen können. Masten war, wie weite Teile East Buffalos, ein schwarzes Arbeiterviertel in der Innenstadt, in dem es eher ruppig zuging; allerdings war es Anfang der Achtziger noch nicht ganz das heruntergekommene Ghetto. Damals brummte das Bethlehem-Stahlwerk noch, und Buffalo war die letzte große Stahlmetropole Amerikas. Die meisten Männer der Stadt, ob schwarz oder weiß, hatten ordentliche Gewerkschaftsjobs und verdienten genug, um ihre Existenz zu sichern, was bedeutete, dass die Geschäfte in Masten gut liefen. Für meinen Dad war das immer der Fall gewesen.
Im Alter von 20 Jahren hatte er eine Vertriebslizenz für Coca-Cola und bediente vier Lieferrouten im Großraum Buffalo. Für einen jungen Kerl bedeutete das eine Menge Geld, aber er hatte größere Träume und den Blick in die Zukunft gerichtet. Seine Zukunft hatte vier Räder und wurde mit Disco-Funk beschallt. Als eine lokale Bäckerei dichtmachte, mietete er das Gebäude an und errichtete eine der ersten Rollschuhbahnen in Buffalo.
Zehn Jahre vorgespult: »Skateland« war in ein Gebäude in der Ferry Street umgezogen, das sich im Herzen des Masten District über fast einen ganzen Block erstreckte. Über der Laufbahn eröffnete er eine Bar, der er den Namen »Vermillion Room« gab. In den 1970er-Jahren war das in East Buffalo ein Hotspot, und dort lernte er meine Mutter kennen. Da war er 36 und sie gerade 19 Jahre alt. Sie war vor Kurzem erst von zu Hause ausgezogen. Jackie war ein Kind katholischer Eltern. Trunnis war der Sohn eines Pastors und sprach ihre Sprache gut genug, um sich ihr gegenüber als gläubiger Christ maskieren zu können, was ihr gefiel. Aber machen wir uns nichts vor. Von seinem Charme war sie nicht minder hingerissen.
Trunnis Jr. wurde 1971 geboren. Ich kam 1975 zur Welt, und als ich sechs Jahre alt war, hatte der Rollerdisco-Hype gerade seinen absoluten Höhepunkt erreicht. Im Skateland war jede Nacht was los. Für gewöhnlich kamen wir dort gegen 17 Uhr an, und während mein Bruder am Verkaufsstand arbeitete – wo er das Popcorn zubereitete, die Hot Dogs grillte, den Kühlschrank neu befüllte und Pizzen zubereitete –, sortierte ich die Schlittschuhe nach Größe und Design. Jeden Nachmittag stand ich auf einem Tritthocker, um die Bestände mit einem Schuhdeodorant zu besprühen und defekte Gummistopper zu ersetzen. Der Aerosol-Gestank nebelte meinen Kopf ein und setzte sich in meinen Nasenlöchern fest. Meine Augen waren ständig blutunterlaufen. Stundenlang konnte ich nichts anderes riechen. Aber davon durfte ich mich nicht ablenken lassen, ich musste immer den Überblick behalten und ständig auf Trab sein. Denn mein Vater, der am DJ-Pult arbeitete, sah alles, und wenn auch nur ein Rollschuh fehlte, ging’s mir an den Kragen. Bevor der Laden öffnete, wienerte ich den Boden der Rollschuhbahn mit einem Wischmopp, der doppelt so groß war wie ich.
Gegen 18 Uhr rief meine Mutter uns zum Abendessen in das Büro in den hinteren Räumen. Diese Frau lebte in einem permanenten Zustand des Nicht-wahrhaben-Wollens, aber ihr Mutterinstinkt war aufrichtig, und wenn sie versuchte, irgendwie an einem letzten Rest Normalität festzuhalten, dann legte sie sich dabei hemmungslos ins Zeug. Jeden Abend stellte sie in diesem Büro zwei Elektrokochplatten auf den Boden, hockte im Fersensitz dahinter und bereitete ein vollständiges Dinner zu – Rostbraten, Kartoffeln, grüne Bohnen und Baguette-Brötchen –, während mein Vater die Buchführung erledigte und Telefonate machte.
Mit sechs Jahren im »Skateland«
Das Essen schmeckte gut, aber selbst im Alter von sechs, sieben Jahren wusste ich schon, dass unsere »Familienessen« ein lächerlicher Abklatsch dessen waren, was bei den meisten Familien stattfand. Auch weil wir so schnell aßen. Wir hatten keine Zeit, es zu genießen, denn wenn um 19 Uhr die Türen öffneten, dann hieß es »Showtime«, und jeder von uns hatte an seinem Platz und vorbereitet zu sein. Mein Dad war der Sheriff, und wenn er erst mal in seiner DJ-Kabine stand, hatte er jeden von uns im Blick. Wie ein allsehendes Auge scannte er den Raum, und wenn man etwas vermasselte, dann wurde er lautstark. Wenn er denn nicht sofort handgreiflich wurde.
Unter dem harschen Licht der Deckenleuchten sah der Raum nach nichts Besonderem aus, aber wenn mein Dad die Lampen dimmte, badeten die Scheinwerfer die Rollbahn in rotem Licht, das von der sich drehenden Diskokugel reflektiert wurde und den Rollerdisco-Traum heraufbeschwor. Ob unter der Woche oder am Wochenende, an jedem Abend drängten sich Hunderte von Skatern durch unsere Türen. Die meisten kamen mit ihrer Familie; sie zahlten die 3 Dollar Eintritt und liehen sich für 50 Cent ein paar Rollschuhe, bevor es auf die Bahn ging.
Ich allein war für den Rollschuhverleih und das ganze Drumherum zuständig. Meinen Tritthocker führte ich mit mir wie eine Krücke. Ohne dieses Ding hätten die Kunden mich gar nicht sehen können. Die Rollschuhe in den größeren Größen lagerten unter dem Tresen, aber die kleineren Größen waren so weit oben verstaut, dass ich an den Regalen hochklettern musste, was die Kunden immer zum Lachen brachte. Mom und niemand sonst saß vorne an der Kasse. Sie kassierte die Eintrittsgelder, und für Trunnis ging es einzig und allein ums Geld. Er zählte die Leute beim Reinkommen, errechnete in Echtzeit seinen Verdienst, damit er eine grobe Vorstellung davon hatte, was er beim Kassensturz nach Ladenschluss erwarten konnte. Und wehe, es fehlte etwas.
Das Geld gehörte ihm ganz allein. Uns Übrigen wurde der Schweiß nicht mit einem Cent vergolten. Niemals bekam meine Mutter Geld zur freien Verfügung. Sie hatte kein Bankkonto und keine auf sie ausgestellten Kreditkarten. Er kontrollierte alles, und wir alle wussten, was passieren würde, wenn ihre Kasse mal nicht stimmen sollte.
Von den Kunden, die bei uns zur Tür hineinkamen, wusste das natürlich niemand. Für sie war das Skateland eine Traumwolke im Familienbetrieb. Mein Dad drehte die schwachatmigen Vinyl-Echos aus Disco und Funk auf dem Plattenteller, und ab und an rumpelte auch früher Hip-Hop. Von den roten Wänden waberte der Bass. Da liefen dann die Songs von Buffalos Lieblingssohn Rick James, von George Clintons Band Funkadelic und ein paar der ersten Tracks der Hip-Hop-Pioniere Run DMC. Ein paar der Kids auf der Laufbahn betrieben Speed-Skating. Ich hatte selbst gern einen ziemlichen Zahn drauf, aber bei uns gab es immer mal wieder ein paar echte Rollschuh-Tänzer, und dann ging es so richtig zur Sache.
Die ersten ein, zwei Stunden blieben die Eltern der Kids unten und skateten selbst, oder sie sahen ihren Kindern dabei zu, wie die ihre Runden drehten, aber irgendwann verzogen sie sich nach oben und machten ihr eigenes Ding, und wenn es genug von ihnen waren, verließ Trunnis sein DJ-Pult, um sich zu ihnen zu gesellen. Mein Dad war so etwas wie der inoffizielle Bürgermeister von Masten und ein verlogener Politiker durch und durch. Seine Kunden waren für ihn Zielscheiben, und sie hatten keinen Schimmer davon, dass er sich – egal, wie viele Drinks er aufs Haus spendierte; egal, wie oft er sie kumpelhaft umarmte – einen Dreck um sie scherte. Für ihn waren sie wandelnde Dollarzeichen. Wenn er jemandem einen Drink spendierte, dann nur, weil er wusste, dass die Person anschließend noch zwei oder drei weitere bestellen würde.
Ab und an blieb das Skateland die ganze Nacht lang geöffnet oder es gab einen 24-Stunden-Skate-Marathon, aber normalerweise war um 22 Uhr Schluss. Und dann machten meine Mutter, mein Bruder und ich uns an die Arbeit. Wir fischten blutige Tampons aus verschissenen Toiletten, lüfteten beide Toilettenräume, um den Cannabis-Geruch zu vertreiben, kratzten bakterienstrotzende Kaugummis vom Boden der Laufbahn, putzten die Gewerbeküche und machten Inventur. Kurz vor Mitternacht schleppten wir uns halbtot ins Büro. Unsere Mutter bereitete meinem Bruder und mir eine kleine Schlafstätte auf dem Bürosofa. So lagen wir, Kopf an Kopf, während die Decke unter den schweren Bässen von Funk-Musik aus der Bar im Obergeschoss erzitterte.
Für Mom war die Arbeit noch nicht zu Ende.
Kaum hatte sie die Bar betreten, setzte Trunnis sie an den Einlass oder schickte sie wie einen Schnaps-Esel nach unten, um sie kistenweise Spirituosen aus dem Keller nach oben schleppen zu lassen. Irgendwelche niederen Dienste gab es immer zu verrichten, und sie kam niemals zur Ruhe, während mein Vater an der Bar, von der aus er alles überblicken konnte, Wache hielt. Damals schaute Musikstar Rick James, der in Buffalo zur Welt gekommen war und zu den besten Freunden meines Vaters zählte, im Laden vorbei, wann immer er in der Stadt war. Seinen Luxusschlitten – ein Excalibur – parkte er draußen auf dem Bürgersteig. Dieses Auto war eine Werbetafel, die die Hood wissen ließ, dass der »Superfreak« im Haus war. Er war nicht der einzige Promi, der sich blicken ließ. O. J. Simpson zählte zu den größten Stars des amerikanischen Profi-Footballs, und er und seine Teamkollegen von den Buffalo Bills waren Stammgäste. Mit den R&B- und Soul-Größen Teddy Pendergrass und Sister Sledge fand sich regelmäßig weitere musikalische Prominenz bei uns ein. Wem die Namen nichts sagen, der kann ja das Internet befragen.
Wäre ich älter gewesen oder wäre mein Vater ein guter Mensch gewesen, dann hätte es mich vielleicht mit ein wenig Stolz erfüllt, Teil dieses kulturellen Momentums zu sein, aber kleine Kinder sind für ein solches Leben nicht zu begeistern. Es ist beinahe so, als würden wir alle mit einem gut ausgerichteten moralischen Kompass zur Welt kommen, ganz egal, wer unsere Eltern sind und was sie tun. Mit sechs, sieben oder acht Jahren weiß man, was sich richtig und was sich verdammt noch mal völlig falsch anfühlt. Und wenn man in einen Wirbelsturm des Schreckens und des Schmerzes hineingeboren wird, dann weiß man, dass es auch anders ginge, und diese Wahrheit sitzt einem wie ein Splitter im empfindsamen Geist. Man kann versuchen, sie zu ignorieren, aber da ist immer dieses stumpfe Pochen, während die Tage und Nächte zu einer einzigen verschwommenen Erinnerung ineinanderfließen.
Einige Momente jedoch stechen heraus, und einer davon – ich denke gerade jetzt an ihn – verfolgt mich bis heute. Es war die Nacht, als meine Mutter die Bar früher als erwartet betrat und sah, wie mein Dad eine Frau umgarnte, die etwa zehn Jahre jünger als sie selbst war. Trunnis bemerkte ihren Blick und tat es mit einem Schulterzucken ab, während meine Mutter die Augen verdrehte und zwei Shots Johnnie Walker Red runterkippte, um ihre Nerven zu beruhigen. Ihre Reaktion entging ihm nicht, und sie gefiel ihm ganz und gar nicht.
Mom war über die Dinge im Bilde. Sie wusste, dass Trunnis Prostituierte über die kanadische Grenze bei Fort Eerie schmuggelte. Ein Sommerhaus, das dem Präsidenten einer der größten Banken in Buffalo gehörte, diente als Bedarfsbordell. Trunnis machte Buffalos Banker mit seinen Mädchen bekannt, wann immer er einen höheren Kreditrahmen brauchte, und seine Anträge wurden jedes Mal bewilligt. Meine Mutter wusste, dass die junge Frau, die sie da sah, eines der Mädels aus seinem Stall war. Sie sah sie nicht zum ersten Mal. Einmal hatte sie die beiden dabei erwischt, wie sie es im Skateland auf dem Bürosofa trieben – dort, wo sie ihre Kinder jeden verdammten Abend schlafen legte. Als sie die beiden erblickte, hatte die Frau sie angelächelt. Trunnis hatte nur mit den Schultern gezuckt. Nein, ahnungslos war meine Mutter nicht, aber es tat ihr jedes Mal aufs Neue weh, es mit eigenen Augen zu sehen.
Gegen Mitternacht fuhr meine Mutter mit einem der Security-Männer zur Bank, um Geld einzuzahlen. Er flehte sie an, meinen Vater zu verlassen. Er sagte ihr, sie solle noch in derselben Nacht verschwinden. Vielleicht wusste er, was als Nächstes kommen würde. Sie wusste es ebenso, aber sie konnte nicht gehen, weil sie über keinerlei eigene Mittel verfügte, und sie würde uns nicht seiner Obhut überlassen. Außerdem hatte sie keinerlei Anspruch auf etwaige gemeinsame Güter, da Trunnis sich stets geweigert hatte, sie zu heiraten – ein Problem, mit dem sie sich erst jetzt zu befassen begann. Meine Mutter kam aus einer anständigen Mittelschichtsfamilie und war immer ein rechtschaffener Charakter gewesen. Ihn widerte das an, er behandelte seine Nutten besser als die Mutter seiner Söhne, und das alles hatte zur Folge, dass sie in der Falle saß. Sie war voll und ganz von ihm abhängig, und wenn sie gehen wollte, dann würde sie mit leeren Händen gehen müssen.
Im Skateland konnten mein Bruder und ich nie gut schlafen. Die Decke, die sich direkt unter der Tanzfläche befand, wackelte zu sehr. Als meine Mutter in jener Nacht ins Büro kam, war ich bereits wach. Sie lächelte, aber ich bemerkte die Tränen in ihren Augen und erinnerte mich noch daran, dass ihr Atem nach Scotch roch, als sie mich so behutsam wie nur möglich in die Arme nahm. Kurz nach ihr kam mein Vater in den Raum, schwankend und verärgert. Er zog eine Pistole unter meinem Kissen hervor (ja, Sie lesen richtig, unter dem Kissen, auf dem ich als Sechsjähriger schlief, lag eine geladene Waffe!), wedelte damit vor mir herum und grinste, bevor er sie in einem Knöchelholster unter seinem Hosenbein verschwinden ließ. In der anderen Hand hielt er zwei braune Einkaufstüten aus Papier, in denen er fast 10 000 Dollar in bar verstaut hatte. So weit ein ganz gewöhnlicher Abend.
Auf der Heimfahrt schwiegen meine Eltern, auch wenn die Stimmung zwischen ihnen brodelte. Kurz vor 6 Uhr morgens fuhr meine Mutter den Wagen in unsere Einfahrt in der Paradise Road, was für unsere Verhältnisse recht früh war. Trunnis stolperte aus dem Auto, schaltete die Alarmanlage aus, warf das Geld auf den Küchentisch und ging nach oben. Wir liefen hinter ihm her und Mom brachte uns beide ins Bett. Sie gab uns einen Kuss auf die Stirn und schaltete das Licht aus, bevor sie ins Elternschlafzimmer ging, wo er bereits wartete, seinen Ledergürtel in der Hand. Trunnis mochte es nicht, wenn meine Mutter ihn unverhohlen ansah – schon gar nicht in der Öffentlichkeit.
»Dieser Gürtel hier kam extra aus Texas, um dich zu verdreschen«, sagte er mit ruhiger Stimme. Dann fing er an, ihn zu schwingen, mit der Schnalle voran. Manchmal setzte meine Mutter sich zur Wehr, und in jener Nacht tat sie das. Sie wollte ihm einen Kerzenständer aus Marmor an den Kopf schmeißen. Er duckte sich und der Kerzenständer krachte gegen die Wand. Sie rannte ins Bad, verriegelte die Tür und kauerte auf der Toilette. Er trat die Tür ein und schlug ihr mit dem Handrücken ins Gesicht. Ihr Kopf knallte gegen die Wand. Sie war kaum bei Bewusstsein, als er ein dickes Büschel ihrer Haare packte und sie daran den Flur entlangzerrte.
Inzwischen hatten mein Bruder und ich den Gewaltausbruch mitbekommen, und wir sahen mit an, wie er sie die Treppe hinunter ins Erdgeschoss zerrte, wo er sich, den Gürtel in der Hand, auf sie hockte. Sie blutete aus der Schläfe und der Lippe, und der Anblick des Blutes entfachte eine Zündschnur in mir. In diesem Moment obsiegte in mir der Hass über die Angst. Ich rannte die Treppe hinunter und stürzte mich auf ihn, schlug ihm meine winzigen Fäuste auf den Rücken und kratzte nach seinen Augen. Er hatte nicht mit mir gerechnet und fiel auf ein Knie. Ich heulte auf.
»Hör auf, meine Mom zu schlagen!«, schrie ich. Er warf mich zu Boden, stelzte auf mich zu, den Gürtel in der Hand. Dann wandte er sich meiner Mutter zu.
»Du ziehst einen Gangster groß«, sagte er und lächelte beinahe.
Ich zog Arme und Beine dicht an meinen Körper, als er anfing, seinen Gürtel zu schwingen. Ich konnte fühlen, wie die Wunden auf meinem Rücken anschwollen, während meine Mom zur Haustür kroch, wo sich das Control-Pad der Alarmanlage befand. Sie drückte den Panik-Button und im Haus explodierte der Klang der Sirenen. Trunnis erstarrte, blickte an die Decke, wischte sich mit dem Ärmel über die Brauen und holte tief Luft. Er formte den Gürtel zu einer Schlaufe und schloss die Schnalle, dann ging er nach oben, um sich all das Böse und den Hass abzuwaschen. Die Polizei war unterwegs, und das wusste er.
Die Erleichterung meiner Mutter war von kurzer Dauer. Als die Polizei eintraf, empfing Trunnis sie an der Tür. Sie blickten über seine Schulter in Richtung meiner Mom, die einige Schritte hinter ihm stand, das Gesicht angeschwollen und blutverkrustet. Aber das waren andere Zeiten damals. Da gab es kein #metoo. So etwas existierte nicht, und man ignorierte sie. Trunnis machte ihnen weis, es sei alles nur viel Lärm um nichts und wieder nichts gewesen. Nur eine unvermeidliche häusliche Disziplinierungsmaßnahme.
»Schauen Sie sich mein Haus doch an. Sehe ich aus, als würde ich meine Frau misshandeln?«, fragte er. »Ich schenke ihr Nerze und Diamantringe, ich reiße mir den Arsch auf, um ihr alles kaufen zu können, was sie will. Und sie wirft mir einen Kerzenständer aus Marmor an den Kopf. Sie ist einfach verwöhnt.«
Die Polizisten und er lachten leise vor sich hin, während er sie zu ihrem Wagen begleitete. Sie gingen, ohne Mom zu befragen. An jenem Morgen schlug er sie kein weiteres Mal. Das musste er auch nicht. Der seelische Schaden war angerichtet. Von diesem Zeitpunkt an war uns klar, dass das Gesetz Trunnis nicht im Wege stehen würde. Jagdsaison war immer. Und die Gejagten waren wir.
Im Laufe des nächsten Jahres blieb unser Programm weitgehend dasselbe; immer wieder setzte es Prügel, während meine Mutter versuchte, die Finsternis mit kleinen Lichtblicken zu überspielen. Sie wusste, dass ich gerne ein Pfadfinder sein wollte, also meldete sie mich für eine der regionalen Gruppen an. Ich weiß noch, wie ich eines Samstags das marineblaue Hemd der Wölflinge anzog. Es erfüllte mich mit Stolz, eine Uniform zu tragen und zu wissen, dass ich wenigstens für ein paar Stunden so tun konnte, als sei ich ein Kind wie alle anderen. Meine Mom lächelte, als wir zur Tür hinauswollten. Der Grund für beides – mein Stolz, ihr Lächeln – waren nicht nur die verdammten Pfadfinder. Es war etwas Tiefgreifenderes. Wir bemühten uns in einer düsteren Situation aktiv um etwas Positives. Es war der Beweis dafür, dass wir zählten, dass wir nicht völlig machtlos waren.
In diesem Augenblick kam mein Vater aus dem »Vermillion Room« nach Hause.
»Wo wollt ihr beiden hin?« Er starrte mich zornig an. Mein Blick blieb am Boden haften. Meine Mutter räusperte sich.
»Ich fahre David zu seinem ersten Pfadfindertreffen«, sagte sie mit sanfter Stimme.
»Den Teufel wirst du tun!« Ich blickte auf und er lachte, als er die Tränen in meinen Augen sah. »Wir gehen zur Pferderennbahn.«
In weniger als einer Stunde kamen wir an der Batavia Downs an, einer Trabrennbahn alter Schule, auf der die Jockeys in leichten Einspännern sitzen und von den Pferden gezogen werden. Kaum hatten wir das Gelände betreten, schnappte mein Vater sich einen Wettzettel. Stundenlang sahen wir drei ihm dabei zu, wie er eine Wette nach der anderen setzte, Kette rauchte, Scotch trank und Krawall schlug, als ein Pferd nach dem anderen ihn seinen Wetteinsatz kostete. Während mein Dad die Wettgötter verfluchte und sich wie ein Idiot aufführte, versuchte ich mich vor den Blicken der vorbeikommenden Leute zu verstecken, aber dennoch fiel ich auf. Ich war das einzige Kind auf der Tribüne, das wie ein Pfadfinder gekleidet war. Vermutlich war ich der einzige schwarze Pfadfinder, den sie je zu Gesicht bekommen hatten, und meine Uniform war eine Lüge. Ich war ein Heuchler.
Trunnis verlor an jenem Tag mehrere Tausend Dollar, und die ganze Fahrt nach Hause über zeterte er deswegen, die Kehle rau vom vielen Nikotin. Mein Bruder und ich saßen auf der engen Rückbank, und immer wenn er aus dem Fenster spuckte, flog mir der Schleim wie ein Boomerang ins Gesicht. Jeder Tropfen seines widerlichen Speichels brannte wie Gift auf meiner Haut und ließ meinen Hass noch größer werden. Ich hatte längst gelernt, dass ich einer Tracht Prügel am besten entkommen konnte, indem ich mich so unsichtbar wie möglich machte – jeden Blickkontakt vermeiden, mich außerhalb meines Körpers treiben lassen und darauf hoffen, dass er mich nicht bemerken würde. Ein Vorgehen, das sich über die Jahre bei uns allen eingeschliffen hatte, aber ich hatte die Schnauze voll davon. Ich würde mich nicht länger vor dem Teufel verstecken. Als Trunnis an diesem Nachmittag auf den Highway Richtung Williamsville fuhr und immer weiter wütete, starrte ich ihn vom Rücksitz aus böse an. In Amerika gibt es ein Sprichwort: »Faith over fear – Vertrauen über Angst.« Für mich hieß es an jenem Tag: Hass über Angst.
Er bemerkte meinen Blick im Rückspiegel.
»Hast du was zu sagen?«
»Wir hätten gar nicht erst zur Rennbahn fahren sollen«, entgegnete ich.
Mein Bruder schaute mich an, als hätte ich den verdammten Verstand verloren. Meine Mutter krümmte sich in ihrem Sitz.
»Sag das noch mal.« Er sprach die Worte langsam, grauenerregend. Ich sagte kein Wort, also versuchte er, nach hinten zu langen, um mir eine runterzuhauen. Aber ich war so klein, dass ich leicht ausweichen konnte. Der Wagen scherte nach links und rechts aus, als Trunnis sich halb zu mir nach hinten drehte und in die Luft schlug. Er berührte mich kaum, was ihn umso wütender machte. Wir fuhren schweigend weiter, bis er wieder zu Atem gekommen war. »Wenn wir zu Hause sind, ziehst du dich aus«, sagte er.
Das sagte er immer, wenn es eine heftige Tracht Prügel setzen sollte, und es gab keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Ich tat, was er befohlen hatte. Ich ging auf mein Zimmer und zog meine Kleidung aus, dann ging ich durch den Flur in sein Zimmer, schloss die Tür hinter mir, machte das Licht aus und legte mich dann bäuchlings über die Bettkante – mit baumelnden Beinen, ausgestrecktem Oberkörper und blankem Hintern. So lautete das Protokoll, und es diente ihm dazu, uns größtmöglichen seelischen und körperlichen Schaden zuzufügen.
Die Prügel waren oftmals brutal, aber das Schlimmste daran war zu wissen, was mich erwartete. Ich konnte die Tür hinter mir nicht sehen, und er ließ sich Zeit, damit meine Angst nur umso größer war. Als ich hörte, wie er die Tür öffnete, erreichte meine Panik ihren Höhepunkt. Selbst da war der Raum noch so dunkel, dass ich in meinem peripheren Sichtfeld kaum etwas wahrnehmen konnte. Ich konnte mich auf den ersten Schlag nicht vorbereiten, bevor der Gürtel nicht auf meine Haut niederging. Es blieb auch nie bei nur zwei oder drei Hieben. Es gab keine feste Zahl, daher wussten wir nie, wann oder ob er aufhören würde.
Diese Tracht Prügel dauerte Minuten um Minuten. Er fing mit meinem Hintern an, aber weil der Schmerz so stechend war, bedeckte ich ihn mit meinen Händen, sodass Trunnis nun meine Schenkel auspeitschte. Als ich dann diese mit meinen Händen bedeckte, zielte er auf meinen Rücken. Dutzende Male ging sein Gürtel auf mich nieder. Er war schweißnass und außer Atem, als er hustend von mir abließ. Auch ich rang nach Luft, aber ich weinte nicht. Seine Boshaftigkeit war zu real und mein Hass gab mir Mut. Ich weigerte mich, diesem Hundesohn die Genugtuung zu geben. Ich stand einfach auf und schaute dem Teufel in die Augen, dann humpelte ich in mein Zimmer und stellte mich vor einen Spiegel. Ich war vom Hals bis zu den Kniekehlen mit Striemen überzogen. Mehrere Tage lang ging ich nicht zur Schule.
Wenn man immer wieder geschlagen wird, verflüchtigt sich jede Hoffnung. Man unterdrückt seine Emotionen, aber das Trauma findet auf unbewusste Weise ein Ventil. Nach zahllosen Schlägen, die sie ertragen und mitansehen musste, war es diese eine Tracht Prügel, die meine Mutter in eine immerwährende Benommenheit schickte; sie war nur noch die Hülle der Frau, als die ich sie Jahre zuvor erlebt hatte. Die meiste Zeit über schien sie abgelenkt und geistesabwesend. Nur wenn er ihren Namen rief, spurte sie, als sei sie seine Sklavin. Erst Jahre später erfuhr ich, dass sie Selbstmord als Lösung in Betracht gezogen hatte.
Mein Bruder und ich ließen unseren Schmerz aneinander aus. Wir saßen oder standen uns gegenüber und er schlug mich, so fest er nur konnte. Meist begann es als Spiel, aber er war vier Jahre älter und viel stärker als ich, und er hielt sich kein bisschen zurück. Wann immer ich umfiel, stand ich wieder auf und er schlug mich erneut, so fest er nur konnte. Dabei schrie er aus voller Lunge, wie ein Kampfsportler, mit wutverzerrtem Gesicht.
»Du tust mir nicht weh! Ist das alles, was du verdammt noch mal draufhast?«, schrie ich zurück. Ich wollte ihn wissen lassen, dass ich mehr Schmerz zu ertragen imstande war, als er mir je zufügen konnte, aber wenn es an der Zeit war schlafenzugehen und es keine Kämpfe mehr auszutragen gab, wenn es keinen Ort mehr gab, mich zu verstecken, dann nässte ich das Bett ein. Beinahe jede Nacht.
Der Alltag meiner Mutter war Anschauungsunterricht in Sachen Überleben. Sie bekam so oft gesagt, dass sie wertlos sei, dass sie es schließlich selbst glaubte. All ihr Tun war der Versuch, Trunnis zu beschwichtigen, damit er nicht ihre Söhne schlagen oder ihr den Arsch versohlen würde, aber ihre Welt war voller unsichtbarer Stolperdrähte, und manchmal wusste sie erst, dass sie etwas in ihm ausgelöst hatte, wenn er bereits die Scheiße aus ihr herausgeprügelt hatte. Manchmal wusste sie es sofort und machte sich auf eine brutale Tracht Prügel gefasst.
Einmal kam ich frühzeitig und mit fiesen Ohrenschmerzen aus der Schule nach Hause. Ich legte mich auf die Bettseite meiner Mutter, mein linkes Ohr pochte vor entsetzlichen Schmerzen. Mit jedem Pochen wuchs auch mein Hass. Ich wusste, dass ich nicht zum Arzt gehen würde, da mein Vater nicht einsah, Geld für Ärzte auszugeben. Wir hatten keine Krankenversicherung, keinen Kinderarzt und keinen Zahnarzt. Wenn wir uns verletzten oder krank wurden, wurde uns gesagt, dass wir uns zusammenreißen sollten, weil mein Vater nicht willens war, für irgendetwas zu zahlen, was nicht dem direkten Nutzen von Trunnis Goggins diente. Unsere Gesundheit zählte nicht dazu, und das kotzte mich verdammt noch mal an.
Nach etwa einer halben Stunde kam meine Mutter hoch, um nach mir zu sehen, und als ich mich auf den Rücken drehte, konnte sie sehen, dass Blut meinen Hals entlang und über das Kissen lief.
»Genug jetzt«, sagte sie, »du kommst mit mir mit.«
Sie half mir aus dem Bett, zog mich an und stützte mich auf dem Weg zu ihrem Auto, aber bevor sie den Motor zum Laufen bringen konnte, hatte mein Vater uns eingeholt.
»Was glaubt ihr denn, wo ihr hingeht?«
»In die Notaufnahme«, sagte sie, während sie den Schlüssel im Zündschloss drehte. Er langte nach dem Türgriff, aber sie fuhr mit quietschenden Reifen los und ließ ihn in einer Staubwolke stehen. Wutentbrannt stampfte er ins Haus, knallte die Tür zu und rief nach meinem Bruder.
»Sohn, bring mir einen Johnnie Walker!« Trunnis Jr. kam mit einer Flasche Red Label und einem Glas von der Hausbar. Wieder und wieder goss er das Glas voll und sah meinem Vater dabei zu, wie er einen Scotch nach dem anderen kippte. Jedes Glas befeuerte ein Inferno. »Du und David, ihr müsst stark sein«, tobte er. »Ich werde hier keine Bande von Schwuchteln großziehen! Und genau das wird aus euch werden, wenn ihr mit jedem Wehwehchen zum Arzt rennt, verstanden?« Mein Bruder stand stocksteif da und nickte. »Ihr seid Goggins’ und wir reißen uns zusammen!«
Der Arzt, bei dem wir an jenem Abend waren, sagte meiner Mutter, dass sie mich gerade noch rechtzeitig in die Notaufnahme gebracht habe. Ich hatte eine derart heftige Ohrenentzündung, dass ich auf dem linken Ohr für den Rest meines Lebens taub gewesen wäre, wenn wir auch nur ein wenig länger gewartet hätten. Sie hat ihren Arsch riskiert, um meinen zu retten, und wir wussten beide, dass sie dafür bezahlen würde. Auf dem Weg nach Hause herrschte gespenstisches Schweigen im Wagen.
Als wir in der Paradise Road ankamen, saß mein Vater noch immer vor Wut kochend am Küchentisch, und mein Bruder schenkte ihm noch immer Scotch nach. Trunnis Jr. fürchtete unseren Vater, aber er verehrte den Mann auch und stand unter seinem Bann. Als Erstgeborener wurde er besser behandelt. Trunnis wurde auch ihm gegenüber handgreiflich, aber in seiner verqueren Wahrnehmung war Trunnis Jr. sein Prinz. »Ich erwarte von dir, dass du später einmal der Herr in deinem eigenen Haus bist«, sagte er zu ihm. »Und heute Abend werde ich dir zeigen, dass ich Herr in meinem Haus bin.«
Kaum dass wir zur Tür herein waren, prügelte mein Vater wie von Sinnen auf meine Mutter ein, aber mein Bruder konnte es nicht mitansehen. Wann immer die Gewaltausbrüche meines Vaters wie ein Donnerwetter über uns hereinbrachen, saß mein Bruder die Sache in seinem Zimmer aus. Er ignorierte die Dunkelheit, weil die Wahrheit zu schwer wog, als dass er sie hätte ertragen können. Ich schaute jedes Mal verdammt genau hin.
Während der Sommerferien gab es auch unter der Woche keine Atempause von Trunnis, aber mein Bruder und ich begriffen, dass es das Beste war, wenn wir uns auf unsere Fahrräder schwangen und uns so lange wie irgend möglich draußen aufhielten. Eines Tages kam ich zum Mittagessen nach Hause und betrat das Haus wie üblich durch die Garage. Mein Vater schlief für gewöhnlich bis spät in den Nachmittag hinein, also ging ich davon aus, dass die Luft rein war. Ich hatte mich geirrt. Mein Vater war paranoid. Er hatte genug zwielichtige Deals am Laufen, um sich Feinde zu machen, und nachdem wir das Haus verlassen hatten, hatte er die Alarmanlage eingeschaltet.
Als ich die Tür öffnete, jaulten die Sirenen auf und mir rutschte das Herz in die Hosen. Den Rücken an die Wand gepresst erstarrte ich und lauschte nach seinen Schritten. Ich hörte das Knarzen der Treppenstufen und wusste, dass ich geliefert war. In seinem Hausmantel aus braunem Frottee und mit der Pistole in der Hand kam er nach unten. Er lief durch das Esszimmer ins Wohnzimmer, die Waffe im Anschlag. Ich konnte sehen, wie ihr Lauf langsam um die Ecke kam.
Sobald er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Ecke lauerte, konnte er mich sehen. Ich stand nur etwa 6 Meter von ihm entfernt, aber er senkte seine Waffe nicht. Er richtete sie direkt zwischen meine Augen. Ich starrte ihn an, so ausdruckslos wie möglich, die Füße wie festgeschraubt auf dem Dielenboden. Niemand sonst befand sich im Haus, und ein Teil von mir rechnete damit, dass er den Abzug drücken würde, aber an diesem Punkt in meinem Leben kümmerte es mich nicht länger, ob ich leben oder sterben würde. Ich war ein völlig erschöpftes Kind von acht Jahren, ich hatte es schlicht und verdammt noch mal satt, in ständiger Furcht vor meinem Vater zu leben, und das Skateland hatte ich auch satt. Nach ein oder zwei Minuten senkte er seine Waffe und ging wieder nach oben.
Inzwischen war klar, dass in der Paradise Road jemand sterben würde. Meine Mutter wusste, wo Trunnis seinen Kaliber-.38-Revolver aufbewahrte. An manchen Tagen passte sie die Zeiten ab und folgte ihm – sie malte sich aus, wie es ablaufen würde. Sie würden mit verschiedenen Autos zum Skateland fahren, und sie würde seine Waffe, die unter den Sofakissen lag, an sich nehmen, bevor er sie in die Finger bekommen konnte. Dann würde sie uns früher nach Hause fahren, uns ins Bett bringen und an der Haustür auf ihn warten, die Waffe in der Hand. Wenn er dann ankam, würde sie zur Tür hinausgehen und ihn in der Einfahrt erschießen – und seine Leiche würde sie dort liegen lassen, bis der Milchmann sie entdeckte. Meine Onkel, ihre Brüder, redeten ihr das aus, aber sie stimmten ihr darin zu, dass sie zu drastischen Maßnahmen greifen müsse, weil sonst sie diejenige wäre, deren Leiche man finden würde.
Es war eine ehemalige Nachbarin, die ihr einen Weg aufzeigte. Betty hatte gegenüber von uns gewohnt, und nachdem sie weggezogen war, waren die beiden in Kontakt geblieben. Betty war 20 Jahre älter und weiser als meine Mom. Sie ermutigte meine Mutter dazu, ihre Flucht mit wochenlangem Vorlauf zu planen. Zuerst musste sie sich eine Kreditkarte besorgen, die auf ihren Namen lief. Das bedeutete, dass sie Trunnis’ Vertrauen wiedergewinnen musste, da sie seine Unterschrift benötigte. Betty schärfte meiner Mutter auch ein, dass die Freundschaft zu ihr ein Geheimnis bleiben müsse.
Ein paar Wochen lang spielte Jackie ihr Spielchen mit Trunnis, verhielt sich ihm gegenüber, wie sie es getan hatte, als sie noch eine verliebte Schönheit von 19 Jahren gewesen war. Sie ließ ihn glauben, dass sie ihn wieder anbeten würde, und als sie ihm einen Kreditkartenantrag vorlegte, stimmte er bereitwillig zu, ihr ein wenig Kaufkraft zuzugestehen. Als die Karte in der Post lag, konnte meine Mutter ihre harten Plastikränder durch den Briefumschlag ertasten. Ein Gefühl der Erleichterung machte sich in ihr breit. Mit ausgestreckten Armen hielt sie sich die Karte vors Gesicht und bestaunte sie. Sie funkelte wie ein goldenes Ticket.
Ein paar Tage später hörte sie, wie mein Vater am Telefon mit einem seiner Freunde sprach und über sie herzog, während er mit meinem Bruder am Küchentisch frühstückte. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Sie kam zu uns an den Tisch und sagte: »Ich verlasse euren Vater. Ihr beiden könnt bleiben oder ihr könnt mit mir kommen.«
Mein Vater verharrte in erstauntem Schweigen, genau wie mein Bruder, aber ich sprang von meinem Stuhl auf wie von der Tarantel gestochen, griff mir ein paar schwarze Müllbeutel und ging nach oben, um zu packen. Irgendwann fing auch mein Bruder an, seine Sachen zusammenzusuchen. Bevor wir gingen, hielten wir zu viert noch einen letzten Kriegsrat am Küchentisch. Trunnis starrte meine Mutter böse an, voller Schock und Verachtung.
»Du hast nichts und ohne mich bist du nichts«, sagte er. »Du hast nichts gelernt, du hast keinen Cent und keine Perspektive. Es wird kein Jahr dauern und du gehst anschaffen.« Er machte eine Pause, bevor er seine Aufmerksamkeit auf mich und meinen Bruder richtete. »Aus euch beiden werden zwei Schwuchteln werden. Und glaube nicht, dass du wieder zurückkommen kannst, Jackie. Fünf Minuten nachdem du weg bist, wird hier eine andere Frau deinen Platz eingenommen haben.«
Sie nickte und stand auf. Sie hatte ihm ihre Jugend geschenkt, ihre ganze Seele, und nun, endlich, hatte sie genug. Sie packte nur das Allernötigste aus ihrer Vergangenheit. Die Nerze und die Diamantringe ließ sie da. Ihretwegen konnte er dieses Zeug seiner Hure von einer Freundin geben.
Trunnis sah uns dabei zu, wie wir unsere Sachen in den Volvo meiner Mom luden (das einzige Fahrzeug in seinem Besitz, hinter dessen Steuer er sich nie setzte). Die Fahrräder hatten wir bereits am Heck festgebunden. Wir fuhren langsam an und zunächst rührte er sich nicht, aber bevor wir um die Ecke gebogen waren, konnte ich sehen, wie er in Richtung Garage ging. Meine Mutter trat aufs Gas.
Mom hatte für alle Eventualitäten geplant, das muss man ihr lassen. Sie hatte damit gerechnet, dass er ihr folgen würde, deshalb fuhr sie nicht Richtung Westen auf die Autobahn, die uns nach Indiana, zum Haus ihrer Eltern führen würde. Stattdessen fuhr sie zu Betty, eine staubige Straße entlang, von der mein Vater nicht einmal wusste, nicht mehr als eine Baustelle. Betty erwartete uns mit geöffnetem Garagentor. Wir fuhren hinein. Betty riss das Tor nach unten, und während mein Vater in seiner Corvette auf den Highway fuhr, um uns zu folgen, warteten wir nur einen Katzensprung von unserem Haus entfernt, bis kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Inzwischen, so wussten wir, würde er im Skateland sein, um den Laden aufzumachen. Die Gelegenheit, Geld zu verdienen, würde er sich nicht entgehen lassen. Komme, was wolle.
Wir steckten plötzlich in der Scheiße, als der alte Volvo etwa 140 Kilometer außerhalb von Buffalo anfing, Öl zu verbrennen. Aus dem Auspuff stießen dicke tintenschwarze Rauchschwaden und meine Mutter schaltete in den Panikmodus. Als hätte sich das alles in ihr aufgestaut, als hätte sie ihre Angst tief in ihrem Innern vergraben und hinter einer Maske gezwungener Fassung versteckt, bis das erste Hindernis sie zusammenbrechen ließ. Tränen liefen ihr über das Gesicht.
»Was mache ich denn?«, fragte Mom, die Augen groß wie Untertassen. Mein Bruder hatte nie gehen wollen, und er sagte ihr, sie solle wieder umdrehen. Ich saß auf dem Beifahrersitz. Erwartungsvoll blickte sie mich an. »Was mache ich denn jetzt?«
»Wir müssen weiter, Mom«, sagte ich. »Wir müssen verschwinden.«
Sie fuhr eine Tankstelle mitten im Nirgendwo an. Hysterisch eilte sie zu einem Münztelefon und rief Betty an.
»Ich kann das nicht, Betty«, sagte sie. »Der Wagen ist liegen geblieben. Ich muss zurück.«
»Wo bist du?«, fragte Betty ruhig.
»Ich weiß nicht«, antwortete meine Mom. »Ich habe keine Ahnung, wo ich bin.«
Betty sagte ihr, sie solle zu einem Tankwart gehen – damals gab es die noch an jeder Tankstelle – und ihn ans Telefon holen. Er erklärte ihr, dass wir ganz in der Nähe von Erie, Pennsylvania, waren, und nachdem Betty ihm ein paar Hinweise gegeben hatte, reichte er den Hörer wieder an meine Mutter.
»Jackie, in Erie gibt es einen Volvo-Händler. Sucht euch für die Nacht ein Hotel und bring den Wagen morgen dorthin. Der Tankwart wird euch genug Öl nachfüllen, dass ihr es bis dorthin schafft.« Meine Mutter hörte zu, aber sie antwortete nicht. »Jackie? Hörst du mich? Tue, was ich dir sage, und alles wird in Ordnung sein.«
»Ja. Okay«, flüsterte sie, emotional aufgezehrt. »Hotel. Volvo-Händler. Verstanden.«
Ich weiß nicht, wie Erie heute aussieht, aber damals gab es dort nur ein akzeptables Hotel in der Stadt: ein »Holiday Inn«, nicht weit entfernt vom Volvo-Händler. Mein Bruder und ich folgten meiner Mom an die Rezeption, wo uns weitere schlechte Nachrichten erwarteten. Das Hotel war komplett ausgebucht. Meine Mutter ließ die Schultern hängen. Mein Bruder und ich standen rechts und links von ihr, in den Händen schwarze Müllbeutel, in denen sich unsere Klamotten befanden. Wir boten ein Bild der Verzweiflung, und dem Nachtportier entging das nicht.
»Hören Sie, ich kann Ihnen ein paar Klappbetten im Konferenzsaal aufbauen«, sagte er. »Da gibt es auch eine Nasszelle, aber dann müssen Sie sehr früh wieder verschwunden sein, weil um 9 Uhr eine Konferenz losgeht.«
Dankbar schlugen wir unser Lager in jenem Konferenzsaal mit seiner Auslegeware und den Leuchtstoffröhren auf – unser eigenes kleines Fegefeuer. Wir waren auf der Flucht und hingen in den Seilen, aber meine Mutter gab nicht klein bei. Sie legte sich hin und starrte an die Deckenplatten, bis wir eingeschlafen waren. Dann schlich sie sich in ein Café nebenan, um einen ängstlichen Blick auf unsere Fahrräder und die Straße werfen zu können, die ganze Nacht lang.
Wir warteten vor der Werkstatt des Volvo-Händlers, bis sie ihre Tore öffnete. Die Mechaniker hatten gerade genug Zeit, das Ersatzteil aufzutreiben, das wir benötigten, sodass wir, als sie Feierabend machten, bereit zum Aufbruch waren. Bei Sonnenuntergang verließen wir Erie und fuhren die ganze Nacht durch, bis wir acht Stunden später am Haus meiner Großeltern in Brazil, Indiana, ankamen. Meine Mutter weinte, als sie den Wagen kurz vor Morgengrauen vor ihrem alten Holzhaus parkte, und ich begriff, warum.
Unsere Ankunft fühlte sich bedeutsam an, damals wie heute. Ich war gerade mal acht Jahre alt, aber es hatte bereits ein zweiter Lebensabschnitt für mich begonnen. Ich wusste nicht, was mich erwartete – was uns erwartete in dieser kleinen, ländlichen Stadt im Süden Indianas, und es war mir auch ziemlich gleich. Ich wusste nur, dass wir der Hölle entkommen waren, und zum ersten Mal in meinem Leben waren wir aus den Fängen des leibhaftigen Teufels befreit.
* * *
Während der nächsten sechs Monate blieben wir bei meinen Großeltern, und ich kam in die zweite Klasse – zum zweiten Mal –, diesmal in einer örtlichen katholischen Schule namens Annunciation, »die Verkündigung«. Ich war der einzige Achtjährige in der zweiten Klasse, aber keines der anderen Kinder wusste, dass ich das Jahr wiederholte, und ich hatte es zweifellos nötig. Ich konnte kaum lesen, aber ich hatte das große Glück, Schwester Katherine als Lehrerin zu haben. Schwester Katherine war eine kleine, zierliche Frau von 60 Jahren mit einem Vorderzahn aus Gold. Sie war Nonne, trug aber nicht die Tracht. Außerdem war sie höllisch übellaunig und ließ sich nichts gefallen, und ich liebte diese Gangsterbraut.
Zweite Klasse in Brazil
Annunciation war eine kleine Schule. Schwester Katherine unterrichtete die erste und die zweite Klasse gemeinsam in einem Klassenzimmer, und da sie nur achtzehn Kinder zu unterrichten hatte, war sie nicht willens, sich vor ihrer Verantwortung zu drücken, indem sie meine Probleme im Unterricht oder irgendjemandes schlechtes Benehmen mit Lernschwächen oder emotionalen Belastungen rechtfertigte. Sie kannte meine Vergangenheit nicht und das brauchte sie auch nicht. Für sie zählte lediglich, dass ich mit nicht mehr als einer Vorschulbildung zu ihr gekommen war, und ihr Job war es nun, meinen Geist zu formen. Sie hätte sich dem problemlos entziehen und mich einem Spezialisten überlassen oder mich als Problemkind abstempeln können, aber das war nicht ihre Art. Sie hatte das Unterrichten angefangen, bevor es zur Normalität geworden war, Kindern einen Stempel aufzudrücken, und sie war die Verkörperung einer Keine-Ausreden-Mentalität, die ich brauchte, um aufholen zu können.
Schwester Katherine ist der Grund, weshalb ich keinem Lächeln je trauen und keinen finsteren Blick je verurteilen würde. Mein Dad hat verdammt viel gelächelt, und er hat sich einen Scheißdreck für mich interessiert. Aber die grummelige Schwester Katherine war an mir interessiert, war an uns interessiert. Sie wollte, dass jeder von uns die bestmögliche Version seiner selbst war. Das weiß ich, weil sie es unter Beweis stellte, indem sie mir mehr Zeit widmete, als sie gemusst hätte – so viel Zeit, wie es eben brauchte, bis ich meinen Stoff gelernt hatte. Bevor das Jahr um war, konnte ich auf dem Niveau eines Zweitklässlers lesen. Trunnis Jr. hatte sich nicht annähernd so gut anpassen können. Es dauerte nur ein paar Monate und er kehrte zurück nach Buffalo, wo er sich wieder seinen Aufgaben im Skateland widmete, immer im Schlagschatten meines Vaters, als ob er nie fort gewesen wäre.
Zu dieser Zeit hatten wir bereits eine eigene Wohnung bezogen: eine Sozialwohnung von etwa 55 Quadratmetern, ein Zweizimmer-Apartment in einem Wohnblock namens Lamplight Manor, für das wir 7 Dollar im Monat zahlten. Mein Vater, der jeden Abend Tausende verdiente, ließ uns sporadisch, alle drei oder vier Wochen (wenn überhaupt), 25 Dollar Unterhalt zukommen, während meine Mutter mit ihrem Job in einem Kaufhaus ein paar Hundert Dollar im Monat verdiente. In ihrer freien Zeit belegte sie Kurse an der Indiana State University, die ebenfalls Geld kosteten. Wir hatten also Lücken im Budget zu füllen, weshalb meine Mutter Sozialhilfe beantragte und monatlich 123 Dollar sowie Lebensmittelmarken zugesprochen bekam. Man stellte ihr einen Scheck für den ersten Monat aus, aber als man herausfand, dass sie ein Auto besaß, strich man ihr die Leistungen wieder und erklärte ihr, dass man gern bereit sei, ihr zu helfen, wenn sie ihr Auto verkaufe.
Das Problem war, dass wir in einer ländlichen Stadt mit rund 8000 Einwohnern lebten, in der es keinen öffentlichen Nahverkehr gab. Wir brauchten das Auto, damit meine Mom mich zur Schule bringen und selbst zur Arbeit und zu ihren Abendkursen kommen konnte. Sie war felsenfest entschlossen, ihre Lebensumstände zu ändern, und fand eine Behelfslösung in Form eines staatlichen Programms, das hilfsbedürftige Kinder unterstützte. Sie ließ den Scheck an meine Großmutter ausstellen, die ihr das Geld auszahlte, aber das machte das Leben nicht wirklich einfacher. Wie weit kommt man mit 123 Dollar schon?
Ich erinnere mich noch lebhaft an einen Abend, als wir so abgebrannt waren, dass wir mit einem fast leeren Tank nach Hause fuhren. Die Stromrechnung war noch nicht bezahlt und der Kühlschrank so leer wie unser Konto. Dann fiel mir ein, dass wir noch zwei Einmachgläser hatten, die mit Pennys und anderem Kleingeld gefüllt waren. Ich holte sie aus dem Regal.
»Mom, lass uns unser Kleingeld zählen!«
Sie lächelte. Als sie noch ein Kind war, hatte ihr Vater sie gelehrt, Münzen, die sie auf der Straße fand, immer aufzuheben. Er selbst war während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren aufgewachsen und wusste, was es bedeutete, pleite zu sein. »Du weißt nie, ob du es nicht irgendwann brauchen wirst«, pflegte er zu sagen. Als wir in der Hölle lebten und jeden Abend Tausende Dollar nach Hause brachten, schien die Vorstellung, dass wir jemals ohne Geld dastehen könnten, lachhaft, aber meine Mutter hatte die Gewohnheiten ihrer Kindheit nie abgelegt. Trunnis machte sich deswegen über sie lustig, aber nun war es an der Zeit zu sehen, wie weit unser Geld uns bringen würde.
Wir leerten die Gläser auf den Wohnzimmerboden und zählten alles zusammen; es reichte, um die Stromrechnung zu bezahlen, den Tank zu befüllen und Lebensmittel zu kaufen. Wir hatten sogar noch genug, um uns auf dem Heimweg Burger bei »Hardee’s« zu holen. Das waren finstere Zeiten, aber wir kamen über die Runden. Gerade so. Meine Mutter vermisste Trunnis Jr. schrecklich, aber sie freute sich, dass ich mich einlebte und Freunde fand. Mein Schuljahr lief gut, und seit unserer ersten Nacht in Indiana hatte ich kein einziges Mal mehr ins Bett gemacht. Es schien, als würde ich heilen, aber meine Dämonen waren nicht fort. Sie schliefen nur. Und als sie wieder erwachten, brachen sie mit voller Wucht über mich herein.
* * *
Die dritte Klasse brachte mein System schockartig ins Wanken. Nicht nur, weil wir Schreibschrift lernen mussten, während ich noch damit beschäftigt war, Sicherheit beim Lesen von Druckbuchstaben zu erlangen, sondern auch, weil unsere Lehrerin, Ms. D., so ganz anders war als Schwester Katherine. Wir hatten noch immer eine kleine Klasse, insgesamt etwa zwanzig Kinder aus der dritten und vierten Klasse, aber sie ging damit nicht annähernd so souverän um und hatte keinerlei Interesse, sich für mich die Extrazeit zu nehmen, die ich gebraucht hätte.
Mein Ärger begann mit dem standardisierten Test, den wir während der ersten zwei Unterrichtswochen ablegten. Ich schnitt so richtig schlecht ab. Ich hinkte den anderen Kindern noch weit hinterher und ich hatte Probleme, das Gelernte vom Vortag anzuwenden – vom Unterrichtsstoff des vorangegangenen Schuljahres ganz zu schweigen. Schwester Katherine hatte ähnliche Situationen als Anlass genommen, ihren schwächsten Schülern mehr Zeit zu widmen, und sie hatte mich täglich aufs Neue herausgefordert. Ms. D. wollte sich darum drücken. Noch im ersten Monat der dritten Klasse sagte sie meiner Mutter, dass ich auf eine andere Schule gehöre – auf eine »Förderschule«.