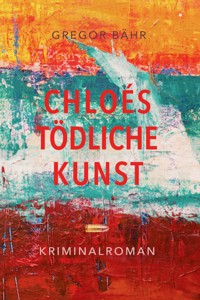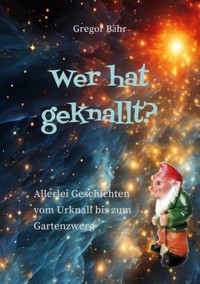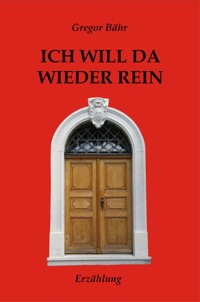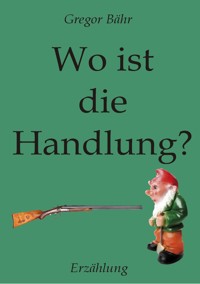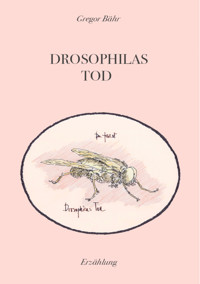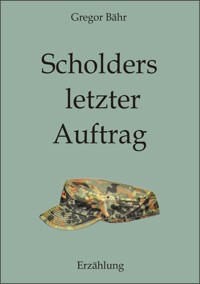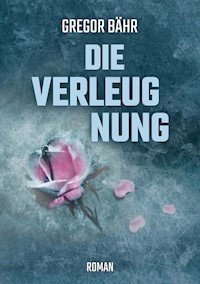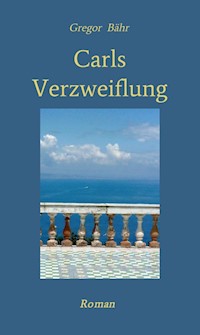
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Grund für Carls Verzweiflung ist die Frage, warum ihn seine geliebte Frau Leonie verlassen hat – einfach so, ohne Vorzeichen, die er hätte deuten können. Er findet auch keinen Abschiedsbrief. Auf der Suche nach einer Erklärung reist er nach Capri, an den Ort seiner schönsten Erinnerungen mit Leonie. Dort erhält er die Antwort auf die Frage nach dem Warum, aber eine ganz andere, als er jemals erwartet hätte. -- Der literarische Roman ist das Psychogramm eines Familiendramas, das sich auf der unvergleichlich schönen Insel Capri abspielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© 2022 Gregor Bähr – alle Rechte vorbehalten.
Gregor Bähr
Gaisburgstr. 29
D- 70182 Stuttgart
gregor-baehr-autor.de
Paperback
978-3-7469-6627-4
Hardcover
978-3-7469-6628-1
e-Book
978-3-7469-6629-8
Umschlaggestaltung: tredition/Gregor Bähr
Titelfoto: © Gregor Bähr, Abbildung: Terrasse der Villa Lysis, Capri.
Verlag & Druck: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Gregor Bähr
wurde als Nachkriegsmodell geboren und in wirtschaftswunderlichen Zeiten am altsprachlichen Gymnasium mit Latein und Griechisch traktiert. Danach lernte er Offsetdrucker. Während der ersten Mondlandung absolvierte er seinen Militärdienst. Drei Jahre nach der Studentenrevolte studierte er in Berlin Wirtschaftskommunikation und Marketing. Es folgte ein zweijähriger Sidestep als Reiseleiter in Süditalien. Seither betrachtet er das Land als zweite Heimat. Nach seiner Rückkehr arbeitete er in Marketingagenturen als Kundenberater, Texter und Etat-Direktor. Seit dem Mauerfall schreibt er als freier Werbetexter und seit mehreren Jahren auch als Schriftsteller. Gregor Bähr lebt in Stuttgart.
Gregor Bähr
Carls Verzweiflung
Roman
„Der neue Tag erwartete ihn in allerfeinster Frühlingsgarderobe. Glitzernder Strass von Regentropfen lag auf Hibiskusblüten, der Seidenhauch einer kaum wahrnehmbaren Luftbewegung schmeichelte der Haut, weiße Wolken vor blauem Himmelsgrund trieben dahin, rundum das wogende Gewand in Ultramarin. – Doch weder der Schmuck, noch die Grazie der Insel bewirkten Bewegung in seiner Seele. Die hatte sich zurückgezogen in eine der Karsthöhlen, von denen es so viele an den steilen Hängen Capris gibt.”
ERSTER TEIL
CARL | SALTO MORTALE
Wie aufmunternd sind die Tage im März, wenn erstes Frühlingserwachen den Park durchstreift. Grund zum Durchatmen, Grund die Fenster zu öffnen und neues Leben einzusaugen. – Es war aber keiner dieser Tage. Viel mehr war es einer der grauen und kalten Tage, die wie alter Schnee auf der Seele liegen.
An einem solchen Tag, nur wenige Stunden, bevor Carl von einer Geschäftsreise aus den USA zurückkommen sollte, hatte ihn Leonie, seine Frau verlassen. Sarah, seine Tochter aus erster Ehe und nur etwa zwei Jahre jünger, erwartete ihn an diesem Tag in der Empfangshalle seines Hauses. Er öffnete die schwere Eingangstür der alten Villa und glaubte, vom Windfang aus Leonie im dämmerigen Licht des späten Nachmittags zu erkennen: die gleiche Statur, die gleiche Größe. Doch es war seine Tochter.
„Sarah? – Du? – Was …?“, stammelte er überrascht.
Ganz in Schwarz gekleidet stand sie da, mit verschränkten Armen. Vermutlich sah sie ihn an, doch er konnte ihre Augen hinter der Sonnenbrille nicht erfassen. Gewiss war es ihre Absicht, damit noch unnahbarer zu wirken als es Kleidung und Haltung schon deutlich machten. Im Tonfall einer Tagesschau-Sprecherin sagte sie: „Deine Frau ist tot. Sie hat sich heute Nacht das Leben genommen und liegt oben im Schlafzimmer. Du kannst aber jetzt nicht zu ihr, die Polizei ist da.“ Geschockt von der unerwarteten Begegnung starrte er sie an: „Was redest du da?“ Sie wiederholte ,etwas eindringlicher: „Deine Frau ist tot, sie hat sich heute Nacht umgebracht.“
Langsam tropften die Worte in sein Bewusstsein. So nacheinander aufgereiht, schnörkellos und ohne jedes Mitgefühl, entfalteten sie eine Wucht, die ihn taumeln ließ. Er starrte sie an, griff hinter sich, ertastete den Handlauf der Treppe nach oben und klammerte sich fest. Seine Blicke prallten an den schwarzen Gläsern ihrer Sonnenbrille ab.
Indem er versuchte zu begreifen, was er eben gehört hatte, wiederholte er tonlos: „Tot? Umgebracht? – Das ist doch Unsinn. Nein, das kann nicht sein.“
Und gleichsam, um das nicht Begreifenkönnen in ein sich Bewusstmachen umzuwandeln, flüsterte Carl erneut: „Tot? Umgebracht? – Nein.“
So standen sie beide eine Weile: Er am Fuß der grau marmorierten Treppenstufen, die seitlich in leichtem Schwung nach oben zur Galerie führten, Sarah inmitten der Eingangshalle. Wie Statuen zeichneten sich ihre beiden Silhouetten im Zwielicht des hohen, halbrunden Raumes ab.
Die Stille wäre erdrückend gewesen, wenn nicht aus einem der Räume, die von der Galerie aus zu erreichen waren, Geräusche gekommen wären. Es waren Schritte, die mal hierhin, mal dorthin gingen. Ein Schienbein war wohl gegen eine offene Schrankschublade gestoßen, dem ein unterdrückter Fluch folgte – der Impuls für Carl, sich mit einem Ruck am Handlauf nach oben zu reißen. Erstaunlich behände für seine knapp siebzig Jahre nahm er mehrere Stufen auf einmal, strauchelte, richtete sich wieder auf und rief: „Leonie! – Leonie!!“
Am oberen Treppenabsatz prallte er gegen einen Polizisten in Zivil, der sich ihm in den Weg stellte. Er tobte, versuchte sich losreißen, brüllte den Beamten an, dass er zu seiner Frau wolle. Er kam bis zur offenstehenden Schlafzimmertür, die der Treppe auf der Galerie gegenüber lag. Dort wurde er endgültig festgehalten. Von hier aus sah er das letzte Bild, das sich wie ein Brandeisen auf seine Seele presste. Da lag sie im gemeinsamen Bett: wächsern, still, wie aufgebahrt.
Dass Sarah ihren Vater in seinem Haus erwartete, um ihm Leonies Tod mitzuteilen, war ein unbeabsichtigter Effekt eines Plans, den sie gegen ihn verfolgte.
*
Als Carl in der Klinik erwachte, setzte sein Denken und Erinnerungsvermögen nur zögerlich ein. An diesem Krankenhaus hatte seine Tochter ihre Berufslaufbahn begonnen, bald Karriere gemacht und stand seit drei Jahren der „Inneren“ als leitende Oberärztin vor. Von ihr erfuhr er, dass er im Anblick seiner toten Frau einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Infolge dessen sei er die Treppenstufen so unglücklich abwärts gestürzt, dass Verdacht auf ein schweres Gehirntrauma bestand. Deshalb habe sie ihn auf die neurologische Abteilung von Dr. Nöther bringen lassen. Dieser hätte sich für eine Behandlung mit größtmöglicher Schonung des Gehirns entschieden und ihn für zehn Tage in ein künstliches Koma versetzt. Unterdessen habe sie stellvertretend für ihn veranlasst, dass seine Frau in einer angemessenen Zeremonie beerdigt wurde.
Der allmähliche, von Dr. Nöther in Gang gesetzte Prozess des Erwachens bewirkte, dass sein Gedankenapparat zwar mühsam in Schwung kam, das Gemüt aber bleiern auf dem Seelengrund lagerte. Daher erlitt er keinen weiteren Schock, sondern dachte nur in sonderbarem Gleichmut: „Sie sorgt zwar für die medizinische Pflege, doch sie gönnt mir nicht den Abschied von Leonie an ihrem Sarg.“
Während der einförmigen Stunden und Tage in der Klinik, wuchs das Fünf-Buchstaben-Wort WARUM zu immenser Größe: "Warum hat mich Leonie auf die radikalste aller denkbaren Arten verlassen?" Es gab keinen Abschiedsbrief, da Sarah seine diesbezügliche Frage mit Nein beantwortete.
Er grübelte nach Andeutungen, Zeichen und Hinweisen, versuchte sich zu erinnern, fand aber keine Antwort. Nur, dass sie in letzter Zeit stiller geworden war und sich häufiger als sonst in ihr Arbeitszimmer zurückgezogen hatte. Dann die spontane Reise nach Agadir …
Er hatte alledem keine Bedeutung beigemessen, weil sie schon bei ihrem Kennenlernen eine stille, introvertierte Person war. Damals, in der ersten Zeit, hatte sie diese Wesensart mit ihrem „dunklen Schicksal“ begründet, das wie eine fremde Macht ihr bisheriges Leben überschattet hatte. Bald hatte sie diese Angst offenbar überwunden, denn sie sprach nie mehr davon. War dieses dunkle Schicksal doch wieder an sie herangetreten?
Weil er nicht den geringsten Anhaltspunkt für ihren freiwilligen Tod fand, trieb der Zweifel wie ein Keil Verstand und Herz auseinander: Er sah das letzte Bild, wie sie dalag: wächsern, still, wie aufgebahrt – ein Beweismittel, das der Verstand lieferte und sich mühte, die Seele für die Trauer um Leonies Tod zu öffnen. Der Kampf zwischen beiden tobte. Was, wenn sie lebte und ihr Tod nur eine Inszenierung war? – Hirngespinste, Irrsinn! – Wenn er nur einmal hätte sehen können, wie ihr Leichnam im offenen Sarg liegt, wenn er sich von ihr hätte verabschieden können, dann wäre alles leichter. So trug er nur dieses letzte Bild in sich, das ihn im Moment vor seinem Blackout erreichte, wie sie dalag: wächsern, still, wie aufgebahrt.
Seiner Tochter verriet Carl nichts von der Tobsucht seiner Gedanken und Gefühle, die ihn ständig attackierten und bis zur völligen Erschöpfung trieben. Nur dem Neurologen vertraute er seine Not an. Der verschrieb ihm zwei Medikamente, die er seitdem täglich einnahm. Er war sich bewusst, dass es Krücken waren, auf die er sich stützen musste, um diese Seelenlast zu ertragen.
Bald nach seinem Klinikaufenthalt war er von diesen seelischen Gehhilfen abhängig geworden wie ein Junkie vom Rauschgift. Zwar hielten die Psychopharmaka die quälenden Gedanken und Depressionen auf Distanz, doch seine Empfindungen und Gefühle bewegten sich nahe der Null-Achse: kaum Ausschläge nach unten oder oben, weder Trauer, noch Freude, als schwämme er wie ein Embryo in einer rosaroten Fruchtblase. Oft fühlte er sich wurstig und antriebslos: Es war egal, ob er etwas unternahm oder unterließ. Er, der sich für agil gehalten hatte, der bis zum Verkauf vor drei Jahren über Jahrzehnte sein florierendes Unternehmen geleitet hatte. Er empfand diesen Zustand als unwürdig. Es musste andere Wege geben, den Verlust Leonies zu verarbeiten.
Die beste Lösung war, noch einmal nach Capri zu reisen, wie mit Leonie all die Jahre zuvor, die Insel erleben. Dieses Mal in dem Bewusstsein, dass er allein war. So hoffte er, endlich ihren Tod bedingungslos annehmen zu können. Er versprach sich Heilung, indem er die Orte aufsuchte, an denen er Momente schier unfassbaren Glücks mit ihr erlebt hatte. Allein und ohne die Geliebte an seiner Seite – so wollte er der Seele den Weg zeigen, auf dem sie dem Verstand folgen konnte: Leonie ist tot. Sie ist nicht mehr. Sie ist nicht mehr als eine große, schöne Erinnerung.
Mit der Reise nach Capri würde er die Kraft finden, von den Medikamenten loszukommen. Er wollte sich selbst den Schlüssel anfertigen, mit dem er sein Seelengefängnis wieder verlassen und befreit nach Hause zurückkehren konnte. Vor dieser Do-it-yourself-Therapie hatte ihn Dr. Nöther eindringlich gewarnt. Er aber vertraute seiner Stärke.
2.
Ende Mai traf er auf Capri ein. Das Hotel war für zwei Wochen gebucht, mit Option auf weitere Tage. So konnte er den Aufenthalt beliebig gestalten. Er nahm auch gleich das morgendliche Ritual auf, das er schon beim ersten Mal vor acht Jahren eingerichtet hatte: die ausführliche Zeitungslektüre bei einem doppelten Espresso und dem Sambuca in seinem Stammcafé. Der Anislikör musste dem alkoholfreien Crodino weichen – kein gleichwertiger Ersatz, sondern ein Tribut an die Medikamente, die Alkoholkonsum strikt ausschließen.
Damals waren sie vom Hotel aus gewöhnlich ein paar Schritte gemeinsam gegangen, bevor Leonie abbog, um auf der Via Camerelle und Umgebung die mondänen Boutiquen, Parfümerien, Juweliere, Schuh- und Lederwarengeschäfte unsicher zu machen. Er hingegen schlenderte weiter zur Piazzetta, kaufte eine deutsche Tageszeitung am Kiosk im Torre dell’Orologio, dem Uhrenturm mit Glockenschlag, und suchte „Al Piccolo Bar“ nebenan auf. Es gab weitere Cafés auf dem Platz, alle mit den gleichen Sonnenschirmen, Tischen und Stühlen bestückt. Er hatte sich damals für dieses entschieden, weil es im Hintergrund lag und deshalb in den Vormittagsstunden weniger als die anderen frequentiert war.
Salvatore war ebenfalls ein Grund, warum er dieses Lokal bevorzugte. Der Ober sprach englisch und etwas deutsch. Vor allem war er immer gut gelaunt. Sobald ein Gast das zweite Mal das Café besuchte, war er Stammgast, erfragte höflich seinen Namen, den er sich merkte und begrüßte ihn fortan persönlich. Irgendwann erfuhr Carl, dass Salvatore mehrere Jahre in New York gearbeitet hatte, in einem Restaurant in Upper East Side, das er ebenfalls kannte. So hatte sich zwischen ihnen eine gewisse Vertrautheit entwickelt, die stets mit einem kurzen Small Talk gepflegt wurde. Danach bekam Carl sein gewohntes Gedeck serviert, bei dem er in Ruhe die Zeitung las. Erst in dieser Beschaulichkeit und Umgebung wurde ihm bewusst, dass er sich im Urlaub befand.
Manchmal kam es jedoch vor, dass schon früh ein paar Touristen sein Stammcafé aufsuchten, bevor er die Zeitungslektüre beendet hatte. Das störte ihn nicht, wenn die neuen Gäste nicht lärmig wurden. Jetzt genügte schon das Quengeln des Mädchens an einem der Nebentische. Es bettelte seine Eltern um Geld für ein Eis vom nahe gelegenen Gelati-Stand an. Das Kind nervte ihn. Er warf einen kurzen Blick über den Rand seiner Zeitung und vermutete, dass die Familie von Sorrent oder Positano herübergekommen war - typische Tagestouristen, die die Cafés auf der Piazzetta bevölkern. Wie Mückenschwärme fallen sie schon in der Frühe auf der Insel ein. Nach dem Motto: „Ganz Capri in 5 Stunden“ klappern sie bis zur Rückkehr aufs Festland die traditionellen Höhepunkte ab. Vom Hafen mit dem Boot zur Blauen Grotte und wieder zurück, anschließend mit der Funicolare nach Capri-Ort. Dann weiter in dichten Pulks zu den Augustusgärten für das obligatorische Selfie „Ich vor den Faraglioni“, den drei im Meer stehenden, steilen Felsklippen und Wahrzeichen Capris. Danach mit Kleinbussen die Straße hinauf nach Anacapri. Unterwegs der beklemmende Blick aus dem Bus über den Straßenrand zweihundert Meter senkrecht abwärts. In Anacapri die drängelnde Enge auf dem schmalen Weg zur Villa San Michele, von einem Souvenir-Laden zum nächsten, wo alles gekauft wird, was es zu kaufen gibt. Carl empfand den Massenandrang als Beleidigung dieser herrlichen Insel, da die Touristen in den hastigen Stunden nicht den wahren Charme erleben, den Capri jenen Gästen offenbart, die wenigstens einige Tage auf der Insel verbringen.
Den morgendlichen Ansturm der Besucher verglich er mit dem Anrollen von Flutwellen, wenn im Abstand von wenigen Minuten die Fähren im Hafen einliefen und mittels Bussen, Taxis und Funicolare ihre Fracht hinauf in den Ort spülten, und weiter mit geringer zeitlicher Verzögerung bis nach Anacapri. Am späten Nachmittag zog sich die Flut mit der Rückfahrt der Ausflugsschiffe zurück. Jedes Mal, wenn er mit Leonie die Urlaubstage verbrachte, fiel ihm dieser Vergleich mit Ebbe und Flut wieder ein. Heute, über ein Jahr nach ihrem Tod, berührte ihn das Treiben der Touristenmassen unangenehmer und aufdringlicher als erwartet.
Mit zwei steilen Falten über der Nasenwurzel faltete er den ungelesenen Teil der Zeitung längs und steckte ihn in die Innentasche seines Sakkos. Bevor die quengelnde Göre ihn weiter ärgerte, bezahlte er lieber. Mit Salvatores Wunsch auf einen schönen Tag trat er aus dem Schatten der Sonnenschirme. Seine Stimmung tendierte nach mürrisch, trotz des wolkenlosen, warmen Vormittags.
Die Glocke im Turm schlug zehn. Er wandte sich der Balustrade zu mit Blick auf den Hafen und wäre von einer erneuten Welle Tagestouristen fast weggespült worden. Sie quoll aus der Funicolare-Station und kam über die breite Treppe nach oben auf ihn zugerollt. Unwillkürlich drehte er sich mit dem Rücken dagegen und stand dann etwas unschlüssig in der Sonne: ein hochgewachsener, schlaksiger Herr Ende sechzig, mit silbrig glitzerndem Hemingway-Bart, im cremefarbenen Leinenanzug und Panamahut – wie von der Titelseite eines Seniorenmagazins. Mit seinen stattlichen einssechsundachtzig umwuselten ihn die Menschen, deren Sprachensalat umso bunter und lauter klang, je mehr von ihnen auf den Platz drängten. Dazwischen die Reiseführer. Mit allen möglichen in den Himmel gereckten Schildern, Stockschirmen und Fähnchen mühten sie sich, die Herde zusammen zu halten. Eine penetrante Vertreterin ihrer Gilde bahnte sich mit der Dynamik eines Schlachtschiffes den Weg durch die Menge. Ihre Schafe führte sie mit regelmäßigen Pfiffen aus einer Trillerpfeife an.
„Entsetzlich“, murmelte Carl und verließ den Platz in Richtung Via Krupp, die abwärts führte zur Marina Piccola. Dort würde er sich auf einer der Strandterrassen einen Liegestuhl mit Sonnenschirm mieten, auf das blaue Meer hinausblicken, mit der Zeitungslektüre fortfahren und sich vom Strandleben in dieser kleinen Bucht ablenken lassen. Sicher würde es seiner lädierten Stimmung guttun, wenn er sich an den Beginn seiner Liebe zu Leonie erinnerte – damals, als er sie das erste Mal im New Yorker Flughafen traf und seitdem völlig neue Erfahrungen machte nach der kargen Zeit, in der er nichts anderes kannte als seine Firma.
Bei seinem Entschluss, die Via Krupp hinabzuwandern hatte er nicht bedacht, dass er vorher die Carthusia passieren musste – jene Parfum-Manufaktur, die Ursache der einzigen schmerzhaften Enttäuschung war, die ihm Leonie jemals bereitete. Bei ihrem letzten gemeinsamen Capri-Aufenthalt hatte er ihr ein Eau de Parfum aus dem Ladengeschäft zum Geschenk gemacht. Genau diesen Duft nahm er wahr, als er in das Sträßchen zu den Augustusgärten und zur Via Krupp einbog.
3.
Düfte sind Brandbeschleuniger der Erinnerung. Sie haben die Macht, schlagartig, distanzlos und authentisch vergessen geglaubte Bilder, Situationen, ja ganze Gefühlswelten wieder aufleben zu lassen. Carl bog in das Sträßchen ein, und weil die geöffnete Ladentür nur wenige Meter entfernt war, empfing seine Nase den Duft der Carthusia und übersetzte ihn in Szenen eines Filmstreifens: Leonie im Hotelzimmer, wie sie den Flakon zweifelnd betrachtete und wie sich ihre Mine eintrübte, als sie den Glasstopfen vorsichtig einen Spalt öffnete und sofort wieder verschloss. Erst der verständnislose Blick und die Unschlüssigkeit, ob sie gegen den aufsteigenden Groll ankämpfen sollte; wie dann die Lippen schmal wurden und die Augenbrauen sich unmerklich zusammenschoben, sah sie ihn an. Sie wurde nicht laut. Es war allein die Schärfe ihrer Worte, die ihn so verletzte: Wie er auf die Idee käme, ihr ein Parfum zu schenken, das nicht duften, sondern fast schon ordinär riechen und überhaupt nicht zu ihrem Typ passen würde. Wenn er ihren Duft nicht mehr möge, solle er es, bitteschön, ehrlich sagen und nicht mit so albernen Andeutungen verklausulieren. Diese Reaktion hatte er nicht erwartet. Er war so gekränkt, dass er wortlos das Hotelzimmer verließ. Je mehr er darüber nachdachte, umso mehr schmerzten ihn ihre Vorwürfe.
Damals war er genau denselben Weg wie heute gegangen: an der Duft-Werkstatt vorbei, die Via Krupp hinunter zur Marina Piccola. Dort hatte er sich nicht lange aufgehalten, sondern war niedergeschlagen mit dem Taxi kreuz und quer über die Insel gefahren. Erst spät abends kehrte er zurück, seine Frau lag schon im Bett und schlief oder tat so, als schliefe sie. Auch am folgenden Tag hatte er ihre Nähe gemieden. Erlösung von seinem Schmerz erhielt er erst zum Abendessen. Sie trafen sich an ihrem angestammten Tisch.
Nach dem Antipasto legte sie sachte ihre Hand auf die seine, sah ihn mit dem ihr eigenen feinen Schleier der Trauer an und sagte nur: „Verzeih mir bitte.“
Mehr hatte es nicht bedurft, um alles davor Geschehene ungeschehen zu machen.
*
Diese Erinnerungen trafen ihn so unvermittelt, dass er stehen bleiben musste. Dabei nahm er noch mehr von dem vergifteten Duft in sich auf. Er beschleunigte seinen Schritt wieder, um der Duftwolke zu entkommen, passierte das schmiedeeiserne Tor nahe den Augustusgärten und ließ den Duft hinter sich. Die innere Betäubung aber blieb. In anderer Verfassung hätte ihn der Anblick begeistert, wie sich die Via Krupp in langgestreckten, engen Serpentinen den steilen Abhang entlang nach unten schlängelte. Vor über hundertzwanzig Jahren war sie aus den grau-weißen, senkrecht aufsteigenden Felswänden herausgemeißelt worden, mit denen die Insel an dieser Stelle wie eine Gralsburg aus dem Meer aufsteigt. Der Duft-Flashback aber machte ihn blind für diesen Anblick. Er war verstört von den Erinnerungsbildern, die er eben gesehen hatte. Er wanderte weiter abwärts, Kehre um Kehre. In der prallen Sonne war es heiß geworden. Er spürte es nicht. Eine Motoryacht zog eine weiße Schleppe durch das Ultramarin des Meeres. Er sah es nicht. Die roséfarbenen Oleanderblüten dufteten, er dagegen litt unter dem Duft des verschmähten Parfums.
Da lag er nun im Liegestuhl unterm Sonnenschirm, mit Blick hinaus ins verlaufende Milchblau, wo es keine klare Grenze gibt, nur Wasser und Luft, sonst nichts. Die Gedanken vagabundierten durch sein vergangenes Leben. – Ja, es gab einen weiteren Duft, der von lindgrünen Limetten. Verbunden mit strohblonden, glatten Haaren und strahlend blauen Augen. Kirsten, die Kunststudentin aus Kiel – eine über Jahrzehnte verblasste Erinnerung an die leidenschaftliche Romanze in Ravenna während seiner letzten Semesterferien an der Uni. Er fragte sich, was aus ihr geworden war. Kurz nach den Ferien hatte er einen Brief von ihr erhalten, den er aber nicht beantwortete. Bald darauf lernte er Zita Kastell kennen und heiratete sie.
4.
Die Ehe hielt kaum sieben Jahre. Und wie in den meisten Ehen war das Scheitern ein schleichender Prozess. Die Erosion begann schon mit Zitas erster Schwangerschaft und Carl auf ihre freudestrahlende Verkündung dieser Umstände weniger euphorisch reagierte, als sie vermutlich erwartet hatte. Sie warf ihm daraufhin Gemütsarmut vor. Aus seiner Sicht war es eher das Gefühl größerer Gebundenheit und zusätzlicher Verpflichtung. Es war schon Belastung genug, die Firma seines Vaters, die Werkzeugmaschinen herstellte, wieder voranzubringen, der zunehmend kränker geworden war und sich kaum noch um das Geschäft kümmern konnte. Carl hatte die Leitung übernommen und setzte als 27-jähriger seine ganze Kraft ein, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Zudem hatte er nie darüber nachgedacht, dass seine Frau die Erwartung ihres ersten Kindes Sarah in eine offenbar neue Gefühlswelt führte, von der sie sich mehr und mehr ausfüllen ließ. Er liebte sie. Davon war er damals fest überzeugt, er hätte sie sonst nicht geheiratet. Für ihn war es aber auch völlig selbstverständlich, mit einer Frau eine Familie zu gründen und dass sie für die Kinder zuständig sei. Das war halt damals der Zeitgeist, rechtfertigte er sich.
Ob er mit dieser sachlichen Sichtweise zum unaufhaltsamen Sinkflug seiner Ehe entscheidend beitrug, würde er niemals erfahren. Er stellte nur fest, dass sich Zita nach der Geburt von Sarah, und Gerrit zwei Jahre später, ausschließlich auf die Kinder konzentrierte, sie waren ihr Lebensmittelpunkt geworden. Anfänglich war er erleichtert, denn so konnte er sich weiterhin auf die Führung der Firma konzentrieren. Dass aber Zita keinerlei Interesse an seiner Arbeit und am Erfolg des Unternehmens zeigte, kränkte ihn. Es schien für sie selbstverständlich zu sein, dass er ihr und den Kindern eine standesgemäße Lebensweise bot. Wenn es Gespräche zwischen ihm und Zita gab, dann war es meist ein Monolog seiner Frau mit dem Thema „unsere Kinder“, wobei er des Öfteren Anzeichen fand, dass sie „meine Kinder“ meinte. Sie referierte, welche Fortschritte sie machten, wo sie Probleme sah. Tatsächlich waren es aber keine Probleme mehr, weil sie die Lösung im nächsten Atemzug mitlieferte. Anscheinend war seine Meinung nicht wirklich gefragt. Vielmehr schien sie ihm ihre Entscheidungen in der Absicht mitzuteilen, dass er die damit verbundenen, oft erheblichen Kosten akzeptieren möge. Er ließ sich dabei auf keine Diskussionen ein, denn gegen das Argument, man wolle doch nur das Beste für die Kinder, und ob er das etwa anders sähe, hätte er nichts ausrichten können.
Mit den Kindern hatte Zita einen Schutzwall gegen seine Libido errichtet. Er war der Meinung, dass sie einer dauerhaften Desexualisierung erlegen war und nach Gerrits Geburt der Auffassung, alle so genannten ehelichen Pflichten erfüllt zu haben. Fortan war sie ausschließlich Mutter und wies die Avancen ihres Gatten im Ehebett zurück. Selten ließ sie es im Wortsinn lustlos über sich ergehen, bis er seine diesbezüglichen Bemühungen endgültig einstellte. Die Folge war, dass er ab und an die Dienste einer Edelkurtisane in Anspruch nahm, die ihm ein Geschäftsfreund vermittelt hatte. Ein offenes Gespräch über den Zustand der Ehe fand nie statt. Dafür war er in diesen Dingen zu gehemmt und sie sah ebenfalls keine Veranlassung, das Thema anzusprechen. Schließlich hatte sie ihm klar genug zu verstehen gegeben, was sie wünschte und was nicht, und er hatte ihr die Verantwortung für die Kinder übertragen.
So wuchs die Entfremdung zwischen ihm und Zita. Sie verstand es, sich zur alleinigen Bezugsperson für Sarah und Gerrit zu machen. Sein Bemühen um sie bestand in Geschenken, die er von seinen zahlreichen Geschäftsreisen mitbrachte. Opportunistisch wie Kinder meist sind, gelang es ihm damit, ihre Zuneigung wachzuhalten – erkaufte Liebe, wie er bald erkannte.
Nach wenigen Jahren lebten sie wie unzählige Paare in einer klassischen, uninspirierten Ehe nebeneinander her – bis zu jenem Ereignis, das die Mutter veranlasste, mit den Kindern – Sarah war sechs Jahre alt, Gerrit vier – fluchtartig das Haus zu verlassen. Er durchlebte eine kurze Periode seelischen Chaos‘. Dann breitete sich ein Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber dem getrennten Rest der Familie in ihm aus.
Etwa ein halbes Jahr nach Zitas Flucht überkreuzten sich ihre Scheidungsanträge, was Zufall und ebenso eine logische Folge war. Danach interessierte es ihn nicht mehr, wo sie lebten und was sie machten. Er hatte alle Vorgänge rund um die Trennung aus seinem Leben gestrichen. Zita, die mit der Scheidung wieder ihren Mädchennamen Kastell angenommen hatte und auch die Kinder umbenennen ließ, war nahezu inexistent geworden. Gelegentliche Schriftwechsel, den monatlichen Unterhalt betreffend, wickelten die Rechtsanwälte ab.
Frauen? Dieses Kapitel, im Sinne einer engeren Bindung, hatte er abgeschlossen. In Abständen ergaben sich Affären, die er rasch wieder beendete, sobald sie ihn zu sehr von seiner Firma ablenkten oder nicht mehr reizten. Selten verbrachte er ein Wochenende in einem Wellness-Hotel, inklusive bezahlter Begleitung: Vergnügen ja, aber bitte ohne Verpflichtung.
5.
Der Liegestuhl mit Sonnenschirm, den Carl an der Marina Piccola gemietet hatte, stand in einer Reihe mit weiteren Exemplaren auf einer bewirtschafteten Strandterrasse, wo er sich einen Eiskaffee bestellte. Den Schirm hatte er auf Beschattung ausgerichtet, sich bis auf die Boxershorts, die er unter der Leinenhose trug, entkleidet, Hose mit Sakko, einmal gefaltet, neben sich auf den Terrassenboden und den Hut obenauf gelegt. Das Kopfteil der Liege stellte er etwas steiler und nahm wieder die Lektüre der Zeitung auf. Nur kurz, denn bald war er eingenickt. Es war ein Schlaf mit bizarren Träumen. Gegen zwei Uhr erwachte er mit unveränderter Missstimmung.
Weder zum Abendessen im Hotel noch während des anschließenden Spaziergangs durch die Sträßchen des Ortskerns hatte er den Trübsinn ablegen können. Vor dem Zubettgehen widerstand er der Versuchung, die Medikamente doch wieder in ursprünglicher Dosierung einzunehmen. Nein, klein beigeben war nicht seine Sache. Am folgenden Tag würde er den Spaziergang zum Tiberiuspalast unternehmen: zuerst ins Café, dann zu den Ruinen des einst prunkvollen Palasts des römischen Kaisers.
Was der kurze Schlaf unter dem Sonnenschirm angekündigt hatte, war in der Nacht mit Wucht aufgetreten. Wie in früheren Jahren quälten ihn wider gewalttätige Albträume. Seit er die Antidepressiva regelmäßig einnahm, waren sie ausgeblieben. Offenbar machte sich die Halbierung der Dosis bemerkbar. Trotzdem, er würde diese Nebenwirkungen durchstehen. Auf dieser wunderbaren Insel mit all den Erinnerungen musste es ja bald besser werden.
*
Die nervige Göre gehörte doch zu den Hotelgästen. Erneut hörte er ihr Quietschentenorgan, zum Glück drei Tische entfernt. Trotzdem beendete er die Zeitungslektüre bald und brach in Richtung Tiberiuspalast auf – einer der vielen Ankerplätze seiner Erinnerungen an Leonie.
Zu Beginn der Via Le Botthege, wo beiderseits Ladengeschäfte teuren Schmuck, exquisite Textilien und handbemalte Töpferwaren anbieten, passte er sich der Trägheit des dichten Besucherstroms an. Der lichtete sich bald, wo die Läden spärlicher wurden und der Weg ihn aus der Ortsmitte hinausführte. Wenngleich die Straßen in und um den Ort mit „Via“ benannt waren, stellten sie nur gut ausgebaute Fußwege dar, auf denen schmale Elektrokarren verkehrten und die Fußgänger sich oft an Hauswände drücken mussten, um die Fahrzeuge passieren zu lassen.
Der mit Kopfstein gepflasterte Weg war ein enger, schattiger Schacht mit beiderseits aufragenden Wohnhäusern, der sich in eine stetig ansteigende Galerie öffnete. Auf der linken Seite weiterhin Häuser, zumeist Pensionen und Hotels im Stil der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Rechts war der Blick frei auf die vielen üppig grünen Gartengrundstücke mit den kleinen, schmucken Villen, in denen sich diskret der Wohlstand der Capresen verbirgt.
Bald vernahm Carl nur noch den unkoordinierten Chor der Vögel, atmete tief durch und sog die warme, würzige Luft ein. Nachdem er schon einige Höhenmeter geschafft hatte, blickte er zurück über den Sattel, in dem der Ort eingebettet lag. Jenseits davon stiegen die