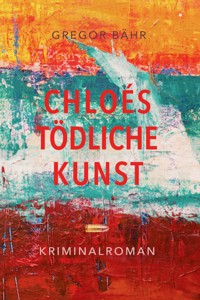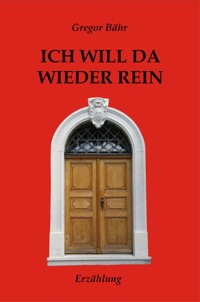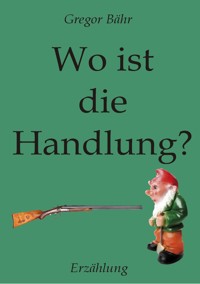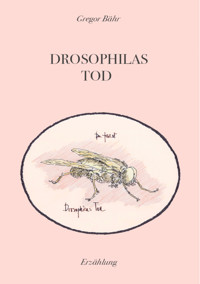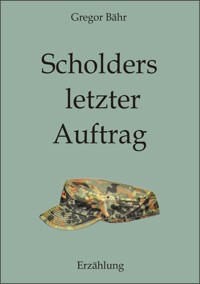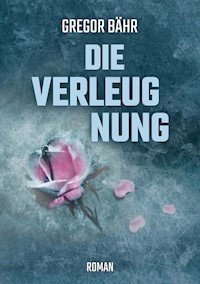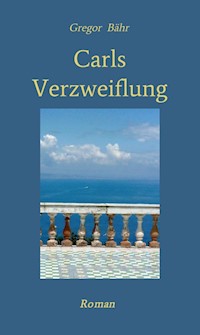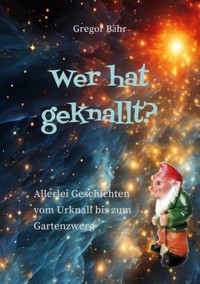
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Großen und Kleinen, vom Leben und Lieben, von Versuch und Irrtum, von Lebensfreude und Genuss handeln die Geschichten unbeschwerter Zeitgenossen, gescheiterter und dennoch tapferer Helden, zweifelhafter Virtuosen und offensichtlicher Dilettanten. Siebzehn Erzählungen, Kurzgeschichten und Mini-Storys, von amüsant über skurril bis nachdenklich, sind die ideale Begleitlektüre in der U-Bahn, am Strand oder als Betthupferl zum sanften Geleit in Morpheus Arme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gregor Bähr
Wer hat geknallt? - Allerlei Geschichten vom Urknall bis zum Gartenzwerg
Impressum
© 2023 Gregor Bähr
Website: gregorbaehrautor.de
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Titelgestaltung: Gregor Bähr
Bildnachweis:
‘Urknall’: Pixabay, © InfiniteFantasy
‘Gartenzwerg’: Fotolia, © weseetheworld
Autorenporträt: © Thomas Bender Fotografie
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Gregor Bähr, Gaisburgstr. 29, 70182 Stuttgart, Germany.
Zu diesem Erzählband Angesichts der galaktischen Ausmaße, die das Universum vom Urknall vor vielen Milliarden Jahren bis heute angenommen hat, mutet der thematische Bogen zum Gartenzwerg recht abenteuerlich an. Aber so ist nun mal der Mensch: Demut vor dem Großen, dem schier Unvorstellbaren ist nicht seine Stärke. Im Gegenteil, er ersinnt immer neue, kühne Theorien. Gleichzeitig aber sucht er Zuflucht im Kleinen, Überschaubaren und Vertrauten und findet nicht einmal dort sein Paradies. Ja, große Fragen stellen und nicht beantworten können, dafür aber im Kleinen versagen – das sind die beiden wahren Seelen in unserer Brust.
Vom Großen und Kleinen, vom Leben und Lieben, vom Scheitern und Aufstehen, von Lebensfreude und Genuss handeln die Geschichten gescheiterter und dennoch tapferer Helden, zweifelhafter Virtuosen und offensichtlicher Dilettanten. Folglich passt in diesen Rahmen die Geschichte des Philosophen, der die Frage stellt, “Wer hat geknallt?“ und stattdessen die Antwort zum Wertekanon der Drosophila Melanogaster – gemeinhin als Fruchtfliege bekannt – erhält.
Doch die meisten der in diesem Buch enthaltenen Erzählungen, Kurzgeschichten und Mini-Stories geben Antworten auf gar nicht gestellte Fragen – von amüsant über skurril bis nachdenklich.
Gregor Bähr
wurde als Nachkriegsmodell geboren und ist aufgewachsen in wirtschaftswunderlichen Zeiten. Am altsprachlichen Gymnasium musste er sich mit Caesar und Homer herumschlagen und lernte danach Offsetdrucker. Die erste Mondlandung erlebte er im Wehrdienst bei einer Sanitätseinheit. Drei Jahre nach der Studentenrevolte studierte er in Berlin Wirtschaftskommunikation und Marketing. Ein Sidestep in die Tourismusbranche führte ihn für zwei Jahre nach Süditalien. Nach seiner Rückkehr arbeitete er in mehreren Marketing-Agenturen. Seit dem Mauerfall ist er freier Werbetexter und schreibt seit einigen Jahren auch Romane. Gregor Bähr wohnt in Stuttgart.
Gregor Bähr
Wer hat geknallt?
Allerlei Geschichten vom Urknall bis zum Gartenzwerg
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Urheberrechte
Titelblatt
Angstschweiß im Angesicht des Publikums
Ausgesperrt
Hugo und ich
Tierisch lyrisch (1)
Wenn bei Capri…
Erotischer Wunschtraum im Mai
Einfach cool
Begegnung am Aufzug
Drosphilas Tod (Wer hat geknallt?)
In der Eisenbahn
Scheiße gelaufen
High Noon
Wo ist die Handlung?
I Shot the Sheriff
Kindergartenliebe
Tierisch lyrisch (2)
Die Ampel an der Kreuzung
Scholders letzter Auftrag
Ganz entspannt
Wer hat geknallt?
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Angstschweiß im Angesicht des Publikums
Ganz entspannt
Wer hat geknallt?
Cover
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Angstschweiß im Angesicht des Publikums
Vor der Autorenlesung greift der erfahrene Literat nochmal prüfend an den Hosenschlitz, ob er auch zu ist und stürmt dann selbstbewusst aus der Kulisse an sein Lesepult. Der Debütant hingegen krallt sich hinterm Vorhang an einer Stuhllehne fest oder beißt verzweifelt in sein Leseexemplar, bevor er sich beim Stichwort der Gastgeberin oder des Begrüßungsredners mit weichen Knien dem Publikum nähert. Ich bin der Debütant. – – Also los!
Guten Abend, liebes Publikum!
Glauben Sie bitte nicht, dass ich wirklich der bin, den Sie hier vor sich stehen sehen. Schlimmer noch: Sie sehen quasi ein Mensch gewordenes Phantom. Und überdies sieht jeder von Ihnen ein anderes. Wenn also Sie als Publikum – ich zähle mal kurz durch – 17 Personen sind, dann stehe ich hier auf diesem kleinen Podest in 17-facher Ausfertigung vor Ihnen. Das wäre ein veritabler Männerchor! Da ich nun allem Anschein nach aber doch allein hier zu sehen bin, wäre ich folglich eine multiple Persönlichkeit. Dazu kommt, dass ich Sie ebenfalls sehe: 17 Personen, in der Mehrzahl weiblichen Geschlechts. Das wären schon 34 und damit eine Verdoppelung der Personenzahl, nun als gemischter Chor. Dann zähle ich mich als Einzelperson dazu. Denn ich glaube, dass ich nicht multipel, sondern einmalig bin - gerne auch im doppelten Wortsinne. Damit wären wir 35.
Diese verwirrende Vorstellung und natürlich die bange Frage: Wie werden Sie auf meine Lesung reagieren, treibt mir vor jedem Auftritt Fieberschweiß auf die Stirn – bis zu dem Moment, da ich vor Ihnen stehe und mit dem Satz beginne: Glauben Sie bitte nicht, dass ich wirklich der bin, den Sie hier vor sich stehen sehen … Dann werde ich augenblicklich total cool. – Das ist pure Psychologie. Ich muss mir nur die Zusammenhänge bewusst machen, dann erklärt sich mein Problem des Lampenfiebers und löst sich in Wohlgefallen auf.
Es ist doch so: Wir kontrollieren nicht fortwährend, was in unserem Oberstübchen passiert. Im Gegenteil, unser Gehirn arbeitet ganz überwiegend autonom. Wir können es bekanntlich auch nicht abstellen – obwohl manche Zeitgenossen zuweilen diesen Eindruck vermitteln. Nein, unbewusst läuft und läuft unser Gehirn im Hintergrund mit. Momentan sitzen Sie hier in Erwartung, was kommen wird. Das machen sie sich aber nicht bewusst, Sie denken nicht: Momentan sitze ich hier in Erwartung, was kommen wird. Statt dessen beobachten sie mich intuitiv und nehmen vielleicht das Bild auf: Typisch Schriftsteller, wie der daherkommt mit seinem braunen Cord-Sakko und Jeans – das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ihre Nachbarin sieht mich gleichzeitig aber so: Ziemlich schmächtig, der Typ, kann wohl gerade mal die Schreibfeder halten. Oder Sie, Verehrteste in der ersten Reihe, haben den zwiespältigen Eindruck: kein Adonis, aber vielleicht schreibt er gut. – Das ist der zweite Knackpunkt: Wird mein Werk bei Ihnen ankommen? Wird Ihnen gefallen, was ich daraus vorlesen werde? Wobei ich nicht weiß, was mich mehr in Panik versetzt: die Vorstellung, von jedem von Ihnen anders wahrgenommen zu werden und Sie mich sozusagen in Einzelwahrnehmungen zerlegen, tranchieren und sezieren. Oder ist es die Befürchtung, dass ich mit meinem Buch Ablehnung, gar heftige Kritik einstecken muss?
Ich leide also unter der Angstvorstellung, dass ich für jeden und jede von Ihnen ein Anderer bin, obwohl ich doch von mir als einem Unikat überzeugt bin. Das gilt im Übrigen auch für mein Werk, aus dem ich gleich vorlesen werde. Sie nehmen ja nicht einfach nur zur Kenntnis, was ich Ihnen biete, sondern Sie bewerten das Gebotene. Ihre Wahrnehmungen sind an ein Bewertungssystem gekoppelt, das Sie sich im Lauf der Zeit aufgebaut haben. Alle machen das. In jedem Moment, in dem wir uns unter Menschen bewegen, gleichen wir unsere Wahrnehmungen mit dem Fundus dieses Bewertungssystems ab. Wir fungieren unbewusst ständig als Kampfrichter, die ihre Punktetäfelchen von 1 bis 10 hochhalten. Kleidung 1, Gestik 4, Vortrag 5, Handlung des Textes 8, Schreibstil 6. Wie anders kämen wir sonst zu einem Urteil, ob uns jemand sympathisch ist oder nicht? Oder ganz konkret, ob Ihnen gefällt, was ich Ihnen gleich vorlesen werde.
Indem Sie hier sitzen, bauen Sie - wohlgemerkt unbewusst - Steinchen für Steinchen Ihrer Beobachtungen zu einem Bild zusammen. Und weil das jeder für sich macht, kommt dabei eine Heerschar von Figuren heraus, die jede ich sein soll, obwohl keine mir ähnlich ist in der Art wie ich mich selbst sehe. Das kommt ja auch noch hinzu: mein riesiges Unbehagen über den tiefen Graben zwischen meiner Selbstwahrnehmung und Ihrer Fremdwahrnehmung.
Das sind die Gründe für mein höllisches Lampenfieber vor jeder Lesung: gescannt zu werden von zig Augenpaaren. Jeder legt eine andere Messlatte an. Jede und Jeder urteilt über mich. Es ist das Gefühl, von Ihren Blicken durchlöchert und von Ihren Gedanken ins Maß genommen zu werden. Das ist wie der Gang zum Schafott, als würde ich jedes Mal vor einer versammelten Schar von Scharfrichtern auftreten. – Ja, ich weiß, Sie sind ein braves Publikum, ein milde gestimmtes, aufgeschlossenes Publikum. Aber solche Selbstbeschwörungen noch 5 Minuten vor Lesungsbeginn nützen nichts, überhaupt nichts.
Deshalb diese kurze Vorrede, bevor ich in den Lesungsabend einsteige. Jede Veranstaltung beginnt damit. Indem ich das erzähle, sage ich es mir selbst vor. Ich tue nur so, als würde ich Ihnen das alles vortragen. Stattdessen nehme ich damit meine AntiLampenfieber-Medizin ein. Dieses Vorwort ist nichts anderes als Autosuggestion, ein Mantra: Om mani padme hum. Und ich sage Ihnen: Die Medizin wirkt. Sie wirkt jedes Mal – besser als jedes Beruhigungsmittel. – Ich bin ganz ruhig, habe kein Lampenfieber. Om mani padme hum. – So, dann wollen wir mal!
Ausgesperrt
Im Vorwärtsstürmen nach draußen durch die Haustür stoppte Tobi ruckartig, drehte sich auf dem Absatz um und setzte zu einem verwegenen Sprung an. Da machte es auch schon ‚Klack’. Ein metallisches Klack, das so unwiderruflich, so endgültig klang, dass er laut „Scheiße“ rief. Wütend trat er gegen das schwere, zweiflügelige Portal, da der automatische Schließer die Tür soeben zurück ins Schloss gedrückt hatte. Nun stand er draußen und die Schlüssel lagen drinnen. Synchron mit dem Tritt brüllte er noch einmal: „Scheiße!“ Es war am frühen Abend des letzten Freitags vor Weihnachten.
Tobias Lackschus, kurz Tobi oder auch Lacki genannt, war Grafik-Designer. Er hatte sein Atelier, das sich im Hochparterre des vierstöckigen, denkmalgeschützten Geschäftshauses befand, etwas überhastet verlassen.
Eigentlich war Tobi ein sanfter Mensch. Nur bei versehentlich sich schließenden Türen, die er dann nicht mehr öffnen konnte, bekam er einen Wutanfall. Und im Malträtieren von Türen hatte er Erfahrung. Denn die Haustür zu seinem Atelier war nicht die erste, die ihm mit diesem charakteristischen ‚Klack‘ den Wiedereintritt in die jenseitige Atmosphäre verweigerte. Seine Wohnungstür beispielsweise, von schwarzen Striemen gezeichnet, konnte ein Lied über solche Misshandlungen singen. Die Wut, die jedes Mal bei diesem Geräusch in ihm aufstieg, entsprang dem Gefühl, plump überrumpelt worden zu sein. Dazu spielte sich zwanghaft in seinem Kopf dieser stumme und unversöhnliche Dialog zwischen der Tür und ihm ab:
Die Tür: „Schlüssel?“
Tobi: „Liegt drinnen.“
Tür: „Und jetzt?“
Tobi: „Ich muss rein.“
Tür: „Vergiss es.“
Deshalb empfand er die Situation stets als einen Akt der persönlichen Zurückweisung durch die Tür. Sie stellte sich ihm in den Weg, verweigerte die Korrektur seines vergesslichen Handelns und ließ ihn nicht zurückkehren, um so wieder in den Besitz seines Schlüssels zu kommen.
Im Prinzip sei doch eine Tür, so entwickelte er gerne seine Theorie, nichts weiter als ein rechteckiges Loch in der Wand – genau genommen ein Nichts, das seine Wahrnehmbarkeit nur seiner materiellen Umgebung verdanke. Wenn dieses Nichts sich erdreiste, als selbst ernannter Türsteher ihm den gewohnten Zugang zu verwehren, betrachte er dieses Konstrukt als seinen persönlichen Feind.
Diese abstruse Argumentation führte regelmäßig zu einer völlig verqueren Diskussion. Wie bitte schön, könne man ein Nichts, also etwas, was es Tobis Aussage zufolge gar nicht gab, als Feind betrachten? Und überhaupt: Eine Tür sei ein Gegenstand, dem man weder menschliche Eigenschaften noch absichtliche Verhaltensweisen unterstellen könne.
Tobi aber ließ sich nicht davon abbringen, dass er mit Türen, vor allem mit verriegelten Türen, auf Kriegsfuß stand – nicht weil er es provozierte, sondern weil Türen, die sich nur von innen ohne Schlüssel öffnen ließen, per se hinterhältig seien.
Dabei verdanke die Tür, so fuhr er zunehmend empört fort, ihre Machtstellung doch nur dem Umstand, dass er den passenden Schlüssel als Legitimation für den ungehinderten Zugang nicht vorweisen und benutzen könne. Diese ihr so unverhofft zuteil gewordene Macht nutze die Tür ungerechtfertigt aus und wende sie schamlos gegen ihn an …
Wie dem auch sei, – hätten seine Freunde das Geschehnis zwischen dem vergeblichen Sprung zurück zur Haustür und der lauthalsen Frust-Äußerung mit anschließendem Fußtritt beobachtet, hätten sie wohl gemeinsam schmunzelnd und einhellig nur gesagt:
„Typisch Tobi“, was sich auf eines seiner persönlichen Markenzeichen bezog: Er war der Inbegriff des Zerstreuten, des Hans Guckindieluft, des Träumers, der sich viel lieber mit absurden Gedanken und phantastischen Bildern in seinem Kopf beschäftigte, als mit der Wirklichkeit um sich herum. Aus dieser Geistesabwesenheit ergaben sich immer wieder merkwürdige Situationen, die nur Tobi passieren konnten.
Ein weiteres Markenzeichen des überaus kreativen Grafikers war seine eigenwillige Garderobe, mit der er wie sein eigener Opa daherkam: verknitterte Baumwollhemden mit schmalem Kragensaum, in den die Träger zwei oder drei Generationen zuvor den gestärkten, separaten Kragen und die ebenfalls gestärkte Hemdbrust einknöpften; dazu Stresemann-Hosen im gleichen antiquierten Schnitt, gehalten von original dazu passenden Hosenträgern. Seine Füße steckten grundsätzlich in verschiedenfarbigen Socken, vorzugsweise Miss-Piggy-Pink und Kermit-Grün. Dazu trug er sommers wie winters die berüchtigten Riemensandalen, mit denen heute noch schmerbäuchige Touristen an den Stränden von Mallorca negativ auffallen. Dabei war er das genaue Gegenteil: eine lange, dünne Gestalt, die von einem ungebändigten schwarzen Haarschopf gekrönt war.
Ohne Zweifel war er ein sympathischer Typ, vor allem, wenn er sein verschmitztes Grinsen aufsetzte. Das brachte ihm nicht nur Erfolge in der Damenwelt, sondern auch in beruflicher Hinsicht. So hatte sich in letzter Zeit alles fein in seinem Sinne entwickelt.
Vor kurzem war er noch Art Director in einer Werbeagentur. Aber weil er mit dem neuen Geschäftsführer nicht klar kam, war er eines Tages einfach nicht mehr gekommen und die Verwirrung daraufhin groß. Denn der Chef hatte dem Agenturkunden zugesichert, dass Tobi am Wochenende in der Agentur noch ein Handout für eine Printbroschüre anfertigen und sie in den Briefkasten des Kunden einwerfen würde, damit dieser sie gleich am Montagmorgen vorfände und zur Produktion freigeben könnte – wie immer waren die Termine äußerst knapp.
Das Handout hatte der Kunde aber am Montag nicht vorgefunden. Deshalb rief er gleich in der Agentur an und fragte danach. Weil Tobi nicht da war, nahm der Chef den Anruf entgegen und musste seine Unwissenheit offenbaren, was Chefs bekanntlich gar nicht schätzen. Wortreich versicherte er, sofort nachzuforschen, was geschehen und wo das Layout abgeblieben sei: „Herr Lackschus ist leider noch nicht an seinem Arbeitsplatz. Ich werde aber die Fehlleistung umgehend aufklären und Herrn Lackschus zur Rede stellen, sobald er eintrifft.“
Dazu hatte der Chef aber keine Gelegenheit mehr. Stattdessen erhielt er nämlich am späten Vormittag per Post einen Brief von Tobi mit der handschriftlichen Mitteilung, dass das Layout in einem Schließfach im Bahnhof zu finden sei, der Schlüssel dafür läge bei. Im Übrigen hätte er sich spontan entschlossen, ein paar Tage Urlaub in Paris zu machen. – – Der Geschäftsführer schäumte, der Kunde war verschnupft und Tobi gefeuert.
Natürlich war nichts so spontan, wie es schien, sondern wohl durchdacht und vorbereitet. Einerseits wollte er dem Chef eins auswischen, weil sich Tobi von ihm schlecht behandelt fühlte, unter anderem wegen zu wenig Gehalt und zu viel Arbeit, verbunden mit der Aufforderung, morgens gefälligst pünktlich zu sein. Das abendliche Open End und Wochenendarbeit, um dringende Jobs termingerecht zu erledigen, wurden dagegen als selbstverständlich vorausgesetzt. Andererseits hatte er aber auch nicht im schnöden Streit die Brocken einfach hinwerfen wollen, weil es seinem guten Ruf in der Branche geschadet hätte. Deshalb war ihm die Idee dieses kreativen Abgangs gekommen, der in der lokalen Szene für schadenfrohes Gelächter sorgte. Auch hatte Tobi schon einen Raum als Atelier im Fotostudio seines alten Freundes Heiko angemietet. Von dort aus kurbelte er kurz nach seiner Rückkehr aus Paris, wo er tatsächlich ein paar Tage mit seiner aktuellen Affäre namens Inga verbracht hatte, das Neugeschäft an: Er verschickte an örtliche Werbeagenturen und Firmen ein Mailing mit einem in Pappe nachempfundenen Schließfachschlüssel, dazu einen Begleitbrief, der in launigen Worten auf seinen neuen Status als selbstständiger Grafik-Designer aufmerksam machte.
Die vielen Bilder in seinem Kopf und die Fähigkeit, sie im Sinne seiner Kunden virtuos umzusetzen, waren der Hauptgrund, warum er schnell zum gefragten Freelancer wurde. Dazu kam seine fröhliche Unbekümmertheit, die durch die neu gewonnene Freiheit weiter angeregt und von so manchem ‚Agentursklaven’ heimlich beneidet wurde. Die Aufträge kamen rein, ohne dass er sich um sie bemühen musste. Seine Ideen waren stets so brillant, dass seine Kunden die chronisch geplatzten Termine als drittes, unvermeidbares Markenzeichen gleich mit einkalkulierten. Es war also „alles tippitoppi“, wie Tobi zu sagen pflegte. Was das alles mit der zugeschlagenen Haustür zu tun hat? Vordergründig nicht viel, letztlich aber doch alles. Denn Tobi war nicht nur ein sympathischer Träumer und hochtalentierter Grafiker, sondern auch ein Sonntagskind, ein Glückspilz, dem alles scheinbar anstrengungslos in den Schoß fiel. Folglich hatte er keine Veranlassung, etwas an sich und seinem Verhalten zu ändern oder gar in Selbstzweifel zu verfallen. Er blieb der unbeschwerte Luftikus, der liebenswerte Schussel, dem immer mal wieder eine Tür vor der Nase zuknallte – oder ein Kofferraumdeckel, wie damals mitten in der Toskana.