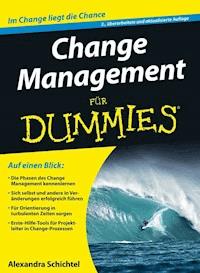
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Unternehmen stehen vor allem in Krisenzeiten vor der Aufgabe, sich Veränderungen inner- und außerhalb des Unternehmens zu stellen, um ihre Existenz langfristig zu sichern. Alexandra Schichtel zeigt in "Change Management für Dummies" Entscheidern, Erleidern, Engagierten und Interessierten, was Veränderungen für die Organisation und die Menschen darin bedeuten, wie Sie mit Ängsten umgehen können und als Führungskraft Betroffene für die Veränderung gewinnen, welche Haltung und zentralen Tools Sie als Projektleiter für die Steuerung von Change-Prozessen benötigen und wie Sie sich als Mitarbeiter in der Veränderung erfolgreich neu orientieren und einbringen können. Die Autorin erklärt, wodurch fundamentaler Veränderungsbedarf entsteht, was einen Change-Prozess ausmacht, wie Sie mit dieser Situation umgehen können und welche Rolle jede Hierarchiestufe einer Organisation für die erfolgreiche Veränderung hat. Schritt für Schritt führt Alexandra Schichtel Sie dann behutsam durch die Phasen der Veränderungen und zeigt, worauf Sie achten sollten, damit Sie und Ihre Organisation die Veränderung erfolgreich bewältigen.Change Management ist Handwerk, nicht Hexenwerk. Dieses Buch macht Mut und jeden in seiner Rolle wieder handlungsfähig - gerade in turbulenten Zeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2., aktualisierte und überarbeitete Auflage 2016
© 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress aretrademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States andother countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sindMarken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeitvon Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © Fotolia.com – richardlyons
Korrektur: Geesche Kieckbusch, Hamburg und Frauke Wilkens, München
Satz: inmedialo Digital- und Printmedien UG, Plankstadt
Print ISBN: 978-3-527-71162-8ePub ISBN: 978-3-527-80027-8mobi ISBN: 978-3-527-80028-5
Über die Autorin
Dr. Alexandra Schichtel ist die Inhaberin der Managementberatung Change Compass für Change Management und Unternehmensentwicklung. Seit vielen Jahren berät sie Führungskräfte bei der Steuerung von Veränderungsprozessen in Unternehmen, öffentlicher Verwaltung und Non-Profit-Organisationen.
Dr. Alexandra Schichtels Beratungsschwerpunkte im Change Management beinhalten die strategische Zielfindung, die Gestaltung von Veränderungsprozessen, Führen und Kommunizieren im Change und die Analyse und Veränderung der Unternehmenskultur. Sie begleitet Führungskräfte und Projektleiter als strategische Sparringspartnerin, Coach, Trainerin und Moderatorin. Sie unterstützt ihre Kunden dabei, die Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten der angestrebten Veränderung besser zu verstehen und erfolgreich umzusetzen.
Ein besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt auf wirkungsvollen Maßnahmen, die helfen, der wachsenden Veränderungsmüdigkeit in Unternehmen mit innovativen Methoden und emotionaler Intelligenz zu begegnen. Und sie unterstützt Führungskräfte dabei, Wege der gesunden Mitarbeiter- und Selbstführung zu finden.
Vor ihrer Karriere als Beraterin war Dr. Alexandra Schichtel als Leiterin im Business Development und kaufmännische Leiterin in einer großen Fachverlagsgruppe für die Strategieentwicklung, die Unternehmenssteuerung, den Aufbau neuer Geschäfte, Restrukturierungen, Zu- und Verkauf von Geschäftsteilen, den Ausbau von Kooperationen und die Steuerung großer IT-Projekte zuständig. Ihre kaufmännische Expertise in Verbindung mit ihrem sozialwissenschaftlichen Hintergrund baut die Brücke zwischen den wirtschaftlichen und den sozialen Komponenten von Veränderungsvorhaben.
Außerdem ist Dr. Alexandra Schichtel an Hochschulen als Lehrbeauftragte für Change Management tätig.
Mehr Informationen finden Sie auf der Website www.change-compass.de.
Wenn Sie Dr. Alexandra Schichtel als Beraterin, Trainerin, Coach, Rednerin oder Moderatorin kontaktieren möchten, senden Sie eine E-Mail an info@change-compass.de.
Danksagung
Ein solches Buch kann nicht entstehen, wenn es nicht auf den vielen Erkenntnissen und Ideen all derer fußen könnte, die ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Mein Dank gilt:
Allen Praktikern und Wissenschaftlern, die bereits zum Thema Change Management publiziert haben und die Professionalisierung von Change Management, Organisationsentwicklung und Unternehmensentwicklung vorantreiben.
Meinen Kunden, die ich den vergangenen Jahren begleiten und von denen ich lernen durfte.
Allen Führungskräften, die sich in Zeiten der Veränderung gut um ihre Mitarbeiter kümmern und ihnen damit eine Stütze sind.
Allen Betroffenen, die offen und kritisch den Blick nach vorn richten.
Inhaltsverzeichnis
Über die Autorin
Danksagung
Einführung
Wer sollte dieses Buch lesen?
Über dieses Buch
Konventionen, die in diesem Buch verwendet werden
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Teil I: Change-Management-Basics
Teil II: Was Sie bei einem Change-Projekt erwartet
Teil III: Das Vorgehen im Change Management
Teil IV: Ihre eigene Rolle im Change
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I Change-Management-Basics
1 Durch den Dschungel der Begriffe
Beispiele für Veränderungen
Veränderungen im beruflichen Umfeld
Veränderungen im gesellschaftlichen Bereich
Veränderungen in der Wirtschaft
Veränderungen im privaten Umfeld
Veränderung ist Teil des Lebens
Zentrale Fragen für Führungskräfte im Wandel
Wandel ist überall
Der Unterschied zwischen Change und Evolution
Was die begriffliche Trennung von Evolution und Change bringt
Der Übergang zwischen Evolution und Change ist individuell
Change Management – viel Verwirrung um einen Begriff
Was ist Change Management?
Was ist der Gegenstand von Change Management?
Wofür wendet man Change Management an?
Wie wendet man Change Management an?
Wer managt da was und wen im Change Management?
Stakeholder im Change-Prozess
Analyse: Die Stakeholder bestimmen
Wen wie managen: Stakeholder-Management
Teil II Was Sie bei einem Change-Projekt erwartet
2 Im Wechselbad der Gefühle – Emotionen im Prozess des Wandels
Durch Verstehen zu Gelassenheit
Die Normalität: Veränderungen werden abgelehnt
Typische Reaktionen, mit denen Sie rechnen müssen
Die Gründe für die Abwehr kennenlernen
Den Übergang von Alt zu Neu bewerkstelligen
Der Unterschied zwischen Change und Transition
Das Transition-Modell
Faktoren, die Einfluss auf die Reaktion der Betroffenen ausüben
Folgeerscheinung einer Veränderung: Produktivitätsverlust
Auswirkungen von Stress
Ursachen von Stress
Von harten Weicheiern und soften Machern
Der betriebswirtschaftliche Nutzen von Change Management
In der betriebswirtschaftlichen und sozialen Dimension der Veränderung gleichzeitig handeln
Was Sie gegen die Orientierungslosigkeit im Change tun können
Stärken Sie die Zusammenarbeit der Betroffenen
Bereiten Sie die Führungskräfte auf die Veränderung vor
Bauen Sie bei den Betroffenen Vertrauen auf
Stärken Sie vorhandene Stärken der Betroffenen
Erinnern Sie sich: Was Sie erleben, ist normal
3 Die Phasen des Wandels
Die Bedeutung von Phasenmodellen im Change
Kurt Lewin – der Vater aller Phasenmodelle
Erste Phase: »Unfreezing« – Auftauen
Zweite Phase: »Changing« – Verändern
Dritte Phase: »Freezing« – Einfrieren
John Kotter – die acht Schritte erfolgreichen Wandels
Schritt 1: Wecken Sie ein Gefühl der Dringlichkeit
Schritt 2: Vereinen Sie die richtungweisenden Personen in einem starken Change-Team
Schritt 3: Entwickeln Sie eine Vision für die Zukunft
Schritt 4: Vermitteln Sie Vision und Strategie
Schritt 5: Ermöglichen Sie anderen Eigendynamik und Handlungsfreiheit
Schritt 6: Sorgen Sie gezielt für kurzfristige, sichtbare Erfolge
Schritt 7: Bauen Sie erreichte Verbesserungen konsequent aus
Schritt 8: Verankern Sie die Veränderungen im Alltag
Integriertes Phasenmodell des Wandels
Leitfragen des integrierten Modells
Das Phänomen der Phasenverschiebung
Wie lange dauern Change-Prozesse?
Abhängigkeit vom Veränderungsziel
Abhängigkeit von der Organisationskultur
Abhängigkeit von den Individuen
Teil III Das Vorgehen im Change Management
4 Erkennen, welches Vorgehen zu Ihrer Organisation passt
Die Unterscheidungsmerkmale von Organisationen
Pionierphase oder reife Organisation?
Das Wachstum von Organisationen ist eine Abfolge von erfolgreich bewältigten Krisen
Modell der Organisationsreife – Tipps für Führungskräfte
Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft schaffen
Leitlinien für das Vorgehen im Change
Die Vielschichtigkeit von Veränderung berücksichtigen
Den Change als Prozess gestalten
Befehlen oder beteiligen?
Wann beteiligen Sie wen und wie im Change? Wann lieber nicht?
Das Menschenbild beeinflusst das Vorgehen beim Change
Unterschiedliche Menschenbilder und ihre Auswirkungen auf den Change
Was das Menschenbild für das Change Management bedeutet
5 Die Kultur der Organisation im Change berücksichtigen
Der Begriff »Unternehmenskultur«
Ebenen der Unternehmenskultur
Ausdrucksformen und Einflussfaktoren der Unternehmenskultur
Warum Unternehmenskultur wichtig ist
Was die Kultur für die Organisation leistet
Orientierung geben
Das Verhalten von Menschen eigenständig steuern
Effizienz über Rituale sichern
Veränderungen nachhaltig sichern
Die Eigenheiten unserer Branche, unserer Kultur
Organisationstypen und ihr Verhältnis zu Change
Leitlinien kultureller Veränderung in Organisationen
6 Dos im Change Management: Die Chance auf erfolgreichen Wandel steigern
Die menschliche Seite der Veränderung systematisch in den Veränderungsprozess einbeziehen
Mit den Veränderungen an der Spitze beginnen und glaubwürdig handeln
Alle Ebenen in den Change-Prozess einbinden
Ein Gefühl der Dringlichkeit schaffen
Eine Atmosphäre der Selbstverpflichtung und des Engagements schaffen
Die Kultur der Organisation frühzeitig analysieren
Sich auf das Unerwartete vorbereiten
Veränderungskonzepte individuell entwickeln
Veränderung als Prozess gestalten
Die Betroffenen aus der Komfortzone holen, ohne sie zu überfordern
Offen, ehrlich und in die Change-Strategie integriert kommunizieren
Kommunikation als strategischen Erfolgsfaktor begreifen
Ein Change-Team mit echter Veränderungsbereitschaft zusammenbringen
Eine Vision für die Veränderung entwickeln
Die Veränderung fest verankern
Eine positive, chancenorientierte Grundeinstellung zur Veränderung einnehmen
Systematisch über den Tellerrand der unmittelbaren Zuständigkeit schauen
Erwartungsmanagement betreiben
7 Don’ts im Change Management: So nicht! – Bremsen für das Change Management
Zu früh den Sieg feiern
An der Oberfläche kratzen
Veränderung als Lichtschalter verstehen: »Umlegen – fertig!«
Den Change delegieren
Eng kontrollieren
Aus Kostengründen kein Change Management betreiben
Change Management nebenbei betreiben
Sich selbst und die Organisation überfordern
Kurzfristige Erfolge proklamieren, aber nicht einlösen
Manipulieren, aber nicht beteiligen
Widerstand als grundsätzliche Ablehnung auffassen
Die Salamitaktik anwenden
Starr an der Planung festhalten
Change-unerfahrene Projektleiter berufen
8 Kommunizieren im Change-Prozess
Warum Kommunikation im Change-Prozess besonders wichtig ist
Was Sie mit Change-Kommunikation bewirken können
Der Beitrag von Kommunikation zum Erfolg ist messbar
Change-Kommunikation investiert in vier Märkte
Aufgaben der Change-Kommunikation
Warum läuft es dann nicht?
Grundlagen und Grundfunktionen von Kommunikation
Das Grundmodell der Kommunikation: Sender und Empfänger
Nachrichten haben vier Ebenen
Man kann nicht nicht kommunizieren
Die mentale Abstraktionsleiter
Die Störanfälligkeit von Kommunikation
Was der Sender tun kann
Was der Empfänger tun kann
Aktives Zuhören
Funktionen der Kommunikation
Kommunikationswege beeinflussen Entscheidungen
Kommunikation macht Leader
Was Change-Kommunikation vom Alltagsgeschäft unterscheidet
Das finden Sie in der Regel vor: Die kommunikative Ausgangssituation
Ihre Aufgabe als Change-Kommunikator
Erfolgsfaktoren bei der Change-Kommunikation
Erste-Hilfe-Tipps für die operative Umsetzung
Das Vorgehen klar analysieren
Bei Empfängern die Bereitschaft erzeugen, überhaupt zuzuhören
Was – wann – an wen – wie viel – und wie: Der Kommunikationsplan
Was der Kommunikationsplan leistet
Ein Beispiel aus der Praxis
Besondere Anforderungen an die Top-Manager hinsichtlich der Change-Kommunikation
Tipps für besondere Situationen
Teil IV Ihre eigene Rolle im Change
9 Plötzlich Leiter für ein Change-Projekt – und nun?
Warum ich?
Sich einen Überblick über die Erwartungen verschaffen
Ihre Chancen als Projektleiter für Ihre berufliche Zukunft
Dann sind Sie als Change-Projektleiter erfolgreich
Kann ich das? Will ich das?
Das Kompetenzprofil eines Projektleiters
Ihre Rollen als Projektleiter im Change
Der Erste-Hilfe-Kasten für Change-Projektleiter
Punkt 1: Projektstatus grob bestimmen – wo stehen Sie im Projekt?
Punkt 2: Den Projektauftrag vertiefen
Punkt 3: Persönliche Beziehungen aufbauen
Punkt 4: Interessengruppen analysieren
Punkt 5: Vorläufige Projektorganisation entwerfen
Punkt 6: Kick-off für die Projektbeteiligten zeitnah organisieren
Punkt 7: Projektmanagement im Detail aufsetzen
Nach Unterstützung für das Change-Projekt suchen
Interne Kompetenzen bündeln – ein Change-Team gründen
Externe Unterstützung in Anspruch nehmen
10 Als Führungskraft im Scheinwerferlicht
Führungskraft – Manager – Leader
Die Aufgaben einer Führungskraft im Change
Ziele setzen und ihre Erreichung kontrollieren
Rahmenbedingungen und Prozesse steuern
Glaubwürdig handeln
Strategien entwickeln
Mitarbeiter motivieren
Führen in Zeiten des Wandels
Zusätzliche Arbeitsbelastung
Ansprüche an Führungskräfte im Veränderungsprozess
Schlüsselqualifikationen für Führungskräfte im Change
Die Rolle des Top Management im Change
Sich aktiv und sichtbar engagieren
Die Organisation mitreißen
Den Rahmen für eine nachhaltige Wirkung des Change etablieren
Die Rolle des Middle Management im Change
Die Sandwichposition des Middle Management
Die Machtposition des Middle Management
Der erste Schritt zur Lösung: Führungskräfteentwicklung
Change-orientierte Führungskräfteentwicklung
Projektbezogene Führungskräfteentwicklung
Personenbezogene Führungskräfteentwicklung
Führungstipps für Veränderungssituationen
Zuversichtliche Grundstimmung verbreiten
Gemeinsames Lernen organisieren
Sich an den vorhandenen Stärken orientieren
Präsenz und Nähe zeigen
Chancen und Bedrohungen vermitteln
Klare Worte finden
Trennungsgespräche richtig führen
Die eigene Widerstandsfähigkeit trainieren (Resilienztraining)
Projektorientiert arbeiten
Vertrauen in die Zukunft schaffen
Persönliches Vorbild geben
Ziele als Kompass im Nebel einsetzen
Sicherheit innerhalb der Veränderung vermitteln
Sich selbst und die Mitarbeiter fokussieren
Besonnen auf die Forderung nach mehr Ressourcen reagieren
11 Umgang mit Widerstand und Konflikten
Widerstand erkennen
Die Häufigkeit von Widerstand
Indirekter Widerstand
Messbarer Widerstand
Widerstand kommt auch aus dem Management
Auslöser von Widerstand
Die vier Hauptquellen von Widerstand
Weitere Gründe für Widerstand
Die Funktion von Widerstand
Widerstand konstruktiv nutzen
Vier Grundsätze für den Umgang mit Widerstand
Tipps für den Umgang mit Ihren Interessengruppen
Mitstreiter gezielt gewinnen und motivieren
Wenn aus Widerstand ein Konflikt wird
Was Konflikte von Widerstand unterscheidet
Die Rolle von Konflikten im Veränderungsprozess
Konflikte erkennen
Konfliktursachen
Konfliktbearbeitung
Konfliktgespräche führen
Teil V Der Top-Ten-Teil
12 (Mehr als) zehn große Missverständnisse rund um das Change Management
Fast alle Change-Management-Projekte scheitern
Change Management bedeutet Kuschelkurs mit den Mitarbeitern
Change Management ist nur für Weicheier und passt nicht in die harte Unternehmenswelt
Change Management nimmt den Führungskräften die Entscheidungsmacht
Wenn ich Change-Manager engagiere, gebe ich zu, dass ich die Sache nicht selbst im Griff habe
Ich bin so beschäftigt, da habe ich für Change Management keine Zeit
Bei den Betroffenen handelt es sich immer um Mitarbeiter
Change Management ist Gehirnwäsche für die Mitarbeiter
Die Beteiligung der Betroffenen hilft immer
Nicht über Veränderung reden, sondern machen
Change Management als Coaching-Maßnahme begreifen
Change ist ein IT-Thema
13 (Mehr als) zehn ChangeManagement-Bücher, die Sie lesen sollten
Bridges, William: Managing Transitions (2010)
Doppler, Klaus / Lauterburg, Christoph: Change Management (2014)
Doppler, Klaus / Fuhrmann, Hellmuth / Lebbe-Waschke, Birgitt / Voigt, Bert: Unternehmenswandel gegen Widerstände (2013)
Drucker, Peter F.: Die fünf entscheidenden Fragen des Managements (2009)
Fisher, Roger / Ury, William / Patton, Bruce: Das Harvard-Konzept (2014)
Glasl, Friedrich: Konfliktmanagement (2013)
Heller, Jutta: Resilienz: 7 Schlüssel für mehr innere Stärke (2013)
Hüther, Gerald: Biologie der Angst. Wie aus Stress Gefühle werden (2012)
Kotter, John P. / Rathgeber, Holger: Das Pinguin-Prinzip (2011)
Portny, Stanley E.: Projektmanagement für Dummies (2011)
Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander Reden 1 – 3 (2005 – 2013)
Senge, Peter M.: Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxis der lernenden Organisation (2011)
Stolzenberg, Kerstin / Heberle, Krischan: Change Management: Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten – Mitarbeiter mobilisieren (2013)
Storch, Maja: Das Geheimnis kluger Entscheidungen (2011)
Wellensiek, Sylvia Kéré: Handbuch Resilienz-Training (2011)
OrganisationsEntwicklung
Stichwortverzeichnis
Einführung
Willkommen im Change Management! Sie haben sich mit diesem Buch einen Kompass gekauft, der Sie durch die Welt des Change Management leiten wird. Es gibt ziemlich viele Anekdoten darüber, was Change ist und was nicht, aber häufig bleibt nebulös, was denn darunter verstanden wird. Praktisch also, wenn man eine Orientierungshilfe hat.
Die Erwartungen an das, was bei einem Change passiert, wie lange er dauert und wie herausfordernd er sein kann, fallen sehr unterschiedlich aus. Deshalb kommt es häufig zu Missverständnissen oder Konflikten. Allerdings gibt es inzwischen einige gesicherte Erkenntnisse darüber, was zu einem erfolgreichen Change gehört und was es für Betroffene und Beteiligte bedeutet, wenn eine Organisation sich verändert. Change Management für Dummies führt Sie daher zu den größten Sehenswürdigkeiten im Land des Change: Diese Orte müssen Sie einfach gesehen haben! Manchmal wird solch eine Reise ein abenteuerlicher Rundgang, wenn Sie sich beispielsweise mit der Machete durch den Dschungel der Begriffe schlagen müssen. Aber mit der dadurch gewonnenen begrifflichen Klarheit können Sie dann gefahrlos weitergehen. Dieses Buch warnt Sie rechtzeitig vor organisatorischem Treibsand, sozialen Fallgruben und bringt Sie sicher über strategisches Glatteis. Und dann führt das Buch Sie noch zu den Orten, wo Tipps und Ratschläge auf Sie warten, mit denen Sie die Veränderung meistern. Im Reisegepäck finden Sie Erste-Hilfe-Kästen für Führungskräfte und Projektleiter, damit Sie handeln können, bevor Sie sich Blasen an den Füßen gelaufen haben.
Dieser Kompass erlaubt Ihnen eine stressfreiere Reise im Land der Veränderung. Change ist nie ohne Überraschungen (Sie werden lesen, warum). Aber mit diesem Buch können Sie sich orientieren und deshalb Ihre nächsten Schritte besser lenken. Und nach der Lektüre können Sie andere leichter auf die Change-Reise in Ihrer Organisation mitnehmen. Wo manche nur reißende Flüsse sehen, erkennen Sie bereits die Furt und haben Ideen, wie Sie sie überqueren könnten – also wie Sie die Veränderung managen können.
Wer sollte dieses Buch lesen?
»Fehlende Vorbereitung des Linienmanagements gefährdet Transformationserfolg« titelte 2008 die Pressemitteilung einer Change-Management-Studie. Obwohl es schon jahrzehntelange Erfahrung mit Erfolgsfaktoren und Stolpersteinen im Change gibt, sind diese Erkenntnisse noch kein breites Allgemeingut in der Managementpraxis. Dieses Buch ist deshalb vor allem für die Verantwortlichen im Change Management geschrieben:
für Führungskräfte: Sie sind die Leitenden in einem Change-Prozess und haben ganz unterschiedliche Rollen je nach der Stufe, auf der sie in der Organisationshierarchie angesiedelt sind. Je nach Hierarchiestufe gehören die Führungskräfte zum Top Management, Middle Management oder Lower Management.
für Leiter eines Change-Projekts: Sie leiten ebenfalls, aber ohne formale Macht, und halten alle Handlungsstränge in der Organisation zusammen.
für Mitarbeiter: Sie sind den Wogen der Veränderung häufig ohne Orientierung ausgesetzt und gleichzeitig am Ende verantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung der Veränderung.
Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie Ihren Aufgaben entspannter und zielstrebiger nachgehen können, weil Sie Ihr eigenes Verhalten und Ihre Rolle im Change besser verstehen. Auch die Rolle Ihrer Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeiter ist dann klarer umrissen und die Zusammenarbeit im Change mit ihnen dadurch wesentlich stressfreier. Problemtrance: Ade! Initiative: Willkommen!
Wenn Sie also weniger Getriebener als vielmehr aktiver Steuermann im Change sein wollen – egal auf welcher Hierarchiestufe der Organisation –, dann liegen Sie mit diesem Buch richtig.
Über dieses Buch
Change Management für Dummies bündelt für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus rund 50 Jahren Change Management. Inzwischen haben sich bestimmte Vorgehensweisen und Maßnahmen als besonders erfolgreich herausgestellt. Sie sind hier zusammengefasst. Das Buch versammelt auch wesentliche Forschungsergebnisse, aber vor allem ihre praktische Anwendung.
Allerdings bietet dieses Buch kein Kochrezept nach dem Motto: »Man nehme nur dies und das, und schon ist der Change erfolgreich!« Diese Wunderformel gibt es nicht (und diese Erkenntnis unterscheidet die Change-Management-Methode von der Change-Management-Mode). Betrachten Sie dieses Buch als einen guten Freund, bei dem Sie sich bei Bedarf Anregung holen können. Die jeweilige Situation einschätzen und sich für eine Vorgehensweise entscheiden, müssen Sie aber immer selbst. Denn nur Sie kennen die individuellen Voraussetzungen, unter denen die Veränderung stattfinden soll, in der Sie gerade stecken.
Ich belästige Sie daher nicht mit Detaildarstellungen, sondern gebe Ihnen mit dem »Best of« aus der Change-Management-Praxis und wichtigen Tipps einen (Buch-)Partner für die berufliche Praxis an die Hand. Indem Sie Ziele, Zusammenhänge und grundsätzliches Vorgehen verstehen, sind Sie gerüstet, um später aus der Masse der Fachliteratur über Change Management die für Sie passenden Informationen herauszusuchen. Und damit der Unterhaltungswert größer ist, mache ich um die Fachsprache, soweit möglich, einen Bogen.
Sie haben Fragen oder Anregungen zum Buch und würden sich gerne dazu austauschen? Dann sprechen Sie mich gerne an. Sie erreichen mich unter info@change-compass.de.
Konventionen, die in diesem Buch verwendet werden
Mehrere Hundert Seiten Text sind leichter zu lesen, wenn es ein paar Hinweisschilder gibt. Ich habe mich deshalb an folgende Regeln gehalten:
Jedes Mal, wenn ich einen neuen Begriff einführe, ist er kursiv gesetzt und wird definiert.
Auch ein Begriff, der sehr wichtig für den Zusammenhang ist und den Sie nicht überlesen sollten, ist kursiv gesetzt.
Fett gedruckt sind Schlüsselwörter.
Aussagen von Change-Management-Gurus sind als Zitate hervorgehoben.
Was Sie nicht lesen müssen
Ich nehme einmal an, Sie wollen nicht jedes Wort in diesem Buch lesen müssen, weil Sie ziemlich viel zu tun haben. Eilige lassen deshalb die grauen Kästen und die Beispiele aus der Praxis weg. Zwar finden Sie dort spannende Hintergrundinformationen oder Übungen, aber die holen Sie einfach nach, wenn Sie mehr Zeit mitbringen.
Törichte Annahmen über den Leser
Vielleicht stehen Sie gerade in der Buchhandlung und denken sich: »Klingt ja wirklich interessant, aber ist das auch etwas für mich ganz persönlich?« Dann lesen Sie einmal die folgenden Annahmen, denn so habe ich Sie mir als Leser vorgestellt:
Sie haben Lust auf seriöse, praxiserprobte Informationen, die leicht verständlich geschrieben sind.
Sie schlafen über akademischen Wortpirouetten genauso ein wie über abstrakt-theoretischen Metadialogen (genau: so eben nicht!).
Sie wollen mit diesem Buch drei Dinge bekommen: theoretische Absicherung, praktische Anwendbarkeit und Spaß beim Lesen.
Sie übernehmen Verantwortung in einem Veränderungsprozess beziehungsweise eine Veränderung kündigt sich in Ihrer Organisation an. Jetzt wollen Sie sich zügig einen fundierten Überblick verschaffen über das, was auf Sie zukommt.
Sie wollen sich an einem Wochenende über das Wesentliche von Change Management informieren.
Sie wollen wissen, worauf Sie achten müssen, damit ein Change-Vorhaben erfolgreich ist.
Und Sie sind sich dessen bewusst, dass Sie mit einem Buch alleine nicht zum Change Manager werden, da dies Übung, genaue Beobachtung und individuelles Vorgehen braucht. Aber Sie wollen eine gute Grundlage legen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Insgesamt umfasst dieses Buch fünf Teile. Wie bei allen ... für Dummies-Büchern sind alle Kapitel und sogar alle Abschnitte so aufgebaut, dass sie losgelöst von den anderen gelesen werden können. Sie können also mit dem Kapitel beginnen, das Sie am meisten reizt. Zwischen den Kapiteln gibt es Querverweise, wo Sie an einer anderen Stelle zusätzliche Informationen finden.
Hier lesen Sie im Überblick, was Sie in den einzelnen Teilen erwartet.
Teil I: Change-Management-Basics
Teil I ist zugleich Kapitel 1. Hier geht es zunächst um wesentliche Anlässe für und Auslöser von Veränderungen aus dem beruflichen, privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich. Danach erfahren Sie den Unterschied zwischen Change und Evolution und welchen Nutzen diese Differenzierung für die Praxis hat. Sie lesen außerdem, was Change Management ist, was der Gegenstand der Veränderung ist und wofür das Ganze eigentlich gut ist. Und zum Schluss erfahren Sie, welche beteiligten und betroffenen Interessengruppen (Stakeholder) es in einer Veränderung geben kann und wie man sie herausfindet.
Teil II: Was Sie bei einem Change-Projekt erwartet
Veränderungen sind immer von starken Gefühlen begleitet. Abwehr dominiert dabei regelmäßig die anderen Gefühle wie Neugier. Warum das normal ist und welche Hintergründe es dafür gibt, erfahren Sie in Kapitel 2. Kapitel 3 zeigt, was diese Emotionen für den Prozessverlauf der Veränderung zur Folge haben, wie Stress entsteht und in welchen Phasen sich Change abspielt. Noch spannender sind die Hinweise, wie Sie mit diesen Emotionen bei sich und anderen gut umgehen und mit welchen Maßnahmen Sie die einzelnen Phasen der Veränderung begleiten können.
Teil III: Das Vorgehen im Change Management
In diesem Teil lesen Sie, nach welchen Gesichtspunkten sich entscheidet, welches Vorgehen zur Veränderung Ihrer Organisation passt. Sie erhalten Leitlinien für das Vorgehen und erfahren von den Vor- und Nachteilen, die es mit sich bringt, Betroffene an der Veränderung zu beteiligen. Die Kultur einer Organisation spielt für das Vorgehen eine große Rolle. Warum das so ist und wie Sie daraus Nutzen ziehen können, erfahren Sie in einem weiteren Kapitel. Die Dos and Don’ts im Change Management fassen prägnant die bisher bekannten größten Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für organisationale Veränderungen zusammen. Zu einem der größten Erfolgsfaktoren, der Change-Kommunikation, erhalten Sie zahlreiche Hintergrundinformationen und Praxishilfen in einem eigenen Kapitel.
Teil IV: Ihre eigene Rolle im Change
Wer als Führungskraft in Top oder Middle Management für Veränderung verantwortlich ist, erfährt in diesem Teil, was seine ganz besondere Rolle für erfolgreichen Change ist. Beispiele aus der Praxis, ein Erste-Hilfe-Kasten für Projektleiter und zahlreiche Tipps zu Führung und Resilienz helfen Ihnen, Ihre Aufgabe wahrzunehmen. Wenn Sie Unterstützung brauchen, zeigen Ihnen die entsprechenden Abschnitte in den Kapiteln, wie Sie sich diese organisieren können. Und weil Widerstand ein unvermeidbares Phänomen in einer tief greifenden Veränderung ist, handelt ein Kapitel ausführlich davon, wie Sie damit umgehen können.
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Hier können Sie sich in ganz knapper Form mit den größten Missverständnissen auseinandersetzen, die es zu Change Management gibt.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Im gesamten Buch finden Sie Symbole. Das sind kleine Grafiken an den linken Seitenrändern. An diesen Stellen möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die folgenden Dinge lenken:
Wichtige Informationen oder Gedanken, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie die vorgestellten Techniken und Vorgehensweisen anwenden.
Dieses Symbol ist ein Hinweis auf praktische Ideen und Tipps, mit deren Hilfe Sie das Gelesene in die Praxis umsetzen können. Probieren Sie das mal aus!
Mögliche Stolperfallen und Gefahrenstellen. Sollten Sie unbedingt vermeiden!
Beispiele aus der Praxis, die die im Text vorgestellten Theorien und Probleme verdeutlichen.
Übungen oder Selbsttests in den grauen Kästen sind mit diesem Symbol hervorgehoben.
Wie es weitergeht
Jetzt wissen Sie, worum es in Change Management für Dummies geht, und können sich nun aussuchen, womit Sie am liebsten anfangen wollen. Das Inhaltsverzeichnis hilft Ihnen dabei, Ihren Startpunkt auszumachen.
Wenn Sie den Unterschied zwischen Change und Evolution (siehe Kapitel 1) schon kennen, können Sie sowieso direkt zu Ihrem Lieblingskapitel springen. Wenn Sie das allerdings nicht wissen, empfehle ich, doch erst Kapitel 1 zu lesen. Hier werden die zentralen Begriffe geklärt, die Ihnen im ganzen Buch immer wieder begegnen.
Nachdem Sie das Buch gelesen haben, werden Sie sich in Sachen Change Management deutlich sicherer fühlen. Für echte Sicherheit brauchen Sie allerdings praktische Übung, zum Beispiel um als Projektleiter oder Führungskraft sicher durch einen Change führen zu können. Wenn möglich, sollten Sie dazu nicht auf das nächste Change-Projekt warten, das könnte unnötig hektisch werden. Vielmehr empfehle ich Ihnen in diesem Fall, sich zusätzlich zu diesem Buch durch Trainings- oder Praxisgruppen vorzubereiten.
Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Teil I
Change-Management-Basics
In diesem Teil . . .
In diesem Teil geht es um die wesentlichen Auslöser von Veränderungen aus dem beruflichen, privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich. Danach erfahren Sie den Unterschied zwischen Change und Evolution und welchen Nutzen diese Differenzierung für die Praxis hat. Sie lesen außerdem, was Change Management ist, was in einer Organisation verändert wird und wofür das Ganze eigentlich gut ist. Und zum Schluss erfahren Sie, welche beteiligten und betroffenen Interessengruppen (Stakeholder) es in einer Veränderung geben kann, wie man sie identifiziert und mit ihnen in einem Change-Prozess umgeht.
1
Durch den Dschungel der Begriffe
In diesem Kapitel
Erfahren, was Change Management ist
Den Unterschied zwischen Change und Evolution verstehen
Grundlegende Begriffe des Change Management kennenlernen
Die Stakeholder im Change kennenlernen
Wandel, Wechsel, Entwicklung, Transformation, Erneuerung, Neuregelung, Abweichung, Bewegung, Korrektur, Modifikation, Neuerung, Reform, Umwandlung, Wende, Neubeginn, Neuordnung, Revolution, Variation, Umgestaltung, Beginn, Ende, Change – Veränderung hat viele Namen. Würde man alle Begriffe hinzunehmen, die die Veränderung zugleich bewerten (zum Beispiel Verbesserung, Verschlechterung, Fortschritt, Niedergang), dann wäre die Liste noch um ein Vielfaches länger. Und die verschiedenen Wege der Veränderung (zum Beispiel Umstrukturierung, Fusion, Prozessoptimierung, neues Führungsmodell) machen die Liste schier endlos.
Dieses Kapitel schafft Klarheit in der Begriffsvielfalt rund um die Veränderung und erläutert, was Sinn und Zweck von Change Management ist. Sie erfahren außerdem, wie Change Management mit den Disziplinen Organisationsentwicklung und Unternehmensentwicklung zusammenhängt, die auch häufig im Zusammenhang mit Veränderungen in Organisationen genannt werden. Zum Schluss zeigt das Kapitel, welche Personengruppen in einem Change berücksichtigt werden müssen und warum man auf diese Personengruppen individuell eingehen muss.
Beispiele für Veränderungen
Die Gründe für eine Veränderung sind sehr vielfältig. Auslöser können aus der Mitte der Organisation, aber auch von außen kommen. Dabei kann es sowohl um Chancen als auch um Risiken gehen.
Die Auslöser sind so individuell wie die Organisationen selbst. So können sehr erfolgreiche Unternehmen gerade wegen ihres Erfolgs gezwungen sein, sich ganz neu aufzustellen. Firmen der Solarbranche beispielsweise wuchsen zunächst so schnell, dass sie in kurzer Zeit viele neue Mitarbeiter in die Organisation integrieren mussten. Was gestern noch eine kleine Gründergruppe mit informellen Kommunikationsstrukturen war, musste sich dann strukturell und formal ganz neu aufstellen, weil die alten Abläufe einfach nicht mehr passten. Heute schrumpft die Zahl der Anbieter bereits wieder.
Da Menschen Veränderungen gegenüber tendenziell ablehnend gegenüberstehen (siehe Kapitel 2), werden Veränderungen häufig nicht vorausschauend in Angriff genommen, sondern erst dann, wenn der Veränderungsdruck so groß ist, dass diese Tatsache nicht mehr verdrängt werden kann. Risiken und Bedrohungen von außen sind in der Regel auch mit großem Zeitdruck verbunden.
Veränderungen gibt es im privaten, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich und haben ganz unterschiedliche Gesichter. Eine Idee von dieser Vielfalt vermitteln die folgenden Abschnitte, in denen wichtige Trends beispielhaft zusammengefasst sind. Abbildung 1.1 stellt diese Trends im Überblick vor.
Abbildung 1.1: Megatrends und ihre Einflüsse auf das Arbeitsumfeld
Zu diesen großen Trends gehören die Globalisierung und Regionalisierung, technologische Entwicklungen, gesellschaftliche und Umweltveränderungen und andere Arten zu arbeiten. All diese Trends haben erhebliche organisatorische, berufliche und private Auswirkungen.
Veränderungen im beruflichen Umfeld
Sie arbeiten in einem Unternehmen, das durch eine Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten geraten ist? Dessen Produkte keine Abnehmer finden? Sie arbeiten in einem Verband, der unter Mitgliederschwund leidet? Oder Ihre Organisation expandiert so stark, dass sie sich ganz neu erfinden muss und damit alle Strukturen und Abläufe auf den Prüfstand stellt? Durch Änderungen auf der Nachfrageseite (zum Beispiel wie in der Automobilindustrie 2009/2010), veränderte Produktionsbedingungen (zum Beispiel durch die Verlagerung ins Ausland) oder neue Konkurrenten gehen die Umsätze zurück? Oder ist »irgendwie« erkennbar, dass dringend gehandelt werden muss, nur noch nicht, wie? Nur so viel ist sicher: Wie bisher geht es nicht mehr weiter? Oder arbeiten Sie in einem Unternehmen, dem es gut geht, das sich aber auf absehbare Trends vorbereiten und deshalb vorausschauend schon einiges ändern will? Vielleicht werden Abteilungen umstrukturiert, neue Formen der Zusammenarbeit erprobt, Sie selbst müssen um- oder dazulernen? Ihr Arbeitsplatz ändert sich inhaltlich, Sie sitzen plötzlich woanders und mit neuen Kollegen zusammen?
Vielleicht ziehen Sie aber auch in eine andere Stadt, haben eine neue Stelle angetreten, bekommen einen neuen Chef, der ganz anders ist als Ihr Vorgesetzter bei Ihrem alten Arbeitgeber?
All das sind Beispiele aus dem beruflichen Umfeld, wenn die Veränderung Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Aufgaben betrifft.
Veränderungen im gesellschaftlichen Bereich
Die Gesellschaft ist permanenten Veränderungen unterworfen:
Demokratisierung, Industrialisierung, Säkularisierung, Informations-, Dienstleistungs- und Freizeitgesellschaft, demografische Änderungen beeinflussen sowohl das Zusammenspiel der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen als auch die Ansprüche von Mitarbeitern an Führungskräfte in Organisationen.
Neue gesellschaftliche Gruppen kommen auf und verändern die Ansprüche an Staat und Gesellschaft. Beispielsweise machen die Bedeutung und Zusammensetzung von Religionsgemeinschaften in einem Land einen Wandel durch. Das hat Auswirkungen auf das öffentliche Leben, auf Spendenflüsse und auf die interkulturelle Kompetenz der Bürger in diesem Land.
Traditionelle Geschlechterrollen verändern sich (zum Beispiel übernehmen Frauen zunehmend berufliche Führungsverantwortung und Männer nehmen Erziehungsaufgaben verstärkt wahr). Neue Familienmodelle entstehen.
Die wachsende Individualisierung ist zugleich Teil wie Treiber eines umfassenden gesellschaftlichen Wertewandels. Wir haben immer mehr Freiheiten im Vergleich zu vor 50 Jahren; der Einzelne kann und muss mehr Lebensentscheidungen allein treffen. Aufgrund der Ökonomisierung der Gesellschaft werden diese zunehmend unter maßgeblich finanziellen Gesichtspunkten getroffen (zum Beispiel bei der Frage, wann das Kinderkriegen am wenigsten karriereschädlich ist).
Neue Parteien entstehen, etablierte Parteien wenden sich neuen Wählerschichten zu.
Oder denken Sie an die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und demnächst privaten Folgen des Klimawandels: In Norwegen wird Wein angebaut, dank milder Winter ist die Malaria auf dem Weg nach Norden, Sturm und Hagelschäden belasten die Sicherheit und die Finanzinstitutionen (zum Beispiel bei Versicherungen). Von den kriegerischen Auseinandersetzungen um knappe natürliche Ressourcen wie Wasser ganz zu schweigen. Dies alles verändert gesellschaftliches Zusammenleben erheblich.
Jede Generation hat ihre eigenen Erfahrungen, aus denen sich ihr Verhalten speist. War die Nachkriegsgeneration stark von Sicherheitsdenken und Streben nach materiellem Wohlstand geprägt, stehen heute Lebensbalance und Gesundheit hoch im Kurs, während andere Bevölkerungsgruppen sich mit wachsender materieller Not konfrontiert sehen. Das hat Auswirkungen auf die Angebotspalette und Produktionsweise von Unternehmen und erzeugt Spannungen in der Gesellschaft.
Das politische System, in dem Sie leben, ist nicht mehr, was es einmal war. 1989 durfte man nach der friedlichen Revolution als DDR-Bürger plötzlich in die ganze Welt reisen, bald danach war das ganze DDR-System verschwunden. Millionen von Menschen mussten sich politisch wie gesellschaftlich neu orientieren.
Die demografische Entwicklung sorgt in den Industrieländern dafür, dass die bestehenden Sozialsysteme nicht mehr funktionieren: Wir werden immer älter. So gibt es zum Beispiel zu wenige Arbeitnehmer im Verhältnis zu Rentnern. Wir altern aber auch anders: Die traditionellen Altersrollen greifen immer weniger, ältere Menschen sind viel agiler und starten mit Ende des Berufslebens immer häufiger noch einmal neu. Durch neue Lebensphasen oder Schleifen entsteht eine Multigrafie, die die lineare Biografie des Industriezeitalters ablöst.
Die Folgen der Trends sind immer individuell zu betrachten und prägen sich je nach der konkreten Situation einer Organisation unterschiedlich aus. Dazu gehört zum Beispiel auch der Standort: Demografischer Wandel hat etwa in China ein ganz anderes Gesicht als in Deutschland!
Veränderungen in der Wirtschaft
Die Wirtschaft verändert sich rasant. Unter dem Stichwort »Globalisierung« ist eine Vielzahl von einzelnen Veränderungen gebündelt, die jeweils für sich bereits große Auswirkungen haben, beispielsweise:
Internationale Verflechtungen erhöhen die Veränderungsrate (auch in Zeiten relativer Stabilität).
Die Märkte werden weltweit schrittweise geöffnet. Das schafft auf den regionalen Märkten Konkurrenz und Leistungsdruck.
Junge Menschen in Deutschland sind zunehmend bereit, auf der Suche nach Entwicklungsmöglichkeiten nationale Grenzen zu überschreiten. Aus ihrer Perspektive ist Europa als Rekrutierungsmarkt zu verstehen, nicht nur Deutschland.
Es gibt globale Unternehmen mit deutscher Herkunft, in denen Mitarbeiter aus zum Beispiel 190 verschiedenen Nationen arbeiten. Interkulturelles Verständnis ist erforderlich, um erfolgreich auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten; wo es fehlt, ist der Unternehmenserfolg gefährdet.
Organisationen agieren zunehmend weltweit und nutzen die Vorteile des jeweiligen Landes oder Kontinents. So werden Abläufe in wissensbasierten Branchen (zum Beispiel in der Internetbranche) zunehmend global organisiert. Es ist also nicht mehr nötig, bestimmte Arbeiten zu unterbrechen. Denn wenn der eine Mitarbeiter Feierabend macht, kann ein Kollege auf der anderen Seite der Erdkugel die Arbeit übernehmen.
Transportdienstleistungen sind weltweit inzwischen so günstig, leicht verfügbar und zuverlässig, dass es für einen Auftraggeber viel attraktiver sein kann, Waren mehrere Tausend Kilometer entfernt von seinem Standort zu produzieren oder veredeln zu lassen. So werden etwa Krabben teilweise auf der einen Seite der Erdkugel gefangen, auf der anderen geschält und wieder woanders verkauft.
Die Anzahl der Anbieter in einzelnen Branchen nimmt ab, entweder weil sie sich gemeinsam gegen Konkurrenten zusammenschließen oder weil sie übernommen werden (beispielsweise in der Chemie- und Pharmabranche).
Es gibt ein Überangebot an Waren in unterschiedlichen Qualitäten. Das vorhandene Budget der Konsumenten verteilt sich damit auf viele verschiedene Anbieter. Eine auf »billig« fixierte Kultur entsteht.
Aber auch jenseits der Globalisierung gibt es große wirtschaftliche Veränderungen:
Staatsbetriebe werden privatisiert (zum Beispiel die Deutsche Bahn, die Deutsche Post, Energieversorgungsunternehmen); diese Unternehmen verlieren ihr Monopol. Das bedeutet Wettbewerb und ganz neue Verhaltensweisen. Plötzlich muss man Vertrieb und Werbung für etwas machen, zu dem die Kunden früher von selbst kamen; betriebswirtschaftliches Handeln ist also angesagt, wo vorher eher planwirtschaftlich gedacht wurde.
Neue Technologien beschleunigen den Wirtschaftskreislauf und den Austausch von Informationen (zum Beispiel durch Internet, E-Mail, Twitter, Facebook und Blogs).
Die sozialen Medien verwischen die Grenze zwischen privat und beruflich zunehmend. Während die Kommunikationsabteilung noch die zentralen Botschaften abstimmt, organisiert sich via Flashmob bereits eine Demonstration.
Die Demokratisierung der Gesellschaft führt zur stärkeren Einbindung von Betroffenen, etwa bei Infrastrukturprojekten (zum Beispiel Stuttgart 21 oder Ausbau des Stromnetzes).
Patente laufen aus, die für große Firmen bisher eine sichere Bank waren. Ein erhöhter Verbraucherschutz hat den Effekt, dass neue Produkte nicht so schnell auf den Markt kommen, wie etablierte Produkte im Patentschutz auslaufen (beispielsweise in der Wirkstoffentwicklung).
Die demografische Entwicklung führt zu Fachkräftemangel, zu zunehmender Vielfalt von Kulturen, zu größerer Bedeutung von Gesundheitsfragen und zu neuen Lehr- und Lernkonzepten. Organisationen müssen sich darum kümmern, dass ihre Mitarbeiter lebenslang lernen, weil es nicht ausreichend jüngere Nachfolger gibt, die eine nachlassende Innovationskraft ausgleichen können. Ältere Arbeitnehmer müssen ihre Beschäftigungsfähigkeit daher durch lebenslanges Lernen sichern – und entdecken, dass dies möglich ist.
Der Fachkräftemangel wird dazu führen, dass Firmen sich stärker spezialisieren und nicht mehr alles aus einer Hand bedienen können. Konkurrenten werden in Bereichen kooperieren, was als Coopetition bekannt ist.
Der Aufschwung der Wissensindustrie macht einzelne Arbeitnehmer weniger austauschbar und schafft neue Berufsbilder. Das Personal taucht in den Bilanzen also nicht mehr nur als Kostenfaktor auf, sondern zugleich als Werttreiber (im Englischen: Value Driver).
Veränderungen im privaten Umfeld
Selbst bei größter Stabilität der äußeren Verhältnisse könnte sich kein Mensch fundamentalen Veränderungen entziehen. Eine solche Veränderung ist etwa der biologische Lebenszyklus mit seinen Stufen Kindheit, Pubertät, Erwachsensein, Altwerden, Tod. Mit diesem Zyklus gehen automatisches (zum Beispiel Sprache und Kultur) und gezieltes Lernen (zum Beispiel Ausbildung), die Mitgliedschaft in sozialen Gruppen am Arbeitsplatz wie im privaten Umfeld oder persönliche Krisen (zum Beispiel der Verlust eines Partners) einher.
Im Privatleben wimmelt es von Veränderungen: Sie ziehen um, lernen neue Menschen und Kulturen kennen. Sie lernen von anderen und beeinflussen andere. Oder Sie kommen eines Tages nach Hause und müssen Ihre Wohnung plötzlich mit einem Haustier teilen, weil Ihr Partner sich einen Hund zugelegt hat.
Krisenrückblick
Krisen sind Wendepunkte und Entscheidungssituationen. Man weiß sie erst im Nachhinein zu »schätzen«, wenn man aus ihnen mit neu entwickelten Fähigkeiten hervorgegangen ist und sie gut durchlebt hat. Natürlich gibt es keine Garantie für glückende Krisenbewältigung. Aber das Wichtigste, was Sie in einer Krise tun können, ist, sich aktiv auf die Suche nach der Lösung zu machen (zum Beispiel: sich die Tipps in diesem Buch durchzulesen und sie auszuprobieren). Sie könnten stattdessen ja auch in Selbstmitleid versunken auf der Couch sitzen und an wen auch immer die Forderung richten, dass »man« Ihnen gefälligst aus der Krise helfen soll.
Die wichtigste Erkenntnis in einer Krise lautet also: Sie selbst sind verantwortlich, das in Ihrer Macht Stehende zu versuchen! Wer das anerkennt, hat den wesentlichen Schritt zur Krisenbewältigung bereits gemacht.
Erinnern Sie sich nun an eine abgeschlossene Krise, die Sie persönlich durchlebt haben:
Welche kritischen Veränderungen haben bei Ihnen im letzten Jahr stattgefunden?
Woraus bestand die Krise jeweils?
Mit welchen Mitteln haben Sie es geschafft, diese Krisen zu überwinden?
Wie blicken Sie heute auf diese Krisen zurück? Was haben Sie aus ihnen über sich gelernt (positiv/kritisch)?
Über welche Krisen sind Sie heute froh, über welche (noch) nicht?
Im Privatleben scheinen Veränderungen eher akzeptiert zu sein. Im beruflichen Kontext hingegen werden sie zwar verstandesmäßig erfasst, aber trotzdem eher mit Entrüstung und Widerstand bedacht. Versuchen Sie daher, die Normalität Ihrer privaten Veränderungserfahrungen auf Ihr Berufsleben zu übertragen. Vielleicht nimmt das der Krise ein Stück weit den Geschmack von Katastrophe.
Veränderungen sind also unvermeidbar, man muss gar nicht erst auf die Gesellschaft oder die globale Wirtschaft schauen. Wenn das so ist, dann ist es umso lohnender, die eigene Veränderungsfähigkeit zu trainieren und nicht krampfhaft zu versuchen, den Status quo zu erhalten. Der Status quo (der »gegenwärtige Zustand«) ist nur eine Augenblicksaufnahme, konstant ist der Wandel.
Veränderung ist Teil des Lebens
Wenn Sie sich die verschiedenen Beispiele zum Thema Veränderung in diesem Kapitel anschauen, werden Sie feststellen:
Veränderungen umgeben uns überall, sie sind ein unausweichlicher Teil des Lebens. Sie sind sogar das Wesen von Leben. Das heißt allerdings nicht, dass sie deshalb automatisch schön oder angenehm wären.
Wandel ist kein Übergangsstadium auf dem Weg zu einem (neuen oder alten) Gleichgewicht, das auf immer besteht. Vielmehr folgt auf Wandel weiterer Wandel. Die Zeit dazwischen ist nur eine etwas breitere Stufe vor dem nächsten Aufstieg am Berg.
Für Organisationen besteht der besondere Druck darin, dass sie Wachstum und gleichzeitig Kosteneinsparungen verwirklichen müssen. Früher waren das meistens hintereinander geschaltete Zyklen. Die Beschleunigung der Veränderungen bringt es aber mit sich, dass sich beide Zyklen mittlerweile weitgehend überlagern. Der Innovationsdruck steigt.
Zentrale Fragen für Führungskräfte im Wandel
Die Fähigkeit zum Wandel hat sich zum zentralen Erfolgsfaktor im Leben von Organisationen entwickelt, die Fähigkeit zum schnellen Wandel ist die Überlebensformel in der heutigen Wirtschaft.
Angesichts der Komplexität und der Geschwindigkeit von Veränderungen hat sich der Fokus für Führungskräfte von »Ordnung erhalten« auf »Veränderung gestalten« verschoben. Dabei beschäftigen sich Führungskräfte vor allem mit folgenden strategischen Fragestellungen:
Wandel ist unausweichlich. Was kann ich also tun, damit meine Organisation von den Veränderungen profitieren kann?
Wie gelingt es meiner Organisation, ihre Mitarbeiter zu befähigen, sich an kürzere Veränderungszyklen anzupassen?
Wie können wir als Führungskräfte und unsere Mitarbeiter angesichts des Perma-Change gesund bleiben?
Die Herausforderungen, die mit dem Wandel einhergehen, sind zu bewältigen. Die Bewältigung ist aber nicht ohne Mühe und Einschnitte zu erreichen. Echter Change bedeutet, sich den Fragen vorbehaltlos zu stellen und ergebnisoffen eine Lösung zu suchen. Der Versuch, einen Status quo entgegen geänderten Rahmenbedingungen zu erhalten, führt unweigerlich zu seinem Verlust.
Wandel ist überall
Vielleicht erleben Sie auch, dass Menschen meistens klagen, wenn es um »Veränderungen« geht.
Veränderungen »zum Guten« werden häufig als Selbstverständlichkeit gesehen. Die Menschen übernehmen die Vorteile in den Alltag und vergessen ziemlich schnell, dass es sich um eine Veränderung handelte. Nachteilige Veränderungen bleiben hingegen viel länger im Gedächtnis und werden laut diskutiert. Dabei wird vergessen, dass der Vorteil des einen Nachteile für andere haben kann – und umgekehrt.
Veränderungen haben immer positive und negative Seiten. Die Bewertung ist ein persönlicher Vorgang und hängt von der Perspektive ab. Ein Wandel oder eine Veränderung ist also für sich gesehen nicht gut oder schlecht, sondern bedeutet nur: Etwas ist oder wird anders. Das ist wertneutral. Was daraus wird, hängt davon ab, welche Bedeutung die betroffene Person ihm gibt!
Etwas anders zu machen braucht weniger Geld oder Hilfestellung, als Sie vermutlich denken. Es geht mehr um eine innere Haltung: Sie brauchen den Mut und den Willen zur Veränderung, Offenheit für den Weg zum Ziel und ein Umfeld, das Sie dabei grundsätzlich unterstützt.
Der Unterschied zwischen Change und Evolution
Bei einigen der in den vorangegangenen Abschnitten genannten Beispiele für Veränderungen vollzog sich der Wechsel eher Schritt für Schritt, beobachtbar und nachvollziehbar. Bei anderen Veränderungen hingegen kam alles sehr plötzlich und überraschend. Wie man sich dabei fühlt und damit umgeht, ist allein deshalb schon sehr unterschiedlich. Um diese »kleinen« und »großen« Veränderungen klar voneinander unterscheiden zu können, haben sich Fachbegriffe etabliert. Sie heißen »Evolution« und »Change««, »Veränderung« und »Wandel« sind die Oberbegriffe dafür. Wie diese Begriffe zusammenhängen, sehen Sie in Abbildung 1.2.
Um den kontinuierlichen vom abrupten Wandel zu unterscheiden, hat man die unterschiedlichen Veränderungen mit den Zusatzbezeichnungen »Wandel 1. Ordnung« und »Wandel 2. Ordnung« versehen. Diese Benennung dient zwar der begrifflichen Klarheit, ist aber auch etwas sperrig. Möglicherweise ist deshalb die Unterscheidung in Evolution und Change verbreiteter.
Evolution und Change unterscheiden sich wesentlich. Das Beispiel von Kerze und Glühbirne erklärt, warum.
Bei Evolution (Wandel 1. Ordnung) geht es um kontinuierliche Weiterentwicklung:
Es handelt sich um kleine, ineinanderfließende Schritte, die erst über einen längeren Zeitraum hin zu großen Veränderungen führen. Jeder einzelne Schritt ist aus dem vorhergehenden ableitbar, der Zusammenhang zwischen den Schritten ist erkennbar. Das, was durch Evolution entsteht, ist also eine Variante des Vorgängers, der zwar verändert ist, aber noch durchscheint. Beispiel: Eine weiße Kerze wird in ein Farbbad getaucht und erhält eine neue Farbe. Eine Kerze mit unterschiedlichen Farben bleibt immer noch eine Kerze: Sie erzeugt Licht durch offenes Feuer, das durch das Verbrennen von Wachs entsteht. Die Veränderung (der Farbwechsel) erfolgt also innerhalb der bestehenden Ausgangsbedingungen (Kerze).
Abbildung 1.2: Zusammenhang zwischen Veränderung/Wandel, Evolution und Change
Ein Baum ist im nächsten Jahr immer noch ein Baum, nur größer. Oder ein Kind wird geboren und wird allmählich erwachsen; es ist immer Mensch.
Die Suche nach evolutionären Verbesserungen stellt die bisherige Arbeitsweise nicht prinzipiell infrage, sondern nutzt sie als Ausgangsbasis für alle Weiterentwicklungen. Optimierungen erfolgen nur innerhalb des bestehenden Rahmens beziehungsweise Paradigmas (was ein Paradigma ist, erläutert der graue Kasten »Paradigmenwechsel« in diesem Kapitel). Beispiel: Der Ersatz von Bienen- durch Kunstwachs verringert den Aufwand für die Herstellung einer Kerze. Die Kerze ist aber immer noch eine Kerze, bestehend aus Wachs und Docht.
Auch die sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozesse (KVP) in Organisationen sind mit der jeweils bestehenden Denkhaltung kompatibel. Denn dabei geht es um die Optimierung etablierter Strukturen, Rollen und Verhaltensweisen, die nicht grundsätzlich infrage gestellt werden.
Die Denkweise, die dieser Art von evolutionärer Veränderung zugrunde liegt, ist tendenziell effizienzorientiert (»die Dinge richtig tun«, Peter F. Drucker): »Wie kann man dasselbe zum Beispiel schneller, kostengünstiger oder risikofreier machen?«, lautet die zentrale Frage. Quantitative Verbesserungen durch Üben und Optimieren stehen dabei tendenziell im Mittelpunkt.
Für das Verhalten von Menschen bedeutet Evolution eine Anstrengung, da sie bestehendes Verhalten optimieren müssen.
Bei Change (Wandel 2. Ordnung) geht es um umwälzendeVeränderungen:
Hier handelt es sich um drastische Entwicklungssprünge und Innovationen, also um etwas ganz Neuartiges. Beispiel: Die Glühbirne spendet zwar auch Licht wie eine Kerze, funktioniert aber ganz anders.
Die Raupe wird zum Schmetterling. Etwas völlig Neues entsteht. In der beruflichen Praxis sind dies zum Beispiel Fusionen von Firmen, der Verkauf von Unternehmensteilen, das Ausscheiden des Gründers aus der Firma, die Sanierung zur Abwendung der Insolvenz oder der Austausch eines Vorstands. Dies sind Veränderungen, die plötzlich kommen und sich fundamental auswirken.
Zwischen dem Alten und dem Neuen gibt es einen Bruch. Die Veränderung ist kurzfristig sichtbar, es gibt einen klaren Schnitt. Die Glühbirne ist gerade beispielsweise nicht aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung (Evolution) der Kerze hervorgegangen, sondern stellt etwas völlig Neuartiges dar, das nur dieselbe Funktion wie die Kerze übernimmt.
Der abrupte Wechsel erfordert ein völlig neues Denken und das Verständnis neuer Konzepte. Beispiel: Der Versuch, eine Glühbirne mit einem Streichholz anzuzünden, führt zu nichts. Stattdessen muss man den Zusammenhang von Schalter, Strom und Licht verstehen lernen. Change erfordert also einen Paradigmenwechsel.
Change-orientiertes Handeln ist effektivitätsbetont (»die richtigen Dinge tun«, Peter F. Drucker): »Was muss in einer Situation getan werden? Was ist jetzt überhaupt richtig/angemessen/erfolgreich?«, lauten hier die zentralen Fragen. Die Fragestellung ist dabei vor allem qualitativ. Es geht um radikales Neupositionieren für eine erfolgreiche Zukunft. Beispiel: Welche Wege gibt es, Licht zu erzeugen, ohne etwas zu verbrennen? (Dazu gehören etwa Elektrizität oder Biolumineszenz.)
Change betrifft die gesamten Organisationsebenen: Von der inhaltlichen Ausrichtung (anhand von Vision, Strategie, Zielen) über die Strukturen, Prozesse und Mitarbeiter bis hin zur Organisationskultur und den externen Geschäftspartnern wird alles überdacht oder vom Change beeinflusst. Das heißt nicht, dass sich zwangsläufig alles ändert, aber es heißt, dass alles auf dem Prüfstand steht und wesentliche Veränderungen das Ziel sind. Die Komplexität des Change ist höher als bei der Evolution, weil interne und externe Wirkungszusammenhänge mitbedacht werden müssen.
Übertragen auf menschliches Verhalten bedeutet Change eine deutlich größere Herausforderung als Evolution. Change ist tendenziell eine Zumutung, da Menschen ihr Verhalten nicht nur optimieren, sondern teilweise ganz ändern müssen. Das betrifft auch Einstellungen, kulturelle Fragestellungen (mehr dazu in Kapitel 5) und Vorstellungen von Erfolg, die unbewusst Teil der eigenen Identität sind. Change wirkt daher in der Regel sehr verunsichernd auf die Betroffenen, weil er den inneren Kern des Selbstverständnisses und der persönlichen Identität berührt. Das ruft bei den Betroffenen Abwehr hervor (über die Hintergründe informiert Sie ausführlich Kapitel 2).
Als Change-Projekt ist demnach ein Projekt zu bezeichnen, das für die Betroffenen mit umfassendem mentalem Wandel verbunden ist und das eine grundsätzlich andere Art erfordert, Dinge zu tun.
Der mentale Wandel, der für Change charakteristisch ist, bedeutet eine radikale Änderung des Blicks auf die Welt, auch Paradigmenwechsel genannt (mehr zum Paradigmenwechsel lesen Sie im grauen Kasten »Paradigmenwechsel«). Denn ein neues Paradigma beziehungsweise ein ganz neues Vorgehen bringt es mit sich, dass die eigenen Erfahrungen oder früheren Erfolge ganz oder teilweise nutzlos werden. Die Erfahrungen der Vergangenheit bieten also keine Hilfe für die Zukunft, wenn die Regeln sich wandeln müssen oder sich gewandelt haben.
Paradigmenwechsel
Ein Paradigma (»Muster«, »Denkmuster«) ist eine – unbewusste – Sammlung von inneren Regeln und Vorschriften, die die Wahrnehmung, das Denken, Verhalten und Bewerten eines Menschen leiten. Sie funktionieren wie ein Sieb. Das heißt, Informationen, die im Einklang mit der Erwartung stehen, werden »zugelassen«; abweichende werden vernachlässigt bis hin zu dem Punkt, dass sie überhaupt nicht wahrgenommen oder aber von vornherein als bedrohlich empfunden werden. Das gilt für Arbeits- wie Denkweisen. Beispiele dafür sind:
das Bild von der Erde: Scheibe versus Kugel
die Erschaffung der Welt: Gottes Schöpfung versus Urknalltheorie versus Evolutionstheorien
der Wechsel der Sprungtechnik beim Hochsprung: Schersprung (= vorwärts) versus Flop (= rückwärts über die Stange)
das Bild des Managers: vom allwissenden Macher zum kooperativen Gestalter, der eigene Grenzen kennt und benennt
Paradigmen machen blind für anderes. Deutlich wird dies an dem Ausspruch: »Das ist unmöglich! Das kann nicht sein!« Diese Aussage ist falsch, denn: Nur dieser Mensch, der dies sagt, hält es für unmöglich. Vieles scheitert an genau dieser Grenze im Kopf, insbesondere wenn viele Menschen dieselbe Begrenzung teilen und sie ihnen dadurch nicht bewusst wird. Deshalb ist es wichtig, immer wieder die eigenen Wahrnehmungs- und Denkgrenzen, soweit möglich, zu überprüfen. Überlegen Sie also einmal:
Was scheint heute in Ihrem Unternehmen »unmöglich/undenkbar«?
Welche gemeinsamen Grundvorstellungen und welcher Blick auf Ihre Organisation, glauben Sie, könnten dahinterstehen?
Welche Chancen haben Sie dadurch als Organisation, welche werden versperrt?
Was die begriffliche Trennung von Evolution und Change bringt
Evolution steht für kontinuierlichen Wandel, Change für fundamentale Veränderung. Jetzt stellt sich die Frage, welchen praktischen Nutzen diese Unterscheidung hat. Vielleicht ist es nur eine Modebezeichnung, weil Denglisch gerade »in« ist? Nein, das hat einen Sinn.
»Change« verwendet man, um die damit gemeinte Art der Veränderung eindeutig von der mit »Evolution« gemeinten Art der Veränderung abzuheben (»Veränderung« und »Wandel« sind die allgemeinen Oberbegriffe). Diese begriffliche Unterscheidung bietet die Chance, dass sich Verantwortliche in einer konkreten Veränderungssituation darüber eindeutig verständigen können, worum es bei der Veränderung genau geht. »Change« signalisiert beispielsweise gegenüber »Evolution« ein größeres Ausmaß an einschneidenden Veränderungen, die auf die Betroffenen zukommen.
Leider wird »Change« auch als Modebegriff verwendet mit der Folge, dass es innerhalb einer Organisation eine Flut an »Change-Projekten« gibt, die allmählich den Begriff entwertet und bei manchen Betroffenen reflexartige Genervtheit hervorruft. Dabei ist kein Begriff »besser« als der andere. Wichtig ist vielmehr, dass die Initiatoren der Veränderung sich einig sind, welche Situation vorliegt, um das geeignete Vorgehen zu finden. Dazu tragen klare Begriffe bei.
Und es gibt noch weitere Vorteile, die sich aus der begrifflichen Unterscheidung von »Change« und »Evolution« ergeben:
Die Beteiligten haben die Möglichkeit, eindeutig zu unterscheiden, an welchen Stellen evolutionäres Vorgehen möglich und wo Change unumgänglich ist. Denken Sie zum Beispiel an die Wirtschaftskrise: Wenn hier die Erfolgsmethode von früher die Probleme nicht mehr lösen kann, sondern selbst zum Problem wird, dann hilft ein »Mehr desselben« (Paul Watzlawick) nicht mehr weiter (zum Beispiel die Regeln des Investmentbanking, die 2008 zum Ausbruch der Wirtschaftskrise beitrugen). Ein echter Paradigmenwechsel ist dann notwendig: Change! Das heißt, Sie müssen auf ganz neue Ideen kommen, andere Sichtweisen erlauben und nicht mit »mehr desselben« den Bock zum Gärtner machen.
Wenn sich das Management im Vorfeld einer Veränderung darüber austauscht, welche Ausgangssituation vorliegt, dann zeigt die Diskussion um »Change« oder »Evolution«, wie das Management die Veränderungsfähigkeit der Organisation einschätzt. Gilt die Veränderungsfähigkeit als niedrig, handelt es sich für die Betroffenen tendenziell um Change. Die Prognose lautet: Es wird Widerstand geben. Und dann ist das Vorgehen ein deutlich anderes, als wenn die notwendige Veränderung »nur« als kontinuierliche Weiterentwicklung bereits früher getroffener Entscheidungen (Evolution) empfunden würde. Wenn man dies im Vorfeld bereits analysiert, hilft dies enorm bei der Gestaltung des angemessenen Vorgehens und der zeitlichen Planung der Veränderung (lesen Sie dazu auch den Abschnitt »Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft schaffen« in Kapitel 4). Die Erwartungen an die Zukunft und den Veränderungsbedarf werden also klarer, die Steuerungsmöglichkeiten besser, wenn Verantwortliche nicht aneinander vorbeireden.
Die Unterscheidung hilft, die Maßnahmen richtig zu justieren. Wenn man sich wirklich darüber im Klaren ist, was man vorhat (und vor sich hat), kommt man nicht in die Gefahr, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen oder mit einem einzigen Brief an die Mitarbeiter wirklich umwälzende Veränderungen in der Organisation vornehmen zu wollen.
Bei der Zuordnung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten kann man eine angemessene Auswahl treffen. Change braucht zum Beispiel in der Projektleitung Menschen mit Erfahrung und der entsprechenden Resilienz. Unerfahrene, aber sonst geeignete Personen sind als Projektleiter besser bei einem Projekt zur Entwicklung von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (Evolution) aufgehoben, weil sie aus vorhandenen Erfolgen lernen können.
Resilienz ist die Fähigkeit, auf wechselnde Anforderungen schnell und sehr flexibel reagieren und auch schwierige Situationen erfolgreich bewältigen zu können (zum Beispiel bei Konflikten und Rückschlägen). Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 10 im Abschnitt »Die eigene Widerstandsfähigkeit trainieren (Resilienztraining)«.
Die Vorstellung davon, wie lange die Veränderung in Anspruch nehmen wird, wird ein Stück realistischer. Echter Change dauert in der Regel länger als Evolution.
Change erfordert eine aktive Begleitung und damit mehr Aufmerksamkeit und Zeit aufseiten der Führungskräfte als Evolution.
Der Übergang zwischen Evolution und Change ist individuell
Wenn Sie eine Organisation als Ganzes betrachten und sie auf ihre Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft hin untersuchen, werden Sie relativ klar feststellen können, ob die Betroffenen als Gruppe die beabsichtigte Veränderung eher als radikal oder als evolutionär empfinden wird. Damit wissen Sie aber noch nicht, wie der Change auf einzelne Personen wirkt.
Die individuelle Bewertung eines Ereignisses fußt auf den individuellen Erfahrungen, mentalen Modellen (mehr dazu lesen Sie im grauen Kasten »Mentale Modelle« in diesem Kapitel) und der persönlichen Veranlagung. So kann es für den einen bereits ein Change sein, wenn sich ein einziger Prozessschritt im sonst unveränderten Arbeitsablauf ändert. Einer anderen Person wiederum wäre genau diese Veränderung eher gleichgültig, hingegen wäre der Wechsel des Bürokollegen für sie radikal und damit ein Change.
Die Frage, wann Evolution in Change übergeht, kann man also nicht allgemeingültig beantworten. Es kommt ganz auf die jeweiligen Personen oder auf die jeweiligen Teams beziehungsweise Arbeitsgruppen an, die Sie in einer Organisation vorfinden. Der Übergang zwischen Change und Evolution ist fließend. Und Sie müssen immer damit rechnen, dass einzelne Personen von der Grundstimmung in der Gruppe abweichen.
Mentale Modelle
Mentale Modelle sind Grundüberzeugungen und Denkmuster hinsichtlich des Zustands und der Zusammenhänge in der Welt, die so verfestigt sind, dass sie dauerhaft und unbewusst wirken. Dabei handelt es sich um Vorstellungen (das können Bilder, Annahmen, Geschichten sein) von Mitmenschen, Institutionen und allen anderen Aspekten der Welt, die Menschen in ihrem Kopf mit sich herumtragen. Man kann auch sagen, dass das die Brille ist, durch die sie die Welt betrachten. Beispiel: »Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus.«
Mentale Modelle wirken unbewusst: Sie bilden sich auf der Grundlage von erfolgreichen Erlebnissen in der Vergangenheit. Seitdem »macht man das so«. Das betreffende Verhalten ist also eigentlich nur in einer bestimmten Situation erfolgreich gewesen, trotzdem wird diese Erfahrung verallgemeinert. Das führt dann in die Irre, wenn sich die Umstände ändern. Mentale Modelle sind gewissermaßen Paradigmen bei Einzelpersonen (mehr zu Paradigmen lesen Sie im grauen Kasten »Paradigmenwechsel« weiter vorn in diesem Kapitel).
Schließen Sie nicht von der Grundstimmung in Ihrer Organisation auf das Empfinden eines einzelnen Betroffenen. Die Reaktionen auf ein und dasselbe Ereignis können völlig unterschiedlich sein.
Bei einem Change-Projekt ist es aufgrund dieser fließenden Grenze für die Initiatoren erfolgsentscheidend zu wissen, welche Ausgangslage sie bei der Mehrzahl der Betroffenen vorfinden. Erst wenn sie dies wissen, können sie die passenden Maßnahmen auswählen und ein angemessenes Tempo für die Veränderung einschlagen. Ein Change ist daher immer individuell zu gestalten – bei Organisationen wie bei den Menschen, aus denen sie bestehen.
Change Management – viel Verwirrung um einen Begriff
Häufig gibt es zum Begriff des Change Management Verwirrung. Die Verwirrung löst sich auf, wenn man näher hinschaut und feststellt, dass sich die verschiedenen Begriffsbestimmungen weitgehend ergänzen, weil sie Antworten auf unterschiedlich gestellte Fragen zum Change Management geben. Diese Fragen lauten:
Was ist Change Management?
Was ist der Gegenstand von Change Management?
Wofür wendet man Change Management an?
Wie wendet man Change Management an?
Entsprechend der jeweiligen Fragestellung setzen die Antworten unterschiedliche Schwerpunkte. Diese Unterscheidungen sind keine Haarspalterei, sondern wichtig für das Vorgehen im Change. Denn Change bedeutet einen bedeutsamen Eingriff in die Organisation, Wesentliches wird dabei verändert.
Deshalb sollten sich Initiatoren und Beteiligte darüber einig sein, womit sie es im Change zu tun haben. Wenn Sie sich in Ihrer Organisation gerade mit Change Management beschäftigen, sollten diese Fragen geklärt sein, damit alle Anstrengungen tatsächlich zum selben Ziel führen. Sonst gibt es Missverständnisse, und am Ende ist entweder das Change-Vorhaben gefährdet oder es hat zu viel Energie gefordert und Kosten verursacht.
Die nachfolgenden Abschnitte gehen daher einzeln auf diese Fragen ein, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern.
Was ist Change Management?
Direkt übersetzt heißt Change Management »Steuerung von Veränderungen«. Das ist sehr allgemein. Deshalb ist folgende Definition treffender:
Change Management löst Veränderungen aktiv aus, steuert den sozialen Veränderungsprozess bewusst, setzt Veränderungen gezielt um und sichert sie nachhaltig ab.
Wie das im Wesentlichen geht, erfahren Sie in den weiteren Kapiteln dieses Buches.
Change Management arbeitet dabei auf den Ebenen der Strategie, Struktur, Kultur und des individuellen Verhaltens der Betroffenen. Change Management integriert die fachliche Lösungsfindung und den sozialen Veränderungsprozess in ein gemeinsames Vorgehen. (Warum diese Integration wichtig ist und ein Change ohne Berücksichtigung der Menschen, die ihn umsetzen sollen, nicht funktioniert, erklären die Kapitel 4 und 5.) Change Management berücksichtigt also die Wechselwirkung zwischen Individuen, Gruppen, anderen Organisationen, Werten, Kommunikationsweisen, Machtkonstellationen und anderen Charakteristika, die in einer Organisation bestehen.
Folgende Aspekte sind demnach charakteristisch: Change Management
hilft, die emotionale Ebene bei den von einer Veränderung Betroffenen gezielt, gesteuert und aktiv zu bearbeiten;
hilft, den Veränderungsprozess ganzheitlich zu planen, den Wandel durchzuführen, zu begleiten und zu stabilisieren;
behauptet nicht, eine Wunderwaffe zu sein, sondern plant und portioniert die Veränderungsschritte in einem stufenweisen Prozess;
unterstützt die Betroffenen dabei, gewohnte Denk- und Verhaltensmuster, wenn nötig, infrage zu stellen und neue zu entwickeln;
integriert die fachliche Lösungsfindung und den sozialen Veränderungsprozess in ein gemeinsames Vorgehen. Fach- und Veränderungsprojekt greifen Hand in Hand – von der ersten Minute an.
Die Ausgangssituation für einen Change sieht häufig so aus: Es ist klar, dass sich etwas deutlich ändern muss, weil die jetzige Arbeitsweise in die Sackgasse führt. Klar ist der Weg, auf dem es nicht weitergeht. Aber hinter welchem Weg sich der Erfolg verbirgt, das liegt noch im Nebel. Die Betroffenen müssen unbekanntes Terrain erkunden, Führungskräfte brauchen dafür eine gehörige Portion Pioniergeist. Michael Reiß fasste dies kurz und knapp in folgendem Bild zusammen (1997):
Bildhaft ausgedrückt, findet Change Management auf einer Baustelle statt und nicht in einem fertigen Führungsgebäude.
Change Management umfasst also auch solche Maßnahmen, die sicherstellen, dass neue Strategien wie auch Strukturen überhaupt erst initiiert und dann danach umgesetzt werden können.
Was ist der Gegenstand von Change Management?
Veränderungen können sehr unterschiedliche Ebenen betreffen. Dazu gehören sowohl Dinge, Strukturen, Abläufe als auch Menschen.
Die drei Ebenen nachhaltiger Veränderung
Bei der Veränderung einer Organisation denken die meisten zuerst an Strukturen und Prozesse: Eine neue Führungsebene wird eingezogen, Logistikprozesse werden umgestellt oder Unternehmensteile ausgelagert. Das sind gewissermaßen die operativen (das heißt kurzfristigen und konkreten) Gegenstände der Veränderung.
Daneben geht es allerdings vor allem um die langfristigen und weniger sichtbaren Gegenstände der Veränderung (sogenannte »weiche« Faktoren): die Einstellung und die Unterstützung der Betroffenen. Diese psychosozialen Faktoren stehen im Vordergrund, weil man von der Annahme ausgeht, dass der Erfolg bewusst getroffener Entscheidungen (zum Beispiel für bestimmte Strukturen und Prozesse) von Rahmenbedingungen beeinflusst wird, die unbewusst sind. Und genau dazu gehören Einstellungen, Akzeptanz, Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft. Anders ausgedrückt: Die genialste Strategie bleibt ein Papiertiger, wenn sich keine ausreichende Anzahl von Personen findet, für die die Strategie irgendwie attraktiv ist. Das entscheidet sich im Wesentlichen spontan auf der Bauchebene: Das Unbewusste ist der Entscheidung vorgelagert und hat damit den größeren Hebel. Deshalb befasst sich Change Management mit diesen Faktoren, die auf der »weichen« Seite angesiedelt sind.
Da eine Organisation sich nur verändern kann, wenn die Betroffenen in der Summe mitziehen, geht Change Management auf die Menschen ein und will sie bestmöglich für die Veränderung vorbereiten. Es ist aber nie Ziel, alle Betroffenen überzeugen oder mitnehmen zu wollen. Ein Change braucht »nur« die Schlüsselpersonen und die kritische Menge von Unterstützern, die für eine nachhaltig erfolgreiche Umsetzung ausreicht.
Natürlich gibt es eine Veränderung nicht im luftleeren Raum oder um ihrer selbst willen. Sie folgt einem übergeordneten Ziel, das letztlich von einer Strategie oder Vision abgeleitet ist.
Im Rahmen von Change-Prozessen haben die Change-Manager also immer drei Bereiche zu beachten und miteinander in Einklang zu bringen (siehe Abbildung 1.3).
Abbildung 1.3: Die drei Ebenen nachhaltiger Veränderung
Strategie: Die Strategie beschreibt den grundsätzlichen »Weg zum Ziel«. Sie gibt die Orientierung, wozu die Veränderung gut ist, welches der Sinn und die Vision hinter der Veränderung ist (was eine Vision ist, erläutert ausführlich Kapitel 3). Die Strategie ist die Grundlage zur Gesamtsteuerung der Organisation.
Strukturen: In neuen Ablaufstrukturen (Prozesse) und Aufbaustrukturen (Organigramme) manifestieren sich die messbaren Ergebnisse der Veränderung (lesen Sie dazu den Abschnitt »Harte Faktoren im Change« weiter hinten in diesem Kapitel). Die neuen Strukturen dienen dazu, den veränderten Anforderungen möglichst effizient gerecht zu werden.
Kultur: Kultur steht für die bewussten und unbewussten Verhaltensweisen und Fähigkeiten der von einer Veränderung betroffenen Menschen. Change Management gewinnt die Betroffenen für die Umsetzung der Veränderungsziele und hilft, die Veränderung in ihrem alltäglichen Verhalten fest zu verankern. So findet mit der Gestaltung des Wandels auch die Veränderung menschlichen und zwischenmenschlichen Verhaltens statt.
Ein Kulturwandel wird ausgelöst, wenn mit dem Change ein mentaler Wandel verbunden ist. Wenn zum Beispiel Ideen im Unternehmen leichter fließen können sollen und der bisher eher hierarchisch geprägte Führungsstil dazu nicht mehr passt. Eine Veränderung auf der Ebene Strategie oder Struktur kann also die Notwendigkeit hervorrufen, Werte, Normen und Einstellungen zu überprüfen. Es ist wie ein Mobile: Sobald eine Ebene in Bewegung kommt, schwingen automatisch die anderen Ebenen mit. Bleiben sie starr, gefährdet das den Erfolg der Veränderung.
Change Management umfasst also die Abstimmung von Strategie, Strukturen und Kultur innerhalb eines Veränderungsprozesses – von der ersten Minute an.
Die von einer Veränderung »Betroffenen«
Wenn eine Veränderung angekündigt wird, dann sind alle Mitglieder einer Organisation zunächst einmal Betroffene. Sie haben aber nicht alle die gleiche Rolle oder die gleichen Möglichkeiten in dem Prozess, der nun beginnt. Abbildung 1.4 zeigt, welche unterschiedlichen Begriffe es noch gibt.
Die Begriffe, die Sie in Abbildung 1.4 sehen, werden in diesem Buch durchgängig verwendet.
Betroffene sind alle, die von einem Change berührt werden. Betroffene sind Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen, allerdings in unterschiedlicher Form.
Viele Change-Vorhaben scheitern, weil übersehen wird, dass auch die Führungskräfte nicht automatisch von einer Veränderung begeistert sind, nur weil es zu ihren Aufgaben gehört, Veränderungen voranzutreiben. Ausführlich geht Kapitel 10





























