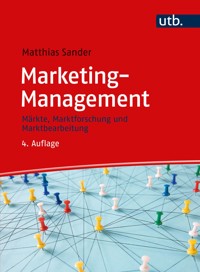Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping will sein Land dank Technologie zur Supermacht formen. Bei künstlicher Intelligenz, E-Autos und Computerchips zählt China schon zur Weltspitze. Doch weitere Fortschritte sind bedroht, etwa durch amerikanische Sanktionen und Xis hartes Durchregieren. Die anschaulichen, erzählenden Texte des Auslandsjournalisten Matthias Sander beleuchten Chinas technologische Ambitionen ganz konkret. Seine Reportagen führen durch den digitalen Alltag, stellen innovative Startups vor und beleuchten die staatliche Subventionspolitik. Dabei betrachtet Sander Technologie stets im größeren Kontext von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Individuum – und den Auswirkungen auf Europa. Das Buch richtet sich somit nicht nur an Technologie-Interessierte, sondern an alle, die das gegenwärtige China besser verstehen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MATTHIAS SANDER | geboren 1986 in Mainz, hat in Bordeaux und Stuttgart Politik und Soziologie studiert. Er ist seit 2014 Journalist der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) aus der Schweiz. Von 2020 bis Ende 2023 war er China-Korrespondent der NZZ für Technologie. Wegen der Pandemie berichtete er zunächst aus Taiwan; ab 2021 dann aus der südchinesischen Metropole Shenzhen, der Heimatstadt von Huawei und weiteren Technologie-Konzernen von Weltrang.
Umschlagfoto: Billy H. C. Kwok
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werks insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen auch für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen und strafbar.
© 2024 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-96311-927-9
VORWORT
Wer aus Europa nach China kommt, dem fällt sofort auf, wie verbreitet Technologie hier ist. Zutrittsschranken an Flughäfen und Wohnanlagen öffnen sich per Gesichtserkennung. Auf den Bürgersteigen filmen Überwachungskameras alle paar Meter die Fußgänger. Taxifahrer halten ihren Fahrgästen am Zielort kommentarlos einen ausgedruckten QR-Code hin, damit sie per Handy bezahlen. In neueren Restaurants klebt auf jedem Tisch ein QR-Code, über den man die Speisekarte aufruft, bestellt und bezahlt, alles innerhalb der App WeChat.
Der Alltag in chinesischen Metropolen ist so digitalisiert wie wohl nirgendwo sonst. Und das Land prescht weiter nach vorn. Der Partei- und Staatschef Xi Jinping will mit neuen Technologien die Wirtschaft und das Militär modernisieren. So soll China Schritt für Schritt zur Supermacht werden. Bis 2030 soll das Land bei künstlicher Intelligenz (KI) weltweit die Nummer eins sein. Bis 2035 soll es weltweit Standards für zentrale Technologien wie Computerchips gesetzt haben. Bis 2049, zum 100. Geburtstag der Volksrepublik, soll China in Sachen Innovation Weltmeister sein.
Doch es läuft nicht alles nach Plan. Die umfassenden Exportkontrollen der USA gegen Chinas Chip-Industrie lähmen die technologische Weiterentwicklung des Landes. Die Milliarden-Subventionen der chinesischen Regierung haben es bisher kaum vermocht, Chinas Abhängigkeit von ausländischer Chip-Technologie zu verringern. Xi Jinping fordert von den Chinesen unbedingte Loyalität zur Kommunistischen Partei – und bedroht damit das freie Unternehmertum und die Kreativität, die es für bahnbrechende Innovationen wohl braucht.
Das vorliegende Buch beleuchtet Chinas technologische Errungenschaften, seine Ambitionen und die Hürden auf dem Weg dorthin. Es erzählt in Reportagen, wie die Digitalisierung ganz konkret den Alltag prägt. Es erklärt, warum die „Super-App“ WeChat viel mehr ist als nur Chinas WhatsApp oder warum das Sozialkreditsystem weniger furchteinflößend ist, als im Ausland angenommen – bis jetzt zumindest. In hintergründigen Analysen ordnet das Buch Xi Jinpings Technologie-Politik ein und geht der Frage nach, warum die bahnbrechende KI-Software Chat-GPT aus den USA kommt – und nicht aus China. Weiter stellt das Buch chinesische Macher und Konzerne vor, etwa den wohl umstrittensten Forscher der Welt, He Jiankui, der als Erster die Geburt von Babys mit genetisch modifiziertem Erbgut herbeiführte, oder den E-Autobauer BYD, der Ende 2023 erstmals mehr batteriebetriebene Autos verkaufte als der amerikanische Pionier Tesla. Dabei wird immer wieder aufgezeigt, welche Konsequenzen Chinas Umgang mit Technologie für andere Länder hat.
Die Beiträge in diesem Buch sind eine Auswahl der besten Artikel, die ich als China-Korrespondent für die „Neue Zürcher Zeitung“ geschrieben habe; für diese Buchausgabe wurden sie nochmals durchgesehen, sprachlich angepasst und wo sinnvoll aktualisiert. Ich habe von Anfang 2020 bis Ende 2023 über Technologie in China berichtet, pandemiebedingt zunächst aus Taiwan, ab 2021 aus der südchinesischen Metropole Shenzhen, der Heimat von Tech-Konzernen wie Huawei und BYD. Alle Beiträge betrachten Technologie stets im größeren Kontext von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Sie richten sich somit nicht speziell an technologieinteressierte Leser, sondern an alle, die das gegenwärtige China besser kennen und verstehen möchten.
Matthias Sander
Shenzhen, im Januar 2024
INHALT
1 ANKUNFT
Drei Wochen Quarantäne, 17 Covid-Tests und unzählige QR-Codes
Mein neues digitales Leben in China
2 ALLTAG
Warum WeChat in China überall ist
Das Sozialkredit-System nimmt Form an – zumindest im Gesetz
Chinas Regierung erlässt ein teilweises Bitcoin-Verbot – Kryptofans machen trotzdem weiter
3 POLITIK
Xi Jinping hat das Potenzial von Technologie wie kein anderer Staatenlenker verstanden
Eine Universität mit dem Segen Wladimir Putins
Oh, wie schön ist Chinas Modellstadt!
4 MACHER
Ein Treffen mit dem umstrittensten Forscher der Welt
Ein Start-up baut die weltweit ersten Quantencomputer für zu Hause
Ein amerikanischer Erfinder wird empfangen wie ein Rockstar
5 BIG TECH
Die Huawei-Finanzchefin und der Genosse Xi
Huawei inszeniert sich nach Washingtons Exportverboten als Phönix aus der Asche
Im privaten Karaokeraum des legendären Jack Ma
Apps für die Partei, Clouds für Saudi-Arabien
China unterwirft seine Tech-Konzerne – der Rest der Welt sollte sich sorgen
6 ÜBERWACHUNG
„In Xinjiang wurden 100.000 Menschen nur wegen ihres Handys festgenommen“
Auf der Flucht vor einem Covid-Lockdown
Eine Suche nach dem Pionier von Chinas Spionageballons
7 INTERNET
Wie Xi Jinping das Internet zensieren lässt
Ein Gesetz zur Datensicherheit fragmentiert das World Wide Web weiter
Hongkongs Tage als Hort der Internetfreiheit sind gezählt
8 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Keine Informationen zu Xi Jinping: Chinas Alternativen zu Chat-GPT
Die ersten Regeln der Welt für die neue Generation von KI
Eine „Weltkonferenz“ ohne die Welt
Es ist kein Zufall, dass die USA Chat-GPT erfunden haben, nicht China
9 CHIPS
China spielt seine Karten im Konflikt mit den USA clever
Der Bosch-Manager staunt
„Das war nur PR, vergiss es“
Warum China trotz Milliarden-Investitionen von den USA abhängig ist
Ein Taiwan-Krieg wäre auch für die Weltwirtschaft eine Katastrophe
10 AUTOS
Wie BYD zu Teslas größtem Konkurrenten wurde
An der Automesse Schanghai beginnt Chinas Europaoffensive
Tesla rockt China. Wie lange kann das gutgehen?
Das Robotaxi und der Traum vom autonomen Fahren
11 EUROPA
Deutsche Tech-Konzerne sind stark von China abhängig
Ein Paradebeispiel für Chinas strategische Technologiezukäufe im Ausland
„Dienen Sie ganz China!“, ruft der Beamte den europäischen Start-up-Gründern zu
„Warum nicht von den Chinesen lernen?“, sagt der deutsche Solar-Manager
FAZIT
ABKÜRZUNGEN UND GLOSSAR
1 ANKUNFT
Drei Wochen Quarantäne, 17 Covid-Tests und unzählige QR-Codes | September 2021
„Die haben natürlich Riesenangst vor unserem Flugzeug“, sagte mein Reisebekannter, als unsere Lufthansa-Maschine aus Frankfurt in Qingdao gelandet war und draußen Gepäckentlader in Ganzkörperschutzanzügen auftauchten. Sie sahen aus wie Michelin-Männchen und trugen Kapuzen, Masken und Gesichtsschutzschilder, obwohl sie nicht mit uns in Berührung kommen würden.
„Kein Wunder“, ergänzte der Bekannte, „wenn es hier nur einen einzigen Fall von Covid-19 gibt, dann rollen die Köpfe.“ Tatsächlich mussten immer wieder chinesische Lokalpolitiker wegen vermeintlicher Fahrlässigkeit gehen, seitdem Mitte Juli die Delta-Variante in der ehemaligen Hauptstadt Nanjing ausgebrochen war und sich in viele Landesteile verbreitet hatte. Zwar meldeten selbst Millionenstädte nur einzelne Fälle, doch im ganzen Land galten wegen Chinas Null-Covid-Strategie strikte Reisebeschränkungen.
Das spürten wir schon im Flugzeug. Ein Steward erklärte per Lautsprecher, gegen Maskenverweigerer „behalten wir uns Konsequenzen bei den zuständigen Behörden in China vor“. Die Effektivität einer solchen Durchsage sollte man einmal in Europa testen. Später kündigte der Steward an, das Aussteigen werde „in enger Absprache mit den chinesischen Behörden“ erfolgen.
Zwei Stunden nach der Landung saßen viele Passagiere immer noch im Flugzeug. Die ersten Passagiere waren namentlich aufgerufen worden, dann ging es in Zweierreihen weiter. Der Steward sagte, ohne einen QR-Code zur Einreise dürften wir nicht aussteigen. Doch ich konnte das nötige Online-Formular des chinesischen Zolls wegen technischer Probleme nicht ausfüllen.
Schon beim Boarding am Frankfurter Flughafen waren auch andere Passagiere daran gescheitert: Egal, ob per Handy oder Laptop, im Firefox-Browser oder in Chrome – die Bilddatei mit dem Verifizierungscode öffnete sich nicht. Ohne Verifizierung kein QR-Code. Und ohne QR-Code kein Boarding. Der eigens zur Kontrolle abgestellte Sicherheitsmann am Gate ließ uns schließlich trotzdem durch.
Nun, im Flugzeug, ging das hektische Tippen von vorn los. Bei mir klappte es letztlich auf dem chinesischen Handy eines Sitznachbarn. Nach drei Stunden durfte meine Reihe 36 hinaus.
In der Gangway stand eine weitere Gestalt im hermetisch geschlossenen Ganzkörperanzug, vermutlich eine Frau. Der Flughafen Qingdao Jiaodong International war funkelnagelneu, er war erst zwei Tage vorher eröffnet worden. Der blitzblanke Steinboden spiegelte sich, weit und breit war kein Mensch zu sehen. Doch da lag etwas mitten im Gang. Das war doch nicht … Doch, ich schwöre es: eine Fledermaus. Eine kleine, tote Fledermaus.
Will man in Pandemiezeiten nach China reisen, fühlt man sich zuweilen wie auf einer Mondmission. Visa werden, wenn überhaupt, sehr restriktiv vergeben. (Immerhin gibt es welche; Australien zum Beispiel lässt nicht einmal alle seine eigenen Bürger herein.) Ergattert man eines, muss man aus jenem Land nach China fliegen, in dem man es bekommen hat. Als ich im Juni 2021 mein Visum in Bern bekam, gab es aus der Schweiz keine Flüge nach China. Alle eingestellt.
Ich wollte also ab Frankfurt am Main fliegen, wusste aber nicht, ob die chinesischen Behörden das zulassen würden. „Ich glaube, dass es klappt“, meinte ein Mitarbeiter im Visazentrum Bern. Zuständig für mich war aber nun das Generalkonsulat Frankfurt, das mir partout nicht antwortete. Erst am Vorabend meines Fluges hatte ich Gewissheit, als das Generalkonsulat tatsächlich die negativen Ergebnisse der verlangten drei Corona-Tests quittierte – zwei PCRTests an verschiedenen Tagen, dazu einen Antikörper-Bluttest am Flughafen Frankfurt, einen Tag vor Abflug – und ich einen ersten QR-Code bekam.
Andere Mitreisende hatten noch in der Schlange am Check-in-Schalter in Frankfurt ihren QR-Code nicht. Auf ihren Handys aktualisierten sie ständig die chinesische Website: War der Code noch im gelben Bearbeitungsstatus oder bereits grün (gut) oder rot (schlecht)? „Ja!“, jubelte ein Vater. Wir applaudierten.
Am Gate sagte ein anderer Vater am Telefon, der Stress der zurückliegenden Woche habe ihn zwei Jahre seines Lebens gekostet. Dabei waren wir noch nicht einmal in China.
Im Flugzeug schwärmten die Stewards mit Thermometern aus. Zwei junge Deutsche notierten auf einer ellenlangen Passagierliste hinter jedem Namen die Temperatur. Einer der beiden sagte gequält, sie wüssten auch nicht, was die Chinesen damit machten. Was ist los, wenn Chinesen gründlicher sind als Deutsche?
Mein Reisebekannter lebte in Peking und kannte Leute, die die Hotelquarantäne in China bereits hinter sich hatten. Einer habe seine Zimmertür nicht richtig schließen können. Bei einem anderen sei das Wasser vom Duschen immer ins Zimmer gelaufen, und ein anderes habe er nicht bekommen. Ein Dritter wollte nach China ziehen – wie ich –, aber die Quarantäne habe ihn so fertiggemacht, dass er danach umgehend zurück nach Europa geflogen sei.
Internationale Medien verbreiteten ähnliche Horrorgeschichten. Anfang 2021 hatten manche chinesischen Städte, inklusive meines Etappenziels Qingdao, für Reisende aus dem Ausland anale Corona-Tests eingeführt. Dazu wurde ein Wattestäbchen drei bis fünf Zentimeter in den Anus geschoben und dann sanft herausgedreht. So schilderte die Nachrichtenagentur Reuters die Anweisungen des chinesischen Center for Disease Control. Nach Protesten der USA und Japans stellte China diese Praxis offenbar wieder ein.
Im Mai hatte laut einem Bericht der „New York Times“ ein Deutscher drei Tage in einem Isolierzimmer eines Spitals in Schanghai verbringen müssen, ohne Handtücher und Klopapier, weil er Covid-19-Antikörper hatte – die der Betroffene sich mit seiner Impfung erklärte.
Um all diesen Unwägbarkeiten zu entgehen, organisierte die deutsche Außenhandelskammer in China im Sommer einen wöchentlichen Charterflug mit der Lufthansa von Frankfurt nach Qingdao, samt Quarantäne in zwei ordentlichen Hotels. Die Kammer hatte dazu das Plazet von ganz oben, von den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, und so schätzte ich mich glücklich, einen Platz zwischen Expats der deutschen Automobilindustrie ergattert zu haben.
Die tote Fledermaus also. Da lag sie auf dem Boden des Flughafens Qingdao, die Flügel eng am Körper, die Äuglein geschlossen. Eigentlich ganz süß. Wie war sie hierhergeraten? War sie gerade erst von der Decke gefallen? Oder warum hatte offenbar keine der Ganzkörperanzugsgestalten, die uns so sehr im Blick hatten, sie gesehen? Verdutzt lief ich weiter zur Wärmebildkamera, die im Vorbeigehen unsere Temperatur maß. Nun ging alles zack, zack. Ganzkörperanzugsgestalten hinter Plastikscheiben kontrollierten unsere Unterlagen und den QR-Code des Zolls. Ganzkörperanzugsgestalten steckten uns Stäbchen in Rachen und Nase. Ganzkörperanzugsgestalten winkten uns zur Passkontrolle, reihten uns in die Warteschlange zum Shuttlebus ein, desinfizierten unser Gepäck und fuhren uns zum Hotel.
Am Flughafen hatten wir aus der Ferne ein paar Taxifahrer gesehen, aber es war dann schon fast ein visueller Schock, als wir nach gut einer Stunde Fahrt in der Stadt ankamen und die ersten Chinesen in Alltagskleidung sahen. Ein Arbeiter mit Wasserschlauch bespritzte austrocknende Nadelbäume. Ein rundlicher Alter saß vor einer Schule und lachte herzhaft, als ein Junge im Basketballtrikot versehentlich durch frisch gegossenen Zement tapste. Eine Frau in einem Auto sah unseren Bus und haute aufgeregt ihren Mitfahrer an. Was genau hatte sie wahrgenommen – einen Bus voller Westler, die Sitze mit Plastikhüllen überzogen, vom Flughafen kommend?
Der Bus parkte vor dem Hotel, ein Chinese im Ganzkörperanzug stieg zu und begrüßte uns auf Englisch mit breitem amerikanischem Akzent. Ob wir alle WeChat hätten, fragte er. WeChat ist vereinfacht gesagt Chinas WhatsApp, aber mit unzähligen weiteren Funktionen. Der Chinese erklärte, die deutsche Handelskammer habe eine Chat-Gruppe für alle Gäste eingerichtet. „Wir wissen, es gibt ein paar Regulierungen zur Privatsphäre in Deutschland“, fuhr er fort. Deshalb habe das Hotel für jeden Gast einen individuellen Kanal zur Rezeption eingerichtet.
Eine Armada von Ganzkörperanzugsgestalten desinfizierte wieder unser Gepäck, eine Frau mit „Police“-Schild über der Brust schaute zu. Wir mussten eine frische Maske, Einweghandschuhe und Schuhüberzüge anziehen. „It’s hot in here“, sagte mein Gepäckhelfer im Ganzkörperanzug keuchend, als er den Gepäckwagen umständlich in den Aufzug gehievt hatte.
Das Zimmer war großzügig und hell und die Aussicht vom 29. Stock auf eine Bucht toll. Vorne eine Mole für Freizeitboote, in der Mitte ein Fischereihafen, hinten militärische Katamarane in Tarnfarben. Dazwischen unzählige Hochhäuser. Doch was bringt die schönste Aussicht, wenn man zwei Wochen eingesperrt ist und im Flur rund um die Uhr ein Aufpasser sitzt?
Oder würde ich sogar drei Wochen bleiben müssen? Das war und blieb unklar. Die Quarantäneregeln variierten von Provinz zu Provinz, von Stadt zu Stadt, von Nachbarschaftskomitee zu Nachbarschaftskomitee – und sie konnten sich täglich ändern. Ich wollte weiter nach Shenzhen, in die Technologie-Metropole direkt neben Hongkong. Die Peking-Reisenden unter uns hatten schon Gewissheit: Sie mussten drei Wochen bleiben und sich dann in der Hauptstadt eine vierte Woche isolieren, also möglichst wenig hinausgehen und Kontakt mit anderen Menschen vermeiden.
Die Tage vergingen rasch. Morgens joggte ich ums Sofa, durchs Bad und zurück. Dann arbeiten, Chinesisch lernen, lesen, telefonieren, Gitarre spielen. Das Essen stellten Ganzkörperanzugsgestalten immer um halb acht, halb zwölf und halb sechs auf einen Tisch vor meiner Tür. Nach einer Woche hatte ich so viele Würste gegessen wie in meinem ganzen Leben nicht. So nett ich die Berücksichtigung der vermuteten Essgewohnheiten unserer deutschen Reisegruppe fand, ich bat fortan um chinesisches Mittag- und Abendessen.
Wenn ich etwas brauchte, rief ich die Rezeption an. WeChat hatte ich noch nicht und vermisste es auch nicht, zumal die App überwacht und zensiert wird. Doch dann überwog die journalistische Neugier, und später würde ich die in China omnipräsente App sowieso installieren müssen.
WeChat verlangt bei der Installation, dass ein bestehender Nutzer einen QR-Code zur Verifizierung scannt. Ich fragte den Aufpasser vor meiner Tür. Er lehnte entschieden ab, fast entrüstet. Okay, ich soll keinen Kontakt mit niemandem haben, schon klar. Ich schilderte der Rezeption das Problem. Eine Mitarbeiterin kam, bat den Aufpasser, mich zu verifizieren, und er scannte meinen Code. Na also.
Schnell zeigte sich, dass ich bisher dank meiner Ignoranz der Chatgruppe für die Quarantänegäste ruhigere Tage verbracht hatte. Eine Reisende schrieb, sie habe von der Rezeption gehört, es könne einen weiteren Bluttest auf Antikörper geben. Andere Gäste, insbesondere solche mit Kindern, beunruhigte das. Schließlich dementierte eine Mitarbeiterin der Handelskammer: Sie hätten mit den Behörden vereinbart, dass bei uns kein Bluttest nötig sei; weil das als Privileg gelte, dürfe die Rezeption das nicht so klar sagen. Behördenkulanz auf Chinesisch. „Jetzt fühle ich mich viel besser“, schrieb eine Nutzerin.
In der Chat-Gruppe für die Peking-Reisenden gab es einen größeren Zwischenfall, wie mir Bekannte am Telefon erzählten. Dort forderte die Rezeption plötzlich die Gäste auf, all ihre Test- und Impfnachweise, die ja bereits das Generalkonsulat Frankfurt genehmigt hatte, an eine E-Mail-Adresse zu schicken: an [email protected]. „Wieso eigentlich?“, fragte jemand. Die Rezeption schien in ihrer Antwort erst zu suggerieren, dass ein Gast Covid-19 habe, dann zog sie das zurück. „Natürlich Paranoia auf beiden Seiten“, sagte mir ein Bekannter am Telefon.
Mitte der zweiten Quarantänewoche war von Behörden und Hotels in Shenzhen und der Provinz Guangdong weiter keine klare Antwort zu erhalten, ob ich nun einreisen dürfe. Das Problem war, dass ich als Zuzügler noch keine Wohnung hatte und somit die neuerdings verlangte dritte Woche Isolation daheim nicht machen konnte. Zugleich durfte ich weder in ein normales Hotel noch in ein Quarantänehotel, weil man dort nur die volle Quarantäne absolvieren durfte. „That’s a special situation“, sagte eine Frau von einer Hotline für Ausländer.
Letztlich musste ich eine dritte Woche in Qingdao bleiben. Nach 15 Tagen gelte Isolationshaft als Folter, hatte ein Kollege am Telefon gesagt, und tatsächlich sieht das die UNO so. Ich wollte nicht in Selbstmitleid verfallen, aber Inhaftierte dürfen immerhin auf eine Stunde Freigang pro Tag hoffen, dachte ich. Wir in unserem Hotelhochhaus konnten nur ein Fenster einen Spaltbreit kippen.
Bei aller Langmut schüttelte ich zunehmend öfter den Kopf. Zum Beispiel, als die zierliche Frau im Ganzkörperschutzanzug am vorletzten Quarantänetag zum sechsten Mal ungeduldig vor dem Zimmer stand: wieder doppelter PCR-Test, Rachen und Nase. Es waren der 16. und 17. Test der Reise.
Als am letzten Tag die Rezeption anrief und sagte, ich dürfe nun auschecken, fühlte ich mich fast aus meiner kleinen Hotelzimmerwelt gerissen, so sehr hatten mich diese drei Wochen in völliger Abhängigkeit offenbar konditioniert. Hinausgehen, wie ging das noch einmal? Ach ja, Schuhe anziehen. Ich konnte mich nicht erinnern, einmal drei Wochen lang keine Schuhe getragen zu haben.
Vor dem Hotel wartete ein Kleinbus, der uns zum Flughafen bringen würde, denn wir durften uns weiter nicht frei bewegen und auf keinen Fall etwa noch kurz Qingdao besichtigen. Ich vertrat mir die Füße bis zur Abfahrt, genoss die frische Luft. Eine Frau im Ganzkörperanzug kam auf mich zu. „Health-Code?“, fragte sie. O nein, nicht schon wieder.
Mit diesem QR-„Gesundheitscode“ hatte mich das Hotel drei Tage vorher fast in den Wahnsinn getrieben. Die Reiseorganisatoren der Handelskammer sagten, der Code sei nicht nötig, aber das Hotel behauptete, ich würde ihn zum Auschecken und am Flughafen brauchen. So oder so konnte ich die nötige App nicht installieren, wohl weil ich keine chinesische Telefonnummer hatte. Das sagte ich nun der Mitarbeiterin draußen. Sie zog schulterzuckend von dannen. Später fragte niemand mehr danach. Das Quarantänezertifikat des Hotels reichte als Passierschein.
Ab da war plötzlich alles herzallerliebst. Ein Flughafenmitarbeiter zahlte wie selbstverständlich für mich 15 Yuan, gut 2 Euro, als ich meinen Gitarrenkoffer zum Schutz in Plastikfolie hatte einwickeln lassen und sich herausstellte, dass man nicht mit Kreditkarte zahlen konnte und es nirgendwo einen Geldautomaten gab. „Welcome to China“, sagte er lächelnd. Dann brachte der junge Mann mich zu einem anderen Schalter, wo ich für Übergepäck per Kreditkarte rund 150 Euro zahlte. „You’re a rich man“, sagte er. Ich fragte vorsichtig nach seinem Monatsgehalt. 1.500 Yuan, erklärte er, gut 200 Euro, er sei Auszubildender. O Mann, er hatte also ein Prozent seines Gehalts für mich gezahlt! Es tue mir so leid, sagte ich: „Zhen de dui bu qi!“ Er winkte gutmütig ab.
Als mein Flugzeug nach Shenzhen schließlich in die Startposition gefahren war, standen auf dem Rollfeld zwei Fluglotsen Spalier und winkten. Sie salutierten nicht etwa auf eine steif-professionelle Art, sondern winkten wie Kinder in Europa, die Hand eng vor dem Oberkörper. Ich war gerührt. Sie winkten natürlich dem Piloten, aber ich winkte zurück. Vielleicht würde ich doch mal nach Qingdao zurückkehren, um mir die Stadt anzuschauen.
Mein neues digitales Leben in China | Oktober 2021
„So, dann gehen wir jetzt dein Gesicht registrieren“, sagte die Maklerin zum Ende der Wohnungsübergabe. Schlüsselübergabe konnte man das Prozedere nicht nennen, denn ich erhielt keine Schlüssel. Weder für die Wohnungstür noch für den Haupteingang. Alle Wohnungen in meinem Hochhaus in der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen, erbaut 2018, haben elektronische Schlösser, wie man sie im Westen vor allem aus Hotels kennt. Und am Haupteingang stehen drei Schleusen mit Gesichtserkennung.
Mein neuer Wohnungsschlüssel ist ein Zahlencode. Das klingt harmlos, und natürlich durfte ich ihn mir selbst ausdenken und erstmals eingeben, während der Mitarbeiter der Gebäudeverwaltung sich wegdrehte. Doch wer weiß schon, wo der Code gespeichert ist, wer Zugriff auf ihn hat und ob er vor Hackerangriffen einigermaßen geschützt ist?
Als ich den Code mit der Rautetaste bestätigt hatte, schob die Maklerin das Touch-Display nach oben. Darunter war eine briefmarkengroße Platine: ein Lesegerät für Fingerabdrücke. „Und nun der Finger“, sagte die Maklerin. Krass, dachte ich, auch so lassen sich die Wohnungstüren also öffnen. Ich lehnte dankend ab.
Aber um die Gesichtserkennung kam man offenbar nicht herum. Ob das wirklich sein müsse, fragte ich die Maklerin, als wir im Aufzug hinunterfuhren, schließlich waren wir zur Wohnungsübergabe ohne Gesichtsscan hereingelassen worden. Ja, für Bewohner müsse das sein, sagte die Maklerin. Anders komme man nicht herein.
„Na gut“, dachte ich, „when in Shenzhen, do as the Shenzheners do.“ Am Empfang zog ich meine Corona-Maske herunter und ließ mich fotografieren. Eine Mitarbeiterin machte ein paar Klicks am Computer, dann sollte ich testen, ob die Schleusen mich erkannten.
Ich stellte mich vor die erste. Keine Reaktion. Lag es an der Maske? Diese Schleuse sei nicht so zuverlässig, sagte der Sicherheitsmann.
Ich machte ein paar Schritte zur nächsten Schleuse. Auf dem Bildschirm unter der Kamera, so groß wie ein Tablet, sah ich mich wie im Spiegel. Alles ging ganz schnell: Ein weißes Rechteck legte sich um mein Gesicht, das gespeicherte Foto erschien, die Maschine zirpte elektronisch wie ein Kassenscanner, die Schleuse öffnete sich. Obwohl ich nun Maske trug.
Wer aus Europa – und wahrscheinlich von so ziemlich jedem anderen Ort der Welt – nach China kommt, dem fällt sofort auf, wie verbreitet Technologie hier ist. Taxifahrer schauen einen entgeistert an, wenn man nicht per Handy zahlen will, sondern bar, schließlich hat kaum jemand Wechselgeld. In vielen Restaurants soll man die Speisekarte als „Mini-App“ innerhalb der Multifunktions-App WeChat aufrufen und so auch bestellen und bezahlen. Überwachungskameras sind überall, wirklich überall; in Shenzhen sind einige sogar fast senkrecht nach oben gerichtet, auf die Balkone von Wohnhochhäusern.
Das alles sei praktisch und sorge für mehr Sicherheit, sagen viele Chinesen. Bevor die Videoüberwachung flächendeckend eingeführt worden sei, habe es mehr Kriminalität gegeben, sagte mir einer. Manchen Leuten sei auf offener Straße das Portemonnaie gestohlen worden. „Heute klaut in Shenzhen keiner mehr ein Auto, weil er genau weiß, dass er erwischt wird.“
Auch westliche Expats sagen solche Sätze. Einer erzählte, er fühle sich mit seiner Familie hier sehr sicher, schließlich täten sie nichts Verbotenes oder Regierungskritisches. Ein Zweiter lobte, dass in China sich die Leute wenigstens an die Regeln hielten, im Gegensatz zu seiner Heimat England, wo es etwa Graffiti gebe. Ein Dritter kritisierte das chinesische Regime zwar grundsätzlich – erzählte dann aber tief beeindruckt, wie die Polizei dank der lückenlosen Überwachung einen Mann aufzuspüren vermochte, der ihm eine Tasche geklaut hatte.
Kritischere Zeitgenossen – und die gibt es durchaus auch unter den Chinesen – lehnen die allgegenwärtige Überwachung und Zensur genauso ab wie wohl viele im Westen. Denn sie wissen: Letztlich sind selbst völlig apolitische Menschen der Willkür der Machthaber ausgesetzt. Und das ist kein schönes Gefühl.
Ein Beispiel: Ein Bekannter erzählte mir von einer chinesischen Freundin, die sich vor zwei Jahren über die Proteste in Hongkong informierte, um zu klären, ob sie problemlos zum dortigen Flughafen kommen würde. Daraufhin wurde ihr WeChat-Konto vorübergehend gesperrt – und damit so wichtige Funktionen wie das Bezahlsystem.
Ein anderes Beispiel: Ein Nachbar von mir musste in seiner Wohnung in Quarantäne. Diese wäre eigentlich nach 14 Tagen zu Ende gewesen. Doch sein „QR-Gesundheitscode“, der jedem Handybesitzer in der Pandemie einen Status in den Ampelfarben zuweist, wollte einfach nicht auf Grün wechseln.
Der Nachbar musste drei weitere Tage in seiner Wohnung bleiben, bis das Problem gelöst war. Seine Wohnung einfach zu verlassen, hätte ihn kaum weit gebracht: Vor seiner Tür war eigens für die Dauer der Quarantäne eine Kamera montiert worden; das Bohrloch in der Decke ist noch sichtbar. Selbst wenn er die Wohnung verlassen hätte, hätten ihn spätestens bei der Rückkehr die Sicherheitsleute am Haupteingang gestoppt.
An solch einem Ort wohne ich nun also. Natürlich bin ich angewidert von der Überwachung und finde etwa die datenhungrigen Handy-Speisekarten unverschämt.
Zugleich finde ich all das durchaus faszinierend. Schließlich habe ich ein Privileg: Ich muss das alles nicht nur als Privatmensch irgendwie erdulden, sondern ich darf als Journalist versuchen, es zu ergründen, zu verstehen und zu erklären. Zumindest mit dem Ergründen bin ich nach gut einem Monat in Shenzhen vorangekommen. Eine erste Erkenntnis: Nichts ist alternativlos. Na ja, fast nichts.
Als die Maklerin mit mir mein Gesicht registriert hatte, sah ich, wie der Sicherheitsmann eine Schleuse mit einer Karte öffnete. Aha, es gab also doch eine Alternative. So eine Schlüsselkarte wolle ich auch, sagte ich der Maklerin. Sie schaute mich skeptisch an, dann fragte sie am Empfang, ob es die Karten auch für Mieter gebe.
Ja, antwortete die Empfangsmitarbeiterin, dazu brauche man jedoch das Einverständnis des Vermieters. Die Maklerin war überrascht. Sie zeigte Kunden regelmäßig Wohnungen in dem riesigen Komplex mit seinen fünf Hochhäusern, doch einen Bewohner mit Schlüsselkarte hatte sie noch nie gesehen.
Die Kartensache stand nun auf meiner To-do-Liste, aber erst einmal sollte ich meinen neuen Wohnsitz anmelden. Auch das ging, wie so vieles in China, per QR-Code. Den Code der Shenzhener Polizei hatte mir die Maklerin über WeChat geschickt, das im Kern ein Messenger wie WhatsApp ist. Scannt man den Code, öffnet sich ein Anmeldeformular. Man füllt es aus, fotografiert sich selbst und scannt einen weiteren, individuellen QR-Code, der in meinem Hochhaus neben jeder Haustür klebt. Schon ist man angemeldet.
So weit die Theorie. In der Praxis scheiterte ich, offenbar weil ich keine chinesische E-Mail-Adresse hatte. Also ging ich aufs Amt beziehungsweise in ein „Expat Service Center“ der Bezirksregierung, wo eine englischsprachige Mitarbeiterin mich rasch registrierte.
Ziemlich beeindruckend war, wie das Internet in meine Wohnung kam. Die Maklerin schickte einem Mitarbeiter von China Telecom per WeChat meine neue Adresse, ein Foto meines Passes und umgerechnet gut 50 Euro als erste Monatsgebühr. Am nächsten Tag kam der Installateur.
Als er fertig war, öffnete er auf meinem Telefon zwei Mini-Apps in WeChat: erstens den Kundendienst, zweitens offenbar ein Bewertungsprogramm, in dem ich zwischen den chinesischen Schriftzeichen nur eine Zeile a la „1 bis 10 Sterne“ erkannte. Ging es um die Arbeit des Installateurs? Der Mann drückte kommentarlos auf die 10 und gab mir mein Handy zurück.
Wenig geschmeidig lief es bei mir auch mit den „QR-Gesundheitscodes“. Man braucht einen grünen Code, um Orte wie Metrostationen, Behörden und Messezentren betreten zu dürfen. Dazu öffnet man eine Mini-App, die man vorher mit allen möglichen persönlichen Daten gefüttert hat, drückt auf „Aktualisieren“, dann belegt Programm anhand der Handy-Standortdaten, dass man sich jüngst nicht in Risikogebieten aufgehalten hat.
In Shenzhen werden mindestens drei Mini-Apps für diese QR-Codes genutzt: eine von der Stadt, eine von der Provinz Guangdong und eine von der Zentralregierung. Meist reicht einer der Codes als Zugangsberechtigung. Aber manchmal werden zwei verlangt, und im Bahnhof der Nachbarstadt Huizhou waren es sogar drei.
Doch in Shenzhen konnte ich zunächst keinen der Codes bekommen. Nur eine der Mini-Apps nannte den Grund: Meine Telefonnummer sei zu neu, weil noch nicht älter als 14 Tage. Ich zeigte also stets die Papierbescheinigung vor, die ich nach der dreiwöchigen Quarantäne bei der Einreise nach China bekommen hatte. Und das war wie russisches Roulette: Meist ging es gut, ab und an nicht.
An einem Strand in Yantian, ganz im Osten von Shenzhen, wollte mich der junge Sicherheitsmann in Uniform partout nicht durchlassen. Egal, dass ich mit meiner Quarantäne-Bescheinigung gerade U-Bahn gefahren war, egal, dass ich ein paar Tage vorher damit einen Zug und ein Flugzeug genommen hatte: Heute. Kein. Strand. Für. Mich.
Ich verlangte nach seinem Chef. Auch der bestand darauf: Ohne Code kein Durchlass.
Ich verlangte nach dem Chef des Chefs. Er kam aus dem Kontrollraum mit den Video-Bildschirmen heraus, schaute mich neugierig an und sagte dann den Lieblingssatz chinesischer Regelfetischisten, die mit einer unvorhergesehenen Ausnahme konfrontiert werden: „Bu xing“, übersetzbar mit: „Geht nicht“, oder einfach: „Nein.“
Wenn es hier schon so landestypisch zuging, dachte ich, dann würde ich mich ebenso landestypisch verhalten: laut werden und ein bisschen Theater machen. Es dauerte einen Moment, dann entschied sich der Chefchef um. Ich wollte glauben, dass ihn die Beharrlichkeit der radebrechenden Langnase beeindruckt hatte, aber wahrscheinlich hatte er einfach Mitleid. Egal, Hauptsache Strand.
Drei Wochen später war definitiv „game over“. Zugegeben, ich hatte mich nicht erneut darum bemüht, die QR-Codes zu bekommen, schließlich hatte es meistens ja auch ohne geklappt, und ich wollte mich nicht freiwillig überwachen lassen. Doch ein Sicherheitsmann an einer Metrostation ließ überhaupt nicht mit sich reden – und wollte den Code gleich für mich erstellen.
Er bat um mein Handy, öffnete eine der Mini-Apps und gab meinen Namen, meine Passangaben, meine Wohnadresse und einiges mehr ein. Wo ich hinfahren wolle, fragte er. „Nanshan“, sagte ich nur, das ist ein Stadtbezirk, der ungefähr so viele Einwohner zählt wie alle Schweizer Großstädte zusammen. Welche Station? Das ging mir zu weit, ich nannte eine andere Station als mein Ziel.
So oder so – das Formular ließ sich auch nach mehreren Versuchen nicht abschließen, ohne klare Begründung. Vielleicht lag es daran, dass ich noch keine fixe Aufenthaltsgenehmigung hatte, wer weiß. Als der Sicherheitsmann nach 20 Minuten einfach nicht aufgeben wollte, verließ ich kopfschüttelnd die Station und nahm stattdessen ein Taxi – für das ich das Zwanzigfache des Metrotickets zahlen musste.
Am nächsten Tag fand ich heraus, dass eines der QR-Programme in einem Feld das Format „Nachname, Vorname“ verlangte und nicht umgekehrt. Endlich hatte ich meinen Code.
Der eigentliche Messenger von WeChat füllte sich derweil in unglaublicher Geschwindigkeit mit Kontakten und Chats. Nicht dass ich darauf erpicht gewesen wäre, es passierte einfach. Sobald ich in einem Laden Möbel kaufte oder Zimmerpflanzen, sobald ich einen Café- oder Barbetreiber anquatschte, sobald mir Chinesen den Weg erklärten und dann vorschlugen, sich ein Taxi zu teilen, folgte eine Variation des Satzes: „Ich füg mal deinen WeChat-Kontakt hinzu, ja?“
Die meisten WeChat-„Freunde“, die ich so gewann, waren wohl einfach nur nett, neugierig und am (englischsprachigen) Austausch mit einem Ausländer interessiert. Ich gehöre hier ja einer sehr seltenen Spezies an. Nur 1,4 Millionen Einwohner sind keine Festlandchinesen, also 0,1 Prozent der Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden. Und selbst von diesen 1,4 Millionen sind fast die Hälfte Hongkonger, Macauer oder Taiwaner.
Aber was genau will etwa jene ältere Dame von mir, der ich am Nationalfeiertag auf der Straße zu ihrem knallroten Kleid gratulierte? Sie lud mich daraufhin gutgelaunt zum Tee in ihr Büro gegenüber ein, wir tauschten mangels vertiefter Sprachkenntnisse ein paar Banalitäten aus, dann fügte sie mich auf WeChat hinzu. Nun schickt sie mir seit drei Wochen Memes mit jungen Frauen im Bikini. Eine Bekannte meint, sie wolle mich vielleicht verkuppeln.
Die Schlüsselkarte also. Die Vermieterin war damit einverstanden, dass ich eine beantragen wollte, ich solle sie halt selbst bezahlen. Am Empfang meines Wohnkomplexes wollte die Mitarbeiterin die Erlaubnis meiner Vermieterin sehen. Ich zeigte ihr die Nachricht auf WeChat und machte mich auf ein landestypisch bürokratisches Prozedere gefasst.
Aber plötzlich ging alles ganz einfach: Die Frau öffnete eine Schublade, darin lag eine ganze Stange mintgrüner Karten. „Wie viele wollen Sie?“, fragte sie. Ich war baff. „Jetzt nicht übertreiben“, dachte ich, und bat um zwei. Die Mitarbeiterin schaltete die Karten frei, ich testete sie an der Schleuse, und fortan konnte ich auf die Gesichtserkennung verzichten.
Doch ich muss gestehen: Ich habe die Karten bisher kaum genutzt. Die Gesichtserkennung ist, ehrlich gesagt, ganz schön praktisch. Wenn ich mit Einkaufstaschen in beiden Händen nach Hause komme oder mit dem Fahrrad, kann ich einfach durch die Schleuse laufen. Und wenn meine Jogginghose keine Tasche mit Reißverschluss hat, muss ich nicht befürchten, dass die Karte beim Laufen rausfällt. Vor allem denke ich, dass die Hausverwaltung mein Porträtfoto sowieso schon hat und dass ich nicht wissen kann, ob sie es wirklich komplett löscht, wenn ich das eines Tages verlange. Ganz abgesehen davon, dass der chinesische Überwachungsapparat mein Foto längst in mehreren Ausführungen hat. Vielleicht wird es sogar regelmäßig aktualisiert, wenn mich die Videokameras auf der Straße, an Bahnhöfen und überall sonst erfassen.
Oh Gott, ist das einfach Assimilation, schon Unterwerfung – oder beides?
2 ALLTAG
Warum WeChat in China überall ist | Juli 2023
Als Elon Musk 2022 Twitter übernahm, schwärmte er von der chinesischen „Super-App“ WeChat. „In China lebt man grundsätzlich auf WeChat, weil es so hilfreich und nützlich für das tägliche Leben ist“, erklärte Musk den Twitter-Mitarbeitern. „Ich denke, wenn wir das erreichen oder mit Twitter auch nur annähernd daran herankommen, wäre das ein Erfolg.“
Lange geschah nichts, doch jetzt macht Musk offenbar Ernst. Anfang der Woche begann der Kurznachrichtendienst seine Umbenennung in „X“ und will nun wie WeChat eine umfassende „Alles-App“ werden.
Was genau also kann Musks großes Vorbild WeChat, und warum ist die App in China so erfolgreich?
„Ich scan dich“ ist in China ein ganz alltäglicher Satz. Er steht für die sagenhafte Verbreitung von Weixin, wie die chinesische Version von WeChat genau genommen heißt, die von rund einer Milliarde Chinesen im Monat genutzt wird. Egal, ob man in der App einen neuen „Freund“ hinzufügen, eine Zahlung tätigen oder ein Anmeldeformular aufrufen will: Man scannt dazu einen QR-Code. Das geht viel schneller, als etwa, wie bei WhatsApp lange üblich, die Telefonnummer eines neuen Kontakts im Telefonbuch speichern zu müssen.
Weixin wurde 2011 zunächst wie WhatsApp als reiner Nachrichtendienst für Texte und Fotos lanciert. Entwickler ist der Shenzhener Technologie-Konzern Tencent, der nach dem Erfolg seines Desktop-Chatdienstes QQ ein Nachfolgeangebot für das Smartphone-Zeitalter suchte. Die Funktionen von WeChat waren anfangs so rudimentär, dass manche Nutzer der ersten Stunde sich in Online-Kommentaren darüber beschwerten.
Doch das sollte sich ändern: Ein erster Wendepunkt war, dass Weixin ein paar Monate nach dem Start eine neue Funktion für Sprachnachrichten bekam. Das habe leitende Geschäftsleute, die das Tippen in Smartphones nicht gewohnt gewesen seien, zu Weixin-Nutzern gemacht, sagte der Tencent-Gründer Pony Ma einmal.
Weitere Funktionen folgten alle paar Monate: Dank „Shake“ können sich zwei Nutzer miteinander verbinden, die ihr Handy zufällig gleichzeitig schütteln. Mit einer „Flaschenpost“ kann man unbekannte Nutzer erreichen, genauso wie mit der Funktion „Leute in der Nähe“.
Heute kann man auf WeChat auch Nutzer „kitzeln“, also anstupsen, um zum Beispiel zu sehen, ob sie online sind. Sehr praktisch ist die integrierte Übersetzungsfunktion, dank der insbesondere Ausländer einfach mit Chinesen chatten können. Und während man in WeChat bereits seit 2014 mit anderen Nutzern seinen genauen Standort live teilen kann, ist das auf WhatsApp erst seit 2017 möglich.
WeChat ist praktisch mehrere soziale Netzwerke in einem. Denn man kann auf WeChat nicht nur chatten, sondern ähnlich wie auf Instagram „Momente“ posten, also kurze Texte, Fotos und Videos. Zudem funktioniert WeChat wie eine Plattform für Blogs. Zum Beispiel veröffentlichen Intellektuelle auf WeChat Essays, die teilweise hunderttausendfach geteilt werden.
Das absolute Massenphänomen wurde WeChat dank weiterer Funktionen. Das digitale Bezahlen per WeChat Pay ist heute in China omnipräsent, doch bei der Einführung 2013 schlug es zunächst gar nicht so sehr ein, auch weil es mit Alipay bereits einen etablierten Konkurrenten gab. Erneut brachte ein ebenso praktisches wie verspieltes Feature den Durchbruch: WeChat ermöglichte es 2014 seinen Nutzern, die traditionell zum chinesischen Neujahrsfest verschenkten roten Geldcouverts digital zu verschicken.
Heute kommt es in China durchaus vor, dass Freunde aus einer Spendierlaune heraus in einer Chat-Gruppe sozusagen einen kleinen digitalen Geldtopf posten und jeder Teilnehmer sich umgerechnet ein paar Euro herausnehmen kann. Umgekehrt gibt es auch eine Funktion zum Aufteilen etwa von Restaurant-Rechnungen. Üblicherweise zahlt in chinesischen Lokalen stets eine Person für die gesamte Gruppe. Per WeChat kann sie sich das Geld einfach zurückholen.
Immens wichtig für den Erfolg von WeChat sind auch die 2017 lancierten sogenannten Miniprogramme. Das sind gewissermaßen Apps in der App. Zu den bekanntesten gehören der Taxidienst Didi und der Essenskurier Meituan, deren Miniprogramme mittlerweile fest in WeChat integriert sind.