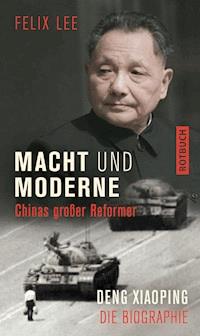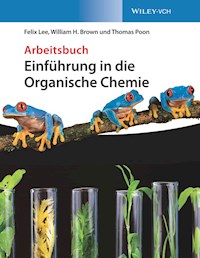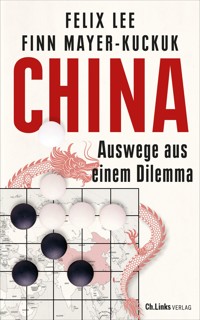
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Spiegel-Bestsellerautor Felix Lee und Finn Mayer-Kuckuk, langjährigerHandelsblatt-Korrespondent, entwerfen Wege aus dem China-Dilemma.
Xi Jinping verfolgt knallharte Interessen: die Formung einer Welt mit China an der Spitze. Deutschland spielt derzeit dabei nur eine nützliche Nebenrolle. Das zu erkennen, sollte uns nicht frustrieren, sondern motivieren! Wenn wir Schlüsseltechnologien, Infrastruktur und Digitalisierung vorantreiben, Entscheidungen in Politik und Wirtschaft beschleunigen und vor allem zwei Verhaltensweisen ablegen: unsere Unentschlossenheit und unser Harmoniedenken – dann können wir wieder Verhandlungspartner auf Augenhöhe werden. Denn China braucht uns, politisch, aber auch wirtschaftlich. China-Experte undSpiegel-Bestsellerautor Felix Lee und der langjährigerHandelsblatt-Korrespondent für Ostasien Finn Mayer-Kuckuk entwerfen Wege aus dem China-Dilemma.
»China stellt unser System infrage – das sollte uns nicht frustrieren, sondern motivieren!« Felix Lee und Finn Mayer-Kuckuk, China-Experten.
Das neue Buch von Felix Lee, Autor desSpiegel-Bestsellers »China, mein Vater und ich«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Xi Jinping verfolgt knallharte Interessen: die Formung einer Welt mit China an der Spitze. Deutschland spielt dabei eine nützliche Nebenrolle. Wenn wir Schlüsseltechnologien, Infrastruktur und Digitalisierung vorantreiben, Entscheidungen in Politik und Wirtschaft beschleunigen und vor allem zwei Verhaltensweisen ablegen: unsere Unentschlossenheit und unser Harmoniedenken – dann können wir wieder Verhandlungspartner auf Augenhöhe werden.
Das wegweisende Buch von China-Experte und Spiegel-Bestsellerautor Felix Lee und dem langjährigen Handelsblatt-Korrespondenten für Ostasien Finn Mayer-Kuckuk.
Über die Autoren
Felix Lee, geb. 1975 in Wolfsburg, studierte Soziologie, Volkswirtschaft und Politik und absolvierte die Berliner Journalistenschule. Von 2003 bis 2022 arbeitete er als Wirtschafts- und Politikredakteur der taz. Ab 2010 war er neun Jahre China-Korrespondent in Peking. Er arbeitete für Table Media, bevor er Redakteur bei Süddeutsche Zeitung Dossier wurde. Sein Buch »China, mein Vater und ich« wurde zum Spiegel-Bestseller, gewann den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2023 und war ein Jahr lang unter den Top 10 des manager magazin. Er lebt in Berlin.
Finn Mayer-Kuckuk, geb. 1974 in Bonn, ist Wirtschaftsjournalist. Er hat Sinologie und Japanologie studiert und besuchte die Holtzbrinck-Journalistenschule. Von 2006 bis 2019 war er Korrespondent u.a. für das Handelsblatt in Ostasien, zunächst in Tokio, dann in Peking. Er leitete das Ressort »China« bei Table Media und ist Redaktionsleiter bei Süddeutsche Zeitung Dossier. Er lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Felix Lee, Finn Mayer-Kuckuk
China
Auswege aus einem Dilemma
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Einleitung
1 Von China umgarnt – nirgends ist Pekings Umgang mit der Welt besser zu beobachten als auf Kinmen
2 Sunzi: Hauptsache der Gegner weiß nicht, was wirklich los ist – über die Geheimnisse chinesischen Denkens
3 Deutsche Wirtschaft in der China-Falle – und wie wir uns daraus befreien
BASF in China – eine riskante Wette auf die Zukunft
Euphorie des Aufbruchs, Schock von Tiananmen und business as usual
China wird zum Traumstandort
Der Pakt mit der Staatswirtschaft
Übermächtiger Konkurrent unter staatlicher Lenkung
Xi Jinping schaltet in den Rückwärtsgang
Bedauerlich versus lebensgefährlich – der Verlust ganzer Industriezweige
Abhängigkeiten und der Versuch sie kleinzureden
Warum es jetzt kein De-Risking geben wird
»Wer sich aus China verabschiedet, findet sich im Mülleimer der Wirtschaftsgeschichte wieder«
De-Risking versus De-Coupling und Chinas Supraplan
Chinas Wachstumsstau und das Ende einer Ära
Intelligente Industriepolitik, strategische Handelspolitik, kluges De-Risking
Geld ausgeben gegen Konfliktfall-Risiken
Energiesicherheit trotz chinesischer Solar-Dominanz
Batterietechnologie – zu wichtig, um sie China zu überlassen
Deutschlands Spezialisierungen erhalten und in Fachkräfte investieren
Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen
Und die Big Five?
4 Vom Gastgeber zum Gast im eigenen Haus – Chinas Technik-Dominanz und wie Deutschland wieder aufholen kann
Datenkrake TikTok
Huawei – wie die Deutschen Gast im eigenen Haus wurden
Autokratie und Kreativität
Künstliche Intelligenz – China und die USA im Kopf-an-Kopf-Rennen
Quantentechnologie – von China lernen für die Zukunft
Kampfplatz Chip-Herstellung
Das Auto als Smart-Gerät auf Rädern – Chinas Dominanz in der E-Mobilität
»Made in China 2025« als nationalistische Strategie
Den Spieß umdrehen
5 Unsere Moral und die Realität der Lieferketten – wie wir Anspruch und Wirklichkeit in Einklang bringen
Experimentierfeld Xinjiang – die digitale Diktatur der Zukunft
Überwachung als Mittel der Diskriminierung und wie sie die chinesische Gesellschaft lähmt
Die Auflösung des Lieferketten-Dilemmas
6 Kanzler, Kanzlerin und die KP – über politische Irrwege und was uns neue Orientierung gibt
Kontinuitäten – Kanzler und Kanzlerin auf ihrem Weg ins China-Dilemma
Die China-Strategie der Bundesrepublik – Chancen und Grenzen einer politischen Neuorientierung
China-Strategie in der Praxis
Partner? Rivale? Wettbewerber!
Politik in der Pflicht – klare Ziele, konsequente Umsetzung, positive Haltung zu Veränderungen
Mangelnde Handlungsfähigkeit – liegt es am System?
China-Kenntnisse stärken
7 Europa als Schlüssel zur Lösung des China-Dilemmas
Vernarrt in Mao – frühe China-Begeisterung der westdeutschen Linken
Deutsch-chinesische Beziehungen unter Deng Xiaoping
Menschenrechte in China – die Zeit der Hoffnung
Stimmungswechsel in den 2010er Jahren
Xi Jinping und Dokument Nr. 9
China macht die Wirtschaft zur Waffe – und die EU rückt zusammen
Der BDI schlägt sich auf die Seite der EU
Die EU wird wehrhafter – Deutschlandmuss mitziehen
8 Chinas weltweiter Machtanspruch – und wie wir ihm begegnen sollten
Chinas Interesse an Geopolitik wächst
Brics plus – wie China zur Alternative für den Globalen Süden wird
Chinas militärische Aufrüstung wird zur weltweiten Drohkulisse
China unterhöhlt internationale Institutionen und schafft eigene
Xi spielt mit Nationalismus
Chinas globale Machtspiele ausmanövrieren
Den Globalen Süden in eine neue Weltordnung einbeziehen
9 China und wir – Bilanz und Ausblick
Anmerkungen
1 ■ Von China umgarnt – nirgends ist Pekings Umgang mit der Welt besser zu beobachten als auf Kinmen
2 ■ Sunzi: Hauptsache der Gegner weiß nicht, was wirklich los ist – über die Geheimnisse chinesischen Denkens
3 ■ Deutsche Wirtschaft in der China-Falle – und wie wir uns daraus befreien
4 ■ Vom Gastgeber zum Gast im eigenen Haus – Chinas Technik-Dominanz und wie Deutschland wieder aufholen kann
5 ■ Unsere Moral und die Realität der Lieferketten – wie wir Anspruch und Wirklichkeit in Einklang bringen
6 ■ Kanzler, Kanzlerin und die KP – über politische Irrwege und was uns neue Orientierung gibt
7 ■ Europa als Schlüssel zur Lösung des China-Dilemmas
8 ■ Chinas weltweiter Machtanspruch – und wie wir ihm begegnen sollten
9 ■ China und wir – Bilanz und Ausblick
Dank
Impressum
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257
Einleitung
Deutschland hat gute Jahrzehnte hinter sich. Das mag vielleicht nicht jeder und jede Einzelne zu spüren bekommen haben, aber insgesamt sind die Deutschen sehr viel wohlhabender geworden. Die Löhne sind gestiegen, die Vermögen ebenfalls. Kleidung, Spielzeug, Elektroartikel und viele andere Konsumartikel wurden derweil lange Zeit kaum teurer.
Dieses robuste Wachstum bei geringen Preissteigerungen hat vor allem ein Land möglich gemacht: China. Den Aufstieg von einem armen und rückständigen Land zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat China einem gigantischen Heer von Arbeiterinnen und Arbeitern zu verdanken. Diese strebten nach Wohlstand und waren bereit, die Weltmärkte zu niedrigen Löhnen mit günstigen Waren zu versorgen. Die politische Führung unterstützte diese Entwicklung. Sie ließ Fabriken, Straßen, Schienen, Datennetze, aber auch Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen bauen. Außerdem lenkte sie die Wirtschaft hin zu immer wertigeren Produkten. Durch dieses geschickte Zusammenspiel hat sich China technisch an die Weltspitze gehievt.
Von Chinas Einbindung in die Weltwirtschaft haben fast alle Länder profitiert. Eines aber ganz besonders: Deutschland. Denn die Deutschen lieferten genau die Geräte, Maschinen und Vorprodukte, die die chinesische Wirtschaft für ihren Aufstieg brauchte. Von Deutschland übernahmen die Chinesen zugleich viel Know-how und Managementwissen.
Die Deutschen haben ganz besonders zu Chinas Aufstieg beigetragen. Wer in den Nuller- und Zehnerjahren in Peking und Shanghai unterwegs war, konnte sich davon überzeugen: Dort wohnten, arbeiteten und vergnügten sich Zehntausende Deutsche, zumeist Vertreter von deutschen Firmen und ihre Angehörigen. Aber auch in den neu entstandenen Industriezonen in der Provinz stellten sie mit Abstand die größte Gruppe westlicher Ausländer. Für ihre Bedürfnisse entstanden eigene Schulen, Läden und Biergärten.
Für die Deutschen wurde China zum größten Absatzmarkt der Welt, und sie stießen auf dankbare Abnehmer. Sie kamen als Lehrmeister und fühlten sich in dieser überlegenen Rolle sichtbar wohl. Die deutschen Unternehmer wollten aber nicht nur die billige Arbeitskraft ausnutzen, sondern viele von ihnen waren ehrlich an der Entwicklung des Landes interessiert. Die Stimmung war gut, man versicherte sich gegenseitig der guten Partnerschaft. »Made in Germany« war ein Gütesiegel, die deutsche Produkte waren hoch angesehen. Wenn es nach den Geschäftsleuten gegangen wäre, hätte es ewig so weitergehen können.
Noch ist diese nützliche Wechselbeziehung nicht an ihr Ende gekommen, aber sie ist zum Problem geworden. Von der großen Chance hat sich China zum vielleicht größten Dilemma für Deutschlands Wirtschaft und Politik gewandelt.
China ist nicht mehr der friedliche Riese, der sich nur entwickeln und seine Menschen aus der Armut holen will. Die Erwartung, das aufstrebende Land werde sich in die internationale Weltordnung einfügen, die Europa und die USA vorgegeben haben, erwies sich schlicht als falsch. China zeigt sich als mächtiger Spieler, der die globalen Beziehungen umformt und auf seine eigenen Interessen ausrichtet.
China ist auch nicht mehr der Bittsteller, der den Investoren dankbar ist und zu ihnen aufschaut. Insbesondere die Deutschen, die sich eben noch in der Rolle des Lehrmeisters gefallen haben, erleben hier manchen Schockmoment. Die Volksrepublik hat Deutschland in vielen Bereichen technologisch überholt und schickt sich an, die Technologien von morgen lange vor Deutschland zu besetzen. Die chinesische Führung hat vorgegeben: Das Land soll bis 2049 wirtschaftlich, kulturell und militärisch global an der Spitze stehen. Gut die Hälfte der To-do-Liste hat China bereits abgehakt. Deutsche Unternehmen müssen plötzlich von den überlegenen Chinesen lernen.
Geopolitisch stellt sich China als neue Weltmacht dar, die sich in ihrem weiteren Aufstieg von den USA behindert sieht. Unverhohlen unterstützt die Volksrepublik nicht nur das russische Kriegstreiben in der Ukraine, sondern schmiedet mit großem Erfolg neue Bündnisse mit Ländern des Globalen Südens. Für China ist das eine Alternative zur alten Weltordnung, die vom Westen dominiert war – und für die Länder des Globalen Südens ebenfalls.
Die USA wiederum machen Druck auf die EU und insbesondere auf die Bundesrepublik. Washington fordert die Europäer auf, sich für eine Seite zu entscheiden. Spielt Deutschland nicht für Team USA, drohen diese mit der Aufkündigung der Sicherheitsgarantien.
Was demokratische Werte und die Einhaltung der Menschenrechte betrifft, ist China trotz seiner Öffnungspolitik und seines wirtschaftlichen Aufstiegs immer ein Unrechtsstaat geblieben. Das hat Deutschland und alle anderen westlichen Staaten in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht davon abgehalten, immer mehr in die Volksrepublik zu investieren. »Wandel durch Handel« lautete der Spruch, mit dem man sich das Engagement schönredete: Profit machen und dabei noch Gutes tun. Die Phrase musste vor allem dann herhalten, wenn die kommunistische Führung wieder besonders heftig gegen Dissidenten vorging, gegen Tibeter oder die muslimische Minderheit der Uiguren. Das Wegschauen rächt sich jetzt. Der Wandel führte politisch in die denkbar schlechteste Richtung, und Deutschland ist zum Komplizen der Unterdrücker geworden.
Kurzsichtiges Handeln, Unkenntnis der chinesischen Ziele und der chinesischen Vorgehensweise, vielleicht auch Ignoranz und eine gewisse Überheblichkeit holen Deutschland jetzt ein. Es hat sich abhängig von China gemacht – bis hin zur Erpressbarkeit. Die bekanntesten Großunternehmen wie VW und BASF und die führenden Branchen wie der Maschinenbau kommen ohne China nicht mehr aus. Das Geschäft in der Volksrepublik macht einen so großen Teil ihrer Bilanzen aus, dass ein Rückzug aus Aktionärssicht ein großes Unglück wäre. Europa zögert, Sanktionen im Falle eines Übergriffs auf Taiwan anzudrohen. Denn ohne Lieferungen aus China läuft in den Fabriken der EU kaum noch etwas.
Das betrifft nicht nur Zulieferteile wie Batterien oder die für moderne Industrien so fundamental wichtigen Halbleiter, sondern auch Antibiotika oder Industrierohstoffe wie Seltene Erden. Deutschlands Energiewende beruht zu einem großen Teil auf günstigen Photovoltaikanlagen aus China. Ein Ende des China-Handels würde nicht nur viele Prozentpunkte Wachstum kosten und soziale Verwerfungen auslösen. Er könnte Deutschlands gesamte Industrie zum Erliegen bringen.
Wenn China hustet, fängt Deutschland sich eine Grippe ein. Und derzeit hustet es. Nach mehr als drei Jahrzehnten unaufhörlich hoher Wachstumsraten schwächelt Chinas Wirtschaft. Das Land hat gewaltige Überkapazitäten geschaffen. Das ist auf der einen Seite wirtschaftlich ungesund. Auf der anderen Seite versucht China, seine Waren in die Weltmärkte zu drücken. Chinesische Elektroautos sind nicht nur gut, sondern auch günstig. Deutschlands wichtigster Industriezweig steht unter Druck.
Für die Deutschen ist das China-Dilemma noch größer als für andere Länder. Wie konnte es so weit kommen? Hat China das alles bewusst eingefädelt? Waren wir blind oder naiv oder beides? Und vor allem: Wie kommen wir da wieder heraus? Um diese Fragen zu beantworten, gilt es genauer auf China zu schauen. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch auf wichtige Entwicklungen in der Vergangenheit und mögliche in der Zukunft.
Was in Deutschland fehlt, ist ein Verständnis dafür, wie das Land tickt, wie die chinesische Führung und wie Chinas Bürgerinnen und Bürger denken. Es fehlt Wissen über Chinas strategisches Handeln und seine Ziele. Ebenso wenig gibt es einen Konsens darüber, wie wir der Volksrepublik und ihrem weltweiten Machtanspruch gegenübertreten sollten. Dieses Buch will die richtigen Fragen stellen, um plausible Antworten darauf zu finden, wie wir im Umgang mit China wieder souveräner und erfolgreicher werden können.
Hinter den beschriebenen Entwicklungen stehen Menschen. Es kommen daher auch wichtige Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und den Medien zu Wort, Gestalter, Beobachterinnen und Mahner. Sie haben das deutsche Verhältnis zu China mitgeprägt. Aus ihren verschiedenen Blickwinkeln ergibt sich ein fein abgestuftes Bild.
Ein differenzierter Blick ist wichtig, denn für das China-Dilemma gibt es keine einfache Lösung. Wir müssen China genauer zuhören, aber wir müssen ihm auch widersprechen. Noch wichtiger aber ist: Wir müssen uns selbst ändern, um unseren Wohlstand und unsere Unabhängigkeit im globalen Wettbewerb zu erhalten. Die neue Konkurrenz aus Fernost kann auch eine Motivation sein, längst fällige Modernisierungen und Veränderungen mit Tatkraft und Optimismus anzugehen.
Felix Lee und Finn Mayer-Kuckuk Berlin, August 2024
1Von China umgarnt – nirgends ist Pekings Umgang mit der Welt besser zu beobachten als auf Kinmen
Kinmen wirkt heute wie ein Urlaubsparadies. Fischerdörfer schmücken die beiden Hauptinseln, alte Tempel, die zu Ehren der daoistischen Göttin Mazu errichtet wurden, Beschützerin der Seeleute, leuchten in der Sonne. Den Uferweg auf den Klippen flitzen Mountainbiker entlang. Unten am Strand flanieren Liebespaare, die glitzernde Skyline der Millionenstadt Xiamen auf dem gegenüberliegenden Festland vor Augen.
Xiamen liegt an Chinas Küste, während Kinmen zu Taiwan gehört. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als abtrünniges Territorium. Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigt regelmäßig eine »Wiedervereinigung« mit Taiwan an,1 während Taiwan gar nicht zur Volksrepublik gehören will und auch niemals dazugehörte. Als die Volksrepublik 1949 gegründet wurde, war Taiwan faktisch schon unabhängig. Seit Xi an der Macht ist, führt die Volksbefreiungsarmee auffällig oft Manöver im Meer um Taiwan durch und dringt dabei auch in Gebiete vor, die die Inselrepublik für sich beansprucht.
Die Einwohner der kleinen Inseln direkt vor Chinas Küste sind zwar in einer völlig anderen Lage als beispielsweise Menschen in Deutschland, dennoch lässt sich aus der Art und Weise, wie Kinmen von China geradezu eingesponnen wird, eine für die westliche Welt wichtige Lehre ziehen. Ausschlaggebend ist dabei Chinas Doppelstrategie: Es droht und umarmt gleichzeitig.
In Ufernähe der Kinmen-Inseln ragen noch immer schräg in den Boden gerammte Eisenträger aus dem Wasser. Sie sollten einst vor Landungsbooten des Feindes schützen. Denn China, das war – und ist – für viele Taiwaner: der Feind. Bis heute wagt es das seit über 70 Jahren selbstständig regierte Land mit eigenem Militär und Rechtssystem nicht, offiziell seine Unabhängigkeit zu erklären. So sehr fürchtet die Republik China, wie sich Taiwan nennt, einen Konflikt mit seinem übermächtigen Nachbarn.
Dass Kinmen überhaupt zu Taiwan gehört, hat es dem Führer der Nationalen Volkspartei, der Kuomintang (KMT), zu verdanken: Chiang Kai-shek. Der musste sich 1949 nach seiner Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong mit seinen Anhängern vom chinesischen Festland nach Taiwan zurückziehen. Kinmen konnte Chiangs Armee trotz der Nähe zu China halten. Von hier aus wollte er das Riesenreich zurückerobern und baute die Inseln zu einer Festung aus. Mehr als 100 000 Soldaten stationierte er zeitweise hinter den Verteidigungsanlagen. Dabei ist die Kinmen-Gruppe zusammengenommen kleiner als Fehmarn.
Mehrere Male griff Maos Volksbefreiungsarmee Kinmen an. Einmal im Oktober 1949. Chiangs Truppen konnten den Angriff mithilfe der USA erfolgreich abwehren. Der zweite Angriff erfolgte am 3. September 1954, diesmal als monatelanges Bombardement. Vier Jahre später beschoss Chinas Volksbefreiungsarmee Kinmen erneut. Noch bis in die Mitte der Siebzigerjahre hielten die Angriffe an. Eine Million Granaten ging im Lauf der Jahrzehnte auf Groß-Kinmen und Klein-Kinmen nieder. 2500 Zivilisten und Soldaten kamen ums Leben. In den Hirsefeldern sind noch immer Stöckchen zu sehen, die die Fundorte ihrer Leichen markieren. Bis 1992 galt auf Kinmen das Kriegsrecht, Brieftauben waren verboten, ebenso wie helle Kleidung. Die Bewohner lebten wie Maulwürfe in Verteidigungsanlagen unter ihren Dörfern.
Im Südteil der Hauptinsel befindet sich heute noch ein in den Felsen gesprengter, etwa 350 Meter langer Tunnel mit Zugang zum Meer, in dem einst kleine Kriegsschiffe versteckt wurden. Inzwischen finden in den farbig beleuchteten Höhlen Klassikkonzerte statt.
Entlang der Klippen, teilweise in die Felsen einbetoniert, stehen Bunker umzäunt von Stacheldraht. Sie sind allesamt außer Betrieb, Relikte der Vergangenheit. Die Behörden haben einige der Abwehranlagen für Touristen zugänglich gemacht. Darin zu sehen sind auch ausrangierte Panzer und Kanonen, die aufs Festland zielen.
Am Kliff von Beishan, dem nördlichsten Zipfel der Hauptinsel, erhebt sich ein Turm von etwa 15 Metern in die Höhe, an dem 48 Lautsprecher installiert sind. Sie dienten dazu, China mit Propaganda zu beschallen. Auf dem chinesischen Festland befanden sich ebenfalls Lautsprecher. In den 1950er Jahren beschimpften sich beide Seiten über diese Anlagen anhaltend und lautstark. Später versuchte die taiwanische Seite, ihre Widersacher mit taiwanischen Schlagern für sich zu gewinnen.
Ein paar der Lautsprecher sind heute noch in Betrieb. Allerdings nur für Touristen. Manchmal erklingt daraus die Stimme der inzwischen verstorbenen taiwanischen Sängerin Teresa Teng mit dem Ohrwurm »Tianmimi«. Die erste Zeile lautet: »So süß wie der Honig dein Lächeln.« Und weiter: »Wo habe ich dich bloß gesehen?« – eine Anspielung, dass zusammenwachsen soll, was zusammengehört? Teresa Teng war in den 1980er Jahren auch in der Volksrepublik ein Star. Weil ihre Musik von Kinmen aus übers Meer schallte? Schon möglich.
Das friedliche Miteinander in jüngster Zeit ist also nicht selbstverständlich und nur wegen der exponierten Lage von Kinmen möglich. Was die kleine Inselgruppe früher gefährdet hat, schützt sie heute: die Entfernung zu Taiwans Hauptinsel. Unter Militärexperten kursieren viele Szenarien, wie ein Krieg um Taiwan beginnen könnte. Ein Angriff der Volksbefreiungsarmee auf Kinmen als erster Schritt gilt dabei jedoch als unwahrscheinlich.
Taiwans militärische Verteidigung beruht maßgeblich auf Hilfen der USA. Wäre Taiwan auf sich allein gestellt, würde Chinas Armee sämtliche wichtigen Militäreinrichtungen Taiwans binnen weniger Tage ausschalten. Nicht aber, wenn die USA rechtzeitig eingreifen. Sollte die Volksbefreiungsarmee Kinmen angreifen, wären Taipeh und Washington rechtzeitig alarmiert und könnten den Gegenangriff beginnen. Ein Erstschlag auf Kinmen würde den Alliierten also wertvolle Zeit verschaffen. Wenn die Volksbefreiungsarmee Taiwans Verteidigung überrennen will, muss sie das Land als Ganzes und in einem Zug angreifen.
Chinas Führung verfolgt gegenüber Kinmen aber eine völlig andere Strategie. Sie kommt ganz ohne Waffen aus, ist viel effektiver – und bereits im Gange. Sie lautet: Einnahme durch Umarmung.
Nirgendwo ist Chinas Umgang mit der Welt daher besser zu beobachten als auf Kinmen. Die Inselgruppe befindet sich nur eine halbe Fährstunde von Xiamen entfernt, einer boomenden Vier-Millionen-Metropole. Alle 20 Minuten verkehren Fähren zwischen Kinmen und Xiamen. Chinesische Touristen decken sich in Kinmen mit Gaoliang ein, einem Hirseschnaps, für den Kinmen seit Jahrhunderten berühmt ist. Und sie kaufen Messer und andere Souvenirs aus Granaten, die ihre Großeltern einst auf Kinmen geschossen haben. Die Menschen von Kinmen wiederum vergnügen sich in den großen Shoppingmalls von Xiamen, den Multiplexkinos und Restaurants. Sie genießen das Großstadtleben, das sie auf ihren von Fischerei und Hirseanbau geprägten Inseln nicht haben.
An der Wand des Besprechungsraums von Li Wenliang, dem stellvertretenden Bürgermeister des Landkreises Kinmen, hängt eine Karte. Zu sehen sind Kinmen und Xiamen. Bürgermeister Li zeigt auf eine durchgezogene Linie, die eine bereits bestehende Pipeline darstellt, über die das chinesische Festland Kinmen mit Leitungswasser versorgt. Dann macht er auf gestrichelte Linien aufmerksam: Stromleitungen zwischen China und Kinmen. Als nächstes deutet Li auf den internationalen Flughafen von Xiamen, der sich momentan noch im Inland befindet. Er soll aber verlegt werden. Mit seinem Zeigefinger tippt Li auf zwei kleine Inseln zwischen Kinmen und dem Festland, in der Realität nicht größer als zwei aus dem Wasser ragende Felsen. Den Raum dazwischen schüttet China derzeit auf. Entstehen soll darauf eine riesige Start- und Landebahn für den neuen Flughafen. Das erste Terminal ist im Bau. Sobald es vollendet ist – und das soll bereits 2025 der Fall sein –, wird das chinesische Festland so nah an Kinmen herangerückt sein, dass man fast einen Stein hinüberwerfen könnte.
Auch eine Brücke will China nach Kinmen bauen. Die Regierung in Taiwans Hauptstadt Taipeh will diese Brücke auf keinen Fall. Eine Mehrheit der Menschen in Kinmen hingegen schon. »Wir haben seit 30 Jahren regelmäßigen Fährverkehr«, sagt Chen Tsang-chiang, der sich lange Zeit für die Demokratisch Progressive Partei (DPP) auf Kinmen engagiert hat. Einen grundsätzlichen Unterschied mache eine Brücke nach Xiamen nicht. Sie würde den Grenzverkehr aber sehr vereinfachen und die Wirtschaft auf beiden Seiten beleben.
Die DPP setzt sich für mehr Eigenständigkeit der demokratisch regierten Inselrepublik ein. Die bereits erwähnte KMT, die hier einst die Verteidigungsanlagen eingraben ließ, steht heute hingegen für eine Annäherung an die Volksrepublik.
Eine komplett neue Situation ist entstanden: Ausgerechnet der einstige Erzfeind der Kommunisten ist in Taiwan nun der Verbündete des heutigen China. Landesweit muss sich die Partei immer wieder mit einer Rolle in der Opposition abfinden. In Kinmen nicht. Hier hat die KMT stabile Mehrheiten von über 70 Prozent. Denn die Menschen auf den Inseln direkt vor der Küste der Volksrepublik wollen eine Annäherung an China, keine Konfrontation.
Das gilt aber auch für DPP-Anhänger Chen. »Nur eine Brücke nach Xiamen kann Kinmens Zukunft sichern«, sagt er. Chen ist ein Außenseiter in zweifacher Hinsicht. Auf Kinmen ist er als Vertreter der DPP in der Minderheit. Bei der DPP in Taipeh ist er wiederum wegen seiner Haltung zur Brücke und zu China ein Außenseiter. »Wir haben Krieg erlebt«, sagt er. »Er muss um jeden Preis vermieden werden.« Der Weg, ihn zu vermeiden, sei Dialog und Handel.
Dass ausgerechnet die Menschen auf Kinmen, die jahrzehntelang unter dem Beschuss durch die Volksrepublik gelitten haben, ihre Zukunft nun durch Annäherung sichern wollen, hat aber noch andere Gründe. Von den knapp 140 000 Menschen, die offiziell in Kinmen registriert sind, leben nur etwa 60 000 tatsächlich auf Groß-Kinmen und Klein-Kinmen, die anderen wohnen auf Taiwans Hauptinseln und auf dem Festland. Die meisten der Ansässigen sind verhältnismäßig wohlhabend, was aber kaum am Hirseanbau für den Schnaps liegen kann. Dafür ist die Nachfrage nach Gaoliang dann doch nicht groß genug.
Vielmehr konnten viele der Insulaner mit Immobilienhandel in Xiamen ein Vermögen aufbauen. Als die Volksrepublik Ende der 1990er Jahre ihren Immobilienmarkt liberalisierte, lockte die Stadtverwaltung von Xiamen Menschen aus Taiwan und ganz gezielt aus Kinmen, in Wohnungen und Grundstücke zu investieren. Der Kapitalzufluss sollte dem Ausbau von Wohnraum einen Schub geben. Damals waren die Taiwaner wirtschaftlich schon erfolgreich, aber in Xiamen waren die Preise noch sehr niedrig. Oft bezahlten sie nur wenige Zehntausend Yuan für eine Wohnung, also lediglich einige Tausend Euro. Seitdem haben sich die Bewertungen in Xiamen verzwanzigfacht.
Doch nicht nur die Immobilien in Xiamen binden viele Menschen auf Kinmen ans Festland. »Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind traditionell eng«, bemerkt Chen. »Wir sind kulturell und wirtschaftlich viel enger mit der Region Xiamen verwurzelt als mit Taiwan, das etwa 340 Kilometer weit entfernt ist.« In den vergangenen drei Jahrzehnten, seit der direkte Fährverkehr möglich ist, haben die Familien diese alten Verbindungen wieder intensiviert. Etwa 10 000 der Kinmen-Insulaner sind mit einer Festlandchinesin oder einem Festlandchinesen verheiratet.
Man kann diese Entwicklung als Ergebnis der Öffnung Chinas sehen. Doch das ist nur ein Teil der Erklärung. Vielmehr hat Chinas Führung erkannt, dass mit einer gezielten Annäherung nicht nur verwandtschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Abhängigkeiten geschaffen werden. Die Menschen von Kinmen wurden am Immobilienboom in Xiamen beteiligt. Mit dem Bau von Leitungen ist Kinmens Versorgung mit Wasser und Strom vom Festland abhängig gemacht worden. Die geplante Brücke optimiert die Infrastruktur und bindet den Verkehr stärker ans Festland an. Die Meerenge dazwischen wird nach und nach zugeschüttet. Der Flughafen von Xiamen wird dann schneller zu erreichen sein als der in Taipeh. Kein Wunder, dass sich die Menschen auf Kinmen angesichts dieser Verwobenheit einen Krieg gar nicht mehr vorstellen können. So manch ein Politiker in der rund 340 Kilometer entfernten Hauptstadt gibt Kinmen bereits verloren. »Die sind doch schon komplett von der Volksrepublik indoktriniert«, heißt es dort hinter vorgehaltener Hand.
Schwachstellen erkennen und nutzen: Im Umgang mit Kinmen zeigt Chinas Führung, wie sie mit ganz Taiwan umzugehen gedenkt – und letztlich mit der ganzen Welt. Ob im Südchinesischen Meer, in Afrika, Zentralasien, Russland, Lateinamerika, Südostasien oder in Deutschland – stets folgt China einem strategischen Denken, dessen Ursprung sich über 2500 Jahre zurückverfolgen lässt. Aus dieser Zeit ist das Buch über die Kriegskunst von Sun Wu überliefert, der oft »Meister Sun« oder »Sunzi« genannt wird. Früher wurde er auf Deutsch auch »Sun Tsu« oder »Sun Tse« geschrieben, auf Englisch ist noch »Sun Tzu« gebräuchlich.
Krieg und Angriffe als Mittel der Politik schließt Sunzi nicht aus. Doch der Meister sieht sie eher als letzte Möglichkeit. Wirklich erfolgreich ist aus seiner Sicht, wer seine Ziele kostengünstig und verlustfrei erreicht: durch Listen und Finten. Dazu gehören Einkreisen, Umschließen, Lücken füllen, Abhängigkeiten schaffen sowie glaubwürdige Drohungen einerseits und Verlockungen andererseits.
2Sunzi: Hauptsache der Gegner weiß nicht, was wirklich los ist – über die Geheimnisse chinesischen Denkens
Die Vorgehensweise, Kinmen zugleich zu umarmen und zu bedrohen, entspringt dem politischen Instinkt der chinesischen Führung: Zuckerbrot und Peitsche erzielen hier maximale Wirkung bei minimalem Einsatz – und das praktisch ohne Risiko. Das entspricht der Ideenwelt von Sunzi, einem General und Philosophen, der um 500 v. Chr. gelebt haben soll. Über das Leben dieses Strategiemeisters ist außer einem kurzen Eintrag in den chinesischen Dynastiegeschichten wenig bekannt. Doch Meister Sun hat ein Buch geschrieben, oder zumindest wird es ihm zugeschrieben, das enormen Einfluss auf das strategische Denken Chinas hat.1
Das Buch Sunzi (»Sunzis Kriegskunst«) wird oft in einem Atemzug mit den inzwischen auch im Westen bekannten »36 Strategemen« genannt, manchem gilt Sunzi auch als dessen Autor. Doch das ist sicher nicht der Fall, denn die Sammlung wurde erst rund eintausend Jahre nach Sunzis Tod erstmals erwähnt. Allerdings vermitteln sie die gleiche Geisteshaltung: In beiden Werken geht es darum, einen Gegner mit minimalem Aufwand, aber mit hoher Effektivität zu besiegen, und zwar möglichst unter Anwendung von Tricks und Listen statt roher Gewalt.
Die »36 Strategeme«, chinesisch: Sānshíliù jì, sind weniger Buch als Allgemeingut, das immer wieder neu interpretiert wird, sei es als Kinderbuch, Comic, Managerratgeber oder Militärliteratur. Die Zahl 36, sechs mal sechs, hat dabei eine eher kulturelle Bedeutung. Es handelt sich um eine Phrase aus dem 5. Jahrhundert, die »viele Strategeme« heißen soll. Tatsächlich könnte es auch eine geringere Anzahl von Strategemen sein, weil sich die Ideen hinter einigen der Geschichten wiederholen. Jedes der 36 Strategeme wird in nur vier Schriftzeichen umrissen, manchmal auch nur in drei. Ein Schriftzeichen entspricht dabei jeweils ungefähr einem Wort. Vier Worte also – der Rest ist Interpretation. Und die wandelte sich im Laufe der Zeit, wie der im deutschsprachigen Raum führende Strategem-Experte, der Schweizer Sinologe Harro von Senger, ausführt.2
Urheber einer der ersten Zusammenstellungen von Strategemen soll ein General namens Tan Daoji gewesen sein, der 436 n. Chr. gestorben ist. Die heutige Fassung stammt möglicherweise aus dem 20. Jahrhundert: Sie beruht auf einer geheimnisvollen Handschrift, die in den 1940er Jahren »aufgetaucht« ist. Die Strategeme wurden ab den 1960er Jahren vielfach in modernen Interpretationen veröffentlicht.3
Ein Hauptmotiv ist die Täuschung des Gegners. Dazu gehören dessen unauffällige Einkreisung oder Geländegewinne in der Abwesenheit seiner Streitmacht. Ein Sieg durch Umgehung der feindlichen Armee gilt im Vergleich zu einer offenen Schlacht immer als der schlauere Weg. Bei Sunzi sind blutige Kämpfe allenfalls nur der drittbeste Weg, um das Kriegsziel zu erreichen. All das ist unterlegt mit der Botschaft, dass die Haltung der Befehlshabenden entscheidend sei für deren Erfolg, nicht unbedingt die Größe der Armee. Krieg als Mittel wird zwar nicht ausgeschlossen, dient aber vor allem der Drohung. Denn Kriege sind schmerzvoll und kostspielig – für alle Beteiligten. Heldenhafte Kämpfe mit geringen Erfolgsaussichten hält Sunzi schlicht für dumm.
Weder Sunzi noch die Strategeme haben dabei den Anspruch, eindeutige Regeln oder Handlungsanweisungen zu geben. Im Gegenteil. Es geht oft darum, Regeln gezielt zu brechen und den Gegner skrupellos auszutricksen. Jede List ist recht, wenn sie zum Erfolg führt. Die Botschaft beider Bücher lautet, außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken und überraschende Lösungen zu finden. Es geht um die offene Geisteshaltung, mit der man an Schwierigkeiten herangeht.
Agiert das heutige China entsprechend diesen Strategemen und den Lehren des Sunzi? Ja und nein. Es verwendet sie nicht als direkte Gebrauchsanleitung. »Zu glauben, dass die chinesischen Politiker und Diplomaten immer klug und strategisch handeln, ist weltfremd«, sagt von Senger. Sie haben sie auch nicht immer auf dem Tisch liegen, um den nächsten Schritt nachzuschlagen. Aber so wie chinesisches Denken diese Werke hervorgebracht hat, haben sie ihrerseits das Denken der Chinesen beeinflusst.
Die Kommunisten unter Mao hatten die Strategielehren des Sunzi ganz selbstverständlich in den Dienst des Sozialismus gestellt und ihnen ihre Sprache übergestülpt.4 »Die rote Fahne schwenken, um die rote Fahne zu bekämpfen« war ein Vorwurf, der beispielsweise dem Reformer Deng Xiaoping gemacht wurde.5 Möglicherweise zu Recht. Als Deng 1979 an die Macht kam, führte er die Marktwirtschaft ein und nannte sie dreist eine Vorform des Sozialismus.
Während eine sozialistische Version des ersten Strategems also lautet: »Die rote Fahne schwenken, aber den Sozialismus bekämpfen«, findet sich in der Urversion folgender Gedanke: »Den Kaiser täuschen und übers Meer gehen.« Mehr steht nicht im Originaltext. Er beruht auf einer alten Geschichte, in der Generäle ihren Kaiser mit einer Täuschung auf ein Schiff locken, das als Haus getarnt ist. Sie stechen mit dem Kaiser auf dem Haus-Schiff in See und wollen ihn damit zu einer Invasion Koreas bewegen.
Wer in die Denkmuster hinter den Strategemen eintauchen will, darf nicht zu kritisch sein. Die Geschichte vom Kaiser auf dem Schiff ist weder politisch noch nautisch glaubwürdig. Fast allen alten Strategem-Erzählungen ist zudem gemeinsam, dass sie genauso gut hätten schiefgehen können. Ihre Helden gingen enorme Risiken ein. Überliefert sind offenbar nur die Erfolgsgeschichten, in denen die Lehren der Strategeme glanzvoll funktionierten.
Und doch ist ihre Relevanz für das moderne China nicht zu unterschätzen. Generationen von Chinesen sind mit den vielen kleinen Strategem-Geschichten aufgewachsen. Bis heute sind sie Teil der chinesischen Kultur und Mentalität. Es ist in China völlig unmöglich, sich ihnen zu entziehen. Wurden sie früher in der Familie und in der Schule erzählt, begegnen Kinder ihnen heute beim Lesen von Comics, in Videospielen oder Filmen. Einzelne dieser Stories wurden dabei zu Blockbustern mit Starbesetzung und Tricktechnik-Feuerwerk aufgeblasen, beispielsweise in dem Film »Red Cliff«6 oder der Fernsehserie »Zhuge Liang«.7 Die wiederkehrenden Hauptfiguren, allen voran den hyperintelligenten Oberbefehlshaber und Regierungschef des Landes Shu, Kongming, kennt auch heute noch jeder – wirklich absolut jeder – in China. Sie dienen in der Managementliteratur auch als Vorbilder für Wirtschaftslenker. Und das inzwischen auch im Westen.
Eine dieser westlichen Wirtschaftslenkerinnen ist die ehemalige Siemens-Managerin Cornelia Anderer. Sie hat zwischen 2002 und 2016 mit einer Unterbrechung neun Jahre lang die Finanztochter des Siemens-Konzerns in China geleitet und musste dabei viel mit Behördenvertretern und Geschäftspartnern in Banken verhandeln. Dabei hat sie viel über die chinesische Denkweise gelernt. Das Studium der Sinologie und Interesse an chinesischer Literatur kamen ihr dabei ebenso zugute wie frühe Erfahrungen mit einem China, das ab den 1980er Jahren seinen Weg auf die Weltbühne suchte. Dass der ganzheitliche Blick des Sunzi in China keine Theorie vergangener Zeiten ist, sei im Westen immer noch wenig bekannt, so Anderer.
Hier liegt vielleicht der Hauptunterschied zu vergleichbaren westlichen Werken von Julius Caesar bis Carl von Clausewitz, die über weite Strecken ganz ähnliche Ratschläge enthalten wie das Buch Sunzi. Diese Werke sind aber nie in vergleichbarem Maße Teil der Alltagsschläue geworden.8 Selbst Xi Jinping soll – zumindest nach Darstellung der Propaganda – ein Buch mit den 36 Strategemen in seinem Bücherregal stehen haben.9
Wer die Strategeme kennt, muss sie sich im Umgang mit China immer wieder ins Bewusstsein rufen. Diese Erfahrung beschrieb auch schon der amerikanische Diplomat und China-Experte John S. Service: »Es ist, als ob man eine besondere Brille aufgezogen hat.«10 Service wurde 1909 als Sohn eines Missionars in China geboren. Eines seiner prägendsten Leseerlebnisse war »Die Geschichte der Drei Reiche«. Der Roman ist eine der Hauptquellen für Erzählungen über Kriegslisten, und seine Hauptfigur, General Kongming, überstrahlt alle anderen Strategen der chinesischen Geschichte.
Nach seiner Lektüre sah Service das aktuelle politische Geschehen in neuem Licht. Das galt vor allem für das Verhalten der örtlichen Machthaber im chinesischen Bürgerkrieg von 1927 bis 1949: »Ihr dramatisches Posieren und die hochtrabenden Manifeste, die endlosen Intrigen und wechselnden Allianzen, die Vorstöße und Rückzüge – und die gelegentlichen Schlachten und die Taktiken dabei – all das kam einem plötzlich bekannt vor.« Die Akteure der Gegenwart, so schien es ihm, wollten »Die Geschichte der Drei Reiche« neu aufführen. Noch in den 1990er Jahren konstatierte Service dem Buch »eine starke Vitalität für die Haltungen und das Verhalten der Chinesen«.11
Sunzi und die Strategeme weckten nach und nach das Interesse der Sinologie, wurden und werden aber nicht systematisch gelehrt. Cornelia Anderer kam erstmals als Studentin bei einem zweijährigen Aufenthalt in Peking von 1979 bis 1981 damit in Berührung. China war damals eine fremde Welt, noch deutlich von Mao Zedong geprägt, auch wenn dieser bereits tot war: unverfälschter Sozialismus und große Armut. Das Studentenwohnheim hatte nackte Betonböden und sie bekam eine Schüssel aus Emaille ausgeteilt: für die Körperhygiene und fürs Wäschewaschen. Lebensmittel waren rationiert und nur gegen Essensmarken zu bekommen.
Doch China blieb nicht arm, wie wir alle heute wissen. Nach der Machtübernahme durch Deng Xiaoping 1979 war es das strategische Denken der chinesischen Führung, das die eigene Wirtschaft nach vorn brachte. Die gegenwärtige hohe Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Industrie geht darauf zurück, dass viele der damaligen Pläne tatsächlich aufgegangen sind. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, auf die in diesem Buch noch eingegangen wird.
Anfangs hatte China kein Kapital, kein Management-Wissen, keine Patente. Die Reformjahre unter Deng waren von trial and error geprägt. Was klappte, wurde beibehalten, was nicht funktionierte, aufgegeben. Das war die Strategie. Sie unterscheidet sich wesentlich von der deutschen Vorstellung, wie mit einem einmal gefassten Plan umzugehen ist. Denn hierzulande ist man unflexibler und besteht geradezu engstirnig darauf, Pläne einzuhalten, selbst wenn sie sich als nicht vielversprechend herausstellen.
Dabei wird in der Volksrepublik eines seit jeher großgeschrieben: spontane Chancenverwertung. Auch hier kommen wieder die alten Strategeme ins Spiel: Wie bei der Umklammerung der Kinmen-Inseln fordern sie dazu auf, gute Gelegenheiten auszunutzen und Lücken zu füllen, die der Gegner offengelassen hat.12 Die Kommunistische Partei verhalte sich dementsprechend, so Harro von Senger: Stets verfolge sie Ziele, und immer achte sie auf sich bietende Gelegenheiten, die sie diesen Zielen näherbringen.13
Die deutsche Politik und Öffentlichkeit fühlte sich überrumpelt, als diese Strategien China ab den 2010er Jahren technische und industrielle Überlegenheit brachten. Vielleicht lag das daran, dass in Europa das Denken in Langfristplänen noch weniger verwurzelt ist als das in Strategemen. Europäische Kulturen sind ebenfalls reich an Fabeln und lehrreichen Geschichten. Doch, wie von Senger schreibt: »Das Strategem-Bewusstsein ist bei den Europäern offenbar schwächer ausgeprägt.« Das fängt schon bei dem deutschen Wort »List« an: Es klingt unehrlich, unehrenhaft und nach etwas Schlechtem. Noch deutlicher wird es bei »listig«, das eher mit »gerissen« assoziiert wird als mit »schlau«. Das chinesische Wort für List, »ji«, das als »Strategem« übersetzt wird, klingt in chinesischen Ohren hingegen nach geschickter Planung und Klugheit.
Auf Chinesisch gibt es für übergreifende Pläne das Wort »Molüe«. Von Senger übersetzt es mit »Supraplanung« und beobachtet: »Ein dynamisches Konzept wie die Supraplanung, das ein Denken in derartigen Zeitdimensionen und mit solch einer Betonung von ständig aktivierbarer Strategem-Kompetenz empfiehlt, scheint es im westlichen Bewusstsein nicht zu geben.«14 Auf den Alltag bezogen formuliert es Cornelia Anderer so: »Die Manager und Politiker im Westen denken nur selten über den Quartalsbericht oder die nächste Wahl hinaus.«
Als Altmeister der Molüe-Supraplanung gilt, wenig überraschend, Sunzi.15 Zudem sieht auch der Sozialismus eine Wirtschaftsweise in Produktionsplänen vor, die sogenannte Planwirtschaft. In der chinesischen KP hat sich also sozialistische Planungswut mit altchinesischer Planungsfreude gemischt. Im heutigen China gibt es denn auch nicht nur Fünfjahrespläne, sondern Initiativen, die Jahrzehnte umspannen und sogar Hundertjahrespläne.
Xi Jinping selbst spricht gerne von den zwei Hundertjahreszielen.16 Das erste galt für den Zeitraum von der Gründung der Kommunistischen Partei bis 2021. China hat es nach Xis Deutung plangemäß erreicht: Die Partei wollte bescheidenen Wohlstand für alle erreichen. Das zweite Ziel betrifft den Zeitraum seit der Staatsgründung 1949 bis zum Jahr 2049.17 Bis dahin will die Volksrepublik »wohlhabend, stark, demokratisch18, kulturell fortschrittlich und harmonisch« sein – und weltweit die Nummer eins.