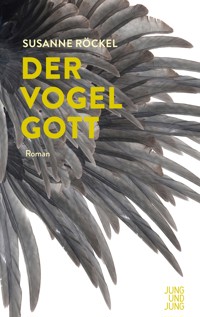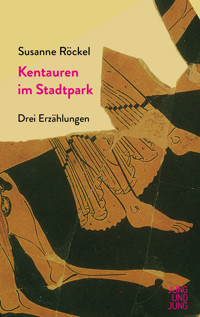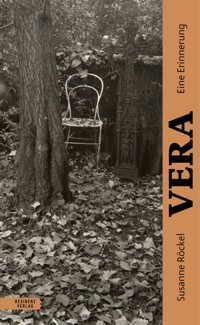
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Empathie und Präzision ist Susanne Röckel ein Meisterwerk literarischer Erinnerungsarbeit gelungen. 1968 findet in Darmstadt der "Callsen-Prozess" statt. Angeklagt sind acht SS-Männer, die 1941 am Massaker von Babyn Jar beteiligt waren. Dina Proničeva hat das Morden mit unvorstellbarem Mut überlebt, jetzt kommt sie in das Land der Täter, um bei dem Prozess auszusagen. Am Tag der Verhandlung kreuzt die damals 14-jährige Susanne Röckel das Auto, das die Zeugin zum Gericht bringt. Diese Begegnung löst ein literarisches Nachdenken über Widerstand, Gerechtigkeit und Verleugnung aus, Jugenderinnerungen vermengen sich mit Prozessprotokollen und eindringlichen Bildern von den Tagen, die die Zeugin aus Kiew im Nachkriegs-Deutschland verbringt. Zwischen Roman und Memoir ist "Vera" der bewegende Versuch, sich behutsam dem Unfassbaren zu nähern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Röckel
VERA
„Ainsi la violence écrase ceux qu'elle touche.“
simoneweil
„Mit der letzten Kraft meines Traumes wünsche ich, dass die Vergangenheit nicht umsonst war, dass die Tränen und das Blut nicht umsonst flossen.“
fritzbauer
„Die Schwierigkeit nein zu sagen, anfangs eine kleine Schwierigkeit im Umgang mit andern, ist jetzt das Problem des Widerstandes in den Bewegungen der Selbstzerstörung.“
klausheinrich
Inhalt
Cover
Halftitle
Title
Inhalt
Vera
Copyright
Ich wohne nirgends. Mein Haus, meine Straßen sind nirgendwo. Ihr Grün und Grau schält sich ab und steht wie eine kalte Haut, in die der Wind bläst, mit wechselnden Ausbuchtungen in der Luft. Ich gehe meinen Weg, ich sehe Oberflächen ohne Tiefe, Fassaden, Geäst, ich will Gesichter finden, die ich nicht kenne. Das Gebaute hat kein Alter, es ist schattenlos. Die Zimmer hallen von Stimmen wider, körperlosen Stimmen – was wollen sie mir sagen? Die Sonne steht wie ein Scheinwerfer über den glatten Dächern, den blinden Fenstern, der greisen, tauben Erde. Überwucherte Ruinen. Leute mit Schals vor der Nase. Autos, aufgereiht am Horizont. Was habe ich damit zu tun? Ich fühle mich wie ein unbeschriebenes Blatt. Bin ich es? Ich stelle Fragen. Sind es die richtigen? Was ist es, was fehlt? Ich bin 14. Es ist, als könnten sich im nächsten Moment die Dinge aus ihrer Verankerung lösen und im Raum herumwirbeln wie Schneeflocken im April. Als wäre auch ich in Gefahr, auf meiner ungeschickten Suche (wonach?) im nächsten Moment den Boden nicht mehr zu spüren. Ich schrecke vor unsichtbaren Hindernissen zurück. Es fällt mir schwer, fest aufzutreten und weit auszuschreiten, wie andere es tun. Oft laufe ich in eine Richtung und merke dann, es ist die falsche. Ich will, dass alles anders ist! Ja, ja, sagt die Welt. Ja, ja, sagen alle Münder, ja, ja, sagt auch mein Mund, wenn auch schon zögernd. Das Nein ist noch nicht da. Spüre ich, dass die Welt lügt? Ich will etwas erleben! Um etwas zu erfahren? Zu ermitteln? Um etwas wachzurufen, was nirgends ist: Erinnerung?
Jetzt, über 50 Jahre später, ist Vera in meiner Nähe. Habe ich sie gefunden – oder fand sie mich? Ich weiß nicht, wer sie ist. Kein Gesicht: ein Schatten, kaum feststellbar, leicht zu stören, ein leises Rauschen, Erschauern, wie wenn sich eine Wasserfläche bei Windstille plötzlich kräuselt. Eine Art Geist, Totengeist. Eine Unbekannte. Vor 44 Jahren ist sie gestorben. Und doch gibt es eine Verbindung, unbezweifelbar, einen Anruf, Anklang, etwas, was anklopfte, sich jedenfalls auf unmissverständliche Weise bemerkbar machte – oder war es nur die Vorstellung, die mich beim Lesen ihrer Aussage überfiel, Phantasie, Obsession? Eine Quelle, deren leise rieselndes Wasser nicht leicht zu entdecken ist, zu der man hinabsteigen muss in eine gewisse Tiefe. (Ich weiß nicht, warum mir dieses Bild einfällt, warum mir immer wieder Wasser einfällt, wenn ich an sie denke, strömendes Wasser, ein Fluss, ein Meer.) Anfangs gab es einen Namen. Einen anderen Namen, einen langen, schwer zu behaltenden ukrainischen Namen, den ich las, aber gerufen wurde sie „Vera“. So stand es unter dem Foto. Ein Schwarz-Weiß-Porträt aus ihrer Jugend, im Internet. Sie hatte dunkle, wellige Haare, sie lächelte mit hübschen kleinen weißen Zähnen. Ihr Lächeln ist die Gewissheit, geliebt zu werden, von Mutter und Vater und Schwester, von der Welt, belohnt zu werden, wenn man es verdient, beschützt zu werden, wenn man schwach ist, und, davon abgeleitet: Erwartungen von Frieden, von Erbarmen, von Gerechtigkeit. Wäre ich an Beweisen interessiert, könnte dieses verträgliche, fröhliche, kindliche Gesicht sich einfügen in eine Reihe von Untersuchungen, von biographischen Ausgestaltungen, es könnte der Anfang einer Recherche sein. Aber daran bin ich nicht interessiert, ebenso wenig wie an dem Gefühl, das mit Tränen aus mir heraussickern könnte, feuchte, trübe, schmelzende Weichheit, wohlfeiles, schamloses Mitleid – nein! Ich will – ja, was? Etwas wollen und zugleich davor zurückschrecken: Könnte man es so beschreiben, wenn man versucht, sich Schock, Angst, Schmerz zu nähern? Der eigenen Angst und der Angst der anderen, dem eigenen Schmerz und dem der anderen, dem eigenen Tod und dem Tod der anderen – gäbe es Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen, Gemeinschaft? Deshalb also, mit diesen Fragen und solchen Überlegungen im Hintergrund, bin ich auf sie gestoßen: Vera, die Wahre. Nicht jener unkrainische Name, der gerichtlich bezeugt, mit Daten, Akten, Dokumenten versehen, unwiderlegbar ist, doch für mich kaum von Belang. Nicht das Gesicht auf dem Foto, nicht die Zeugin aus dem Protokoll, sondern ein Schattenwesen, das in mich einfiel: meine Vera. Ein Geist, den ich dazu bewegen will, in der Nähe zu bleiben, um meiner Geschichte willen.
Meine Geschichte, die Geschichte einer jugendlichen Verzweiflung, kann man es so nennen? Eine banale Geschichte, eine geradezu lächerliche, nahezu frivole Geschichte angesichts von Veras Geschichte, wie ich sie mir vorstelle und erzählen will, heute, über 50 Jahre danach. Ich war ein Teenager, als ich Vera (vielleicht) begegnete, ohne sie zu sehen, an einer Kreuzung in Darmstadt, an einem Tag Ende April. Ich war ein Teenager, als ich in meinem Elternhaus ins Bad ging und das Röhrchen mit den Schlaftabletten meines Vaters leerte. Dann ging ich in mein Zimmer, ließ den Rollladen herunter, legte mich aufs Bett und wartete, dass mich jemand fand. Natürlich begriff ich nicht, was ich damals schrieb: „Ich will sterben.“ Aber heute, mit 70, dem Tod näher denn je, will ich begreifen, warum ich es tat. Und was hat Vera damit zu tun, von deren Geschichte ich erst über 50 Jahre nach ihrem kurzen Aufenthalt in Darmstadt erfuhr, deren Erscheinen überhaupt bei niemandem Aufsehen erregte und nur dem Darmstädter Echo eine kleine Meldung wert war? Plötzlich stört, bedrängt, bestürmt mich die Geschichte meiner jugendlichen Verzweiflung, als hätte ich sie bisher noch nicht erfahren, als könnte ich sie erst begreifen, wenn ich Veras Geschichte mit ihr verbinde, als wäre ich bisher blind gewesen und könnte nur sehend werden, indem ich mir nachträglich eine Erfahrung zuschreibe, die ich damals versäumte. Als bräuchte meine kleine, nicht besonders originelle Geschichte den Rahmen von Veras Geschichte, um wahr zu werden oder um sich aus einem irgendwie beunruhigenden, unbestimmten, luftigen Zustand in etwas zu verwandeln oder zu verfestigen, was überhaupt erst Erfahrung genannt zu werden verdient. Eine Frage, die zu lange ungelöst geblieben ist, etwas, was nicht aufgeht, eine Fehlstelle, ein nicht verschließbares Loch in einem elastischen Ganzkörperanzug namens „Identität“. Kann es dafür eine Lösung geben? Trägt die Realität immer den Sieg davon? Definition von Realität: Es ist, wie es ist. Lasst die Toten ihre Toten begraben! Nein, keine Lösung, aber vielleicht eine Antwort, eine Art Antwort, die darin besteht, immer wieder zurückzukehren an die Stelle, immer wieder das Fehlende aufzurufen, heranzuziehen, herbeizuzitieren, immer wieder das Ja-ja zurückzuweisen, das Nein mit den Lippen zu formen, bis man es aussprechen kann. Kann ich heute, über 50 Jahre danach, noch einmal dorthin gehen, in mein Zimmer, wo ich, mitten am Tag mit heruntergelassenem Rollladen auf dem Bett liegend, meinen stummen Hilfeschrei ausstieß, kann ich, indem ich von Vera erzähle, mich selbst dazu bewegen, aus dem tiefen Schlaf zu erwachen, in den ich gesunken war, weil ich das Leben im Nirgendwo, in der Schattenlosigkeit, der Bodenlosigkeit nicht mehr ertrug? Kann ich mich selbst finden, bevor meine Mutter kommt, die vergeblich versucht, mich wachzurütteln, bevor der Rettungswagen kommt, bevor man mir den Magen auspumpt, bevor eine Psychologin hormonelle Unausgewogenheit konstatiert und die Röhrchen mit den Schlaftabletten meines Vaters aus dem Badezimmer verschwinden? Heute, mit 70, will ich die Geschichte so erzählen, dass mir klar wird, wo ich stehe, auf welchem Boden, was mir fehlt. Ich will Vera rufen, um zu erkennen, was damals im Schatten lag, ich will sehend werden durch ihren Blick. Ich will zwei Zeiten miteinander verbinden, meine Zeit und ihre Zeit, und etwas aus mir machen, was ich nicht war. Mehr als die Hilflosigkeit und Fürsorge meiner Eltern, mehr als alle Untersuchungen, die man mit mir anstellte, weil man sich meine Tat nicht erklären konnte, mehr als den kühlen Zuspruch der Psychologin, den ich nach meiner Rettung eine Zeitlang über mich ergehen ließ, brauche ich heute den Schmerz, der mir vorenthalten wurde, die Angst, über die man nicht sprach, die Vergangenheit, die man beendet zu haben glaubte. Ich brauche Vera. Ich glaube an sie. Ich glaube an ihren heilsamen Blick, über die Zeiten hinweg, außerhalb der Zeit, in den Worten, die ich für sie finde, um sie zurückzuführen in die Welt, unsere Welt. Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich kann nur von dem Schattenwesen sprechen, auf das ich stieß, als ich heute, mit 70, das Protokoll ihrer Aussage von 1968 las, als sie sich einen Vormittag lang in meiner Nähe aufhielt, ohne dass ich es wusste, in Darmstadt, wo ich wohnte. Seitdem drängt sie sich mir auf, nimmt jeden Tag ein bisschen mehr Platz ein und schnürt mir die Luft ab. Um das Schattenwesen loszuwerden, um mich nicht länger vor ihm zu fürchten, muss ich ihm einen Namen geben, es in Worte und Sätze verwandeln. Um wieder atmen zu können. Um den Boden zu spüren, der unter meinen Füßen ist, einen Ort zu finden, statt dem Nirgendwo.
Einmal sah ich sie: in einem Youtube-Video. Als sie 1946 vor dem sowjetischen Militärtribunal aussagte. Da stand sie in einer Menge von Menschen an einem Pult. Eine Frau im Profil, nicht groß, eher kräftig und schlank, aufrecht, mit dunklem, aus der Stirn gestrichenem Haar. Sie ist 35. Das Haar reicht bis kurz über den Kragen ihrer hellen, taillierten Strickjacke, es endet in einer Welle, es sieht aus wie von einem billigen Friseur geschnitten. Die Augen liegen tief, das Kinn ist rund und weiß. Der linke Arm ruht auf dem Pult, der rechte Arm ist nicht zu sehen. Ihr Körper hat kein Volumen. Immer wird sie dort bleiben, an ihr Pult geheftet, ohne dass die Kamera versuchen würde, sie näher heranzuholen. Denn es ist besser so – es ist besser, sie bleibt weit weg, bleibt uns vom Leib. Das hat die Kamera begriffen, alle begreifen es. Der Krieg ist ja erst ein Jahr vorbei, und worüber sie spricht, liegt erst fünf Jahre zurück. Die beiden Frauen, die ein paar Meter von ihr entfernt sitzen, an einem mit einem schwarzen Tuch bedeckten Tisch – wo sind sie gewesen vor fünf Jahren? Und die Männer auf der Tribüne, mit ihren Mützen und Schnurrbärten, mit eckigen Schultern in ihren Uniformen? Mit neugierigen skeptischen verwunderten ungläubigen fassungslosen Blicken. Man spürt ihr Unbehagen, weil sie ihre Augen immer wieder abwenden, ihre Ohren aber nicht verschließen können. Man spürt das Unbehagen beim Hören dieser Stimme, die sie als künstlich, als übertrieben empfinden mögen und vielleicht ihrer Ausbildung als Schauspielerin zuschreiben (sie war nämlich Schauspielerin am Kiewer Puppentheater). Man merkt den Männern an, dass etwas sie angreift, sie nehmen plötzlich ein weiches Gewicht wahr, das von innen an den Stoff ihrer Uniformen drückt, sie spüren die Knöpfe, die Tressen, die Nähte. Wie hart ist die Uniform auf einmal, die sie so viele Jahre lang mit sich herumschleppten, den Krieg hindurch, ein Korsett, ein Käfig, dem sich ihr Körper anpasste, bis sie ihn nicht mehr fühlten. Vielleicht haben sie schon so viel gesehen, dass ihre Augen den Dienst quittierten. Vielleicht gibt es einen Apparat in der Uniform, der das Mustern und Prüfen für sie übernimmt. Sehen sie die Frau, die am Pult steht? Sie lassen sie reden. Aber jeden Augenblick kann es passieren, dass sie sie unterbrechen, ihr Einhalt gebieten, dass jemand aufsteht und sagt: Die Redezeit ist überschritten. Oder: Das tut nichts zur Sache. Oder einfach: Genug! Wie es später auch in Darmstadt passieren wird. Man lässt sie reden, aber nicht ausreden. Wo käme man hin, wenn man das täte?
Nur ihre Stimme ist zu hören in der Menge der Menschen, die den Hals recken unter ihren hohen Mützen und groben Haarschnitten und sich vorbeugen, um besser zu hören. Ihre helle, feste, unerschütterliche Stimme, ihre getragene Stimme – von was getragen? Ich höre ihr zu. Höre diesem Foto-Audio-Wesen, dieser Geisterstimme auf meinem Bildschirm zu, schließe die Augen, um besser zu hören, verstehe nichts. Die englischen Untertitel erklären mir nicht, was sie sagt. Seitdem sie sich zum ersten Mal bemerkbar machte, kann ich nicht mehr aufhören, ihrer Stimme zu lauschen, auch wenn ich nicht verstehe, was sie sagt. Ich merke, wie riesengroß und leer der Raum ist, in dem ich gehe, seit Jahrzehnten gegangen bin, seit meiner Geburt gegangen bin, halb blind, halb taub, ein Raum aus sehr leisen, zitternden, sich überkreuzenden, unverständlichen Botschaften, und ich gehe mitten unter ihnen und höre immer nur das Falsche. Ist das das Leben gewesen? Habe ich es verpasst? Ihre Stimme fährt fort zu reden, zu deklamieren. Sie sagt etwas, was sie nicht betrifft. Ja, als wäre nicht sie es, die das alles erlebt hat, sondern eine andere – jene andere, die unter den Toten begraben war, die sich unter dem Berg der Erschossenen regte und schließlich darunter hervorkroch, jene andere, die die Augen öffnete, mit Blut übergossen, und wieder lernte zu atmen, Erde im Mund, Hände und Füße zu bewegen, der es gelang, unbemerkt von den Mördern die steile Sandwand der Schlucht zu erklimmen und sich zu retten –, und als stünde sie nur als Stellvertreterin dieser anderen hier, eine Wiedergängerin, eine Untote, ein Gespenst, und müsste für sie sprechen und käme nie zum Ende, wenn man sie nicht unterbrechen würde. Wenn nicht jemand riefe: Halt! Genug! Das tut nichts zur Sache! Sie würde immer wieder anfangen zu reden. Eines Abends kam ein großer deutscher Mann in unsere Wohnung und suchte nach Juden. Sie würde ihrer Erzählung immer wieder, als Auftakt, die kleine Szene voranstellen, wie die Soldaten im Hof Jagd machten auf eine fremde Frau, in ihrer Stadt, Kiew, in ihrem Hof, vor ihrem Fenster, wie die fremde Frau von einer Tür zur anderen lief, auf den Trockenboden lief, aufs Dach lief, die Dachrinne hinunterrutschte, und hinter ihr die Soldaten – halt! Genug! Wie damals in Darmstadt. Welche Uniform haben die Männer getragen? Was ist mit den Leichen passiert? Wie viele waren es? Keine weiteren Fragen. Wie damals, als uns in der Aula der Film über Bergen-Belsen gezeigt wurde. Das Stühlerücken und Mantelanziehen und Fensteraufmachen und Reden und Schlurfen und Fahrradklingeln und Anfahren der Autos draußen war danach so laut wie nie zuvor, kilometerweit setzte es sich fort, reichte bis zum Ende der Straße, der Stadt, der Welt. Deshalb ist Veras Stimme so getragen. Es ist dieser Lärm, unser Lärm, unser lärmendes Schweigen, unser Alltagsradau, der sie trägt, dem sie sich anvertraut wie eine Schwimmerin einem aufgewühlten, schmutzigen, sich ewig hin und her wälzenden, donnernden Meer. So hat sie an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Zeiten von dem gesprochen, was hinter ihr liegt, hat so vom Lärm getragen und über den Lärm hinweg gesprochen, nicht auf sicherem Boden, nie mehr auf sicherem Boden, Wiedergängerin, Botschafterin der Toten, und wenn ich sage, sie sei in meiner Nähe, meine ich nicht die Stimme, nicht diese Stimme, sondern den leiseren, geisterhaft bebenden Ton dahinter. (Ein Echo?) Am Anfang kaum vernehmbar, doch allmählich deutlicher geworden, scharf, fast materiell, fast wie ein Splitter, in mich eingedrungen, eingewachsen, wie die Granatsplitter, die Kriegsopfer in ihrem Körper tragen, unsichtbar, schmerzhaft, aber vertraut.
In Darmstadt war sie 57, ich 14. Ein Tag im April. Ich stand zu spät auf, wie immer. Amselgesang im Morgengrauen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet am Stadtrand, der Wald ist nah, der Weg zu unserem Haus noch nicht geteert, wenn es regnet, gibt es tiefe Spurrillen mit bläulichen Steinchen darin. An diesem Tag ist schönes Wetter. Ich sitze am Tisch und schlinge das Frühstück hinunter, das mir meine Mutter hingestellt hat. Das Darmstädter Echo liegt aufgeschlagen vor uns. (Am nächsten Tag stand etwas über den Prozess darin. Habe ich den kurzen Bericht gelesen? Streifte ich die Worte „Grube“, „Fangschüsse“ in der Überschrift? Sind es diese Worte, die sich in mir festsetzten und jetzt jene Unbekannte in mir wachrufen, die ich Vera nenne?) Ich hole mein Rad aus der Garage und fahre in die Schule. Ich sehe meinen Schulweg vor mir: zuerst bergauf, am letzten alten, halb zerfallenen Haus vorbei, das es noch gab, an dem dazugehörigen überwucherten Garten vorbei, an einem neuen Haus mit Rasen und Schwimmbad vorbei, an der Weggabelung mit Haselnusssträuchern, aus deren Holz mein Vater Wanderstöcke schnitzte, vorbei, dann nach links, die Anhöhe entlang, an der Wiese mit Kirschbäumen vorbei (auch die Kirschbäume gab es bald nicht mehr), an der Kapelle der Marienschwestern vorbei, dann in einer breiten Kurve wieder bergab. Manchmal hielt ich an, wenn ich oben war. Vor mir die Wiese, dahinter die Ebene unter den großen, weißen, rötlich oder orange gesäumten Wolken, die am blauen Himmel entlangsegeln, die Häuser, die Vororte, die amerikanische Kaserne, die Fabriken mit ihren Schloten, ihrem Rauch, am Horizont die Autobahn und dahinter ein blinkender Strich: der Rhein. Darmstadt. Die Oberrheinische Tiefebene. Heller, kühler Frühlingsmorgen mit blühenden Kirschbäumen und ziehenden Wolken. Das trockene Geräusch der Kiefern im Wind, der dünne Glockenton der Kapelle der Marienschwestern, der durchdringende, stählerne Ruf der Fasane am Waldrand. 56. Verhandlungstag. Ein Montag. Um 8 Uhr 30 ist Prozessbeginn. Alle Gerichtspersonen sind vollzählig erschienen. Die Angeklagten mit ihren Verteidigern. Die Dolmetscherin. Die Zeugin. Sie wird belehrt. Sie macht ihre Angaben zur Person. Sie beginnt ihre Erklärung zur Sache mit dem Satz, keinen der Angeklagten zu kennen.
Am Tag zuvor ist sie auf dem Frankfurter Flughafen angekommen. (Kam sie in Begleitung? Gab es jemanden, der dafür zu sorgen hatte, dass sie sich nicht zu antisowjetischen Äußerungen hinreißen ließ? Ich weiß es nicht. Für meine Vera ist es nicht von Belang.) Man holte sie ab. Am Terminal muss sich ein Abgesandter des Gerichts eingefunden haben, ein älterer Herr, vielleicht, in gut sitzendem Anzug und leichtem Mantel, glattrasiert, gewandt, mehrsprachig, zivilisiert. Er zückt einen Ausweis, mit dem er überall passieren kann. Er hält ein Schild, auf dem ihr Name steht. Oder hat man ihm ein Foto geschickt? Er muss nicht lange nach ihr suchen. Er erkennt sie gleich, als sie, nach allen anderen – ein paar Botschaftsangehörigen, vielleicht, und einer Reihe eiliger Geschäftsreisender, die zu ihren wartenden Geschäftspartnern laufen, Hände schütteln, radebrechen –, mit ihrem kleinen Koffer in die Halle tritt. Es ist nicht schwer, sie von diesen Leuten zu unterscheiden. Sie zögert. Wirkt unsicher (eingeschüchtert, verwirrt, erstaunt?). Doch keine Angst: Der ältere Herr weiß, was er zu tun hat. Sie ist nicht die erste Zeugin, die er hier abzuholen hat. Zielsicher wird er auf sie zugehen. Planmäßig wird er ihr die Hand hinstrecken und einen Willkommensgruß äußern.
Warum ist sie hergekommen? Vielleicht fällt es ihr in diesem Moment nicht mehr ein. Vielleicht wundert sie sich plötzlich, dass sie eingewilligt hat, diese Reise zu machen. Dass sie so gutgläubig gewesen ist. Sich von den Versprechungen blenden ließ, eine vage Hoffnung für die Wirklichkeit nahm. Wie die anderen Reisenden hat sie ihren Pass am Schalter unter der Scheibe durchgeschoben. Der Uniformierte hebt den Kopf. Rette dich, Töchterchen! Von jetzt an, weiß sie, muss sie eine andere sein. Unerschrockener Blick, aufrechte Haltung. Ich nahm mich fest in die Hand und versuchte mich vollkommen zu beherrschen, vor allem meine Stimme. Sehen Sie mir in die Augen! Es sind nicht solche Augen. Und meine Nase, klein und gerade, wie eure. Sehen Sie! (Lärm ringsum, weinende Kinder, Geschrei.) Schauen Sie mich an! Ich bin wie ihr! Mit jenen dort habe ich nichts zu tun, sie sind tot. Ich bin nur die Begleitperson. Sie hört ihr Herz klopfen. Sie muss sich auf sich selbst verlassen. Sie hat gelernt, sich auf sich selbst zu verlassen. Oder nicht? Hätte sie sonst eingewilligt, zu kommen? Sie hat das alles viele Male durchgespielt, zu Hause, in ihrer Einzimmerwohnung in Kiew, den Flug, die Ankunft, die Passkontrolle, Männer, die sie abholen, das Hotel, die kurze Fahrt zum Gericht. So stelle ich es mir vor. Sie ist nachts aufgewacht, hat den Brief aus dem Umschlag genommen, den Brief aus Frankfurt, den Brief mit der Unterschrift des Generalstaatsanwalts (niedrige, nach rechts geneigte, rasch gezogene, doch akkurate Buchstaben), hat ihn glattgestrichen, gelesen, wieder gelesen. Man wird sie abholen. Auf sie aufpassen. Es wird nichts passieren. Sie hört ihr Herz klopfen. Sie ist in das winzige Bad gegangen, in dem Wäsche trocknet, hat Licht gemacht, ihr Gesicht im Spiegel betrachtet. Ihr neues, alt gewordenes Gesicht. (27 Jahre sind vergangen. 27 Jahre, seit sie aus der Grube kroch.) Sieh mich an! Ich bin wie ihr! Als könnte der Spiegel beweisen: dass sie die andere ist. Gerettet ist. Lebt. Blinder Spiegel! Was weiß er schon?
Sie hat also dem Uniformierten den Pass hingeschoben, als sie an der Reihe war. Ich habe mir damals nicht genau angeschaut, was für Uniformen es waren. Der Uniformierte stutzt, telefoniert. Oder er winkt einen anderen herbei, der sie zu einem anderen Schalter führt, weiter weg. Neuerliche Begutachtung ihres Passes. Datum, Stempel, Unterschrift. Vergleicht der Mann das Foto mit ihrem Gesicht? (Wie sieht sie aus? Sie ist jung. Sie hat Angst.) Sie hält seinem Blick stand. Weist ihn in die Schranken. Starke, lachende Zähne. (Blaue Augen?) Braungebrannter Hals, Maschinengewehr. Wenn du am Leben bleiben willst, schläfst du mit mir. Aber es gibt keine Schranken mehr. Er darf alles, kann alles. Mit einem Schlag ist das Bild scharf. Mir war klar, dass es keine Rückkehr mehr geben würde. Das Lachen des Soldaten fährt ihr in die Magengrube wie eine Faust. Die Eltern, die Schwester sind noch in der Nähe, warten in der Schlange, mit den anderen. Ausziehen! Los, schnell! Kleider auf die eine Seite, Lebensmittel, Schmuck auf die andere. Sie ist die Einzige, die Bescheid weiß. Die Hoffnungen der letzten Zeit – sie haben davon gelebt, sich daran geklammert – fallen in sich zusammen wie Marionetten, denen man die Schnüre abschneidet. Man hat sie belogen, in die Irre geführt. Die Schlange ist nicht die harmlose Schlange, die sich bildet, wenn sie nach Brot anstehen oder Kartoffeln, wie jeden Tag seit Kriegsbeginn. Es ist eine böse Schlange, eine tödliche Schlange. Die Soldaten schreien, schlagen, starren. Die Schwester nackt. Die Mutter. Gedränge, Gebrüll. Wenn man da stand und versuchte, sich mit den Händen zu schützen, um nicht ganz nackt dazustehen – denn das Anstands- und Schamgefühl erlaubte einem Menschen auch angesichts des Todes nicht, nackt dazustehen –, gab es Schläge. Die Mutter ruft ihr etwas zu. Die Ohren hören es, melden es dem Gehirn: Rette dich, Töchterchen! Kleider auf diese Seite. Erst die Schuhe, dann Tuch, Jacke, Rock, Bluse, Unterhose, Unterhemd auf den wachsenden Stapel der Tücher Jacken Blusen Röcke Unterhosen Unterhemden. Rette dich, Töchterchen! Weiter, weiter! Den meisten wird erst, als sie am Rand der Grube stehen, klar, dass es zu spät ist. Maschinengewehre haben sie schon viele gesehen – seit Monaten ist die Stadt vom Krieg beherrscht –, aber sogar als der Kommandierende die Hand hebt und die Männer ihnen gegenüber anlegen, überlegen sie noch fieberhaft, ob es nicht auch ein Traum sein könnte, aus dem sie im nächsten Moment erwachen. So stelle ich es mir vor. (Ich habe Bilder gesehen. Ich habe Schilderungen gelesen. Ich habe nichts erlebt. Ich habe mir, wachliegend in der Dunkelheit, alles immer nur vorgestellt.) Nur Vera weiß, dass sie nicht träumt. Keine Rückkehr. Aber sie darf nicht zulassen, dass dieses Wissen die Oberhand gewinnt, denn es würde sich ihrer Glieder bemächtigen, sie ihrer Kraft berauben, ihr den Lebenswillen austreiben. Keine Rückkehr. Sie muss also