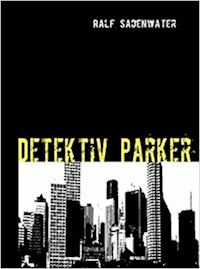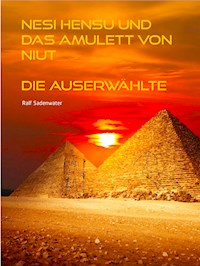Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Da war er doch, der Haken. Der Haken an meinem Erbe. Ich bekam diese unglaubliche Summe nur unter der Auflage, dass ich Mr. Webster bei seinen Unternehmungen unterstützte. Ich bekam nicht nur große Augen, sondern auch den Mund nicht zu, als ich erfuhr, worum es gehen sollte. Ein Buch zu finden sollte nicht so schwer sein, doch es ging nicht um irgendein Buch, sondern um das Buch aller Bücher schlechthin. CHOM! Auf der Suche danach bekamen wir es mit unvorstellbaren Kreaturen zu tun, erfuhren von Ereignissen in der Geschichte der Menschheit, die wir eigentlich ganz anders kannten. Wir lernten neue und alte Feinde kennen, bekamen Hilfe, die wir niemals als solche erkannt hätten. Wir bekamen das Unsichtbare zu sehen, als wir wagten, hinter das Verborgene zu sehen. In einem spannend erzählten, ernsthaft humorvollen Roman habe ich die Ereignisse der letzten Jahre zusammengetragen und hoffe so, das Erlebte verarbeiten und in eine der hinteren Ecken meines Gedächtnisses verstauen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chom
Titelseite123456789101112131415161718192021222324252627ImpressumC H O M
Das Unsichtbare zu sehen erfordert den Blick ins Verborgene
1
„ Was willst du hier? Los verschwinde!“
Völlig aufgelöst und fast schon verwirrt schien das kleine graue Männchen hinter dem Tresen förmlich von einer Ecke in die andere zu springen.
< Wieso spielt der sich so auf?> dachte ich, < Hat der heut morgen vielleicht etwas im Kaffee gehabt? Ich will doch nur ein Buch kaufen, also wenn der Winzling da das Buch überhaupt hat! Behandelt man so seine Kundschaft?>
„ Du sollst abzischen!!! Ich kann dir nichts verkaufen!“ Seine Stimme überschlug sich nun fast, als er merkte, dass ich keinerlei Anstalten machte, eingeschüchtert zu sein, geschweige denn, seinen Aufforderungen Folge zu leisten.
< Was hab ich dem denn nur getan?> dachte ich, und als ich Luft holte, um den Unmut, der nun doch langsam in mir aufstieg, rauszulassen, unterbrach mich diese Giftnudel schon wieder.
Aber seltsamerweise diesmal mit schon fast weinerlicher, flehender Stimme.
Ich glaubte sogar ein wenig Angst mitschwingen zu hören: „ Bitte! Bitte! Nein! Bitte geh! Bitte geh jetzt! Ich hab doch nichts für dich! Bitte! Bitte! Nein!“
Also, das Ganze wurde mir jetzt doch zu bunt. Ich ging den letzten Schritt, der mich noch von der Theke trennte, auf ihn zu, sah, wie der Gnom einen angstvollen Schritt nach hinten trat und dass der Schweiß schier literweise an seinem mehr als schmächtigen Körper herrunterrann.
Ein viel zu großer Kopf auf viel zu schmalen Schultern und ein paar dünne graue Haare, deren Anzahl zusammen mit seinem nervösen Getänzel die Vorstellung bekräftigten, dass er sich diese bei großer Aufregung gern raufte.
Aber nicht genug damit, dass dieser Zwerg so schon reichlich farblos wirkte, nein, er musste unbedingt auch noch eine graue Hose, eine Bundfaltenhose, die wohl noch nie ein Bügeleisen gesehen hatte und ein ebenso zerknittertes Poloshirt in der selben- naja- Farbe, tragen.
Und die Ladenausstattung bekräftigte noch wunderschön sein zierliches Figürchen. Etwa drei Meter hohe Bücherregale, vollgestopft mit Kostbarkeiten soweit man blicken konnte, schienen seine Gestalt erdrücken zu wollen. Dazu dieser für ihn viel zu hohe Tresen.
Andererseits, hätte man den Ladentisch niedriger gehalten, müssten sich die Kunden beim Zahlen hinknien.
Wer wollte das schon?
Dieser kleine Kerl musste Mr. Stampas sein.
Wie auch immer. Es konnte doch nicht so schwer sein, ein Buch zu kaufen.
Also gut, kein normales.
< Franks Bookshop - egal was sie wünschen, ich habe es!>, stand als Untertitel auf dem Schild über der Eingangstür.
Ziemlich einfallsloser Spruch, fand ich.
Aber egal, jetzt wollen wir doch mal sehen, was unser guter Frank so für ein Problem hat.
„ Sie sind Mr. Frank Stampas?“, fragte ich ihn, nicht ohne meine Stimme unwirsch klingen zu lassen, meine Stirn in Falten zu legen und die rechte Augenbraue leicht verärgert aussehend nach oben zu ziehen.
„ Du Idiot!“, rief er unbeeindruckt von meiner Mimik und begann wieder zu tänzeln.
„ Bist du bescheuert? Warum fragst du solchen Blödsinn? Und warum kommst du wieder hier her? Ich habe dir schon damals gesagt, dass wir uns nie wieder sehen dürfen!“ Seine Stimme wurde plötzlich wieder ruhiger und weinerlich.
„ Du blöder, du dummer Junge! Warum hast du mir das angetan? Kommst hierher und stellst dich hin, als wolltest du einen Reiseführer kaufen! Du bist so ein Idiot!“, wiederholte er sich. „Du weißt, dass du es nicht haben kannst. Niemand kann es haben...“, er hielt inne, schien zu überlegen.
Einen Sekundenbruchteil nur, aber lange genug, dass ich es merken musste. ...
„ und im übrigen habe ich es nicht und“, beeilte er sich hinzuzufügen, „ ich weiß auch nicht, wo es ist!“
< Na bitte, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Was redet dieser Gnom eigentlich für wirres Zeug?>, dachte ich und sagte laut: „ Was genau will ich hier? Von ihnen, Mr. Stampas?“
Sofort, als er zu einer Antwort ansetzen wollte, unterbrach ich ihn: „ Langsam, langsam, egal was sie auch sagen wollen, behalten sie es erst mal für sich!“ Meine Stimme wurde zusehends fester.
Ich war mittlerweile der Meinung, dass ich mich von diesem Kerlchen, den ich um fast zwei Köpfe überragte und der sich hinter mir bequem umziehen könnte, wie man so schön sagt, nicht länger verunsichern lassen wollte.
Und schon meine Erscheinung sollte ihm doch einigermaßen Respekt einflößen, oder?
Ich hatte lockere Kleidung und gegen den ständigen Nieselregen einen langen aber leichten Mantel an.
Mit einem Meter und achtzig gehörte ich sicher auch nicht der Kleinenfraktion an. Ich hatte einen Kinnbart, der, wie ich schon oft festgestellt hatte, Eindruck machte.
Welchen auch immer.
Auf jeden Fall schien er in unseren Breiten einigermaßen Achtung zu erzeugen.
Da ich früher immer körperlich schwer gearbeitet hatte, konnte ich eine Figur vorweisen, für die ich mich sicher nicht zu verstecken brauchte.
„ Ich bin einen ziemlich langen Weg zu ihnen hierher gegangen, um ein einziges Buch zu kaufen, von dem mein bester Freund sagte, sie hätten es. Es regnet seit Tagen und es ist mehr als ungemütlich da draußen. Ich komme hier rein und sie...“
„ Hör’ endlich auf zu jammern!!!“, unterbrach mich dieser Mr. Stampas mit harter Stimme. „ Ich weiß, dass dich Ian her geschickt hat, dieser elende Waldläufer, und ich weiß auch, was er damit bezweckt. Er beißt sich seit Ewigkeiten seine faulenden Zähne an mir aus!“
Also, faulende Zähne hat Ian nun wirklich nicht.
Aber jetzt, da Frank es sagte, kam mir der Vergleich mit einem Waldläufer gar nicht so weit her geholt vor. Manchmal benimmt er sich wirklich wie eine schleichende Katze, steht plötzlich, ohne ein Geräusch zu machen in der Tür und ist ebenso leise wieder verschwunden.
Ich kenne Ian nun seit langem und er kommt mir heute immer noch so geheimnisvoll und manchmal sogar unheimlich vor, wie damals, als ich ihn kennenlernte. Sein makellos schwarzer Vollbart und seine großen dunklen Augen unterstreichen das Geheimnisvolle an ihm nur noch.
Ich beschloss zu bluffen.
„Wieso reden sie mit mir, als würden wir uns schon seit Urzeiten kennen?“, fragte ich Frank Stampas.
Auch, um dem ganzen Spuk hier endlich ein Ende zu bereiten.
„ Ich weiß, dass sie das Buch Chom haben, und zwar versteckt in einem Safe, hinter diesem Regal da.“
Ich zeigte auf das dritte Regal rechts neben ihm. Er müsste sich eigentlich nur nach rechts drehen und die vier, fünf Schritte gehen, das Regal mit den schätzungsweise fünfhundert Büchern, die allesamt antik und ziemlich viel wert zu sein schienen, mittels eines versteckten Schalters zur Seite zu schieben und schon käme der in der Wand eingelassene Tresor zu Vorschein.
Genauso stellte ich mir das Szenario vor, das jetzt eigentlich zu folgen hatte. Also gut, ich bluffte und hatte natürlich keine Ahnung.
Aber als ich Mr. Stampas ansah, wurde ich eines Besseren belehrt. Der kleine graue Mann wurde, obwohl dies eigentlich unmöglich sein sollte, weiß wie eine frisch gestrichene Kalkwand und begann unübersehbar zu zittern.
Obwohl, zittern ist nicht ganz richtig, seine Hände fingen förmlich an zu flattern. Er schaute sichtlich verwirrt, fast schon wie irr von links nach rechts und umgekehrt. Frank schien kurz vor einem Kollaps zu stehen.
Ich konnte nicht glauben, dass ich anscheinend ins Schwarze getroffen hatte. Aber was, wenn der mir hier zusammenbrach, oder vielleicht ausrastete und mir mittels einer Waffe Gewalt androhte?
Man konnte ja heutzutage nicht mehr sicher sein, wer einem da gegenüber stand.
Unwillkürlich musste ich zurückdenken.
Wie alles überhaupt begonnen hatte.
Warum ich mich in der jetzigen Lage befand:
2
Eines Tages flatterte ein Brief in meinen Briefkasten, der die Anweisung enthielt, ich solle im Notariat in der 5. Strasse in London- Soho erscheinen. Das Testament meines Onkels Marc Woods würde eröffnet und meine Anwesenheit sei dringend erforderlich. Sehr mysteriös, fand ich. Erstens hatte ich in meiner Familie noch nie etwas von einem Mister Woods gehört, zweitens verband meines Wissens niemanden von uns etwas mit London, außer vielleicht, dass meine Lieblingstante einmal eine Kurzreise als Lehrerin mit ihrer Klasse dahin gemacht hatte. Es konnte sich nur um eine Verwechselung handeln. Zumal mir noch vor dem Zuendelesen des Briefes bewusst wurde, dass ich nicht im Geringsten die Mittel hatte, eine Reise nach England zu unternehmen. Obwohl der Name meiner Familie zugegebenermaßen ziemlich englisch klang, wusste ich doch, dass er mit Great Britain nichts zu tun hatte.
Ein wenig enttäuscht, dass mich das große Los wohl nun doch wieder nicht getroffen hatte, las ich den Brief aber doch bis zum Ende durch und stieß auf einen etwas kleiner gedruckten Nachsatz: „Anfallende Spesen und Reisekosten wie Kost und Logis während ihres Aufenthaltes in London werden von uns übernommen. Ihr Flugticket für den 16. August 2005 liegt am Flughafen München für sie bereit. Hochachtungsvoll Mr. sowieso.“ Punkt. Ende. Aus.
Doch kein Irrtum? Ich bekam ein leicht flaues Gefühl im Magen. Warum sollte ich etwas erben? Na, und wenn, dann sicher nur Schulden. Darauf hätte ich wetten können. Ich hatte es noch nie in meinem Leben zu etwas wirklich Großem gebracht, egal, wie sehr ich mich auch immer angestrengt hatte. Und nun sollte mir alles in den Schoss gelegt werden?
Quatsch!
Ich bin nicht der Typ, dem so etwas passiert.
Aber vorsichtshalber, weil ich von Natur nichts unversucht lasse und nichts verpassen will, fuhr ich zum Flughafen und erkundigte mich nach dem Ticket. Es war tatsächlich da. Ausgestellt auf meinen Namen. Und für den 16. August. Und nach London. Ich träume doch, dachte ich. Ein First class ticket nach Heathrow und das in zwei Tagen.
Also gut, nehmen wir das Geschenk, wenn es sich als solches herausstellen sollte, mal an.
Kurz und gut, ich landete in Heathrow und wurde doch tatsächlich von einer Nobel- Limousine abgeholt. Den Typ des Wagens muss ich leider schuldig bleiben. Mit englischen Autos kannte ich mich leider nicht so gut aus.
Nach etwa einer halben Stunde Fahrt hielten wir vor einem hohen, rot geklinkerten Gebäude. An der Eingangstür prangte ein goldenes Schild, auf dem ich aber nur die Worte Notary, Jugde und Office erkennen konnte, denn der Fahrer schob mich ziemlich eilig und vor allem immer noch wortlos, wie schon während der Fahrt, hinein.
Dann kam es, wie man es aus diesen uralten Gerichtsfilmen kennt.
Als der Notar, der das Testament eröffnen sollte, erschien, musste ich mir wirklich das Lachen verbeißen. Ein älterer, nicht gerade schlanker Herr mit rosigen und durchaus sehr tief gefältelten und nach unten hängenden Wangenlappen, der diese furchtbar altmodische Perücke mit den weißen Locken trug, kam zu mir um den Tisch herum, gab mir freundlich lächelnd die Hand. Ich erhob mich natürlich, bestens erzogen, leicht. Er murmelte kurz meinen Namen und ging nach vorn zu seinem Platz an der Stirnseite des riesigen, mit irgendeinem grünen Material überzogenen Tisches.
Erst als ich aufgefordert wurde mich auszuweisen, fiel mir auf, dass ich mit dem Notar, einem Angestellten und einer Stenotypistin allein war. Sehr seltsam.
Ich „ Alleinerbe“?
Noch bevor ich aufstehen konnte, um meine Papiere nach vorn zu bringen, war der Clerk schon bei mir, warf einen Blick auf meine Einladung und meinen Ausweis und nickte der Bulldogge da vorn kurz zu.
„ Mein Name ist Dr. Eugene Hughes und ich bin testamentarischer Bevollmächtigter des verstorbenen Marc Woods.“ Pause. „ Also, Mr. Sander Banks, ihre Identität wurde bescheinigt, alle für die Eröffnung des Testamentes vorgesehenen Personen sind anwesend. Also beginne ich.“
Um es kurz zu machen, ich erfuhr, dass dieser, mein so genannter Onkel eine Affäre mit der Tante meiner Mutter hatte.
Ich glaube zwar heute, dass er unsterblich in sie verliebt war, aber egal.
Nach der Trennung der beiden, aus welchen Gründen auch immer, machte er Millionen mit diversen Geschäften. Aber er hatte oder wollte niemanden anderen als meine Großtante Martha, mit der er seinen Lebensstil teilen konnte. Also suchte er wieder Kontakt mit ihr, kam aber nur bis zu meiner Mutter. So erfuhr er vom Unfalltod Marthas. Mutter und er wurden Freunde und so erfuhr Marc auch von mir.
Mir ist nie ganz klar geworden, warum er es auf mich und nicht auf meine beiden Geschwister oder sonstwen abgesehen hatte, um sein Erbe los zu werden. Ich weiß nur, dass meine Mutter diesen ominösen Onkel nie erwähnt hatte.
Nun- kurz und gut, am Ende kam jedenfalls heraus, dass ich ab sofort sage und schreibe sechszehn Millionen Euro mein Eigen nennen konnte.
Einen Haken, wie das ja auch in allen klassischen Fällen so ist, hatte die Sache doch. Und zwar hatte mir Marc Woods die Bedingung gestellt, Ian Webster in all seinen Bemühungen zu unterstützen.
Wer auch immer das sein mochte, ich hoffte damals, dass dieser Ian nicht vorhatte, mit Fleiß meinen frisch erworbenen Reichtum durchzubringen. Ich war wirklich verflucht stolz auf meinen Besitz, der mir einfach so in den Schoß gefallen war. Zumindest möchte ich so die Gedanken beschreiben, die mich damals mehr oder weniger beherrschten.
So also kam es, dass ich nach verschiedenen, oft auch sinnlosen, Ausgaben, den Entschluss fasste, Ian zu suchen und die Bedingung des Erbes zu erfüllen. Eigentlich brauchte ich Mr. Webster gar nicht zu suchen, denn bereits zwei Tage nach meinem Entschluss, stand er vor der Tür meines neuen Hauses, dass ich mir mittlerweile zugelegt hatte.
Nicht sehr groß, oder gar pompös, sondern gerade soviel, dass ich bequem damit zurecht kam. Das heißt, dass ich mich nicht verlaufen musste, nicht zu überlegen hatte, wohin ich dies und das verstauen sollte und schon gar nicht einen Putztag aller zwei Wochen einlegen musste.
Für eine Putzfrau oder Haushälterin war ich zu knauserig und zu misstrauisch.
Ich glaube, ich war wirklich ziemlich geizig zu jener Zeit.
Vielleicht war das auch nur dem Wunsch geschuldet, nicht das gesamte Geld doch noch in kürzester Zeit auszugeben.
Aber zurück zu Ian Webster.
Er stand also vor meiner Tür und lächelte mich auf eine warmherzige Art an, die mir sofort bewusst machte, dass ich mit ihm einen neuen Freund gefunden hatte. Einen, der Wegbegleiter und Kamerad für den Rest des Weges sein würde.
Wohin dieser Weg auch führen mochte, aber Moment, was für ein Weg?
Irgendwie hatte ich das Gefühl, als ich Ian damals das erste Mal gegenüberstand, dass ab sofort eine neue, oder besser gesagt, eine andere Zeitrechnung für mich begonnen hatte.
Ich glaube, jeder kennt das, wenn sich plötzlich eine Art Unruhe in einem breit macht und man von einer Aufbruchstimmung erfasst wird, die einem sogar ein wenig Angst machen kann.
Also, wie schon vermutet, hatte ich mit Ian einen wahren Freund gewonnen.
Und dieser Freund führte mich in die Kreise derer ein, die wirklich etwas vom Leben verstehen und wissen, wie man sich die Fragen beantwortet, die man sich schon immer und sein ganzes Leben lang gestellt hat.
Ian, und ich muss sagen, auch Marc waren ziemlich verrückt, was ihr Hobby anging. Anstatt wie andere reiche Leute Golf zu spielen oder immer verrücktere Hotels ins Meer zu bauen, schienen sie von einer Art Zwangsneurose besessen zu sein, die es ihnen unmöglich machte, damit aufzuhören, irgendwelchen Mythen, Sagen und geheimnisvollen Artefakten nachzujagen.
Dabei ging es aber nicht, wie man jetzt vermuten könnte um die ewige Suche nach der Bundeslade, dem Heiligen Gral oder der Dame mit dem heiligen Gral, oder dem Auge des Tigers oder sogar Atlantis.
Nein, Ian und mein verstorbener Gönner suchten nach anderen Dingen. Und zwar nach jenen, die Fragen beantworteten. Genauer ausgedrückt, suchten sie die Bücher derer, die schon vor Unzeiten wussten, wie man ein Flugzeug bauen musste, oder Metall bearbeitete, wie unser Sonnensystem aufgebaut ist und wie man die Chemie beherrscht.
Auf ihrer Suche nach Antworten warfen sie logischerweise immer neue Fragen auf. Bis sie zum Schluss auf die eine, existenzielle Frage stießen. Die nach der Menschwerdung.
Die Frage nach dem Anfang des Menschseins.
Alle Hinweise verfolgend, stellte sich heraus, dass es anscheinend Wesen gab, die sich ein normal denkender Mensch beim besten Willen nicht vorstellen konnte. Wesen, die die Geschicke der Menschen lenkten. Unvorstellbar.
Das warf die nächste Frage auf, nämlich die, ob diese Kreaturen Gottes Werk und Wille waren. Ob er sie lenkte, leitete, beaufsichtigte, sozusagen. Was die Daseinsberechtigung dieser Wesen war. Diese Fragen galt es zu beantworten.
Sie kamen zu dem Schluss, dass Hinweise existieren müssten, die zur Klärung beitrugen.
Und dass es ein Buch darüber geben musste. Die Geschichte der Bibel erzählt uns nämlich nur die halbe Wahrheit.
Ohne Gott und seine Verankerung in den Geschicken der Menschheit in Frage stellen zu wollen, forschten die beiden unermüdlich nach dieser Quelle allen Wissens.
Marc Woods starb bei dem Versuch, sie dieses Wissens zu bemächtigen. Aber nicht so spektakulär, wie man jetzt annehmen möchte, sondern ganz simpel und unmysteriös an, - ja an was eigentlich?
Ian hatte meine Frage danach mit einem lapidaren „ Lungenentzündung“ abgetan.
3
Ian Webster, ein Kerl wie ein Baum. Eine Seele von einem Freund. Als ich ihn kennenlernte, war er gerade siebenundvierzig Jahre alt und hatte nicht ein einziges graues Haar. Er hatte immer wieder beteuert, dass er von Haarfärberei nichts hielte.
Wenn ich mich da so anschaute, mit gut dreißig Jahren und einem ziemlich farblosen, ich hörte es nicht sonderlich gern, wenn man grau dazu sagte, Kinnbart und langsam verblassendem Schläfenhaar, war es für mich fast unvorstellbar, dass man mit knapp fünfzig noch keine
„ farblosen“ Haare haben konnte.
Dieser schwarzbehaarte Kerl also erklärte mir, was er darunter verstand, die Fragen des Lebens zu beantworten und das mit dem Eifer eines Besessenen.
Er hatte eine Art, Dinge zu erläutern, die mitriss und den Wunsch erweckte, es ihm gleich zu tun.
Ian war mir zumindest darin ähnlich, dass wir beide, wenn wir einmal etwas begonnen hatten, niemals aufgaben und bis zum Ende durchhielten, ohne ständig an unserem Tun zweifeln zu müssen.
Auf meine Frage, wie hoch der Preis solcher Unternehmungen, wie das Reisen, die Recherchen vor Ort, eventuelle Bestechungsgelder und Ausgaben für die Literatur, die ja Inhalt der Nachforschungen war, bisher lag, kam wieder die ihn umgebende unheimliche und undurchschaubare Art von Magie zum Vorschein, die es mir immer unmöglich gemacht hatte, mir bis zur letzten Konsequenz meine Fragen beantworten zu lassen.
Ian meinte immer nur, dass ich mir keine Gedanken um mein Geld machen solle. Ich allein wäre verantwortlich, würde ich eines Tages ein verarmter Mann sein, nicht unsere Unternehmungen.
Und im Zusammenhang mit ihm und Marc, war es einfach nicht möglich, aus ihm herauszubekommen, was der Grund für Marcs plötzlichen Tod gewesen sein könnte.
Er verstand es immer vortrefflich, mit Gegenfragen, wie zum Beispiel, „ Wie hättest du es denn gemacht?“ und ausweichenden Antworten, von den Fragen, die er nicht beantworten wollte, abzulenken.
Und kam die Sprache auf die letzte der Unternehmungen der beiden, wich Ian regelmäßig und konsequent aus.
Ich nahm mir damals vor, ihn irgendwann regelrecht auszuquetschen, um herauszufinden, was er mir immer wieder erfolgreich verschwiegen hatte.
So! Und an dieser Stelle fehlte mir ein Stück.
Und zwar ein Stück meiner Vergangenheit.
Woran ich mich noch erinnern konnte, war, dass Ian und ich vor einiger Zeit einem Hinweis nachgegangen waren, der uns zumindest zum Titel des Buches der Bücher führen sollte.
So hofften wir.
Ausgerechnet im vom Krieg zerfressenen Afghanistan hatten wir vor, eine Moschee aufzusuchen, in der dieser Tipp versteckt sein sollte. Ich kam mir damals ziemlich affig vor, weil sich das Ganze wie gewollt anfühlte.
Irgendjemand, so dachte ich, müsste uns nur einen Tipp geben und wir sprangen darauf an und jagten Allem hinterher, was dem Ziel dienlich zu sein schien. So wie ein von fremder Hand gesteuertes Spielchen.
Mein Gefährte wedelte mit einem Blatt Papier herum und winkte mich heran.
„ Was ist das, Ian?“, wollte ich von ihm wissen.
„ Nun“, entgegnete er, „ich war bei Mike und der sagte mir, dass er von einem Mann gehört hat, der einigermaßen durchgedreht ist, weil er angeblich eine Botschaft vom Herrn empfangen hat, die ihm befiehlt, in Afghanistan nach der Lehre Zarathustras zu forschen.“
„ Gott und Zarathustra? Das ist schon etwas ungewöhnlich, oder? Es gibt sicher immer wieder diese Gottesfanatiker, die meinen, mit ihrem Gott im Dialog zu stehen. Aber diese Konstellation?“
„Das war auch nicht das Wesentliche an Mikes Erzählung, sondern vielmehr die Tatsache, dass der werte Herr ständig etwas vom Buch der Genesis laberte. An sich auch nicht verwunderlich, ist doch die Genesis, wie du weißt, Teil der Bibel. Aber jetzt kommt ein Aspekt ins Spiel, der es uns unmöglich macht, das Ganze nicht ernst zu nehmen. Der Typ sprach von der Schrift, nach der die Welt erschaffen wurde! Die Lehre Zarathustras von Gut und Böse, vermute ich jetzt einmal. Weil die Bibel nach der Menschwerdung erschaffen wurde, wie ja allgemein bekannt ist.
Einem normalen Menschen wäre das gar nicht aufgefallen, denn er hätte das unweigerlich mit der mystischen Vergangenheit in Zusammenhang gebracht. Also, du weißt schon, das ewige Spiel der Konkurrenz der Religionen. Aber meiner Meinung nach sind wir hier dem Urgedanken der Schöpfung auf der Spur. Dem Ursprung der Menschwerdung. Weißt du, was das heißt?“
„ Nein. Ich blicke im Moment überhaupt nicht durch. Was hat der Zarathustra mit Afghanistan zu tun? Und was hat Gott mit Zarathustra zu tun? Na gut, die Konkurrenz der christlichen Kirche mit dem Zoroastrismus. Und weiter?“
„Erst mal, Afghanistan hieß früher Baktrien, etwa fünfhundert vor Christus.
Der Prophet Zarathustra ließ einen Weltzyklus von vier Zeitaltern mit jeweils dreitausend Jahren verlauten. So.
Aus dem Herrn des Lichts und der Gerechtigkeit der altiranischen Mythologie schuf er das höchste Prinzip des Guten. Das Ganze im kosmischen Gegensatz zum Prinzip des Bösen, dem Gott der Finsternis.
Irgendwann, im zweiten Weltalter, erklärte der Gott der Finsternis allen Geschöpfen der Welt den Krieg und ließ seine dämonischen Horden gegen sie kämpfen.
Und so weiter und so weiter. So wie man es immer wieder hört, das Gute siegt und das Böse verliert.
Also für mich sieht das so aus, dass es eine Art Chronik gibt, die all das festhält. Ein Buch, dass von Anfang an dabei war, sozusagen.
Wir könnten Glück haben und einen wichtigen Hinweis darauf in Afghanistan finden.“
„ Aha. Weißt du, du erstaunst mich immer wieder. Woher weißt du soviel? Gelesen, wie? Aber ...
Du könntest recht haben, lass’ uns aufbrechen.“
Ich gebe zu, dass ich es Ian nie ganz leicht gemacht hatte, mich von seinen Vorhaben zu überzeugen.
Wie gesagt, ich war im Hinterkopf wohl etwas geizig.
Mann, soviel Kohle geschenkt bekommen und sie dann wegen einer Schnapsidee loszuwerden? Nö!
Das wollte ich nicht zulassen.
Aber Ians Argumente waren meistens überzeugend.
Die Vorbereitungen waren schnell getroffen und so konnten wir rasch abfliegen. Über Delhi nach Kabul, von wo aus wir mehr oder weniger abenteuerlich mit einem Jeep in unbeschreiblich unwegsames aber auch bizarr schönes Land vordrangen. Nach einem Tag wirbelsäulenschädigenden von Loch zu Loch Gehopse kamen wir in einem winzigen Bergdorf an, dessen Mittelpunkt eine eher schäbige Moschee war. Kaum noch Putz an den Wänden, ein windschiefes Eingangstor, jedoch wenigstens noch erkennbar zwei Türme- früher einmal sicher weiß- luden nicht wirklich zum Eintreten ein.
Aber was soll’s.
Wir waren nicht hier um Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Allerdings musste ich zugeben, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt immer noch keinen blassen Schimmer hatte, wonach wir hier eigentlich suchen sollten.
Mit diesem Gedanken im Kopf, sah ich meinen Begleiter an. Und, wie sollte es anders sein, er lächelte leicht, schaute mir in die Augen und ich sah wieder dieses unheimliche Leuchten in seinen Augen.
Unheimlich nicht im Sinne von grauenvoll oder furchteinflössend, sondern geheimnisvoll und magisch. Neugier erweckend.
„Warte es ab. Du wirst es gleich sehen.“, flüsterte er nur kaum hörbar.
Wenige Sekunden später standen wir in der Halle der Moschee, deren Anblick fast schon traurig machte, denn hier drinnen sah es genauso verwahrlost aus wie außerhalb.
Ich schaute mich gründlich um, allerdings ohne meinen Standort, etwa drei Schritte vom Eingang entfernt, zu verlassen. Ian indes ging ziemlich entschlossen in Richtung Altar, ohne sich auch nur einmal umzusehen.
Vor einem einen mal einen Meter großem Bild blieb er stehen und schaute es sehr genau und sehr lange an.
Ich kannte ihn mittlerweile lange genug, so dass ich wusste, dass er, wenn er an seinem Kinnbart nestelte, äußerst konzentriert war.
Und genau das tat er in diesem Moment. Ein Zeichen für mich, mir anzusehen, was er entdeckt hatte.
Ich ging zu ihm, behielt aber augenwinkeltechnisch die Umgebung im Auge. Vielleicht sah ich ja irgendeine Bewegung innerhalb dieses verrotteten Gotteshauses.
Na ja, man konnte ja nie wissen, schließlich waren wir in einem völlig fremden Land und dann auch noch in ein Heiligtum eingedrungen.
Ok- eingedrungen schien zwar übertrieben, aber ein wenig Vorsicht hatte noch nie geschadet.
Mit diesen Gedanken war ich neben Ian und stellte erstaunt fest, dass das Bild ein ziemlich wertvolles Gemälde zu sein schien und darüber hinaus auch noch äußerst gut erhalten war.
Ich sah einen netten Herrn in prunkvoller Kleidung, rechts neben sich einen Affen und links von ihm einen Elefanten um dessen Füße sich eine Schlange geringelt hatte.
Etwas undeutlicher konnte ich einige Kreaturen erkennen, die sich scheinbar anschickten, den Tieren und dem Mann einen feindlichen Besuch abzustatten.
Sollte das den von Ian erwähnten Kampf darstellen, den der Gott der Finsternis mit Hilfe seiner Dämonen vom Zaun gebrochen hatte?
Hinter dieser Gruppe glaubte ich eine holzfarbene Tür auszumachen, die im oberen Drittel eine Inschrift zu tragen schien.
Ich sah mich noch einmal in der Halle um und beugte mich dann weiter vor, um besser sehen zu können.
„ Kein Wort!“, flüsterte Ian, „Schau!“ Er zeigte auf das, was ich für eine Tür hielt. Und je länger ich hinsah, umso deutlicher wurde das Bild, das im Allgemeinen mehr in dunklen Farben gehalten war.
Optische Täuschung, klar, aber es schien mir, als würde das Bild immer heller und der Hintergrund würde immer kräftiger. Und ich begann, die Inschrift lesen zu können.
Vier Buchstaben: C H O M.
Sollte das der Hinweis auf das Buch der Bücher sein?
Wer malt so was?
„Wir gehen! Jetzt!!“
Ians Stimme war leise aber voller Bestimmtheit und Härte.
Und dann noch: „ Sch...“.
Dann spürte ich einen stechenden Schmerz am Hinterkopf, bevor es Nacht wurde.
4
Als ich aufwachte sah ich in das Gesicht eines Engels.
<Blödes Klischee, dass Engel blond sein müssen!>, dachte ich und musste unwillkürlich lächeln.
Ein wunderschönes Gesicht mit ein paar wenigen, nur schwach erkennbaren Sommersprossen, sah mich überaus freundlich an. Ich sah dezent geschminkte Augen und wie gemalt wirkende Lippen. Schwarzes, schulterlanges Haar umspielte ihre Schultern. Ein weißer Kittel... Kittel? Wo bin ich? Schlagartig fiel mir wieder alles ein. Die Moschee, das Mohammedbild und... Ian!
„ Wo ist Ian?“ fragte ich.
Also, wollte ich fragen, denn mehr als ein Krächzen brachte ich nicht zustande.
Mein Hals tat weh bei dem Versuch zu sprechen. Er war mehr als nur trocken.
Ein schlanker, zarter Finger legte sich auf meine Lippen. „Still! Bitte! Nicht sprechen“ flüsterte mein schöner Engel.
„ Ich lasse Mr. Webster holen. Aber bitte nicht reden jetzt!“ betonte sie noch einmal.
„ Bitte trinken sie das hier erst mal!“ Ein Glas mit einer milchigen Flüssigkeit erschien in meinem Blickfeld.
Ihre andere Hand half meinem Oberkörper, sich aufzurichten. Ohne Widerspruch zuzulassen, erreichte das Glas meinen Mund. Das Zeug schmeckte wie..., wie..., ich hatte keine Ahnung, womit ich diesen Geschmack vergleichen sollte.
Auf jeden Fall schmeckte es scheußlich und tat doch gut. Ein bekannter Schmerz am Hinterkopf stellte sich wieder ein und riss mich ins Dunkel zurück.
Das letzte, woran ich noch denken konnte, war mein wunderschöner Engel und das wohltuende Gefühl, geborgen zu sein.
Ein sanftes Streicheln an meiner Wange weckte mich erneut auf. „ Mr. Banks? Mr. Webster ist jetzt da.“
Das Engelsgesicht schwebte über mir und lächelte mich an.
„Mr. Webster ist hier.“ wiederholte sie. Ich drehte meinen Kopf in Erwartung der nächsten Schmerzattacke, die aber zum Glück ausblieb. Ebenso wie die sofortige Erinnerung daran, wer wohl Mr. Webster sein mochte. Dieser trat in diesem Moment in mein Gesichtsfeld und nun fiel mir auch das wieder ein.
„Hallo Sander. Wie geht’s dir heute? Du hast mir ziemliche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, du wachst nie wieder auf. Und als du vor zwei Wochen nach mir hast rufen lassen, war das wohl ein bisschen witzig, oder was?“
An seinen vor Begeisterung leuchtenden Augen sah ich, dass er das nicht ernst meinte.
Aber Moment- vor zwei Wochen? Ich war doch erst heut früh kurz wach gewesen, oder?
Na ja, jeder weiß, dass man die Zeiträume, die man schläft nicht wirklich schätzen kann.
„ Wie lange ist Afghanistan her, Ian?“
Das Leuchten in seinen Augen verschwand für einen Augenblick, als er leise sagte: “ Elf Monate, Sander. Du hattest einen Schädelbasisbruch, na ja - ziemlich kompliziert. Die Ärzte hier haben alles gegeben, sagen sie.
Und dass du vollkommen gesund wirst, wenn du aus dem Koma aufwachen solltest. Aber ich kenn dich ja, du bist ja von nichts unterzukriegen, nicht wahr?“
Ich lächelte Ian an.
„ Danke, dass du an mich geglaubt und gewartet hast. Du könntest mir ja mal erklären, was damals überhaupt passiert ist.“
„Später, alter Freund. Du musst erst mal schlafen und wieder zu Kräften kommen. Ach so, das hier ist Judith, deine persönliche Pflegerin, Betreuerin, Freundin, Komabegleiterin, wie du willst. Sie wird dir weiterhin jeden Wunsch von den Lippen oder sonst wo, ablesen. Ich erscheine morgen früh wieder und dann sehen wir, ob du stark genug bist. So denn!“
Mit einem breiten Grinsen drehte er sich um und verließ leise pfeifend das Zimmer. Ich drehte den Kopf in die Richtung, in der ich Judith vermutete und sah sie lächelnd am Fenster stehen.
„ Keine Angst, Sander. Ich war das ganze letzte Jahr für sie da. Tag und Nacht. Schön, sie wieder unter den Lebenden zu sehen. Ich hab hier ein paar Medikamente für sie. Guten Appetit!“ Mit einem Augenzwinkern reichte sie mir die Kapseln. Wie das schmeckte, weiß ich nicht mehr, ich schlief ein.
Als ich aufwachte, fror ich einigermaßen und stellte fest, dass das Fenster bis zum Anschlag geöffnet war. Ich hörte Vögel zwitschern, den Lärm einer nicht weit entfernten Strasse und sah die Sonne scheinen.
Das tat so unendlich gut.
Ich fühlte einen Hauch Sentimentalität in mir aufsteigen.
Dann mischte sich der Klang von Schritten auf dem Gang vor meinem Zimmer unter die außenseitige Geräuschkulisse. Judith? Wäre ja schön.
Ich versuchte mich aufzurichten. Das ging schon recht gut. Hinsetzen. Erledigt. Herumdrehen und die Beine aus dem Bett hängen lassen. Auch kein Problem.
Ich war so sehr mit mir beschäftigt, dass ich erschrak, als ich Judiths Stimme hörte: „ Meinen sie, dass sie das schon schaffen können? Warten sie, ich helfe ihnen!“
Ihr Arm umfasste meine Hüfte und ich ließ mich langsam nach unten gleiten. Auf den Füßen angekommen, drückte ich meine etwas zitternden Knie durch und stand.
Ganze drei Sekunden lang. Dann wurde mir schwarz vor Augen und ich sah zu, dass ich wieder ins Bett kam. Eigentlich, richtiger ausgedrückt, sah Judith zu, dass ich mich wieder hinlegte.
„ Sie haben es ziemlich eilig, nicht wahr? Geben sie sich noch ein paar Tage und dann gehen wir beide mal eine Runde spazieren.“
Ich brauchte etwa eine Minute, um kreislaufmäßig wieder in ruhigen Bahnen zu schwimmen. Dann ließ ich meinen Blick erst einmal ausführlich auf meinem schönen Engel ruhen.
Sie war wahrlich die Schönheit in Person. Ihr ebenmäßiges Gesicht kam mir an diesem Tag, als die Sonne ihren Teint beleuchtete, noch wundervoller vor.
Sie schien etwa in meinem Alter zu sein, ein paar Jahre jünger vielleicht. Feine Lachfältchen zeichneten sich neben ihren Augen ab. Und das machte sie nur noch schöner.
Im Allgemeinen machte sie einen äußerst gepflegten Eindruck.
Das, was der Kittel preiszugeben vermochte, ließ die absolute Traumfigur erahnen.
Mir kam der Gedanke, dass sie in Wirklichkeit von Ian angeheuert sein könnte und nicht wirklich hier in der Klinik angestellt war.
Schließlich hatte ich außer ihr sonst kein andres Pflegepersonal zu Gesicht bekommen.
Und warum eigentlich sagte sie plötzlich dieses „ Sie“ so oft? Bisher hatte sie eine Anrede doch immer versucht zu vermeiden.
Ich vermutete, dass das wohl durchdachte Absicht war.
„ Wäre es möglich, dass wir uns duzen?“ fragte ich geradeheraus.
„ Sehr gern, Sander.“ antwortete sie lächelnd.
„ Ian kommt in etwa einer Stunde. Ich habe dir einen Tee mitgebracht. Wenn du versprichst, ihn langsam zu trinken, rücke ich ihn raus.“
Ihre lockere Art und dieses offene Lächeln gefielen mir ausgesprochen gut. Sie war einer dieser Menschen, deren Aura Lebensfreude und Frohsinn versprühte. Ich kam nicht umhin, mich in diesem Moment zu fragen, ob sie wohl verheiratet sei, oder wenigstens einen Freund hatte. Unvorstellbar, wenn nicht.
Eine so schöne Frau konnte unmöglich allein sein.
Als sie mir das Glas mit dem aromatischen Tee reichte, versuchte ich auf ihre Finger zu sehen, um eventuell einen verräterischen Ring zu entdecken.
Nun, verräterisch war höchstens mein suchender Blick, denn Judith sagte plötzlich lachend: „ Ich bin weder verheiratet, noch habe ich einen Freund. Mein Job, hier bei dir ließ das nicht zu. Ähm, warte, das ist nicht deine Schuld. Ich habe alles so gewollt.“
„ Sag mal, kannst du Gedanken lesen?“ fragte ich erstaunt, ohne jedoch unangenehm von ihrer direkten Offenheit berührt zu sein. Tatsächlich hatte ich daran gedacht, dass sie wegen ihres Jobs hier keinen Freund oder Mann hatte.
Ich fühlte weder Scham noch Unbehagen aufsteigen, wenn ich daran dachte, dass sie mir fast ein Jahr lang ihre Komplettpflege hat angedeihen lassen. Auch nicht, dass sie einfach so meine Gedanken offen legt. Lag ihr am Ende doch mehr an mir, als ein Pfleger - Patient Verhältnis? Zu früh für solche Gedanken. Mit einem inneren Kopfschütteln schob ich diese beiseite.
Und Judith lachte.
Auf ihre herzliche und wärmende, wohltuende Art.
Ian ließ die vorjährigen Ereignisse in Afghanistan Revue passieren und ich erfuhr endlich, dass mich ein Einheimischer mit einem silbernen, fast zehn Kilogramm schweren Weihkelch fast ins Jenseits befördert hatte. Ian hatte mehr Glück und konnte den zweiten Angreifer abwehren.
Als er ihnen klargemacht hatte, dass wir keine Diebe und Heiligtumsschänder waren, ließen sie ihn gehen und halfen sogar noch, mich in ein Krankenhaus zu bringen.
Ian ließ mich dann nach München in diese Privatklinik fliegen, wo mir nach mehrstündiger Operation nicht die besten Chancen auf Heilung eingeräumt wurden.
Weiter hatte er, nachdem ich schon mehrere Wochen nicht aus dem Koma erwacht war, Judith eingestellt.
Sie war gelernte Krankenschwester, hatte für diesen Job alles aufgegeben und war mit ihrer damals neunjährigen Tochter hierher gezogen, obwohl sie wusste, dass ich jeden Tag aufwachen könnte und ihr Job damit beendet sein könnte.
Warum sie es dennoch tat, konnte ich leicht erahnen.
Ich hatte das Gefühl, dass meine Sympathie und Zuneigung erwidert wurde.
Auf deutsch gesagt, kam von ihr etwas rüber. Und das gefiel mir außerordentlich gut.
Aber zurück zu meinem Kameraden.
„Ian, hast du dir gemerkt, was auf der Tür hinter dem Abbild Mohammeds stand. Und hast du auch etwas damit anfangen können?“ jetzt wollte ich wissen, was mein treuer Freund in der vergangenen Zeit angestellt hatte.
„ Glaubst du, ich könnte das vergessen? Das war im Übrigen keine Tür, sondern das Abbild eines Buches. Im Übrigen das genaue Abbild dieses Buches. Und es existiert. Ich weiß auch wo. Aber ich bin bisher noch nicht nah genug herangekommen. Unser Weg führt mal wieder nach London. Und der, der das Buch haben soll, ist ein mehr als zäher Hund. Ich komm an ihm nicht vorbei.
Na, und freiwillig rückt der das nicht raus, ist klar.“
Ich konnte mir die Situation gut vorstellen, wusste ich doch, dass Ian jegliche Gewalt ablehnte, solange es möglich war.
Wie ich übrigens auch. Und wir waren damit bisher recht gut gefahren.