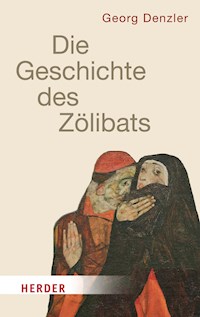19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Sind die Kirchen das Gewissen der Nation gewesen? Haben sie unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft genügend Widerstand geleistet? Georg Denzler und Volker Fabricius verfolgen das spannungsreiche Verhältnis zwischen Kirche und Staat von der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Ähnliche
Georg Denzler | Volker Fabricius
Christen und Nationalsozialisten
Darstellung und Dokumente
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Zeit des Nationalsozialismus
Eine Buchreihe
Herausgegeben von Walter H. Pehle
Vorwort
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und damit seit dem Untergang des Naziregimes sind fast 50 Jahre vergangen. Doch das Gesamtbild vom Verhalten der Kirchen zum Nationalsozialismus und vor allem von ihrer Rolle in Adolf Hitlers »Tausendjährigem Reich« (1933–1945) ist trotz zahlreicher Untersuchungen und Quelleneditionen weder eindeutig noch vollständig. Dies gilt sogar für die Kardinalfrage, ob die Kirchen in jenen Jahren wirklich das Gewissen der deutschen Nation gewesen sind, ob sie ungerecht verfolgten und tödlich bedrohten Menschen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln geholfen haben. Die Antworten lauten heute noch verschieden, ja, sogar widersprüchlich. Während die einen behaupten, die Kirchen hätten zu jeder Zeit das ihnen Mögliche getan, sind andere der Meinung, dieselben Kirchen seien weit hinter ihrer Pflicht zurückgeblieben. Bei »Kirche« denkt man hier freilich vorrangig an Institutionen und Vertreter der Kirche.
Dieselben Fragen und Klagen werden wieder laut, seit im Herbst 1989 die sozialistische Diktatur in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zusammengebrochen ist und zwei Jahre später die über vier Jahrzehnte voneinander getrennten beiden deutschen Staaten als Bundesrepublik Deutschland (BRD) wieder vereinigt wurden. Mit der sogenannten Stasidebatte, das heißt der Diskussion über das Verhältnis der Kirchen zum Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in der DDR (vgl. Exkurs: »Kirche im Sozialismus«), begann nicht nur die Entstasifizierung, sondern lebt auch die Erinnerung an die fragwürdige Entnazifizierung in den Jahren nach 1945 wieder auf.
Die auf Quellen gestützte Darstellung will Antwort geben auf Verdienst und Versagen der Kirchen unter der nationalsozialistischen wie unter der sozialistischen Diktatur, ohne daß aber die beiden Autoren als Ankläger oder als Verteidiger auftreten möchten. Des Historikers höchstes, wenn auch nie erreichtes Bestreben muß es sein, der historischen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Daß dies nur in begrenztem Maß möglich ist, erklärt sich einerseits mit der Lückenhaftigkeit historischer Überlieferung und andererseits mit der Unvollkommenheit historischer Erkenntnis.
Es genügt freilich nicht, daß der Historiker zuverlässige Untersuchungen anstellt und zuverlässige Interpretationen versucht. Auch Beurteilungen – nicht aber Verurteilungen – darf man von ihm erwarten. Der Historiker Hagen Schulze betont völlig zu Recht: »Wenn wir nur die Umstände fatalistisch registrieren und nicht an die Schuldhaftigkeit von handelnden Personen glauben, brauchen wir uns nicht mit ihnen zu beschäftigen« (Süddeutsche Zeitung, 17.1.1983). Erst dann besteht auch die Möglichkeit, aus der Geschichte zu lernen, und zwar vor allem dies: offensichtliche Fehler der Vergangenheit keinesfalls zu wiederholen.
Bei den Publikationen zum Thema Kirchen und Drittes Reich vermißt man bisher schmerzlich – wie übrigens auch heute wieder beim Thema Kirchen und DDR – eine ökumenische Ausrichtung und Zusammenarbeit. Abgesehen von Klaus Scholders Standardwerk »Die Kirchen und das Dritte Reich«, das jedoch wegen des frühen Todes seines Autors in den Anfangsjahren steckengeblieben ist, steht jeweils immer nur eine Kirche, die katholische oder evangelische, im Mittelpunkt des Interesses. Wir waren bestrebt, beide Kirchen im ungefähr gleichen Umfang vorzustellen, um so wenigstens die ersten Schritte zu einer vergleichenden Sicht zu tun.
Weil uns nur ein begrenzter Raum zur Verfügung stand, war die Beschränkung auf das Aufzeigen der Hauptlinien gemäß dem derzeitigen Forschungsstand geboten. Mit Rücksicht auf einen breiteren Leserkreis verzichteten wir auf eine komplizierte Fachsprache ebenso wie auf einen umfangreichen Anmerkungsapparat. Um dem Leser die eigene Urteilsbildung zu erleichtern, kommen originale Quellen reichlich zu Wort.
Diese Publikation stellt eine gründliche Überarbeitung unseres zweibändiges Werkes »Die Kirchen im Dritten Reich. Christen und Nazis Hand in Hand?« Band 1: Darstellung, Band 2: Dokumente (Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 1984, 31988) dar. Statt zweier getrennter Bände werden aber hier Darstellung und Dokumente in einem einzigen Band geboten, wobei jedoch die Zahl der Dokumente beträchtlich verringert werden mußte. Zitate aus dem früheren Dokumentenband werden mit »Denzler-Fabricius, Bd. 2, Seite …« nachgewiesen, Zitate aus Dokumenten in diesem Band tragen den Nachweis »vgl. Dok. Nr. …« Zitate aus Büchern, die unter Quellen und Literatur verzeichnet sind, werden mit dem Namen des Autors, dem Erscheinungsjahr des Buches und der betreffenden Seitenzahl nachgewiesen.
August 1993
Georg Denzler, Bamberg
Volker Fabricius, Washington
Teil I Die Kirchen in der Weimarer Republik
Wenn vom Verhältnis zwischen Kirche und Staat zur Zeit des Nationalsozialismus (NS) die Rede ist, dann taucht unweigerlich der Begriff Kirchenkampf auf. Dieser Begriff spiegelt sicher das Selbstverständnis vieler Kirchenmänner wider, die sich und ihre Kirche im Kampf mit dem NS-Staat sahen. Bereits Ende 1933 war vom »Kirchenkampf« die Rede. Und da dieser Begriff so plakativ wirkte, führte er konsequenterweise dazu, daß er bei zahlreichen kirchenhistorischen Analysen in den Buchtitel aufgenommen wurde. So gleichsam zum Leitmotiv des Quellenstudiums erhoben, begünstigte er nicht selten das geschichtliche Fehlurteil: Beide Kirchen haben von allem Anfang an mit dem Staat im Kampf gelegen; beide Kirchen sind die eigentlichen ernstzunehmenden Größen im Widerstand gegen den NS gewesen. In Wirklichkeit aber war besonders im Jahr 1933, als die Diktatur institutionalisiert und zielstrebig stabilisiert wurde, als auch schon grundlegende Regelungen für das Verhältnis von Staat und Kirche erfolgten, eine in ganz Deutschland – auch in kirchlichen Kreisen – weitverbreitete Begeisterung für die neue, von Adolf Hitler gebildete Regierung zu konstatieren.
Wie konnte es dazu kommen, daß die Leitungsgremien der Kirchen schon in den ersten Wochen der neuen Ära ihren bisherigen Kurs parteipolitischer Zurückhaltung aufgaben und trotz offensichtlicher Rechtsbrüche der Regierung unerwartete Loyalitätserklärungen formulierten? Wie konnte es soweit kommen, daß viele Christen loyal zum neuen Staat und seinem Führer standen sowie begeistert Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Unterorganisationen wurden? Ein Blick zurück in die Zeit der Weimarer Republik (1919–1933) soll helfen, auf diese für das Verständnis der folgenden Ereignisse so wichtige Frage eine Antwort zu geben.
Nationalsozialismus und Christentum
Der Münchener Schlosser Anton Drexler gründete 1919 die »Deutsche Arbeiterpartei«, in die Adolf Hitler am 16. September als Mitglied Nr. 7 aufgenommen wurde. Für diese bald »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei« (NSDAP) genannte politische Vereinigung erstellte der Würzburger Bauingenieur Gottfried Feder im Jahre 1920 ein 25 Punkte umfassendes Parteiprogramm. Das Verhältnis der Partei und des Staates zur Kirche ist in Punkt 24 beschrieben:
»Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen.
Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage: Gemeinnutz vor Eigennutz« (vgl. Dok. Nr. 1).
Zwei Aussagen waren für die Kirchen bedeutungsvoll: (1) Die Partei bejaht ein »positives Christentum«, ohne einer bestimmten Konfession den Vorrang zu geben. (2) »Das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse« gilt als Norm, an der sich auch die Kirche zu orientieren hat, wenn sie ihre Freiheit in einem nationalsozialistischen Staat bewahren will.
Hier zeichnete sich auch schon Adolf Hitlers politisches Weltbild mit Deutschtum und Antisemitismus als Fixpunkten ab. Der Religion selbst bekundete er in seinem zweibändigen Werk »Mein Kampf« (1925–1927) den Respekt der NSDAP:
»Sie sieht in beiden religiösen Bekenntnissen gleich wertvolle Stützen für den Bestand unseres Volkes und bekämpft deshalb diejenigen Parteien, die dieses Fundament einer sittlich religiösen und moralischen Festigung unseres Volkskörpers zum Instrument ihrer Parteiinteressen herabwürdigen wollen« (S. 379f.).
Hitler betonte außerdem, daß seine »Bewegung« ausschließlich politische Ziele verfolge:
»Ihre Aufgabe ist nicht die einer religiösen Reformation, sondern die einer politischen Reorganisation unseres Volkes« (S. 379).
Ebenfalls kein Geheimnis machte der zu dieser Zeit als Volksredner und Agitator bekannte Parteiführer Hitler aus seinem abgrundtiefen Haß auf das Judentum. Die erwähnte Kampfschrift enthielt viele Aussagen, die das spätere Rassismusprogramm des NS im Dritten Reich deutlich ahnen ließen.
Geschickt verstand es Hitler, die traditionelle Judenfeindlichkeit der Kirche für seine antisemitische Ideologie ins Feld zu führen. Er sah sich sogar als den Erfüllungsgehilfen Gottes, als er die blasphemischen Worte niederschrieb:
»So glaube ich heute im Sinn des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn« (S. 70).
Aufmerksame Leser der ersten Stunde erkannten freilich, daß Hitler in seiner vielhundertseitigen Programmschrift, von der bis zum Jahr 1933 nahezu eine Million Exemplare gedruckt waren, längst nicht alle Pläne und Ziele offen ausgesprochen hatte. Doch was hier schwarz auf weiß gedruckt stand, reichte aus, um die Marschroute der neuen völkischen Bewegung vorauszusehen; es hätte auch für die höchsten Kirchenvertreter ausreichen müssen, um der NSDAP und ihren maßgebenden Führern mit einem entschiedenen Nein gegenüberzutreten.
In privaten Kreisen dagegen zeigte Hitler sein wahres Gesicht. Welches Los der zu keinem Augenblick aus der Katholischen Kirche ausgetretene Parteiführer und spätere Reichskanzler Adolf Hitler den christlichen Kirchen und dem Christentum überhaupt zugedacht hatte, offenbarte er zu Beginn der dreißiger Jahre in einem Gespräch mit Hermann Rauschning:
»Mit den Konfessionen, ob nun diese oder jene: das ist alles gleich. Das hat keine Zukunft mehr. Für die Deutschen jedenfalls nicht. Der Faschismus mag in Gottes Namen seinen Frieden mit der Kirche machen. Ich werde das auch tun. Warum nicht? Das wird mich nicht abhalten, mit Stumpf und Stiel, mit allen seinen Wurzeln und Fasern das Christentum in Deutschland auszurotten …
Für unser Volk aber ist es entscheidend, ob sie den jüdischen Christenglauben und seine weichliche Mitleidsmoral haben oder einen starken, heldenhaften Glauben an Gott in der Natur, an Gott im eigenen Volke, an Gott im eigenen Schicksal, im eigenen Blute …
Eine deutsche Kirche, ein deutsches Christentum ist Krampf. Man ist entweder Christ oder Deutscher. Beides kann man nicht sein. Sie können den Epileptiker Paulus aus dem Christentum hinauswerfen. Das haben andere vor uns getan …
Die katholische Kirche ist schon etwas Großes. Herr Gott ihr Leut’, das ist eine Institution und es ist schon was, an die zweitausend Jahre auszudauern. Davon müssen wir lernen. Da steckt Witz und Menschenkenntnis darin. Die kennen ihre Leute! Die wissen, wo sie der Schuh drückt. Aber nun ist ihre Zeit um! Das wissen die Pfaffen selbst. Klug genug sind sie, das einzusehen und sich nicht auf einen Kampf einzulassen. Tun sie es doch, ich werde bestimmt keine Märtyrer aus ihnen machen. Zu simplen Verbrechern werden wir sie stempeln. Ich werde ihnen die ehrbare Maske vom Gesicht reißen. Und wenn das nicht genügt, werde ich sie lächerlich und verächtlich machen« (Rauschning, 1940, S. 50–53).
Wenige Jahre nach Hitlers »Mein Kampf« trat Alfred Rosenberg mit seinem Buch »Der Mythus des 20. Jahrhunderts« (1930) an die Öffentlichkeit, um die nationalsozialistische Auffassung vom Christentum philosophisch zu unterbauen. Die Thesen Rosenbergs, den Hitler später mit der Überwachung der Schulung und Erziehung der NSDAP beauftragte, sind keineswegs originell, sondern ein Konglomerat zusammengetragener Gedanken, die sich in ihrem »völkischen« Kern bis Paul de Lagarde und Nietzsche zurückverfolgen lassen. Für Rosenbergs Grundhaltung zum Christentum sprechen die folgenden Sätze:
»Die Religion Jesu war zweifellos die Predigt der Liebe … Niemand wird dieses Gefühl mißachten; es schafft das seelische Fluidum von Mensch zu Mensch. Aber eine deutsche religiöse Bewegung, die sich zu einer Volkskirche entwickeln möchte, wird erklären müssen, daß das Ideal der Nächstenliebe der Idee der Nationalehre unbedingt zu unterstellen ist; daß keine Tat von einer deutschen Kirche gutgeheißen werden darf, welche nicht in erster Linie der Sicherung des Volkstums dient. Damit ist der unlösliche Widerstreit zu einer Anschauung nochmals bloßgelegt, die offen erklärt, die kirchlichen Bindungen ständen höher als die Bindungen der Nation …
Konfessionen sind nicht Zweck an sich, sondern wandelbare Mittel im Dienste des nationalistischen Lebensgefühls und der germanischen Charakterwerte. Sind sie dies nicht, so beweist dieser Zustand die Krankheit der Volksseele … Die Ablehnung des germanistischen Ideals in Deutschland ist nackter Volksverrat. Eine spätere Zeit wird dieses Verbrechen auf die gleiche Stufe mit Landesverrat während des Krieges stellen … Voraussetzung jeglicher deutscher Erziehung ist die Anerkennung der Tatsache, daß nicht das Christentum uns Gesittung gebracht hat, sondern daß das Christentum seine dauernden Werte dem germanischen Charakter zu verdanken hat … Ein Mann aber oder eine Bewegung, welche diesen Werten zum vollkommenen Siege verhelfen wollen, haben das sittliche Recht, das Gegnerische nicht zu schonen. Sie haben die Pflicht, es geistig zu überwinden, es organisatorisch verkümmern zu lassen und politisch ohnmächtig zu erhalten« (Rosenberg, 1935, S. 663, 692f.).
Politische Praxis freilich wurden diese kirchen- und christentumsfeindlichen Sentenzen in den Anfangsjahren der NS-Diktatur nicht. Weil Hitler die Christen beider Konfessionen zum Aufbau und zur Festigung des »neuen Deutschland« brauchte, spielte er immer wieder die Rolle des Wolfs im Schafspelz. Deshalb auch distanzierte er sich gelegentlich von Rosenbergs Generalangriff auf das Christentum und suggerierte Katholiken wie Protestanten mit der Rede vom »positiven Christentum« immer wieder die Möglichkeit einer Vereinbarkeit von NS und Kirche.
Es wäre allerdings falsch zu meinen, der NS habe von Anfang an und geschlossen die Vernichtung des Christentums als ein Hauptziel verfolgt. Vielmehr ermöglichten die höchst unterschiedlichen Kräfte innerhalb des NS keine einheitliche Auffassung darüber, wie das Christentum nach nationalsozialistischer Auffassung einzuschätzen und welcher Weg beim Vorgehen gegen die christlichen Kirchen einzuschlagen sei. Diesem fehlenden Grundkonsens innerhalb der NS-Führungsclique hinsichtlich der Kirchenfrage verdankten beide Konfessionen bis zum Ende des Dritten Reiches immer wieder neu den nötigen Freiraum zum Überleben.
Daß viele Christen dem NS erwartungsfroh begegneten, hatte eine Grundlage auch in der geschickten Taktik Hitlers, der in öffentlichen Bekundungen fortgesetzt versuchte, auch für kirchliche Wählerschichten attraktiv zu sein. Zwar lag der NSDAP-Kirchenpolitik zu diesem Zeitpunkt noch keine ausgefeilte Programmatik zugrunde, auf deren Grundlage das Verhältnis von Staat und Kirche neu zu bestimmen war; man war aber taktisch so gewieft, die Kirchen richtig als einen in seinem Gewicht nicht hoch genug zu veranschlagenden Machtfaktor einzustufen, der vorerst einmal für die eigenen Zielsetzungen zu instrumentalisieren war. So wurde in Wahlveranstaltungen und offiziellen Erklärungen intensiv und sehr geschickt um Kirchenführer und Kirchenvolk geworben.
Insbesondere vermochte Hitler mit seiner Regierungserklärung vom 23. März 1933 die christlichen Wähler von dem doch so guten Willen der Nazis zu überzeugen, fortan nicht gegen, sondern mit dem Christentum den neuen Staat zu bauen (vgl. S. 59f.).
Gleichlautende oder ähnliche Versprechungen hatte Hitler schon vor der Reichstagswahl im März 1933 bei Rundfunkansprachen und anderen öffentlichen Reden lautstark abgegeben. Massentrauungen von SA-Männern, gemeinsame Tauffeiern und nicht zuletzt von ganzen Parteieinheiten besuchte Gottesdienste gehörten zum Bild des auf einem »positiven Christentum« stehenden NS.
Wenn wir im folgenden nach dem Verhältnis der Kirchen zur Weimarer Republik fragen, erhebt sich im Blick auf unser Gesamtthema die spezielle Frage, ob und wie die Kirchen auf den Aufstieg des NS, das heißt auf Hitler und die NSDAP, reagiert haben.
Protestantismus und Monarchie
Seit den Jahren der Reformation war in den evangelischen Landeskirchen der Landesherr gleichzeitig auch das Oberhaupt der Kirche (summus episcopus). Damals hat Martin Luther zugestanden, daß sein Landesherr in Kursachsen die Aufgaben der nicht mehr im Amt befindlichen katholischen Bischöfe in Notzeiten mit Recht übernähme. Aus dem Notbischof wurde bald der Summepiskopat, d.h. das höchste Bischofsamt, das nunmehr die Landesherren für sich beanspruchten. Sie wollten der Kirche nicht nur in Notzeiten helfen, sondern sich von jeder kirchlichen Bevormundung befreien und ihrerseits Macht über die Kirche gewinnen. Am Ende dieser Entwicklung lag die Verwaltung der Kirchen in Händen des Staates. Die Selbständigkeit der Kirchen war damit aufgegeben, und eine die Jahrhunderte überdauernde Liaison zwischen Obrigkeit und Kirche, von Thron und Altar hatte begonnen. Letztlich lag aber auch die Selbständigkeit der Gemeinden am Boden. Die »Staatskirche« ließ den »Laien« wenig Spielraum für mündige Mitarbeit, geschweige denn für das reformatorische Mitspracherecht. Die Evangelische Kirche präsentierte sich am Ende des monarchistischen Zeitalters als eine »Pastorenkirche« – schlechte Voraussetzungen für eine konstruktive Mitwirkung am Aufbau eines demokratischen Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg.
Denn mit dem Untergang der Monarchie und mit dem Beginn der ersten Republik in Deutschland sah sich die Evangelische Kirche plötzlich ihrer Führungsspitze beraubt. Wie schwer der Abschied von Kaiser und Fürsten fiel, können die folgenden Absätze aus der für viele andere Äußerungen beispielhaften Begrüßungsansprache des Kirchentagsvorsitzenden Reinhard Moeller beim 1. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden (September 1919) veranschaulichen:
»In schwerer ernster Zeit tritt der erste Deutsche Evangelische Kirchentag zusammen.
In einem Weltkrieg ohnegleichen, nach einem mehr als vierjährigen heldenmütigen Ringen ohnegleichen, gegen eine ganze Welt von Feinden ist unser Volk zusammengebrochen.
Die Herrlichkeit des deutschen Kaiserreichs, der Traum unserer Väter, der Stolz jedes Deutschen ist dahin. Mit ihr der hohe Träger der deutschen Macht, der Herrscher und das Herrscherhaus, das wir als Bannerträger deutscher Größe so innig liebten und verehrten …
In den evangelischen Kirchen unseres Vaterlandes bestanden seit den Tagen der Reformation die engsten Zusammenhänge mit den öffentlichen Gewalten des Staates. Wir können nicht anders als hier feierlich es bezeugen, welcher reiche Segen von den bisherigen engen Zusammenhängen von Staat und Kirche auf beide – auf den Staat und die Kirche – und durch beide auf Volk und Vaterland ausgegangen ist.
Und wir können weiter nicht anders, als in tiefem Schmerz feierlich bezeugen, wie die Kirchen unseres Vaterlandes ihren fürstlichen Schirmherren, mit ihren Geschlechtern vielfach durch eine vielhundertjährige Geschichte verwachsen, tiefen Dank schulden, und wie dieser tiefempfundene Dank im evangelischen Volke unvergeßlich fortleben wird« (Denzler-Fabricius, Bd. 2, S. 13f.).
Doch bei aller Trauer war kein entschlossenes Engagement der Kirche für eine Wiederherstellung der alten Zustände zu registrieren. Man trat anfangs sogar prinzipiell für Ruhe und Ordnung und für eine demokratische Republik ein und bekämpfte damit eine Diktatur des Proletariats – so der Tenor der »Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung« im Jahre 1918 (Nowak, 1981, S. 22). Die Zeit des Umbruchs 1918/1919 kam aber national-konservativen Kräften im Protestantismus nur als »Herrschaft der Straße«, »schrankenloser Klassenegoismus«, »brutale Gewalt«, »kolossale Schreckensherrschaft« in den Blick (Nowak, 1981, S. 40ff.). Von den Regierungsparteien befürchteten sie das Schlimmste: Trennung von Staat und Kirche, einen religionslosen Staat und Aufhebung der Konfessionsschulen.
Mit großem Mißtrauen begegnete demzufolge die Evangelische Kirche der jungen Republik von Weimar. Alle republikfreundlichen Kräfte sollten für die Fehlschläge und Fehlentwicklungen der aktuellen Politik verantwortlich sein. Da viele Pfarrer den Aufbruch in den Krieg 1914 enthusiastisch gefeiert, ihn gar als heiligen Krieg begriffen und bis zum Schluß vehemente Durchhalteparolen formuliert hatten, fiel nach dem Waffenstillstand die Dolchstoßlegende auch in kirchlichen Kreisen auf fruchtbaren Boden:
»Wir hatten ein stolzes Heer, mit Lorbeer gekränzt, in tausend Schlachten siegreich. Nun ist es dahin. Ein Stärkerer ist über uns gekommen. Nicht die Feinde. Wir selbst mit Lüge und Bosheit, mit Haß und Unverstand« (Berliner Evangelisches Sonntagsblatt, 23. 3. 1919; Nowak, 1981, S. 54f.).
Kaum erstaunlich ist es auf diesem Hintergrund, daß sich nur wenige Stimmen vernehmen ließen, die die Kriegsschuldzuweisung der Alliierten an Deutschland akzeptierten. Der Friedensvertrag von Versailles (»Schandfrieden«) konnte ebenfalls keine Zustimmung erfahren. Der Deutsche Evangelische Kirchenausschuß bezeichnete ihn in einer Kundgebung an den Weltprotestantismus als eine »Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln«: Die Gebietsregelungen seien Raub, die Entwaffnungsbestimmungen eine Wehrlosmachung, die Reparationen ungeheuerlich hoch und die Kosten für die Besatzungstruppen Ursache für das deutsche Elend (Nowak, 1981, S. 109).
Eine solche Einstellung zu den wichtigsten politischen Fragen in der Anfangszeit der ersten deutschen Republik ließ die Kirchenvertreter nicht nur in den Gesprächen mit ausländischen Kirchenmännern im Abseits stehen. Die Evangelische Kirche fand auch zur Sozialdemokratie, einer der führenden politischen Kräfte der Demokratie von Weimar, kein positives Verhältnis. Die Sympathien der Vertreter des Protestantismus galten nach der neuerlichen Konstituierung des Parteienwesens und gescheiterten Versuchen, eine Partei mit ausdrücklich protestantischer Programmatik ins Leben zu rufen, der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP). Diese Partei konnte als die kompetente Interessenwalterin traditioneller kirchlicher Ziele gelten: Sie richtete sich monarchistisch aus, vertrat evangelische Prinzipien, sprach sich (ganz im Sinn der patriotisch fühlenden Protestanten) für eine enge Verbindung von Christentum und nationalem Gedankengut aus und führte letztlich einen Kampf gegen den vermeintlich zu großen Einfluß des Judentums. Vor allem der konservative Protestantismus schätzte die DNVP als ein Bollwerk gegen Marxismus und Liberalismus sowie als Gegengewicht zum politischen Katholizismus (Zentrumspartei). Wer nicht DNVP wählte, wandte sich der antidemokratisch-konservativen Deutschen Volkspartei (DVP) oder der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) zu, deren Programm aber das Herz der protestantischen Wählerschichten nicht so weit und nicht so leicht erreichen konnte wie die DNVP.
Die Kirche wollte die neuen Gegebenheiten im Lande nicht akzeptieren; ihr Wunschdenken manifestierte sich »in einer neuen Sehnsucht nach der alten Geborgenheit im Staat« (Beyreuther, 1969, S. 21). Die Chancen der gerade erworbenen, aber als aufgezwungen eingeschätzten Selbständigkeit (vgl. die Weimarer Verfassung vom 11. 8. 1919) konnte man zu diesem frühen Zeitpunkt nicht erkennen. Generalsuperintendent Otto Dibelius schätzte in seinem Buch »Das Jahrhundert der Kirche« (1926) die Stimmung in der Kirche als »ganz überwiegend republikfeindlich« ein (S. 76). Nach den unruhigen Anfangsjahren und einer Phase politischer Stabilisierung kamen erst relativ spät (vielleicht zu spät) auf dem Königsberger Kirchentag 1927 Annäherungen des Protestantismus an die Republik zustande. Dort wurden als Grundideen des deutschen Protestantismus der zwanziger Jahre angesprochen: Obrigkeitsgehorsam (W. Kahl), Vaterlandsliebe und Volkstumsideologie (P. Althaus meinte eine Gefährdung des deutschen Volkstums durch das Fremde, nämlich das Judentum, feststellen zu müssen). Was unter Volkstum zu verstehen sei, führte Dibelius in seinem genannten Buch so aus:
»Wie stellt sich eine evangelische Kirche zum Staat? Zunächst ist klar, daß eine evangelische Kirche dasjenige freudig bejaht, das die Grundlage jedes gesunden und einheitlichen Staatswesens ist. Das ist das Volkstum. Die evangelische Kirche will Gott anerkennen, wie und wo er sich offenbart. Niemand aber kann an der Tatsache vorbeigehen, daß nach Gottes Schöpferwillen alles gesunde Menschenleben, sobald es in das Stadium der Kultur eingetreten ist, auf dem Volkstum beruht. Der Mensch, der sich von seinem Volkstum löst, verliert die innere Sicherheit, die Harmonie seines Lebens. Internationalität, die das eigene Volksleben überspringt, ist immer sittlich haltlos, äußerlich, oberflächlich. In ein Volk wird der Mensch hineingeboren. Der Volksgemeinschaft verdankt er, was er ist und hat. Der Volksgemeinschaft ist er verpflichtet durch das Gebot der Nächstenliebe. Denn der Bruder im eigenen Volke ist uns immer der Nächste! Das Ideal der evangelischen Kirche kann nicht eine internationale Gesellschaft christlicher Art sein, sondern eine Menschheit, die sich aus Nationen aufbaut, in der jedes Volkstum den christlichen Glauben auf seine Art erfaßt und in seiner Art ausprägt« (Dibelius, 1926, S. 232f.).
Deutlich wird hier, wie nahe doch die Volkstumsvorstellungen dem nationalsozialistischen Gedankengut kamen.
Mit der sich nun bei vielen Kirchenbehörden einstellenden loyalen Kooperation mit dem Staat trat aber noch kein grundlegender Gesinnungswandel ein: Eine Beflaggung der Kirchen aus Anlaß des Verfassungstages 1928 wurde abgelehnt – einige Jahre später freilich sollte aus allen erdenklichen Anlässen geflaggt werden! So ist es nicht verwunderlich, daß der Protestantismus in den Krisenjahren der Republik seine Stimme nicht erhob zur Verteidigung der Demokratie (Religiöse Sozialisten mußten auf taube Ohren stoßen!) und daß mit dem Aufstieg des NS eine starke Politisierung des evangelischen Pfarrerstandes einsetzte. Nach dem augenscheinlichen Versagen bürgerlich aufgeklärter Vorstellungen in der Demokratie von Weimar folgten eine Aktivierung des Patriotismus und Nationalismus, eine Hinwendung zu mythisch-nationalem Denken, eine Öffnung zu etwas ganz Neuem und Großem. Der bekannte Theologe Hans Asmussen drückte stellvertretend für viele das Empfinden der Zeit in einem antidemokratischen Credo aus:
»Aus der Naseweisheit gegenüber Gott folgt mit zwingender Notwendigkeit die demokratische Pest, diese fluchhaft schwärmerische Verwechslung von Gesetz und Evangelium, welche Autorität und Respekt verpönt und womöglich Vertrauen verordnet oder gar darum bittet, anstatt Respekt zu befehlen« (Nowak, 1981, S. 226).
Schon direkt nach der Reichstagswahl vom 14. September 1930 – die NSDAP kam von 12 Mandaten im Jahre 1928 jetzt auf 107 Mandate – schrieb Dibelius im »Berliner Evangelischen Sonntagsblatt« (29.9.1930):
»Die Nationalsozialisten als stärkste Rechtspartei haben es sowohl durch ihr Programm wie durch ihre praktische Haltung in Thüringen gezeigt, daß sie ein festes positives Verhältnis zum Christentum, unter Zurückstellung konfessioneller Unterschiede haben. Wir dürfen erwarten, daß sie diesem Grundsatz im neuen Reichstage treu bleiben werden« (Nowak, 1981, S. 297).
Jetzt begann eine breite Diskussion über die nationalsozialistische Bewegung in der protestantischen Öffentlichkeit, als deren Ergebnis das Bild einer Dreiteilung angesehen werden kann: Zustimmung (vornehmlich bei jungen Theologen und nationalistischen Kreisen), Neutralität (Prinzip der Überparteilichkeit der Kirche; Theologen und Laien im Bereich der politischen Mitte) und Ablehnung (in geringer Zahl; am entschiedensten bei den Religiösen Sozialisten). Noch setzte sich in vielen Landeskirchen die Position der Mitte durch:
»Die Rücksicht auf das Wohl der Einzelgemeinden wie der Gesamtkirche, die Verpflichtung der evangelischen Kirche zu unbedingter politischer Neutralität veranlaßt uns, den Gemeindekirchenvorständen dringend zu empfehlen, die Überlassung kirchlicher Gebäude an politische Parteien zu vermeiden« (Landeskirche in Frankfurt am Main; Dokumentation, Bd. 25, 1974, S. 366).
Noch wurde den Pfarrern anempfohlen:
»Zu unserem Volk gehören aber alle Volksgenossen ohne Rücksicht auf ihre parteipolitische Einstellung. Will sich unsere Kirche vor dem Verlust breiter Volksschichten und vor dem parteipolitisch oder wirtschaftspolitisch begründeten Zerfall bewahren, so muß sich der Pfarrer in Predigt, Seelsorge und Unterricht wie auch in seiner außerdienstlichen Tätigkeit parteipolitisch der größtmöglichen Zurückhaltung befleißigen« (ebd., S. 366f.).
Auch das Tragen von politischen Uniformen in der Kirche war noch untersagt.
All dies änderte sich aber nach der Wahl vom 31. Juli 1932, in der die NSDAP37,4 % der Gesamtstimmen erringen konnte. Die Annäherung vieler Protestanten an den NS erlitt selbst durch die Stimmenverluste der NSDAP bei der folgenden Wahl am 6. November 1932 (nurmehr 33,1 %) keinen Rückschlag. Bei diesen Feststellungen ist es wichtig zu beachten, daß Teile der nationalsozialistischen Ideologie in Deutschland quer durch alle Schichten der Bevölkerung akzeptiert waren, z.B. das Führerprinzip (vorwiegend in der Jugendbewegung hochgehalten), der Antijudaismus (z.B. die Sündenbockfunktion der Juden in der nahen und fernen Vergangenheit) und das national-völkische Gedankengut. Für die Evangelische Kirche gilt besonders: Als in dem jahrhundertealten Bündnis zwischen Thron und Altar der Thron 1918 gestürzt war, kam es zu einer Liaison von Protestantismus und Nationalismus, wobei dieser »praktisch die stützende Stelle des Thrones« (Beyreuther, 1969, S. 21) einnahm. Mit großem taktischen Geschick verstand es dann Hitler in den Entscheidungsjahren 1932 und 1933, die Kirchen mit nicht ernstgemeinten Versprechungen auf seine Seite zu ziehen.
Eine Einzelstimme aber soll zitiert werden, weil sie schon 1932 in zehn Thesen eine Kritik des NS versucht und die Drahtzieher hinter den Kulissen und ihre Interessen an einer nationalsozialistischen Regierung richtig erkannt hat:
»Sofern er [der Protestantismus] der kapitalistisch-feudalen Herrschaftsform, deren Schutz der Nationalsozialismus tatsächlich dient, die Weihe gottgewollter Autorität gibt, hilft er den Klassenkampf verewigen und verrät seinen Auftrag, gegen Vergewaltigung und für Gerechtigkeit als Maßstab jeder Gesellschaftsordnung zu zeugen« (Denzler-Fabricius, Bd. 2, S. 35).
Dies schrieb der Theologe und Philosoph Paul Tillich, Mitbegründer des Kreises der Religiösen Sozialisten; er ging 1933 in die Emigration. Gleich ihm lehnten noch einige andere demokratisch-liberale Theologen wie etwa Martin Rade den Nationalsozialismus entschieden ab. Sie hatten die NS-Ideologie als ein faktisch auch gegen die Kirche gerichtetes Allmachtsstreben durchschaut. Ihre Theologie feite sie dagegen, in dem Reichskanzler Hitler einen »gottgesandten Führer« zu sehen. Dagegen beteten jetzt die Kirchenvertreter, die in der Weimarer Zeit die Rechte der Kirche gegen tatsächliche oder vermeintliche Angriffe des Staates vehement verteidigt hatten, für Führer, Volk und Vaterland und standen zur Mitarbeit im neuen Deutschland bereit.
Katholizismus und Demokratie
Als die europäischen Staaten, an der Spitze Frankreich, vom Ende des 19. Jahrhunderts an ihre traditionelle Verbundenheit von Thron und Altar allmählich lösten, bereitete den kirchlichen Autoritäten die notwendige Umstellung große Schwierigkeiten. In völliger Verkennung der gewandelten Verhältnisse in Staat und Gesellschaft verurteilte Papst Gregor XVI. in der Enzyklika »Mirari vos« (1832) die Gewissensfreiheit ebenso wie die Demokratie. Sein Nachfolger Pius IX. brandmarkte im »Syllabus der Irrtümer« (1864) den Liberalismus aller Schattierungen als ein Grundübel dieser Zeit. Das von ihm einberufene Vatikanische Konzil (1869–1870) kümmerte sich keinen Deut um die dringenden sozialen Fragen, sondern erhob mit den Dogmen von der obersten Gewalt und der Unfehlbarkeit die Stellung des Papstes himmelhoch über das Hirtenamt der Bischöfe und verlieh damit dem überall sich regenden Ultramontanismus, d.h. einer übertriebenen Romhörigkeit, willkommene Unterstützung. Bischöfe und Kirchenvolk setzten bei Konflikten mit staatlichen Behörden oftmals ihre letzte Hoffnung auf das Papsttum als eine übernationale Macht. Dagegen sahen sich liberal gesinnte Köpfe unter Theologen und Politikern bei ihren Bemühungen um eine bestmögliche Lösung kirchen- und konfessionspolitischer Probleme weithin im Stich gelassen.
Vor allem im Königreich Preußen, zu dem nun auch das Rheinland und Schlesien als überwiegend katholische Territorien gehörten, mußten die Bischöfe um die prinzipielle Freiheit der Kirche und um spezielle Kirchenrechte fortwährend ringen. Die vielfältigen Auseinandersetzungen erreichten im preußischen Kulturkampf unter Ministerpräsident Otto von Bismarck (t 1898) ihren Höhepunkt. Es dauerte allerdings noch Jahrzehnte, bis die Katholische Kirche bereit war, ihr selbst gewähltes Ghetto zu verlassen.
Als der Publizist Julius Bachem, 1876–1891 Abgeordneter der katholischen Zentrumspartei im preußischen Landtag, in einem Aufsatz die Parole ausgab »Wir müssen aus dem Turm heraus« (Historisch-politische Blätter, 1. 3. 1906) und damit seine Partei auch für protestantische Christen öffnen wollte, stieß er auf viel Unverständnis und Ablehnung. Der konfessionalistische Aspekt herrschte auch im Gewerkschaftsstreit vor; denn während die integrale Berliner Richtung für katholische Arbeitervereine unter Aufsicht der Amtskirche eintrat, erstrebte die Köln-Mönchengladbacher Richtung allgemeine christliche Gewerkschaften.
Die Katholiken galten noch zu Beginn unseres Jahrhunderts wegen ihrer Konfession und der damit gegebenen Romabhängigkeit allgemein als unzuverlässige Staatsbürger, als Bürger zweiter Klasse. Eine entscheidende Wende erfolgte erst mit der Weimarer Republik, als der politische Katholizismus in Gestalt der Zentrumspartei und der Bayerischen Volkspartei (BVP) auch unter sozialdemokratischen Reichskanzlern Regierungsverantwortung übernahm. Mit dem entschiedenen Einsatz für eine parlamentarische Demokratie konnten die Katholiken ihren politischen Minderwertigkeitskomplex endgültig abschütteln.
Seit der Gründung der Deutschen Republik im Jahre 1919 war das enge Band zwischen Staat und Kirche vollständig zerrissen. Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 verpflichtete den Staat in weltanschaulicher Hinsicht zu Neutralität und garantierte allen Bürgern Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie ungehinderte Religionsausübung. Die beiden großen Kirchen behielten ihren Status als Körperschaften des öffentlichen Rechts und durften »auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern erheben«. In der heftig umstrittenen Schulfrage einigte man sich in einem Kompromiß auf die Simultanschule als den Normalfall, doch mußten Konfessionsschulen auf Antrag von Erziehungsberechtigten eingerichtet werden. Der Religionsunterricht galt in allen Schulen als ein ordentliches Lehrfach.
Das Deutsche Reich und der Vatikan nahmen schon am 30. Juni 1920 diplomatische Beziehungen auf, wobei die bisherige preußische Botschaft in die Deutsche Botschaft umgewandelt wurde. Wenn auch ein Reichskonkordat wegen unterschiedlicher Ansichten der Parteien über die Rechte der Kirche in einem liberal-demokratischen Staat nicht zustande kam, schlossen doch einzelne Länder mit dem Hl. Stuhl sogenannte Landeskonkordate (Bayern 1924, Preußen 1929, Baden 1932).
Die katholische Hierarchie, der politische Katholizismus und das Kirchenvolk bezogen gegenüber der Weimarer Republik und ihrer liberalen Verfassung verschiedene Positionen, die vom Verlangen nach Rückkehr zum Kaiserreich bis zur Mitarbeit im demokratischen Staat reichten.
Wie schwer allen voran den Bischöfen die Umstellung fiel, beweist die herausragende Gestalt Michael Faulhabers (1869–1952). Der noch vom Willen des letzten Wittelsbacher Königs Ludwig III. im Jahre 1911 auf den Speyerer und 1917 auf den Münchener Bischofsstuhl erhobene Faulhaber blieb sein Leben lang ein überzeugter Anhänger der Monarchie und infolgedessen von einem tiefen Mißtrauen gegenüber der Demokratie erfüllt. Diese Einstellung brachte er am 5. November 1921 bei der Grabansprache für den Bayernkönig Ludwig III. unmißverständlich zum Ausdruck:
»Könige von Volkes Gnaden sind keine Gnade für das Volk, und wo das Volk sein eigener König ist, wird es über kurz oder lang auch sein eigener Totengräber« (Volk, 1966, S. 177).
Ebenso offen bedauerte Faulhaber ein Jahr später beim Deutschen Katholikentag in München den revolutionären Sturz des bayerischen Königs:
»Die Revolution war Meineid und Hochverrat und bleibt in der Geschichte erblich belastet und mit dem Kainsmal gezeichnet« (Volk, 1966, S. 177).
Der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer – nach 1945 der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland – widersprach als Präsident des Katholikentages dem Münchener Kirchenfürsten bei der Schlußkundgebung mit dem Hinweis, daß gewiß nicht alle deutschen Katholiken der Republik feindlich gesonnen seien.
Erzbischof Faulhaber, 1921 von Papst Benedikt XV. in das Kollegium der Kardinäle aufgenommen, näherte sich erst nach Abschluß des Bayerischen Konkordats (1924) schrittweise der Weimarer Republik, und zwar hauptsächlich deshalb, weil der NS mit Adolf Hitler als radikalem Führer und dem Rassismus als einer seiner verhängnisvollsten Irrlehren immer gefährlicher auftrat.
Die katholische Zentrumspartei, schon im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ein wichtiger Faktor in der deutschen Politik, sammelte ihre Mitglieder aus allen sozialen Schichten. Daß auch Katholiken gute Patrioten sein können, hatten viele von ihnen nach dem Kulturkampf im preußisch-deutschen Bismarckstaat und besonders im Ersten Weltkrieg bewiesen. Bei allen Vorbehalten gegenüber dem Weimarer System konnten die Katholiken tatkräftige Republikaner werden, weil der von der Kirche beanspruchte Freiheitsraum gesichert erschien. Manche Schwierigkeiten erklären sich am ehesten aus einem gespannten Verhältnis zum Sozialismus, konkret zu den Sozialdemokraten.
Beim Reichsparteitag des Zentrums in Kassel 1925 ließ sich das früher geflissentlich gemiedene Thema Republik nicht umgehen. Jetzt beschwor Karl Spiecker, neben dem früheren Reichskanzler Joseph Wirth (Zentrum) ein beherzter Verfechter der neuen Republik, die versammelten Mitglieder mit den Worten:
»Wir fühlen uns in unserem Gewissen verpflichtet, die deutsche Republik zu bejahen … Von der Treue des katholischen Volkes in Deutschland wird es abhängen, ob die deutsche Republik Bestand hat oder nicht« (Offizieller Bericht, Berlin 1925).
Zentrum und Bayerische Volkspartei wurden erst im Laufe der Zeit, weniger aus ehrlicher Begeisterung, sondern mehr angesichts der politischen Konstellation, zu Trägern der demokratischen Republik und damit wenigstens prinzipiell auch zu Gegnern des NS. Abgesehen davon, daß eine dauernde Antihaltung ihnen stets neue Nachteile eingebracht hätte, wollten sie doch lieber in einem demokratischen Staat leben als unter einer sozialistischen Diktatur, deren Gefahr nie ganz abgewendet schien. Schließlich ist nicht zu vergessen, daß die Hinwendung zu einem Staat, der den »Schandvertrag« von Versailles mit seinen demütigenden Forderungen (Reparationszahlungen) hingenommen hatte, für viele Deutsche einem Verrat am Reich gleichkam. Gerade in dieser Hinsicht offenbarte sich bei vielen Katholiken ein nationales oder gar nationalistisches Empfinden, das man ihnen vorher in diesem Ausmaß nicht zugetraut hätte.
Die Weimarer Republik erlitt schon Jahre vor ihrem tatsächlichen Untergang einen vernichtenden Stoß, als die letzte parlamentarische Regierung sich über Maßnahmen zur Lösung der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit nicht einigen konnte und deshalb am 27. März 1930 zu Ende ging. Ein unüberhörbares Alarmzeichen ertönte, als Hitlers NSDAP bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 zur zweitgrößten Partei aufstieg und zusammen mit der DNVP unter Alfred Hugenberg die Mehrheit im Reichstag stellte. Jetzt erkannten die meisten Bischöfe schlagartig die tödliche Gefahr der Hitler-Bewegung und reagierten auch auf diese neue Herausforderung. Gleichzeitig setzte eine breite Erörterung des nationalsozialistischen Kurses in der katholischen Publizistik ein.
Das Bischöfliche Ordinariat Mainz antwortete am 30. September 1930 auf eine Anfrage der NSDAP-Gauleitung Hessen, das Programm der NSDAP enthalte Sätze, »die sich mit katholischen Lehren und Grundsätzen nicht vereinigen lassen. Namentlich ist es der § 24 des Programms, den kein Katholik annehmen kann, ohne seinen Glauben in wichtigen Punkten zu verleugnen.« (Vgl. Dok. Nr. 3.) Weil die Kulturpolitik des NS mit dem katholischen Christentum im Widerspruch stehe, lautete die Schlußfolgerung, könne kein Katholik Mitglied der NSDAP sein. Wenn er diesen Schritt dennoch tue, treffe ihn der Ausschluß von den heiligen Sakramenten.
Die bayerischen Bischöfe unterschieden in ihren »Pastoralen Anweisungen« vom 10. Februar 1931 zwischen »Mitläufern der Bewegung« und aktiven Mitgliedern. Gleichzeitig erinnerten sie an ihre Pastoralinstruktion vom Jahre 1921, in der Liberalismus und Sozialismus gleichermaßen verurteilt sind, und betonten, daß der NS mit jenen kirchenfeindlichen Systemen auf ein und dieselbe Stufe gestellt werden müsse.
Dieselbe Einschätzung machte sich die Fuldaer Bischofskonferenz am 5. August 1931 zu eigen, weil der NS »tatsächlich mit fundamentalen Wahrheiten des Christentums und mit der von Christus geschaffenen Organisation der katholischen Kirche in schroffstem Gegensatze steht« (Stasiewski, 1968, S. 838).
Für die Zentrumspartei bleibt bemerkenswert, daß jetzt eine Zusammenarbeit mit der NSDAP nicht mehr von allen Mitgliedern ausgeschlossen wurde. Ihr Vorsitzender, Prälat Ludwig Kaas, von der Notwendigkeit eines Zusammengehens mit den Nationalsozialisten schon frühzeitig überzeugt, machte seinen Einfluß im Vatikan geltend, um den noch zögernden Pius XI. für eine eventuelle Koalition zwischen Zentrum und NSDAP zu gewinnen. Immerhin gab der Papst bei einer Unterredung mit dem bayerischen Gesandten Freiherr von Ritter am 20. Dezember 1931 zu erkennen, eine Zusammenarbeit mit der nationalsozialistischen Partei »ließe sich vielleicht nur vorübergehend für bestimmte Zwecke ermöglichen, um dadurch ein noch größeres Übel zu verhindern« (G. Franz-Willing, 1965, S. 231). Und über den Zentrumsvorsitzenden Kaas teilte von Ritter in demselben Schreiben an die bayerische Regierung mit:
»Prälat Kaas war … kürzlich einige Zeit in Rom, und es gibt Leute, die behaupten, daß er hierher kam, um sich unter anderem auch darüber zu orientieren, wie man es im Vatikan beurteilen würde, wenn das Zentrum sich vielleicht einmal für veranlaßt halten sollte, statt mit der sozialdemokratischen Partei mit der nationalsozialistischen Partei in Koalition zu treten« (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Bayerische Gesandtschaft. Päpstlicher Stuhl, Nr. 1031).
Noch deutlicher äußerte sich Kardinalstaatssekretär Pacelli, der bis Ende 1929 Nuntius in Berlin gewesen war, in einem vertraulichen Gespräch mit dem Gesandten von Ritter nach den für die NSDAP erfolgreichen Reichstagswahlen im Sommer 1932:
»Es sei daher zu hoffen und zu wünschen, daß wie das Zentrum und die Bayerische Volkspartei so auch die anderen auf christlicher Grundlage stehenden Parteien, zu denen sich gleichfalls die nunmehr stärkste Partei des Reichstags, die Nationalsozialistische Partei zähle, alles daransetzen werden, den hinter der Kommunistischen Partei marschierenden Kultur-Bolschewismus von Deutschland fernzuhalten … Unter diesen Umständen dränge sich die Frage auf, ob Zentrum und Bayerische Volkspartei nicht gut daran täten, sich jetzt mehr nach rechts zu orientieren und dort eine für ihre Grundsätze tragbare Koalition zu suchen« (G. Franz-Willing, 1965, S. 231f.; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Bayer. Gesandtschaft. Päpstl. Stuhl, Nr. 1038).
Die fortschreitende Aufweichung der bisherigen Fronten, in den katholischen Parteien ebenso wie in der kirchlichen Hierarchie, erklärt letztlich auch, wie es zum Sturz des Reichskanzlers Heinrich Brüning im Jahre 1932 und zur Kooperation zwischen Franz von Papen und Adolf Hitler kommen konnte.
Die politische Lage spitzte sich gefährlich zu, als die NSDAP bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 mit 37,2 % der Gesamtstimmen 230 Sitze im Reichstag errang. Die katholischen Wähler, zu dieser Zeit ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung, hatten nicht mehrheitlich Zentrum und BVP gewählt, also den Aufstieg der NSDAP nicht verhindert. Eine Rechnung, die hier zwischen »kirchlich gebundenen Katholiken« und nur Namenskatholiken differenziert (z.B. Konrad Repgen), um die »wirklichen« Katholiken von einer Beihilfe zu Hitlers Erfolg freizusprechen, verschleiert nur die tatsächliche Mitverantwortung im katholischen Bereich.
Es ist übrigens bezeichnend, daß der katholische Episkopat jetzt nicht mit einer Verlautbarung das Kirchenvolk über den Ernst der politischen Lage aufklärte, obwohl bei der Konferenz in Fulda vom 17. bis 19. August 1932 auch über die nationalsozialistische Partei und ihren Machtzuwachs ausdrücklich gesprochen worden war. Im Protokoll der Sitzung ist festgehalten:
»Sämtliche Ordinariate haben die Zugehörigkeit zu dieser Partei für unerlaubt erklärt, weil
1. Teile des offiziellen Programms derselben, so wie sie lauten und wie sie ohne Umdeutung verstanden werden müssen, Irrlehren enthalten,
2. weil die Kundgebungen zahlreicher führender Vertreter und Publizisten der Partei glaubensfeindlichen Charakter, namentlich feindliche Stellung zu grundsätzlichen Lehren und Forderungen der katholischen Kirche enthalten.«
Es spricht für die klare Vorausschau der Bischöfe, wenn sie als Resultat ihrer Überlegungen feststellten:
»3. Es ist das Gesamturteil des katholischen Klerus und der treu katholischen Vorkämpfer der kirchlichen Interessen im öffentlichen Leben, daß, wenn die Partei die heiß erstrebte Alleinherrschaft in Deutschland erlangt, für die kirchlichen Interessen der Katholiken die dunkelsten Aussichten sich eröffnen« (Stasiewski, 1968, S. 843f.).
Auffallend ist freilich, daß mahnende oder warnende Worte im Blick auf die staatspolitische Zielsetzung der Hitler-Partei ausblieben: kein Wort gegen die deutlich heraufziehende Diktatur zugunsten der bisherigen Demokratie, kein Wort gegen die lautstark verkündete Revanchepolitik zugunsten einer friedlichen Völkerverständigung, kein Wort gegen die germanische Rassenlehre zugunsten der allgemeinen Menschenrechte. Die kirchliche Hierarchie blieb allein auf kulturpolitische Fragen fixiert und versperrte sich damit den Blick für den totalitären Macht- und Herrschaftsanspruch der konsequent vorwärtsstürmenden NSDAP.
Es gab hingegen einzelne Katholiken, vor allem im Bereich der Presse, die einen umfassenderen Blick für die allgemein drohende Gefährdung besaßen und es auch an Mut zur Warnung vor den nationalsozialistischen Methoden und Zielen nicht fehlen ließen. Neben Walter Dirks, Redakteur der »Rhein-Mainschen Volkszeitung«, war es der Bamberger Diözesanpriester Georg Mönius, der als unerschrockener Herausgeber der »Allgemeinen Rundschau« in Sondernummern über Belgien die deutsche Schuld am Krieg rücksichtslos ausgesprochen hatte und 1931 in zwei weiteren Sondernummern den NS entlarvte:
»Die Ideologie der Nationalsozialisten steht dem römischen Katholizismus diametral gegenüber. Sie ist als Ganzes, als Weltanschauung in Hinsicht auf Rom der Anti-Christ … Der Katholizismus wird in der Tat berufen sein müssen, einem solchen Nationalismus das Rückgrat zu brechen« (Allgemeine Rundschau, Nr. 10, 7. 3. 1931).
Ob die beiden großen Kirchen vor 1933 alles unternommen haben, um die ständig wachsende Hitler-Gefahr zu bannen? Es fehlte gewiß nicht an Warnungen und Verurteilungen von seiten der Bischöfe und einzelner Kirchenmänner, auch wenn sie spät – vielleicht zu spät – ausgesprochen wurden. Schwerer wiegt, daß die kirchlichen Institutionen der Weimarer Republik nur geringe Unterstützung zuteil werden ließen, dafür aber nationalistischen und autoritären Bestrebungen gewogen blieben. Weil die Kirchen das monarchische Regierungssystem zurückwünschten, konnten sie auch nicht zu tragenden Säulen eines auf demokratischer Grundlage gebauten Staatswesens werden und ebneten gerade dadurch, gewollt oder ungewollt, zusammen mit anderen Faktoren dem Nationalsozialismus in Deutschland die Wege.
Teil II Die Kirchen in der NS-Diktatur
Das Entscheidungsjahr 1933
1. Die Evangelische Kirche
Hitler als Reichskanzler
Die politische Nähe vieler evangelischer Laien und Kirchenführer zur nationalsozialistischen Bewegung führte dazu, daß mit dem Eintritt der NSDAP in die Regierungsverantwortung durch die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 die beabsichtigte parteipolitische Neutralität in vielen Landeskirchen aufgegeben wurde. Für diesen Schritt lassen sich in Ergänzung zu den bereits aufgeführten weitere Gründe namhaft machen. War schon im vorigen Jahrhundert der Anschluß an die Arbeiterbewegung verlorengegangen, so ließ man nun nichts unversucht, um nicht noch einmal den Entstehungsprozeß einer neuen sozialen Bewegung zu erleben, ohne zumindest ansatzweise gestaltend einzugreifen beziehungsweise den evangelischen Christen eine positive Orientierungshilfe zu geben. Eine starke nationalsozialistische Führung ließ die Wiedereinkehr von Ruhe und Ordnung im Land erhoffen und schien Garant dafür zu sein, daß Marxismus, Liberalismus und Atheismus in die Schranken verwiesen wurden.
Als Folge davon konnten die ersten und entscheidenden Maßnahmen zur »Neuordnung« des öffentlichen Lebens in Deutschland eingeleitet werden, ohne daß hiergegen von seiten der Evangelischen Kirche protestiert worden wäre. Ohne Entgegnung blieben die Verordnung »Zum Schutz von Volk und Staat« (Aufhebung der demokratischen Grundrechte) vom 28.2.1933, das Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 und die Errichtung der ersten Konzentrationslager. Wenn in diesen entscheidenden Monaten das Schweigen vorherrschte, dann lag der politisch parteiliche Charakter der von der Kirche angestrebten Überparteilichkeit offen zutage.
Doch es sollte nicht beim Schweigen bleiben. Die Voten von zwei bekannten evangelischen Kirchenführern können die Stimmungslage im Protestantismus dieser Monate gut illustrieren; in beiden findet sich kein Wort über die den Weg in die Diktatur ebnenden ersten Gesetzesänderungen der Nationalsozialisten und der mit ihnen verbündeten konservativen Kräfte. Der Landesbischof von Württemberg, Theophil Wurm, schrieb in seinen Erinnerungen rückblickend:
»Es gab ja auch Rückschläge; insbesondere war man in allen kirchlichen Kreisen erschrocken, als im Jahr 1932 Hitler einen politischen Mord in Schlesien ohne weiteres rechtfertigte. Aber als im Januar 1933 Hindenburg sich zur Berufung von Hitler als Reichskanzler an die Spitze eines nationalen Kabinetts entschloß, da glaubte man doch auch in kirchlichen Kreisen, diese Wendung begrüßen und von ihr eine günstige Wirkung auf das Ganze des Volkes erwarten zu können. Die Nationalsozialisten hatten bisher die kirchenfeindliche Agitation des marxistischen Freidenkertums entschieden bekämpft, so daß wirklich Grund vorhanden war zu der Hoffnung, es werde nun anders werden, und diese Hoffnung schien auch in Erfüllung zu gehen, denn es setzte eine entschiedene Bewegung zur Zurücknahme des Kirchenaustritts ein, besonders in Norddeutschland« (Wurm, 1953, S. 85f.).
Und Generalsuperintendent Otto Dibelius argumentierte in seiner Festpredigt zur Eröffnung des Reichstages am 21. März 1933:
»Ein neuer Anfang staatlicher Geschichte steht immer irgendwie im Zeichen der Gewalt. Denn der Staat ist Macht. Neue Entscheidungen, neue Orientierungen, Wandlungen und Umwälzungen bedeuten immer den Sieg des einen über den anderen. Und wenn es um Leben und um Sterben der Nation geht, dann muß die staatliche Macht kraftvoll und durchgreifend eingesetzt werden, es sei nach außen oder nach innen.
Wir haben von Dr. Martin Luther gelernt, daß die Kirche der rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in den Arm fallen darf, wenn sie tut, wozu sie berufen ist. Auch dann nicht, wenn sie hart und rücksichtslos schaltet. Wir kennen die furchtbaren Worte, mit denen Luther im Bauernkrieg die Obrigkeit aufgerufen hat, schonungslos vorzugehen, damit wieder Ordnung in Deutschland werde. Aber wir wissen auch, daß Luther mit demselben Ernst die christliche Obrigkeit aufgerufen hat, ihr gottgewolltes Amt nicht zu verfälschen durch Rachsucht und Dünkel, daß er Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gefordert hat, sobald die Ordnung wiederhergestellt war.
Das muß die doppelte Aufgabe der evangelischen Kirche auch in dieser Stunde sein. Wenn der Staat seines Amtes waltet gegen die, die die Grundlagen der staatlichen Ordnung untergraben, gegen die vor allem, die mit ätzendem und gemeinem Wort die Ehe zerstören, den Glauben verächtlich machen, den Tod für das Vaterland begeifern – dann walte er seines Amtes in Gottes Namen! Aber wir wären nicht wert, eine evangelische Kirche zu heißen, wenn wir nicht mit demselben Freimut, mit dem Luther es getan hat, hinzufügen wollten: staatliches Amt darf sich nicht mit persönlicher Willkür vermengen! Ist die Ordnung hergestellt, so müssen Gerechtigkeit und Liebe wieder walten, damit jeder, der ehrlichen Willens ist, seines Volkes froh sein kann« (Norden, 1979, S. 54f.).
Nationalistische Euphorie und allgemeine Aufbruchsstimmung ließen die wahren Absichten des NS nicht erkennen. Oder wollte man nicht sehen, was bereits über das gewünschte »kraftvolle« Durchgreifen der »staatlichen Macht« hinausging? Machte man sich überhaupt Gedanken darüber, wie nach dem für notwendig erachteten »harten und rücksichtslosen« Schalten »der rechtmäßigen staatlichen Gewalt« von eben dieser »christlichen Obrigkeit« wieder »Gerechtigkeit und Barmherzigkeit« gefordert werden könnten, sobald »die Ordnung wiederhergestellt« war?
Noch deutlicher begrüßte die Osterbotschaft des Oberkirchenrates der Altpreußischen Union (16. 4. 1933) in wohl unmittelbarer Reaktion auf Hitlers Regierungserklärung »den Aufbruch der tiefsten Kräfte unserer Nation zu vaterländischem Bewußtsein, echter Volksgemeinschaft und religiöser Erneuerung«. Mit ihrer Geschichtstheologie (Gott hat »durch eine große Wende gesprochen«) und der Aufnahme zum Teil wörtlicher Formulierungen Adolf Hitlers (»nationale und sittliche Erneuerung unseres Volkes«; vgl. S. 59f.) bleibt diese Verlautbarung deshalb ein gut geeignetes Beispiel kirchlicher Loyalitätserklärungen zur neuen Macht im Staate, weil sie zudem die Verbindung von völkischem und religiösem Gedankengut deutlich erkennen läßt und freudige Mitarbeit der Kirche erklärt. Jetzt wurde auch freudig geflaggt! Im Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Hessen (12. 4. 1933) erging an die Pfarrer der Aufruf, beim Hauptgottesdienst des Herrn Reichskanzlers fürbittend zu gedenken und an dessen Geburtstag (20. April) die kirchlichen Gebäude mit der evangelischen Kirchenfahne zu schmücken (Dokumentation, Bd. 25, 1974, S. 31).
Dieser Hintergrund könnte den Schluß nahelegen, Hitler, der doch die Gleichschaltung des gesamten öffentlichen Lebens als ein Hauptziel verfolgte, habe mit der Evangelischen Kirche leichtes Spiel gehabt, zumal da er innerhalb dieser Kirche eine starke Gruppierung auf seiner Seite wußte, die »Glaubensbewegung Deutsche Christen«, der er die Durchsetzung seiner Vorstellungen in den protestantischen Kirchen überlassen wollte.
Die Deutschen Christen
In den Krisenjahren am Ende der Weimarer Republik konnten im Protestantismus unangefochten Gruppierungen entstehen, die eine fast vollständige Synthese von NS und Christentum für denkbar, mehr noch, für wünschenswert hielten. Wer für dieses Ziel tätig werden wollte, fand schnell zu der »Glaubensbewegung Deutsche Christen«. Diese »Deutschen Christen« (DC) sollten den Auseinandersetzungen zwischen NS-Staat und Evangelischer Kirche im Jahre 1933 ihren Stempel aufdrücken; denn ihnen schlossen sich rund 20 % der Pfarrer und ein weit größerer Prozentsatz protestantischer Laien an. Der Vorläuferorganisation, der in den zwanziger Jahren an Bedeutung und Einfluß zunehmenden Deutsch-christlichen Bewegung, fühlten sich sehr geschätzte Theologen wie Paul Althaus und Emanuel Hirsch verbunden. Ohne eigenständiges Programm ging diese Gruppe 1933 in den DC auf.
Deren Anfangsstunde schlug im November 1932 mit den Kirchenwahlen im Bereich der Altpreußischen Union (APU). Als kirchenpolitischer Arm der NSDAP fiel ihnen der Auftrag zu, die Kirche auch von innen für den NS zu gewinnen. Wilhelm Kube, der Fraktionsführer der NSDAP im preußischen Landtag, konnte seine Partei von der Notwendigkeit überzeugen, daß die evangelischen Nationalsozialisten bei den Kirchenwahlen eigene Kandidatenlisten vorlegten. Weil Hitler den Namen »Evangelische Nationalsozialisten« strikt untersagte, kam es zu der Bezeichnung »Deutsche Christen«. Unter diesem Firmenschild machten nationalsozialistisch gesinnte Protestanten in Thüringen schon seit 1929 von sich reden. Die Reichsleitung und Wahlkampfführung übertrug man Joachim Hossenfelder, der Anfang 1931 bei der Gründung des Nationalsozialistischen Pfarrerbundes hervorgetreten war.
Im Protestantismus dieser Epoche verschloß sich allein die Dialektische Theologie allen von außen und innen kommenden Rufen nach einem Öffnen der Kirchentüren für den politischen Zeitgeist. Vor allen anderen erinnerte der reformierte Theologe Karl Barth immer wieder an die ständige Aktualität der Lehre Christi mit ihrem radikalen Anspruch in allen Lebensbereichen. Affinitäten zu einem national-völkischen Denken waren hier nicht zu erwarten.
Ganz anders stand es jedoch mit der lutherischen Theologie, die sich bereitwillig den aktuellen politischen Strömungen anpaßte und so eine unerhoffte Blütezeit erlebte. Lutherische Theologen stellten den Reformator Martin Luther als Personifikation des wahren Deutschen vor Augen. In Vorträgen und Büchern verband die Konjunktion »und« problemlos und schnell, was vordem unvereinbar schien: »Luther und Deutschland« (Dörries) oder »Luther und Hitler« (Preuß).
Aus Romantik und Idealismus nährte sich die sogenannte Volksnomostheologie, die als wesentlich zeitgeprägte Theologie vom Volk direkt in die deutschchristliche Bewegung einmündete. Dem Volk schrieb man die Rolle einer Schöpfungsordnung Gottes zu, das Volkstum wurde unmittelbar aus der Schöpfung erhoben. Als Wegbereiter dieser Theologie erwies sich, auf den Schultern von Fichte und de Lagarde stehend, Wilhelm Stapel; und als Mentoren der verwandten völkischen Theologie wirkten die Professoren Emanuel Hirsch und Paul Althaus. Viele Pfarrer dieser theologischen Schule konnten aktuell und mitreißend predigen. Für sie war Adolf Hitler ein Geschenk des Himmels.
Schnell konnten die DC schon 1932 erste beachtenswerte Erfolge erringen. Diese lassen sich aus der nationalen Aufbruchsstimmung ebenso erklären wie aus dem deutlich ausgesprochenen Hinweis, daß die »Richtlinien« der DC vom 26. Mai 1932 in erster Linie ein »Lebensbekenntnis« und nicht so sehr ein Glaubensbekenntnis sein sollten. Als oberstes Ziel galt die »Neuordnung der Kirche«: »Wir kämpfen für einen Zusammenschluß der im ›Deutschen Evangelischen Kirchenbund‹ zusammengefaßten 29 Kirchen zu einer evangelischen Reichskirche.« Diese Forderung für sich genommen beeindruckte viele evangelische Christen sehr, da ihnen die Zersplitterung in 29 Landeskirchen schon immer unverständlich war. Die dritte These aber machte jedem aufmerksamen Betrachter deutlich, wes Geistes Kind hier sprach: »Die Zeit des Parlamentarismus hat sich überlebt, auch in der Kirche. Kirchenpolitische Parteien haben keinen religiösen Ausweis, das Kirchenvolk zu vertreten.« Das Ziel hieß also: eine einzige gleichgeschaltete Kirche, dem Führerprinzip entsprechend von oben nach unten gebaut und somit dem Totalitätsanspruch des NS leicht unterzuordnen.
Die folgenden Thesen zeugen unmißverständlich von der ideologischen Nähe der DC zum NS. Vom »positiven Christentum« bis zum »wiedererwachten deutschen Lebensgefühl« fanden sich nationalsozialistische Floskeln neben Kernstücken der neuen Lehre. Das Postulat von der Reinerhaltung der Rasse und die Diskriminierung von Mitleid und Wohltätigkeit (»Bloßes Mitleid ist Wohltätigkeit und wird zur Überheblichkeit, gepaart mit schlechtem Gewissen, und verweichlicht ein Volk«) ließen den Antijudaismus und die »Euthanasie«-Aktion späterer Jahre erahnen (vgl. Dok. Nr. 5).
Diese Richtlinien passierten den Oberkirchenrat in Berlin ohne Beanstandung, so daß die DC im Jahr 1932 zur Wahl für den Bereich der größten Landeskirche, der APU, zugelassen wurden (mehr als ein Drittel aller Sitze fielen ihrer Liste zu!). Sowohl aufgrund dieser Präzedenzentscheidung der Kirchenbehörde in Berlin wie auch wegen ihrer Richtlinien, die ohne theologisches Fundament genau den Nerv der Zeit trafen, war die Zukunft der DC in der Evangelischen Kirche bereits vor der Machtübergabe an Hitler gesichert. Von den wenigen späteren Neuformulierungen blieb das Wesen der deutschchristlichen Richtlinien aus dem Jahr 1932 unberührt. Weltanschaulich stand man stets in der Nähe des Nationalsozialismus, und kirchenorganisatorisch blieb man dem Führerprinzip verbunden. Rein theologisch erreichte das nationalprotestantische Denken der DC1932 seinen Höhepunkt. Nation und Altar, reformatorisches Christentum und völkisches Deutschtum sollten nie wieder so eng zusammengedacht und biblisch fundiert werden.
Reichskirche und Reichsbischof
Die Forderungen nach einer Reichskirche und nach kirchlicher Erneuerung erhoben nicht nur die DC. Lutheraner und Vertreter der Dialektischen Theologie setzten sich ebenfalls für eine Beseitigung veralteter Strukturen und für eine grundlegende Reform der Kirche ein. Anhänger dieser Richtungen fanden sich in der Jungreformatorischen Bewegung zusammen (u.a.Künneth, Lilje, Niemöller). Unter den zwölf Forderungen der Jungreformatoren vom 9. Mai 1933 verdienen diese vier besondere Beachtung:
»2. Wir fordern, daß der Neubau der evangelischen Kirche deutscher Nation so schnell wie möglich durchgeführt wird. Leitung und Körperschaften der Kirche sind ausschließlich der neuen Verfassung gemäß zu bilden. Urwahlen lehnen wir als überwundenen demokratischen Irrtum ab.
3. Die Ernennung eines Reichsbischofs hat umgehend, und zwar durch das bestehende Direktorium, zu erfolgen.
6. Wir wünschen, daß die Vergreisung in Ämtern und Körperschaften durch stärkere Heranziehung jüngerer Kräfte, besonders aus der Frontgeneration, beseitigt wird.
11. Wir fordern, daß die evangelische Kirche in freudigem Ja zum neuen Staat den ihr vor Gott gegebenen Auftrag in voller Freiheit von aller politischen Beeinflussung erfüllt und sich zugleich in unlöslichem Dienst an das deutsche Volk bindet« (Denzler-Fabricius, Bd. 2, S. 46f.).
Klangen diese Sätze auch einigen Überlegungen der DC sehr ähnlich, so wiesen die Jungreformatoren in einer Presseerklärung doch ausdrücklich darauf hin, daß – bei allen Übereinstimmungen – die Unterschiede zu den DC auf rein kirchlichem Gebiet lägen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bestehe darin, daß sie den Ausschluß von Nichtariern aus der Kirche ablehnten, da diese Forderung im staatlichen Bereich zwar ihre Berechtigung habe, im kirchlichen Bereich aber am Wesen der Kirche vorbeiziele (Norden, 1979, S. 246f.).
Das Gesetz zur »Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«, der sogenannte Arierparagraph, war im staatlichen Sektor bereits seit dem 7. April 1933 in Kraft. Obwohl auch prominente Theologieprofessoren (z.B.P. Tillich, G. Dehn, E. Fuchs, K.L. Schmidt) zu den ersten Opfern zählten, blieben Proteste der Kirchenleitungen aus. Da zu dieser frühen Zeit Angst vor staatlichen Repressalien nicht als Erklärungsansatz dienen kann, ist nur eine weitgehende politische Übereinstimmung mit dieser staatlichen Maßnahme zu konstatieren, die zudem (politisch) unbequeme Persönlichkeiten aus den Reihen der Religiösen Sozialisten traf.
Während die Kirche noch die staatlichen Wünsche zu den ihren machte, stand die Führungsspitze der NSDAP dem Wunsch der Evangelischen Kirche nach einem Reichsbischof als »Führer« einer geeinten Reichskirche kurzfristig indifferent gegenüber. Man wußte nur zu genau um die Chancen, aber auch um die Schwierigkeiten einer solchen Lösung. Wollte man die Evangelische Kirche für die eigene Politik funktionalisieren, was bei einer Reichskirche leichter möglich war als bei vielen Landeskirchen, lag eine Erfüllung dieses Wunsches nahe. Der Wunsch mußte aber abgelehnt werden, wenn zu befürchten stand, daß man der Kirche auf diesem Weg zu neuer Macht verhelfen würde. Letztlich fiel die Entscheidung zugunsten einer Kircheneinigung, unter der Voraussetzung allerdings, daß z.B. der Reichsbischof ein Mann von Hitlers Gnaden wäre.
Nach diesen Vorgaben versuchten die DC die geplante Reichskirche aufzubauen. An die Spitze sollte als Mann ihres Vertrauens der Königsberger Wehrkreispfarrer Ludwig Müller, der von Hitler für den Bereich der Evangelischen Kirche Bevollmächtigte, treten. Die Jungreformatoren hingegen wollten die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat behaupten und votierten deshalb für Friedrich von Bodelschwingh, den Leiter der Bodelschwinghschen Anstalten.
An diesem Vorgehen übte Karl Barth, zu dieser Zeit der wohl namhafteste protestantische Theologe, im Juni 1933 mit seiner Schrift »Theologische Existenz heute!« grundsätzliche Kritik: »auch eine zunächst die äußere Gestalt betreffende Kirchenreform muß aus der inneren Notwendigkeit des Lebens der Kirche selbst, sie muß aus dem Gehorsam gegen das Wort Gottes hervorgehen oder sie ist keine Kirchenreform« (Denzler-Fabricius, Bd. 2, S. 50). So gesehen waren Reichskirche und Reichsbischof Reformen, die nicht dem Wesen der Kirche entsprachen, weil sie aus dem Zeitgeist geboren waren. Wer an dieser Stelle seine Zustimmung nicht verweigerte (auch zu Bodelschwingh), konnte in den Augen Barths noch nicht als eigentliche Opposition gegen die DC gelten. Unabhängig von der Person Bodelschwinghs bedeuteten die Wahl eines Reichsbischofs und die Verabschiedung einer Kirchenreform Einigkeit mit den DC über das Wesen der Kirche.
Vor der Wahl des Reichsbischofs erarbeitete ein vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuß (DEKA) am 25. April 1933 berufenes »Dreimännerkollegium« (Kapler, Präsident des DEKA, Marahrens, lutherischer Landesbischof von Hannover, und der reformierte Pfarrer Hesse) in Verbindung mit Müller einen Verfassungsentwurf. Eine gemeinsame Kundgebung des Dreimännerkollegiums und Müllers zur »Gründung der Deutschen Evangelischen Kirche« vom 20. Mai 1933