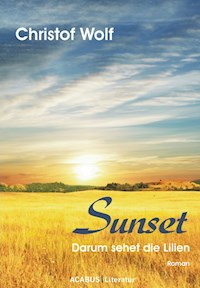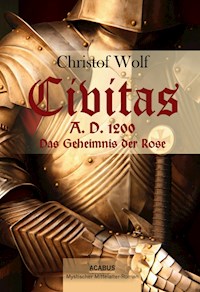
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Das Deutsche Reich im Jahre des Herrn 1200. Der Müllersohn Antonius findet in der Holzbachschlucht im Westerwald einen geheimnisvollen Fremden, der verletzt und orientierungslos ist. Dieser trägt ein kostbares Schwert und einen mysteriösen Holz-Oktaeder bei sich. In Rom überschlagen sich derweil die Ereignisse: Aus der Kirche Santa Croce lässt der Vatikan eine wertvolle Reliquie entnehmen, deren Gegenstück als verschollen gilt. Bruno von Sayn, ein Gesandter des Welfen Otto von Brunswiek, erhält eine rätselhafte Nachricht und alle Hinweise führen in seine ehemalige Heimat - den weit entfernten Westerwald. Dunkle Reiter richten dort Unheil an und versetzen die Gegend in Angst und Schrecken. Derweil sucht Abt Hermann zusammen mit seinen zwölf Glaubensbrüdern einen Platz für den Bau eines neuen Klosters. Doch was hat es mit der Reliquie auf sich und welche Rolle spielt die geheimnisumwobene Rose?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1218
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine
Hommage an
meine Heimat, den Westerwald,
mein Heimatdorf Gemünden (Severus)
und meine Wahlheimatstadt Hachenburg (Civitas/Hagenburg).
Mein Roman soll zeigen, dass sich auch in einer Region
weit ab von den großen Bühnen der Weltgeschichte und
politischen Zentren großartige Geschichten ereignen können.
Christof Wolf
Civitas
A.D. 1200
Das Geheimnis der Rose
Wolf, Christof: Civitas A.D. 1200. Das Geheimnis der Rose, Hamburg, ACABUS Verlag 2011
Originalausgabe
PDF-ebook: ISBN 978-3-941404-34-2
ePub-ebook: ISBN 978-3-86282-111-2
Print: ISBN 978-3-941404-33-5
Lektorat: M. Thalmann/M. Meinhardt, ACABUS Verlag
Korrektorat: C. Mönter, ds, ACABUS Verlag
Covermotiv: © Tomasz Bidermann - Fotolia.com
Umschlaggestaltung: ds, ACABUS Verlag
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2011
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Für
den letzten Müller der Lexemühle,
meinen Großvater Lexe Adolf.
Eine Tabelle zu den verwendeten historischen Ortsnamen
befindet sich auf S. 552.
PROLOG
ROM
Er konnte es kaum fassen, doch die von ihm beauftragten Experten bestätigten uneingeschränkt, dass es wahr sein könnte. Wie ein eingesperrter Löwe im Käfig lief Kardinal Giovanni Sottobosco in seiner Kammer auf und ab. Seine ansonsten wenig auffälligen Wangen leuchteten wie das Purpur seiner Robe. Die pergamentene Haut, die seinem fahlen, schmalen Gesicht nur selten eine Regung entlockte, zeigte heute durchaus einige knittrige Falten.
„Wenn es sich nun tatsächlich bewahrheitet, was Lucca behauptet“, murmelte er unentwegt vor sich hin – und anscheinend konnte er im Lichte neuerer Erkenntnisse tatsächlich fast davon ausgehen, dass es stimmte –, „dann ist dies eine Sensation!“
Sein Vertrauter, Lucca di Locedio, der dem gleichnamigen und direkt am Po liegenden norditalienischen Konvent des Zisterzienserordens vorstand, hatte ihm vor einigen Tagen eine Geschichte zugetragen, die ihn schleunigst hatte handeln lassen.
„Dies könnte Euch die Chance bieten“, flüsterte Lucca ihm konspirativ ins Ohr, als sie sich im Rahmen einer Audienz nicht ganz zufällig in einem der ruhigen Gänge trafen, „auf die Ihr schon Euer Leben lang gewartet habt!“ Sottobosco wurde nervös, was sonst überhaupt nicht seinem Naturell entsprach. Aufgeregt rieb er mit Daumen und Zeigefinger seinen Nasenrücken. Sollte es tatsächlich soweit sein? Wird die göttliche Vorsehung mich alsbald für die höchste Stufe des irdischen Daseins qualifizieren?
Als eine erste Maßnahme ließ er vor wenigen Tagen im Geheimen ein paar Männer in das unweit vom Lateran gelegene Sessorianum entsenden. Hierbei handelte es sich um den ehemaligen Palast der Helena. Nach deren Tod, hatte ihr Sohn, Kaiser Konstantin, diesen der Kirche zum Geschenk gemacht. Fast besessen von dem Drang, möglichst viele Reliquien zu besitzen, hatte Helena dort alles Mögliche und Unmögliche zusammengetragen. Selbst Teile des Kreuzes Christi und sogar Erde aus Jerusalem, die sie mit Ochsenkarren hatte heranschaffen lassen, gehörten zu ihren Schätzen. Natürlich konnte und wollte die Kurie das Geschenk damals nicht ablehnen. So konnte der Vatikan, nach der Segnung des Hauses durch den Pontifex, ein durchaus pompöses Domizil an der Aurelianischen Mauer sein Eigen nennen. Rom wurde somit um die Basilika Santa Croce in Gerusalemme reicher. Die Pflege und den Erhalt des sakralen Baus übertrug die Kurie dem Orden der Kartäuser.
Die Entsandten Sottoboscos mussten sämtliche Überredungskünste aufbieten, um den Kartäuser-Abt Rochus davon zu überzeugen, sein Gotteshaus für die nächsten zwei Tage zu schließen. Weder zum Gottesdienst noch für die zahlreichen Besucher, die tagtäglich in die Kirche pilgerten, sollte das Haus begehbar sein. Und dies bedeutete natürlich – auch wenn es sich lediglich um zwei Tage handelte – einen enormen Spendenausfall. Selbst die regelmäßigen Gebete seiner Mönche durften nicht im Chorgestühl des Altarraums stattfinden. Obgleich Rochus deswegen heftig insistierte, beharrten die energisch agierenden Männer darauf, dass die Tore geschlossen bleiben sollten. Somit gestalteten sich die Verhandlungen von Anfang an schwierig. Hierbei kam erschwerend hinzu, dass es den Beauftragten bei Strafe verboten war, den Namen ihres Auftraggebers zu erwähnen, geschweige denn ein Wort über den Grund der ganzen Aktion zu verlieren. Wäre Abt Rochus bewusst gewesen, in wessen Auftrag die Leute handelten, so wäre die ganze Angelegenheit nie zu einem Problem geworden.
Zähneknirschend ließ der Abt die massiven Eichentüren mit den Querriegeln sperren, die sonst nur des Nachts vorgeschoben wurden, und ließ die Männer ohne jegliche Aufsicht in seinem Haus gewähren. Allerdings sollte die Schließung nur einen Tag dauern. Schon gegen Abend wurde der Corpus Delicti aufgespürt. Wie ein ins Vertrauen gezogener Experte vermutete, fanden sie den gesuchten Gegenstand hinter dem Schlussstein eines markanten Mauerbogens.
Vorsichtig entnahmen die Männer eine wurmstichige und moderige Holzkiste, die einst sicher kunstvoll gearbeitet gewesen war, und betteten sie sanft in einem mit purpurnem Samt ausstaffierten Reliquiar.
Ohne den Mauerstein wieder einzusetzen oder das Leitergerüst abzubauen, waren die Männer wieder aus der Kirche verschwunden. Eiligen Fußes marschierten sie durch die dunklen Gassen Roms und präsentierten dem Kardinal triumphierend ihren Fund. Dieser zahlte ihnen die vereinbarte Summe an Dukaten und entließ sie ins dunkle Labyrinth der vatikanischen Gemäuer.
Sottoboscos Aufregung stieg ins Unermessliche. Er hörte den rhythmischen Klang seines Herzen. Es schlug so laut wie eine Totenglocke, die einsam und allein im Kirchturm ihr Klagelied in die Welt hinausschreit. Während er zunächst davon ausgegangen war, dass Lucca ihm wieder einmal eine Mär aufgebunden hatte, kamen ihm nun berechtigte Zweifel. Seine ansonsten so routinemäßig nach außen zur Schau gestellte Gelassenheit verzog sich wie der weiße Rauch aus den zahlreichen Schornsteinen der Heiligen Stadt in einem Windhauch. Wenn sich diese Sache bewahrheitet und es mir gelingt, den komplementären Gegenstand tatsächlich wieder nach Rom zu holen, um ihn hier mit dem zweiten Original zu vereinen, dann steht meiner Karriere nichts mehr im Weg! Bei nächstbester Gelegenheit, also sobald Innozenz III. seinen letzten Atem getan hätte und das Amt des Stellvertreter Gottes auf Erden vakant wäre, würden sich seine Kardinalskollegen mit Sicherheit an seine große Tat erinnern. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das Konklave sich gegen mich entscheiden würde!
Auf der anderen Seite lief er natürlich auch Gefahr, sich zu blamieren, sobald sich alles als Fälschung herausstellen würde. Tagtäglich tauchten Heimkehrer aus dem Heiligen Land in Rom auf und versuchten, ihre Mitbringsel der Kurie anzudrehen – wenngleich der Vatikan für sich in Anspruch nahm, per se das Eigentum an sämtlichen Reliquien zu besitzen. Gleichwohl ließ sich die vatikanische Administration hier und da erweichen und zahlte einen Obolus – gewissermaßen als Finderlohn –, sofern die Echtheit des guten Stücks tatsächlich vermutet werden konnte. Aber selbst dann, wenn es sich um nachgemachten Plunder handelte, bei dem es sich eigentlich nicht lohnte, ihn in Augenschein zu nehmen, ließ die Kurie sich manchmal nicht lumpen. Denn oftmals reichte es aus, wenn man dem gemeinen Volk auf dem Lande ab und zu einfach einen dieser Gegenstände präsentierte. Ließ sich somit doch gut und günstig ein vager Beweis für die fantastischen Geschichten, die in der Bibel standen, erbringen. „Zwar ist der Pöbel nicht des Lesens mächtig, doch blind sind sie nicht!“, lautete eine zuletzt von Innozenz III. ausgegebene Devise.
Der Gegenstand, der nun vor Sottobosco auf dem Tisch lag, brachte ihn ordentlich in Wallung. Wie schon so oft, schien auch heute an der Glaubwürdigkeit seines alten Freundes und jahrelangen Wegbegleiters Lucca kein Zweifel. Seine Ausgesandten hatten den Beweis erbracht, als sie ihm das Fragment eines überaus interessanten heiligen Gegenstands aus der Basilika Santa Croce übergaben. Ihm war mulmig zumute. Die Schläfe unter seiner dünnen weißen Haut pulsierte und trat in Form einer purpurnen Ader deutlich hervor. Die Hitze eines Flammenmeeres schien sich in seinem Kopf auszubreiten.
Er spürte ein unsagbares Verlangen, den fehlenden Gegenstand zu besitzen. Ich muss alles daran setzen und das Gegenstück so schnell es geht nach Rom zurückholen, um es hier anhand der zweiten Hälfte einer Verifizierung zu unterziehen! Und er wusste auch schon, wie er es anstellen konnte: Schon des Öfteren hatte auch er sich einer mittlerweile in der Organisation des Vatikans breit aufgestellten Einheit bedient. Längst wusste diese sich solch … delikater Angelegenheiten anzunehmen, ohne dem ganzen eine allzu große Öffentlichkeit zu bescheren.
Mittlerweile entsprach der Strom derer, die aus dem Heiligen Land zurückkehrten, fast der Zahl derer, die dorthin pilgerten. Deshalb war auch diese Sondertruppe stetig angewachsen und unterhielt in nahezu allen größeren Städten Niederlassungen. Sottobosco wusste, dass er handeln musste. Unter allen Umständen wollte er das Objekt seiner Begierde alsbald in den Händen halten. Ihm wäre alles Recht und er würde alles in Kauf nehmen: Ob Leben! Ob Tod!
I.
LEXEMÜHLE BEI SEVERUS
Arthur, der Müller der Lexemühle in Severus, hatte sich gerade erst in die Abendsonne gesetzt. Mit einem glimmenden Stöckchen, das er aus der Feuerstelle in der Küche mit nach draußen genommen hatte, entzündete er den Hanf seiner soeben mit Vorfreude gestopften Pfeife. Genüsslich zog er am selbstgeschnitzten Mundstück. Während er den Rauch tief inhalierte, lauschte er dem leisen Knistern, das die kleinen Fädchen von sich gaben, wenn die Glut sie in aromatischen Qualm verwandelte. Er rauchte stets nur eine Pfeife pro Tag, doch diese voller Genuss und vor allem zur Belohnung für einen harten Arbeitstag. Die Sonne näherte sich langsam den Baumwipfeln auf dem Ziegenberg und wollte alsbald dahinter verschwinden. Allerdings hinterließ sie ihm seit ein paar Tagen ein angenehm aufgewärmtes Mauersims, auf dem seine neue Scheune stand. Das alte Holzkonstrukt war im letzten Sommer hungrigen Flammen zum Opfer gefallen.
Über die Jahre hinweg hatten er und seine beiden Söhne es immer wieder instand gesetzt und regelmäßig im Frühjahr das morsche Strohdach geflickt. Sie brachten es einfach nicht übers Herz, dem maroden Gebäude den längst fälligen Todesstoß zu versetzen; schließlich war es eines der letzten Erinnerungen an Arthurs Vater gewesen. Sie wollten warten, bis das Balkenwerk tatsächlich so instabil wurde wie die losen Milchzähne in einem Kindermund und der nasse Schnee im Winter das Dach zum Einsturz bringen konnte. Dass zu guter Letzt der Brand im Sommer die längst fällige Aufgabe übernahm, war ihnen also gar nicht so ungelegen gekommen. Allerdings hieß dies auch, dass sie sich mit dem Errichten des neuen Baus sputen mussten, denn bis zur Einfuhr der Ernte und ihrer Wintervorräte im Herbst sollte er fertig sein.
Zunächst sammelten sie tagelang dicke Kiesel aus dem Bett des Holzbachs und brachen Basaltsteine aus einer Felswand in der gleichnamigen Schlucht. Diese wuchteten sie auf einen Wagen und transportierten sie über die sogenannte Heerstraße, die um die Schlucht herumführte, nach Hause. Feinsäuberlich schichteten sie die Brocken zu einem akkuraten Steinsockel auf, bevor sie darauf wiederum ein ordentliches Holzgerüst mit quadratischen Zwischenräumen errichteten. Diese füllten sie zunächst mit einem Weidengeflecht aus, bevor sie es mit Lehm bestrichen, in den sie Stroh untermengten. So entstand ein nahezu winddichter Belag und letztendlich ein ordentlich abgeschlossener Raum für ihre Wintervorräte – die nun, da der Winter sich langsam neigte, zu Ende gingen.
Voller Entzücken konnte Arthur vor wenigen Tagen feststellen, dass die wenigen Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch das Meer aus grauen Wolken bahnten, ausreichten, um die schwarzgrauen Sockelsteine seines Schuppens bis in die Abendstunden aufzuwärmen. Somit erkor er diesen Platz für sich aus. Nachdem die Arbeit des Tages verrichtet war, ließ er sich auf dem kleinen Mauervorsprung nieder und lehnte sich gemütlich an die lehmgefächerte Fachwerkwand. Er stopfte sich ein Pfeifchen und genoss die wohlige Wärme an Steiß und Rücken. Und seine geschundenen Knochen dankten es ihm. Ob er es glauben wollte oder nicht, doch sie erinnerten ihn tagtäglich daran, dass er mit seinen mehr als vierzig Lenzen ins Lager des älteren Eisens wechselte. Die harte Arbeit in seiner Getreidemühle ging ihm immer schwerer von der Hand. Die Silhouette seiner drahtigen Figur von einst wurde mittlerweile von einem ordentlichen Bauch dominiert. Auch sein Kopfhaar war dünn geworden und die verbliebenen Strähnen, die er zu einem kleinen Zopf zusammenband, leuchteten fast schneeweiß. Tiefe Furchen in der gegerbten Haut seines Gesichts zeugten von einem Leben voll harter Arbeit.
Arthur war aber zufrieden. Die Mühle bescherte ihm und Emma, seinem Weib, ein gutes Auskommen. Sie brauchten sich kaum Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre vier Kinder satt bekommen sollten. Den kleinen Geschöpfen, die durch die lehmigen Gassen von Severus liefen, ging es da nicht so gut.
Vor einigen Jahrzehnten hatte sich um das Kloster Sankt Severus eine Siedlung gebildet, umgeben von einem ständig zu erweiternden Weidenzaun. Der Urort, damals noch Nehrndorf genannt, hatte sich vor mehr als dreihundert Jahren unweit im Tal des weit mäandernden Elbbachs gegründet, dort wo er gemeinsam mit dem kleinen Schafsbach in den Holzbach mündete. Kurz zuvor, man schrieb das Jahr 879, ließ der politisch geachtete Graf Gebhard von Westerborg das Stift Sankt Severus in dem hufeisenförmigen Tal, unweit seines Sitzes, errichten. Die besondere Stellung des Grafen zeigte sich damals darin, dass zu der Weihzeremonie sogar König Ludwig III., wohlgemerkt ein Urenkel von Karl dem Großen, den Weg in dieses riesige unwirtliche Waldgebiet fand. Mit der Unterstützung Gebhards prosperierte Sankt Severus binnen kürzester Zeit. Über Schenkungen und Erbschaften sowie Erwerb oder Enteignungen konnten Besitztümer angehäuft werden, die sich bis zum Rhein hinab erstreckten. So wuchs auch der Ort Nehrndorf – doch nur bis zu dem Tag, als ein Unheil fast alles Leben vernichtete.
„Der schwarze Tod kommt langsam“, hatte der damalige Abt von Severus, Pius, während der Kapitelversammlung gesagt und ließ seinen Konvent nach außen abschirmen. Der Tod kam tatsächlich und fuhr eine große Ernte ein. Die wenigen Überlebenden der Seuche brannten Nehrndorf nieder und begruben die Reste unter einer dicken Schicht Erde. Zurück blieb lediglich ein kleines Meer mit Kreuzen, weshalb der Volksmund diesen Teil des Tals Kreuzern nannte und den Platz, wo einst das Dorf stand, sinnigerweise de Höll. So entstand kurz darauf, um die Steinmauern des Severusklosters herum, die neue Siedlung. In dieser siedelten sich Handwerkerfamilien an, die sich in den Dienst der Kirche stellten, und einige Bauernfamilien, darunter vor allem arme Ziegenbauern.
Und Arthur wusste, dass gerade diese Leute im Winter ums Überleben kämpften. Im Gegensatz zu denen des Lexemüllers sahen deren Kinder aufgrund des permanent an ihnen nagenden Hungers stets aus wie bleiche, hohläugige Gespenster. Und bei den abgemagerten Tieren – gerade am Ende des langen Winters – konnte man fast jede Rippe einzeln zählen. Gemeinsam mit ihren Ziegen hausten diese Menschen in armseligen Hütten am Fuß des Ziegenbergs, dessen Gras erst im späten Frühjahr vom tristen Grau in ein Lebenskraft spendendes Grün wechselte. Und erst dann würden sich ihre Tiere und Kinder wieder erholen. Erst dann war es ihnen vergönnt, täglich fettreiche Milch und vor allem Käse zu erzeugen, von dem sie auch wieder etwas ans kleine Kloster liefern konnten, was ihnen eine gewisse Zeit lang – zumindest bis in die ersten Winterwochen hinein – ein gewisses Auskommen bescherte.
Arthur war deshalb bewusst, dass er mit seiner Mühle privilegiert war. Allerdings hatte er sich seinen Beruf nicht aussuchen können, schließlich war er der einzige Sohn des Müllers Alexander und dessen Frau Katharina gewesen. Das Schicksal hatte ihm einen Weg vorgezeichnet und den zu gehen, war ihm nicht gerade leicht gefallen. Vor gut zehn Jahren musste er die Mühle seines Vaters von jetzt auf gleich übernehmen, nachdem dieser eines Tages regungslos neben dem großen Mühlstein gelegen hatte. Gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Marga und seiner Frau, schleppte er ihn damals unter den Augen seiner beiden Kinder in die warme Kammer hinter der Küche. Dort verstarb er wenige Tage später, ohne zuvor noch einmal zur Besinnung gekommen zu sein. Von diesem Tag an hatte ein hartes Stück Arbeit auf Arthur gewartet. Erschwerend kam hinzu, dass seine Mutter sich nicht von dem unvermittelten Schicksalsschlag erholte. Nach dem Tod ihres Gatten stellte sie zunächst das Reden und kurz darauf auch das Essen ein. So dauerte es keine zwei Wochen, bis Marga und Arthur ihren federleichten Leichnam auf den Gottesacker hinaustragen und sie gleich neben ihrem Mann bestatten mussten.
Von diesem Zeitpunkt an war Arthur endgültig der Lexemüller und musste von heute auf morgen die Rolle übernehmen. Er war der Ernährer, der für das Überleben derer verantwortlich war, die sich in seiner Obhut befanden. Hierzu zählten neben seiner eigenen kleinen Familie und der noch ledigen Schwester fortan auch einige Mägde und Knechte samt ihrer Familien. Arthur stellte sich seiner Aufgabe.
Mittlerweile hatten Emma und er sogar vier Kinder. Während er zunächst noch dachte, dass beide überhaupt nicht in der Lage seien, einen Stammhalter zu zeugen, wurden sie bald darauf eines Besseren belehrt. Nachdem Emma ihm seine Töchter Gertrud und Maria geschenkt hatte, die beide jedoch noch im Kindbett verstarben, erblickten zunächst Albert und zwei Jahre später Antonius das Licht der Welt, bevor ihnen weitere anderthalb Jahre später Hannah und nochmals drei Jahre später das Nesthäkchen namens Klara folgten.
Alexander, Arthur, Albert, Antonius. Diese Auffälligkeit kam nicht von ungefähr: Als Arthurs Großvater Rudolf seine Mühle vor vielen Jahren am Lauf des Holzbaches baute, erhielt er von Amos, dem damaligen Abt des Severusklosters, neben dessen Segensspende auch unentgeltliches Baumaterial aus den klostereigenen Wäldereien sowie einen für die ersten Jahre pachtfreien Boden. Dies verhalf dem jungen Müller schnell auf die Beine und bescherte ihm nach kurzer Zeit ein gewisses Auskommen. Dankbar für das Vertrauen, das Amos ihm entgegengebracht hatte, gelobte er, dass fortan alle seine männlichen Nachfahren in Gedenken an diese Ehre und den Namen des Abtes stets den Anfangsbuchstaben ‚A‘ in ihrem Vornamen tragen sollten. Als Rudolf schließlich im hohen Alter von mehr als sechzig Jahren verstarb, übernahm dessen Sohn Alexander die Mühle, weshalb sie fortan auch ‚des Alex’ Mühle‘ oder kurz die ‚Lexemühle‘ genannt wurde. Und Alexander setzte die mit ihm begonnene Tradition fort, indem er seinen einzigen Sohn Arthur und dieser wiederum seine beiden Söhne Albert und Antonius nannte.
Arthur sah zur Steinbrücke hinüber, die sich unweit seiner Mühle mit einem Bogen über den Holzbach spannte. Er musste daran denken, wie sie im letzten Jahr einen Teil ihrer Steinfracht für die Ausbesserung dieses alten Viadukts verwenden mussten, da das Hochwasser des letzten Frühjahrs ordentlich an dem Brückenbogen genagt hatte. Wenngleich ihnen die Steine auch beim Scheunenbau fehlten, waren diese Arbeiten durchaus notwendig geworden, da sie und zahlreiche Andere nicht auf den einzigen Weg verzichten konnten, der in die Holzbachschlucht führte und der sich alsbald in einen schmalen und nicht ganz ungefährlichen Pfad verwandelte. Den zu Fuß gehenden Reisenden, aber auch vereinzelt mutigen Reitern und geschäftigen Transporteuren mit Lastentieren bot er den kürzesten Weg von Severus zum nächsten Ort nach Seckaha, wo sich auf einer Waldlichtung zwei bedeutsame Handelswege kreuzten: Zum einen die nordsüdlich verlaufende Straße nach Sigena. Zum anderen die vom Rhein kommende, alte karolingische Heerstraße, die wiederum eine Querverbindung zu dem weiter westlich verlaufenden Handelsweg von Coelln nach Frankenvurd bildete. Nicht selten – daher ihr Name – eilten schwer bewaffnete Kompanien diverser Herrscher oder Söldnertrupps auf ihr entlang, um schnellstmöglich zum nächsten Schlachtfeld zu gelangen. Zum Glück umspannte die Heerstraße die in einem Talkessel liegende Gemarkung Severus in weitem Bogen, sodass die Truppen die kleine, im Talkessel liegende Ansiedlung Severus meist unbeachtet seitlich liegen ließen. Gleichwohl häuften sich in den letzten Jahren Übergriffe auf die Bevölkerung und ausgemergelte, aber schwer bewaffnete Kerle versorgten sich ungefragt mit Nahrung oder befriedigten gewalttätig ihre vernachlässigten männlichen Gelüste. Somit war es nur verständlich, dass die Menschen in Severus nach Schutz riefen und den Weg, der über die Steinbrücke durch die Schlucht führte, vorzogen.
Eigentlich müsste Antonius bald mit Kruzi und Fix zurückkehren!, dachte Arthur und stellte beim Betrachten der Brücke fest, dass die Ränder des Brückenbogens bereits schon wieder aussahen wie ein Stück Käse, an dem sich eine Maus gelabt hatte.
Kruzi und Fix? Was im ersten Moment respektlos klang und so gar nicht in die Zeit von tiefem Glauben und Aberglauben zu passen scheint, hat einen banalen Grund: Offiziell hießen die Tiere Kain und Abel, wie das verfeindete Brüderpaar aus der Bibel. Als seine Stute trächtig war, erwartete Arthur zunächst nur ein Fohlen – und dieses wollte er Kain nennen. Und dann sollte das nächste Tier ein ‚Abel‘ werden. Doch Mutter Natur hatte andere Pläne und schickte beide Tiere als Zwillingsfohlen zur Welt. Kein Wunder also, dass dem ansonsten so gottesfürchtigen Arthur ein „Kruzifix!“ über die Lippen kam. Und als die tierischen Zwillinge sich von Anfang an ständig gegenseitig neckten oder störrisch zeigten, war es Antonius gewesen, der den beiden ob der immer häufiger verwendeten Flüche ihre inoffiziellen Namen verpasste. Und die Vierbeiner, mittlerweile zu mächtigen Gäulen herangewachsenen, schienen die neuen Bezeichnungen zu akzeptieren. So reagierten sie selbst dann, wenn irgendjemand einfach nur entsprechend fluchte, indem sie abrupt stehen blieben, die Augen weit aufrissen und die Ohrenpaare wie Fähnchen im Wind ausrichteten. Antonius liebte die Rösser, die sich zu zuverlässigen Lastentieren entwickelt hatten. Mindestens zweimal pro Woche brach er mit ihnen zum herrschaftlichen Gehöft von Dagoberth Näher auf, das unmittelbar am anderen Ende der Holzbachschlucht lag. Dort lieferte er fein- oder grobgemahlenes Mehl und Schrot ab. Dieses Gemahlene nebst weiteren Hofprodukten wie Käse und Trocken- oder gar Pökelfleisch wurde anschließend von Näher Senior persönlich und seinem Hauptknecht Gregor mit einem großen Ochsengespann zur Waldkreuzung bei Seckaha transportiert, wo es entweder weiterverkauft oder gegen andere Gegenstände eingetauscht wurde. In der Regel erstand Näher dort auch wieder günstiges Getreide, das Antonius dann wiederum bei einer der nächsten Lieferungen zur Lexemühle mitnahm, um es schnellstmöglich und vor allem gemahlen zwecks Weiterverkaufs wieder zum Hof der Nähers zurückzubringen. Seit Jahren arbeiteten Dagoberth Näher und der Lexemüller Arthur eng zusammen.
Näher wusste die Dienste und die Qualität des Müllers durchaus zu schätzen, was er nicht selten in kleineren Aufmerksamkeiten ausdrückte; insbesondere im Frühjahr, wenn er, solange der Frost noch im Boden steckte, gleich mehrere Schweine und Rinder schlachten ließ. Natürlich bot er einen ordentlichen Teil der Würste und Schinken sowie des Specks und Rauchfleisches an der Waldkreuzung feil. Doch genauso behielt er einen großen Anteil dieser Leckereien für seine Familie, Gäste und Geschäftspartner zurück, zu denen seit Jahren auch der Lexemüller gehörte.
Arthur musste gerade an die vielen Köstlichkeiten denken, mit denen Näher ihn und seine Familie bereits bedacht hatte, das Wasser lief ihm mittlerweile im Mund zusammen, als ihn eine schrille Stimme aus seinen Wunschvorstellungen riss.
„Vater! Vater!“ Ungläubig hob Arthur seine buschigen Augenbrauen. Der Qualm aus seiner Pfeife umnebelte seinen Kopf und brannte für einen Moment in seinen Augen. War das nicht gerade die Stimme seines Sohnes Antonius gewesen?
„Vater, so eilt mir doch bitte zur Hilfe!“ Antonius schrie erneut, als er die Brücke erreichte und seinen Vater vor dem Schuppen sitzen sah. Dieser blickte ungläubig drein, als er seinen Jüngsten bemerkte, wie er ihm wild gestikulierend entgegenkam. Er runzelte die Stirn. Augenscheinlich schien ihm nichts zu fehlen. Auch die beiden Kaltblüter waren wohlauf und zudem ordentlich mit Säcken bepackt. Das wiederum bedeutete Arbeit – und Arbeit sicherte ihr Einund Auskommen.
„Vater! Kommt doch! Oh, kommt doch!“ Arthur erhob sich und ging seinem Sohn gemächlichen Schrittes entgegen, da er augenscheinlich keine Notwendigkeit sah, sich zu beeilen. Erst nach wenigen Metern bemerkte er, dass irgendetwas nicht stimmte; einmal abgesehen von Antonius’ flehendem Blick.
Hinter den bepackten Kaltblütern trabte ein weiteres Pferd. Bereits aus der Entfernung konnte Arthur erkennen, dass es sich nicht einfach um irgendein Ross handelte, sondern dass es eins der edleren Sorte zu sein schien. In seinem Leben hatte er noch nicht viele dieser Art gesehen, zumal ein solches Leichtgewicht mit Sicherheit nicht für die Feldarbeit geeignet war. Sie waren nicht dazu gedacht, Lasten zu tragen, geschweige denn schwere Wagen oder gar einen Pflug hinter sich herzuziehen. Dieses Tier dort, das grazil und leichtfüßig hinter seinen mächtigen Gäulen trabte, hatte eine gänzlich andere Bestimmung. Entweder handelte es sich um eines dieser Kurierpferde, die Adel oder Klerus sich hielten, um Nachrichten möglichst schnell von einem zu einem anderen Ort zu befördern. Oder aber dieses zarte, allerdings mit einem Stockmaß von mindestens einem Kopf über Arthurs Körper groß gewachsene Tier, trug normalerweise einen edlen Reiter auf seinem Rücken.
Der Müller kam näher und rief seinem Sohn zu: „Antonius, mein Sohn, wo kommst du denn mit diesem edlen Geschöpf her? Stammt es von einem edlen Kaufmann, der bei den Nähers nächtigt? Wie ich sehe, humpelt es ein wenig. Soll dein Bruder sich die Hufe anschauen?“ Doch noch ehe Antonius mit einer Antwort aufwarten konnte, sah Arthur plötzlich etwas, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die wohltuende Wärme der Steine, die seinem Rücken und Steiß noch immer schmeichelte, wich einem abrupten Frösteln. Tatsächlich trug das fremde Pferd einen leblos scheinenden Körper auf dem Rücken. Wie einer der schweren Getreidesäcke, die von Kruzi und Fix rechts und links herunterhingen und bei jedem Schritt kurz wippten, so schlenkerten die Arme und Beine dieses armseligen Menschen mit jeder Bewegung seines Pferdes.
„Vater, er lag plötzlich vor mir rücklings im Bach! Beinahe, wenn Kruzi nicht gescheut hätte, wäre ich an ihm vorbeigegangen. Durch seinen dunkelbraunen Leinenmantel hob er sich kaum vom Erdboden ab. Auch sein Pferd habe ich erst später hinter einer Felsengruppe stehen sehen!“
„Wo hast du den Menschen denn gefunden? Lebt er überhaupt noch? Nicht dass wir nachher noch Scherereien bekommen und man uns vorwirft, wir hätten etwas mit seinem Unglück oder gar Tod zu tun!“ Arthur war ganz aufgeregt und nahm die Zügel des scheuenden Rappen. Er hielt sie ganz fest, um zu vermeiden, dass dieser stieg und seinen wehrlosen Herrn abwarf.
„Seid beruhigt, als ich ihn fand, atmete er noch. Allerdings ist er die ganze Zeit ohne Bewusstsein gewesen. Er lag auf der Höhe des Steinbruchs. Ihr wisst, ungefähr dort, wo wir im letzten Jahr die Steine für unsere Scheune und die Brücke herausgebrochen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er gestürzt ist. Der Waldboden war an dieser Ecke relativ trocken und stabil. Vielleicht hat ein Tier das Pferd erschreckt. Es kann auch sein, dass der Reiter einfach vor Müdigkeit aus dem Sattel gefallen ist. Als ich gegen Mittag den Hof der Nähers erreichte, begegnete mir dieser Herr. Ich hob meine Hand zum Gruß und dachte noch bei mir, was für eine sonderbare Gestalt!“
„Wie meinst du das?“, hakte Arthur nach, während er sich den Mann etwas näher anschaute; tatsächlich konnte er ein leichtes Schnaufen vernehmen. Er lebt! Erleichtert atmete auch der Müller durch und bedeutete seinem Sohn, dass sie sich beeilen sollten, zur Mühle zu kommen, denn die Sonne verschwand allmählich mit rötlichem Schein hinter dem Ziegenberg und hüllte nach und nach die Landschaft in das graue Tuch der Dunkelheit.
„Also, als mir der Herr auf seinem edlen Ross begegnete, dachte ich zunächst, es wäre einer dieser Mönchskuriere. Ihr wisst, wir haben solche ja schon des Öfteren an unserer Mühle vorbeihetzen sehen. Doch dieser Reiter kam gemächlich näher. So konnte ich auch seine, für einen Mönch ungewöhnlich dunkle, sonnengegerbte Haut sehen. Also wir sehen ja schon, wenn wir im Sommer tagtäglich draußen unter der gleißenden Sonne arbeiten, so braun aus wie die Haselnüsse, doch dieser Mann sah aus, als sei er der Höllenglut entstiegen. Seine Bräune hat mit unserer Sommerfärbung nichts zu tun; einmal davon abgesehen, dass wir gerade erst den Winter hinter uns lassen. Ich muss gestehen, ich erschrak, als ich ihn sah. Unwillkürlich dachte ich, der Leibhaftige würde mir begegnen. Seht selbst, Vater. Sein zotteliger Bart sieht wüster aus, als der des dümmsten Ziegenbocks vom Geißen-Jupp.“ Arthur ging in die Knie und besah sich das regungslose Gesicht des Mannes. Sein Sohn hatte Recht, er sah sehr ungepflegt aus. Aber er atmete und das war ihm wichtig.
„Als er dann schließlich zu mir aufschloss“, setzte Antonius fort, „da löste er seine rechte Hand vom Zügel. Bei erhobenem Daumen richtete er seinen Zeigefinger auf mich und zeichnete ein kleines, aber gut zu erkennendes Kreuz in die Luft. Ich bekreuzigte mich ebenfalls und neigte meinen Kopf. Als ich wieder aufblickte, sah er mich mit einem milden Lächeln an. Doch dann blitzte plötzlich etwas Silbernes unter seinem Mantel hervor. Ich zuckte zusammen. Schließlich war ich gerade zu der Überzeugung gekommen, dass ich dort einem Geistlichen begegnete. Doch das, was ich dann sah, war eine Waffe – und was für eine! Das Heft des Schwerts glänzte wie das polierte Silber der Liturgiegefäße im Kloster. Die Verzierungen am Klingenschutz waren äußerst aufwändig. Nie zuvor habe ich eine schönere Arbeit gesehen. Wenn Albert das Teil sieht, wird er ausrasten und sicher nicht glauben können, was ein guter Waffenschmied alles aus Feuer und Eisen herstellen kann. Seht, es ist …“ Antonius wollte seinem Vater das Prachtstück von Schwert zeigen, als er feststellen musste, dass es nicht da war. „Verdammt! Ich glaube, er hat es beim Sturz verloren. Als ich ihn auf das Pferd gewuchtet habe …“
„Wie ist dir das gelungen? Schließlich bist du … nun, bei deinem Bruder könnte ich mir das noch vorstellen, aber im Vergleich zu ihm bist du doch ein wenig schmaler!“ Antonius rollte die Augen. Der ständige Vergleich, dass sein älterer Bruder und er in der Statur so unterschiedlich waren, nervte ihn. „Dafür bin ich vielleicht ein wenig wendiger im Geiste!“ Arthur huschte ein Lächeln übers Gesicht und er wusste, dass sein Jüngster diesbezüglich Recht hatte. Fast entschuldigend legte er seine Hand auf dessen Schulter.
„Nun erzähl, wie ist es dir gelungen?“
„Ich habe kurzerhand seine Beine mit einem Strick zusammengebunden und über sein Pferd geführt. Das Ende des Seils band ich an Kruzis Geschirr. Während ich bei dem Bewusstlosen blieb und sein Pferd hielt, gab ich dem Gaul das Kommando: Ho-hop! Daraufhin ging er wie gewünscht behutsam nach vorne. Also so, als würden wir einen Baumstamm aus dem Wald ziehen und ob der zurückschnellenden Äste vorsichtig sein müssen. Langsam hob sich der Körper aus dem Wasser und vorsichtig zogen wir ihn über seinen Sattel. Dort habe ich ihn dann festgebunden und bin losmarschiert, ohne auf die Waffe zu achten. Also muss ich gleich morgen in der Früh noch einmal losziehen und sie suchen. Ich muss das Schwert finden, bevor ein Anderer es tut!“
Arthur war beeindruckt von seinem Sohn und lobte ihn. Sie ereichten den Mühlenhof und er rief laut nach seiner Frau. Emma hielt zunächst erschrocken auf der Türschwelle inne, kam dann aber schnell heran. Hannah und Klara folgten ihr wie zwei Küken hinter der Henne. Synchron hüpften sie über die Steine und hatten alle Mühe nicht auszurutschen. Der Lehmboden war noch immer vom vor nicht allzu langer Zeit geschmolzenen Schnee aufgeweicht. Zudem waren die zahlreichen Bachkiesel, die Arthur und Albert im Herbst als Fußsteine über den ganzen Hof verteilt hatten, nun nach dem Sonnenuntergang glitschig feucht geworden und keine wirkliche Erleichterung. Als Emma den leblosen Mann sah, schlug sie beide Hände vor den Mund und unterdrückte einen Aufschrei. Doch was ihr gelang, schaffte Klara nicht. Sie schrie schrill und hielt sich die Hände vors Gesicht. „Ist er tot? Ich habe Angst! Der sieht aus wie ein Teufel!“
Die Dämmerung ließ das arme Geschöpf, das nach dem grellen Aufschrei des Mädchens kurz zuckte und aufstöhnte, noch dunkler erscheinen, als es ohnehin schon zu sein schien. Emma beruhigte die Mädchen und bedeutete ihnen, sie sollten zurück ins Haus eilen. Sie trug ihnen auf, zwei Scheite Holz auf das immerwährend glimmende Küchenfeuer zu legen. Sie sollten Wasser in den Eisentopf füllen und diesen anschließend übers Feuer hängen. Die beiden Mädchen packten sich bei den Händen und verschwanden, wie ihnen ihre Mutter geheißen hatte.
Nun kam der schwere und auch spannende Moment: Die Person, die – das kurze Aufstöhnen hatte es bewiesen – doch noch am Leben war, musste vom Pferd genommen werden, ohne ihr dabei noch mehr Schmerz oder Schaden zuzufügen. Vom Aufschrei seiner kleinen Schwester aufgeschreckt, kam auch Albert gelaufen. Schnell ließ er sich von Antonius schildern, was dieser erlebt und vor allem, wen er im Schlepptau mitgebracht hatte. Während Antonius auf der einen Seite stand und das ordentlich zum Knoten vertäute Seil löste, nahmen Arthur und Albert den Körper auf der anderen Seite entgegen. „Wie hast du das nur geschafft, den Kerl auf das Pferd zu bekommen?“ Albert wunderte sich, schließlich war sein jüngerer Bruder nur halb so kräftig gebaut wie er. Nun taten sich selbst er und sein Vater schwer daran, den schlaffen Korpus vorsichtig auf die Erde zu bugsieren.
„Wir legen ihn heute Nacht in den Pferdestall. Dort ist es warm und wir laufen nicht Gefahr, dass er aufwacht und uns allen vielleicht etwas antut!“ Die Söhne sahen ein, dass ihr Vater Recht hatte, schließlich sah dieser Kerl, wer immer er auch war, nicht gerade vertrauenerweckend aus. Wer wusste schon, vielleicht hatte er sogar eine dieser ansteckenden Krankheiten, von denen man sich erzählte, und die ganze Ortschaften auslöschen konnten. Außerdem ließ sich der Stall von außen verschließen. Gemeinsam trugen sie ihn in den Hof hinab und legten ihn in einen ordentlichen Haufen Stroh. Albert holte schnell ein paar Jutesäcke, um ihn zuzudecken. Das Licht wurde immer spärlicher und so konnten sie kaum noch die Konturen des Mannes sehen. Eine Fackel zu holen, um den Raum ein wenig auszuleuchten, war ihnen – nach ihrem Erlebnis im Sommer des letzten Jahres, als es Albert gewesen war, der mit einer Fackel in der Hand auf einer von ihm mit den Füßen zerquetschten Ratte ausrutschte und somit die Scheune in Brand setzte – zu gefährlich.
Behutsam zogen sie dem Fremden die staubigen, aber sehr weichen, ledernen Reisestiefel aus. Der Mann schnaufte, als spürte er, dass ihm geholfen wurde. Vorsichtig lösten sie den Mantelgürtel und erkannten ein Kettenhemd, das am Nacken hervorlugte. Daraus schlossen sie, dass sein Rumpf an sich unversehrt sein musste. Augenscheinlich konnten sie auch keine äußerlichen Verletzungen an Kopf oder den Armen und Beinen erkennen, geschweige, dass irgendetwas auf Blutungen hinwies. Deshalb gingen sie etwas laienhaft davon aus, dass er somit auf jeden Fall die Nacht überleben müsste. Sie deckten ihn mit den Jutesäcken zu, schlichen nacheinander leise aus dem Stall und schoben von außen den Riegel vor. Nachdem auch Kruzi und Fix ihren neuen vierbeinigen Stallnachbarn und dessen bewusstlosen Herrn akzeptiert hatten, wurde es ruhig in der Mühle am Holzbach.
II.
LEXEMÜHLE
Natürlich hielt es keinen der Mühlenbewohner lange im Bett. Die Baumwipfel der mächtigen Buchen des Kirchhölzchens lagen noch im Dunkeln. Als Kirchhölzchen bezeichnete man den großen Kirchenwald, an dessen Rand der Holzbach entlang floss und die Lexemühle lag. Auf der einen Seite versorgte sich die Eigentümerin, also die Kirche, zum Bau und Erhalt ihrer Gebäude mit dem Holz daraus, auf der anderen Seite war es den Einwohnern Severus’ gestattet, dass sie sich an abgeschlagenen Ästen bedienen konnten und Kleingehölz zum Anfachen ihrer Feuerstellen aufklauben durften.
Neben dem Gemurmel der Mägde waren auch bereits Emma und die Mädchen in der Küche zu hören. Das Stimmengewirr der Knechte im Mühlenhof, die üblicherweise vor Sonnenaufgang bereits mit dem Füttern begannen, schien heute ein wenig lauter als sonst. Das wiederum lag daran, dass niemand den Stall betreten durfte, bevor der Müller die Erlaubnis dazu erteilt hatte. So versammelten sie sich alle im Hof. Auch die beiden Söhne der Familie standen bereits dabei und warteten darauf, dass Arthur den Stall öffnete. Natürlich wollte jeder dabei sein und einen ersten Blick auf den Fremden werfen. Ob er überhaupt noch lebt? Das Getuschel und Gemurmel war groß. Es erstarb jedoch abrupt, als Arthur aus dem Haus kam, seine Hose zurechtzog und die dicke Wolljacke zuknöpfte. Es war lausig kalt, denn der sternenklare Himmel hatte noch einmal für Frost gesorgt. Raureif zierte die Dächer und die Atemschwaden der Menschen auf dem Hof umhüllten ihre Gesichter wie weiße Wattebausche. Nun aber schienen die Sterne zu verblassen und der aufgehenden Sonne Platz zu machen, die sich mit einem rotbläulichen Morgenhimmel ankündigte.
Zur Enttäuschung aller ordnete Arthur an, dass der erste Blick in den Stall ihm und vor allem Antonius zustehen würde. Schließlich sei dieser es gewesen, der die wundersame Gestalt in der Holzbachklamm gefunden habe. Außerdem mahnte er seine Leute, dass dies nicht ein Jahrmarktspektakel sei, sondern dass es sich hierbei um ein Unterfangen handelte, dass sehr schnell äußerst gefährlich werden könnte. „So wie der Kerl aussah, kann es durchaus sein, dass es sich um einen Verbrecher handelt!“ Die Frauen schrien erschrocken auf, während die Blicke der Männer entschlossener denn zuvor waren.
Nach einem ersten zaghaften Blick durch einen Spalt schloss Arthur die Stalltür sofort wieder. Er erkannte, dass die Helligkeit nicht ausreichen würde, sich sicher umzuschauen. Aus bekannten Gründen wollte er keine Fackel verwenden. Deshalb ordnete er an, sicherheitshalber so lange zu warten, bis der Pferdestall vom Tageslicht genügend ausgeleuchtet wurde. „So können wir vermeiden, dass wir einem hinterhältigen Angriff zum Opfer fallen!“ Sie vertagten sich für eine weitere Stunde. Während die Müllerfamilie im Haus ein gemeinsames Frühstück einnahm, verrichteten die anderen ihre außerhalb des Stalls zu erledigenden Arbeiten. Eine Stunde später war es dann schließlich soweit. Sie versammelten sich erneut. Arthur ließ den beiden kräftigsten Knechten, Berthold und Kerbel, eine frisch geschärfte Axt aushändigen. Zwei weitere Männer postierten sich rechts und links der Tür mit zwei hölzernen, aber nadelspitzen Mistgabeln. Es war von großem Vorteil, dass der Stall lediglich über einen Ausgang verfügte, der zum Hof hinaus führte. Somit müsste der Fremde, sollte er sich über Nacht tatsächlich aufgerappelt haben und fliehen wollen, auf jeden Fall an ihnen vorbei. Deswegen schickte Arthur seine Töchter in das Hauptgebäude. Nur unter großem Protest räumten sie das Feld und verzogen sich samt ihrer Tante Marga und ihrer Mutter in die Küche.
Arthur selbst verzichtete auf eine Waffe, forderte aber seine beiden Söhne auf, ihm mit ihren geschärften Messern, Sonderanfertigungen von Albert, zur Seite zu stehen. Vorsichtig löste er den Metallriegel und schob erneut die schwere Holztür, die sich nach innen öffnete, auf. Warme Luft und der vertraute süßliche Geruch der Pferde, insbesondere von deren kugelförmigen und dampfenden Exkrementen, schlugen ihnen entgegen. Der einfallende goldfarbene Lichtstrahl leuchtete das provisorische Krankenlager aus. Nachdem sich die Augen an das Düstere gewöhnt hatten, erkannten sie den Unbekannten, der mittlerweile wie ein Hund im Stroh zusammengekauert lag. Vorsichtig senkte zunächst Antonius, der direkt hinter seinem Vater stand, dann auch Albert seine Waffe. Leise traten sie, ihrem Vater auf dem Fuße folgend, in den Stall.
„Herr, könnt Ihr mich hören?“ Arthur versuchte es, um ihn nicht zu erschrecken, zunächst mit leisen Tönen. Als sich nichts tat, hob er seine Stimme, doch noch immer konnten sie keine Reaktion feststellen.
Plötzlich aber drehte sich der Körper des groß gewachsenen Mannes nach links und rechts. Sein Kopf schleuderte von der einen zur anderen Seite.
„Nei-i-i-n!“ Eine gequälte Stimme entglitt dem Geschöpf, die trotz aller Mutmaßungen vom Vorabend mehr einem Menschen als dem Leibhaftigen glich. „Blut! Überall Blut! Tötet sie, sonst werden sie euch töten! Tötet sie, im Namen des Herrn! Semper victrix!“ Sein Kopf wackelte immer noch heftig hin und her. Wieder und wieder rief er seine lateinische Losung: „Immer siegreich!“ Seine Augen waren halb geöffnet. Das Weiße der Augäpfel schimmerte unheimlich hervor und wurde dadurch verstärkt, dass der Rest seines Gesichts sonnengegerbt und nahezu mit Bart und Haaren zugewachsen war. „Sie reißen euch das Herz heraus! Sie werden es essen! Lasst es nicht zu! Bruder, sei auf der Hut! Rette die Ourida!“
Plötzlich verstummte sein Gebrabbel und Geschrei – es sah aus, als sei er wieder in einen tiefen Schlaf gefallen. Schweißperlen rannen seitlich von seiner Stirn. Die Lider seiner Augen flatterten. Sie bewegten sich auf und ab, als wollte irgendetwas sie von innen mit aller Gewalt geschlossen halten.
„Er fiebert! Wir müssen ihn von seinen Kleidern befreien und die Haut untersuchen. Vielleicht hat er doch irgendwo eine Wunde davongetragen, in der sich nun der Brand festsetzt“, sprach Albert. Gemeinsam traten sie auf ihn zu und knieten vor ihm nieder. Gerade wollte Arthur versuchen, ihm den Mantel auszuziehen, als der Mann sich, wie von Geisterhand nach oben gezogen, aufsetzte, die drei Männer, die vor ihm knieten, begutachtete und sagte: „Brüder der Rose, erhebt euch! Ich danke euch, dass ihr gekommen seid, um ihr zu huldigen.“ Dann folgte ein erschreckendes und angsteinflößendes „Tötet die, die ihrer nicht wert sind! Tötet die Ungläubigen! Rettet die Ourida!“ Unvermittelt und begleitet von einem kräftigen Seufzer sackte der Leib, der eben noch so dynamisch nach vorne geschnellt war, erschlafft in sich zusammen. Die drei Helfer schauten einander skeptisch an. Unisono erklang: „Wundbrand!“
Mit vereinten Kräften setzten sie die am gestrigen Abend nur oberflächlich begonnene Untersuchung des Fremden fort. Sie begannen, den schlaffen und bewusstlos wirkenden Körper nach rechts und dann nach links zu drehen. So gelang es ihnen, ihm den braunen Leinenmantel auszuziehen. Ein weiteres Kleidungsstück kam zum Vorschein – ein Mönchshabit. Im Originalzustand schien dieser einmal weiß gewesen zu sein. Unter diesem Überwurf trug der bewusstlose Reiter ein relativ leichtes Kettenhemd mit Kapuze, das von bester Qualität zu sein schien. Albert nahm prüfend einige Maschen des Eisenkonstrukts zwischen Zeigefinger und Daumen und kam nicht umhin, das Werk in den höchsten Tönen zu loben.
Als nächstes zogen sie ihm den Reiterhandschuh aus. Diesen schien sein Träger selten abgenommen zu haben. Das erkannten sie daran, dass die Hand fast schneeweiß schimmerte, während sein Gesicht und seine andere Hand von der Sonne tief braungebrannt waren. Die Fingernägel schienen regelmäßig gepflegt worden zu sein. Alle Nägel waren gleichmäßig gestutzt – bis auf den kleinen Finger, dessen weißes Nagelende fast einen guten Zentimeter maß. Am Ringfinger prangte ein Ring aus gedrehten oder geflochtenen Goldfäden. Ein großes, ebenfalls in Gold gefasstes Siegelrelief aus einem weißgrünlichen Stein war zu sehen. Die Gravur zeigte, umrandet von Schriftzeichen, die den Mühlenbewohnern überhaupt nichts sagten, zwei bewaffnete Reiter. Jeder war mit einem Schild ausstaffiert.
„Moment mal!“, stutzte Arthur, der an seinem Augenlicht zweifelte. „Sitzen die da auf einem oder auf zwei Pferden?“ Albert nahm die Hand und zog den Ring ein wenig ins Licht. Dann bestätigte er seinem Vater, dass es sich tatsächlich nur um ein Pferd handelte. Langsam legte er die Hand wieder ab und begann gemeinsam mit Antonius, den oberen Verschluss des Kettenhemdes zu lösen. Sein Geschick für handwerkliche Dinge, die mit Eisen und dergleichen zu tun hatten, half ihm dabei. So gelang es ihnen, den engen Kragen ein wenig zu lockern.
„Vielleicht sollten wir ihm erst einmal den Umhang ausziehen!“, schlug Antonius vor, wobei sein Augenmerk immer wieder auf den vergilbten Kittel fiel. „Der ist so schmutzig, dass er, wenn wir ihn dort in die Ecke stellen, mit Sicherheit vor Dreck stehen bleibt.“ Irgendetwas störte ihn daran, doch er wusste nicht, was es war. Albert half ihm, die Gürtelschnalle zu lösen. Vorsichtig hoben sie den Kopf des Mannes und befreiten ihn von dem Überwurf. Antonius erhob sich. Als er das verschmutzte Kleidungsstück zusammenlegen wollte, erkannte er, was ihm so unterschwellig aufgefallen war. Vorsichtig drehte er den Umhang um und erspähte ein Zeichen auf der Innenseite. Dieses hatte zuvor durch den Stoff geschimmert und war nur vage auf der Brust des Reiters zu erkennen gewesen. Anscheinend trug dieser den Habit absichtlich falsch herum. Wollte er ihn vor Verschmutzung schützen oder hatte er gar etwas zu verbergen? Auf jeden Fall zeigte es ein eindeutiges Symbol: Ein achtspitziges rotes Kreuz – ein sogenanntes Tatzenkreuz. Dieses hätte sich auf der Herzseite befunden, wenn der bewusstlose Mann seinen Umhang richtig herum getragen hätte.
„Ein Kreuz. Vielleicht handelt es sich doch um einen Mönch!“, rief Antonius.
„Vielleicht sollten wir ihn ins Kloster bringen“, schlug Albert vor.
„Ein Gottesmann!“, atmete Arthur erleichtert auf. Er war froh, das christliche Symbol zu sehen. Im Stillen hatte er sich bereits ausgemalt, welch wüstes Wesen, welch grausame und exotische Kreatur sein Sohn da angeschleppt hatte und wie er seine Familie vor diesem Geschöpf beschützen könnte.
„Wartet! Ich bin mir nicht ganz sicher“, warf Antonius plötzlich ein, „aber der Gregor hat mir erzählt, als wir uns gestern über diesen mysteriösen Reiter unterhielten, dass es eine ganz bestimmte Sorte von Mönchen gibt. Nein, vielmehr seien es eher Ritter, die sich dazu berufen fühlten und es sich zur Aufgabe gemacht hätten, die vielen Pilger zu beschützen, die in das Heilige Land gehen und dort an den Orten beten, an denen Jesus gewirkt hat. Ihr kennt die Bibelgeschichten, die uns die Mönche aus Sankt Severus immer erzählen. Ja, und diese Ritter schützen nicht nur die Pilger, sondern auch die Orte vor den Ung… Ungeheuern. Gregor erzählte aber auch, dass einige Kreise innerhalb der Kirche oftmals gar nicht so gut auf diese Rittersleute zu sprechen wären. Sie seien zu mächtig geworden, oder so.“ Die anderen schauten Antonius verwundert an ob dessen Weisheiten. „So hat es der Gregor erzählt!“, verteidigte dieser sich unbewusst. „Vielleicht ist dieser Mann hier solch ein Ritter? Immerhin trug er ein Schwert bei sich, als er an mir vorbeiritt!“
„Allerdings gleicht er jetzt eher einem Bettelmönch – so abgerissen wie er aussieht!“, ergänzte Albert. Sie lachten gelöst. Das rote Kreuz und Antonius’ Theorie, die auf Gregors Wissen basierte, beruhigten sie ein wenig. Der Knecht Gregor genoss in ihren Kreisen den Ruf eines weisen Mannes. Er arbeitete und lebte seit Jahren auf dem Hof der Nähers. Dort traf und sprach er tagein tagaus zahlreiche Leute von nah und fern. Und diese erzählten ihm die interessantesten Geschichten, unglaublichsten Anekdoten und fantastischsten Mären. Ja, Gregor war bestens über die Welt da draußen, also die hinter der Handelswegkreuzung bei Seckaha, aufgeklärt.
„Ich werde noch einmal in die Schlucht aufbrechen, vielleicht finde ich das Schwert des Reiters! Und wenn ja, dann marschiere ich gleich zum Hof weiter und frage Gregor, was er von der ganzen Geschichte hält.“ Antonius hoffte auf einen relativ entspannten Tag in der Klamm, der sich zudem prima um einen nicht ganz uneigennützigen Kurzaufenthalt auf dem Näherschen Hof ergänzen ließe. Natürlich spekulierte er auch darauf, bei dieser Gelegenheit einen kurzen Blick auf Elisabeth werfen zu können.
* * *
Immer wenn Antonius auf den Hof der Nähers kam, nutzte er auch gleich die Gelegenheit, sich mit dem Hauptknecht Gregor zu unterhalten. Beide verstanden einander gut. Stets nutzten sie die Zeit des Ab- und Beladens, was Gregor auf seine Arbeiter delegieren konnte, und unterhielten sich ausgiebig. Natürlich drehte es sich bei ihren Gesprächsthemen, wie von gestandenen Mannsbildern nicht anders zu erwarten, stets ums Weibsvolk. Genauer gesagt, ging es hierbei nicht um irgendwelche Frauen, sondern beide buhlten um zwei ganz bestimmte Exemplare.
„Hast du sie noch einmal gesehen?“, war Antonius’ Standardfrage, wenn er auf Gregor traf. „Wie geht es ihr? Sah sie hübsch aus?“ Allerdings war dieser so geschickt, dass er stets nur eine Frage beantwortete und erst weitere Informationen preisgab, wenn Antonius ihm von seiner eigenen, heimlichen Herzdame berichtet hatte. Aufgeregt, wie kleine Jungen beim Froschfangen, saßen sie dann beieinander und tauschten ihre Neuigkeiten aus. Sie tuschelten und bemühten sich ihr Geheimnis, so gut es ging, zu hüten.
„Ja, ich habe sie gesehen. Sie ist gestern über den Hof gegangen. Eigentlich, wenn ich mir das genauer überlege, dann ist sie vielmehr eines Engels gleich über den selbigen geschwebt!“ Gregor war um einiges älter als Antonius und liebte es, seinen jüngeren Freund aufzuziehen. Er wusste ganz genau, wie er diesen mit vagen oder fantasiereichen Andeutungen und Auskünften so herrlich auf die Folter spannen konnte. Hibbelig wie ein Welpe hielt es Antonius dann kaum auf der Mauer aus. Meist war er so aufgeregt, dass er aufstand, im Kreis ging und sich wieder setzte. Sah sie glücklich aus? Trug sie ihr weizenblondes Haar offen über ihren Schultern? Antonius überkam stets die Angst, er könnte eine seiner Fragen vergessen. „Oder hat sie es hochgesteckt, wie es diese vornehmen Damen tun?“ Gregor hob dann stets seine Schultern.
„Du weißt, mein Lieber, jeder immer nur eine Frage! Jetzt bin ich dran.“ Gregor wusste, der Wissensdurst des Jünglings schien unerschöpflich, doch auch ihn interessierte das Wohlbefinden seiner Herzdame. Somit hatte Antonius zunächst auch Gregors Frage zu beantworten, so trivial sie ihm auch erschien. So liefen ihre Begegnungen stets gleich ab.
Gregor, mit seinen 32 Jahren ein betagter Herr, schwärmte seit Jahren für Antonius’ Tante Marga. Vor ein paar Jahren hatte er Dagoberth Näher zu einem offiziellen Besuch zur Lexemühle begleitet und lernte dort Arthurs Schwester kennen. Sie schien ungefähr so alt zu sein wie er selbst und saß während des Mittagsmahls neben ihm. Zunächst hatte er sie nur scheu aus den Augenwinkeln angesehen und konnte kaum damit umgehen, dass Marga sogleich die Gelegenheit nutzte und den sympathischen Knecht der Nähers ungeniert ansprach. Schon bald lachten und flachsten sie wie junge Leute. Seit diesem Tag war es um Gregor geschehen und er hatte sein Herz an Marga verloren.
Antonius’ Augenmerk lag hingegen auf Elisabeth – der jüngsten Tochter von Dagoberth Näher. Zwar pendelte Antonius bereits seit gut und gerne drei Jahren durch die Holzbachschlucht zum Hof der Nähers, doch erst im letzten Sommer hatte er sie das erste Mal bewusst wahrgenommen: Kruzi und Fix waren beladen worden und fertig zum Abmarsch. Antonius, der wie immer mit Gregor auf der Mauer der kleinen Steinbrücke an der Ausfahrt vom Hof saß, wollte gerade seinen Plausch beenden, als es ihn plötzlich fast in den Holzbach geworfen hätte. Nur einem Reflex folgend, konnte er sich mit Mühe an Gregors Arm festhalten. Auch dieser erschrak und sah wie der Blick seines jungen Freundes auf dem kleinen Balkon des Haupthauses verharrte.
Das mächtige Herrenhaus des Nähers stand unmittelbar am Holzbach. Neben den Öffnungen der Küche im unteren Geschoss, befand sich an der oberen Etage dieses zweistöckigen Steinhauses ein Holzbalkon – dieser ragte über den Bach hinaus. Eigentlich war er dazu gedacht, dass man den großen Raum im zweiten Stock bei Feierlichkeiten, die der Hofherr regelmäßig für wohlhabende Kaufleute abhielt, mit warmem Essen versorgen konnte. Sobald die Reden geschwungen waren und Trinksprüche ausgerufen wurden, galt dies als Zeichen für die Küchenmamsell Bertha, die Platten mit dem Braten und Gemüse auf das große Tablett zu legen. An diesem waren vier Seile befestigt, die sich in einen einzigen Strick verwoben. Dieser wiederum wurde von einem der Knechte per Flaschenzug zügig nach oben gezogen. Auf dem Balkon stand dann stets ein weiterer Bediensteter, der die Speisen entgegennahm und in das mit feinen Holzbohlen vertäfelte und mit Jagdtrophäen übersäte Zimmer trug. Eines Tages sah Antonius dabei zu, wie ein ganzes Wildschwein nach oben gehievt wurde. Dieses war nachmittags im Wald erlegt, waidmännisch aufgebrochen und anschließend sofort auf der offenen Feuerstelle in der Hofküche gegrillt worden.
Doch an einem ganz normalen Tag, wie es damals im Sommer einer gewesen war, stand plötzlich einer Heiligen gleich – wenngleich Antonius nicht genau wusste, wie eine Heilige eigentlich auszusehen hatte – die Tochter des Hofherrn auf dem Balkon. Sie stand da und bürstete ihr langes rotblondes Haar mit einem Kamm aus Horn. Gregor, dem Antonius’ Erregung nicht unbemerkt geblieben war, musste damals grinsen. Er ahnte, dass für künftigen Gesprächsstoff gesorgt war. Und er sollte Recht behalten. Fortan war es um Antonius geschehen.
* * *
So war es kein Wunder, dass sein Vater flugs den zweiten Grund für das freiwillige Vorhaben seines Sohnes entlarvte. Sogleich machte er ihm einen Strich durch die Rechnung – zumindest was den entspannenden Aspekt seines Tages betraf.
„Nun, wenn du eh außerhalb der Reihe zum Hof aufbrichst, dann kannst du gleich ein paar Säcke mitnehmen. Außerdem trifft sich das gut, so kann ich dir noch etwas von unserem feinsten Mehl mitgeben, dass du vielleicht gegen ein wenig von dem besseren Speck eintauschen kannst – bei deinen hervorragenden Beziehungen dürfte das für dich ja kein Problem sein!“ Arthur grinste. Schon seit geraumer Zeit wusste er, dass sein Sohn ein Auge auf die Tochter des Hauses geworfen hatte. Antonius kniff die Augen zusammen und ahnte, dass sein Vater ihn durchschaute. „Es wäre nicht schlecht, wenn wir unserem Gast – nur für den Fall, dass er die nächsten Tage noch unter uns weilt und sich wirklich als Ehrenmann erweist, etwas Gescheites anbieten können!“
Arthur zwinkerte seinem jüngsten Sohn zu. Er gab ihm so zu erkennen, dass er dessen eigentlichen Beweggrund, freiwillig noch einmal zum Hof aufzubrechen, durchaus erkannt hatte, und dass er, als er von dessen guten Beziehungen sprach, diesmal nicht die Freundschaft mit Gregor meinte. Schamesröte breitete sich über Antonius’ Gesicht aus. Er fühlte sich ertappt.
* * *
„Schützt Ourida!“ Alle wurden wieder aus ihren Gedanken gerissen und sahen zu dem verletzen Reiter. „Pauperes commilitones! Ourida! Seht die Assassinen! Blut! Tod!“
„Er hat hohes Fieber. Wir müssen sehen, dass er etwas Wasser zu sich nimmt.“ Arthur sorgte sich um das Leben des Mannes, der dort hilflos und im Fieberwahn vor ihm im Stroh lag. „Jetzt, wo wir wissen, dass er kein Räuber oder gar der Teufel ist, können wir ihn nachher auch ins Haus holen. Zunächst müssen wir jedoch nach dem Grund seines Fiebers fahnden. Los, Jungs, hebt ihn an, wir ziehen ihm sein schweres Beinkleid aus – auch seinen Wams. Berthold, flitz zur Müllerin und lass dir eines meiner Nachtgewänder geben! Das werden wir ihm anschließend anziehen. Und sag dem Weibsvolk in der Küche, es soll uns ein wenig heißes Wasser bringen. Wir müssen den Körper reinigen!“ Arthur führte das Regiment. Er war der Müller und somit Herr im Haus. Antonius trug er auf, die Pferde zu beladen und sich auf den Weg zu machen.
Als sie den Fremden zur Seite drehten, um ihn völlig zu entkleiden, sahen sie den Verursacher des Fiebers – eine Fleischwunde. Diese war bereits von einem rot bis dunkelblau schimmernden Brand umgeben. Sie roch ekelhaft. Albert stellte fest, dass sie fast so penetrant stank wie die verendete und aufgedunsene Wildsau, die sie letztens im Holzbach gefunden hatten, nachdem diese wahrscheinlich einige Tage zuvor beim Saufen durch das Eis gekracht und dann jämmerlich ersoffen war.
Antonius musste würgen und drehte sich flugs um, während sein Vater und Albert die Wunde näher in Augenschein nahmen. „Na, Vater, da ist aber schon ordentlich Leben drin!“ Arthur nickte und runzelte die Stirn. Sie wussten, was sie normalerweise taten, wenn eines der Tiere sich verletzt hatte und sich die weißen Fliegenlarven schon nach wenigen Stunden an der Wunde zu schaffen gemacht hatten. Doch was sollten sie jetzt und hier tun? Konnten sie ihre altbewährte Methode anwenden?
„Was meinst du, Albert, sollen wir es riskieren? Wird er das überleben?“ Albert überlegte. Von seiner mentalen Natur war er sehr robust, ganz abgesehen von seiner kräftigen Statur, mit Oberarmen so dick wie ein Pferdebein. „Bei den Pferden haben wir bisher immer Erfolg gehabt, aber ob es auch bei einem Menschen funktioniert?“
„Assassinen! Rettet euch! Rettet die Ourida!“ Der Reiter schien völlig im Delirium und warf seinen Kopf hin und her. Der Schweiß bedeckte seinen ganzen Körper. Hier und da flossen kleine Sturzbäche über die nackte Haut. Sie wussten, sie mussten handeln, wenn sie sein Leben retten wollten. Hannah brachte den dampfenden Eimer. Während Albert hinausging, um seine Vorbereitungen zu treffen, wies Arthur zwei seiner Bediensteten an, den Bereich um die Wunde herum zu waschen. Er nahm Hannah an die Hand, die wie gebannt auf den sich windenden Körper starrte, und führte sie aus dem Stall. Antonius folgte ihnen mit den bereits von den Knechten beladenen Kruzi und Fix.
„Pass auf dich auf und sieh zu, dass du nicht allzu spät nach Hause kommst!“ Antonius versprach es. Er verabschiedete sich und küsste seine Mutter auf die Wange, die ihm ein wenig Proviant brachte. Dann drückte er der kleinen Klara, die auf der Treppe stehen blieb, einen Schmatzer auf die Stirn und machte sich auf den Weg in die Schlucht.
Derweil bereitete Albert seine Wunderwaffe in seiner kleinen Schmiede vor. Mit dieser wollte er die Wunde behandeln und vor allem den kleinen, sich in ihr labenden Viechern den Garaus machen. Arthur holte seinerseits das schärfste Messer aus seiner Werkstatt und gebot dem Rest seiner Bediensteten, die bisher nur stumm um sie herumstanden, sich an die Arbeit zu machen. „Hier gibt es nichts mehr für euch zu sehen! Seht zu, dass ihr den Mühlstein zum Laufen bringt. Antonius wird heute zusätzliche Arbeit mit nach Hause bringen. Außerdem will Ignazius nachher noch mit seinem Gespann kommen. Er sagte beim letzten Mal, dass er zig Zentner Weizen aus seinem Kornspeicher mahlen lassen muss. Also, somit habt ihr keine Zeit, hier Maulaffen feilzuhalten. Schafft was für euer täglich Brot!“ Arthur war ein strenger, aber gerechter Hofherr und seine Bediensteten wussten dies. Sofort waren alle verschwunden. Arthur ging in den Stall zurück, wo er seines schweren Amtes walten wollte. Albert folgte ihm und trug seinen rot glühenden Spieß bei sich. Sie knieten sich neben den regungslosen Körper. Vorsichtshalber kontrollierten sie, ob überhaupt noch eigenes Leben in ihm war. Dann legten sie los.
Arthur versuchte dem Fremden ein Knäuel Leinen in den Mund zu zwängen, auf das er beißen sollte, doch nachdem es ihm nicht gelang, ließ er es weg. Noch einmal tief einatmend sah er seinem Sohn fragend und entschlossen zugleich in die Augen. „Was die Medizin nicht heilt, heilt das Eisen.“ Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat! Ein Ausspruch, den einer der Gottesmänner aus dem Kloster einst sagte, als er einen verletzten Ochsen zu Albert brachte und ihn bat, die Wunde entsprechend zu behandeln.
Beherzt setzte Arthur die blanke Klinge seines Messers, das Albert ihm in diesem Winter aus einem guten Stück Eisen geschmiedet und unglaublich scharf geschliffen hatte, gute zwei Zentimeter außerhalb des Wundbrandrands an und stach hinein. Die Haut sprang auf wie die Pelle einer gekochten Wurst. Das rosafarbene Fleisch, das zum Vorschein kam, schien gesund. Blut quoll hervor und rann an der Leiste des Verwundeten hinab. Zögernd schaute er den Bewusstlosen an, doch dieser schien die Operationshandlung nicht zur Kenntnis zu nehmen. Arthur drückte die Klinge tiefer und zog sie kreisförmig um die Wunde herum. Im befallenen Fleisch wimmelte und wuselte es. Die wurmartigen Schmarotzer ahnten anscheinend, dass es ihnen an den Kragen gehen sollte. Langsam löste Arthur das kranke Fleisch heraus – es stank barbarisch. Gleichwohl wunderte er sich, dass seine Handlung sich nicht viel von der Behandlung eines seiner Tiere unterschied. Als er den letzten Rest des verseuchten Gewebes herausgetrennt hatte, stand er auf, trat einen Schritt zurück und überließ Albert das weitere Vorgehen. Dieser sah Arthur fragend an, erkannte aber dessen Zustimmung, unterstützt durch ein leichtes Kopfnicken. Albert kniete nieder und flüsterte: „Der Herr stehe dir bei!“ Was Eisen nicht heilt, heilt das Feuer.
Gezielt und durch den Einsatz beim Vieh geübt, setzte er das rot glühende Eisen an. Es zischte. Dampf stieg auf. Ein Schmorgeräusch war zu hören. Geruch von verbranntem Fleisch breitete sich aus. Albert drehte die Stange einmal komplett an den Wundrändern entlang, bevor er es zum Schluss kurz in der Mitte einsetzte. Er war gerade fertig, als ein markiger Schrei ihm durch die eigenen Knochen fuhr. Der zuvor leblos daliegende Körper wurde in Sekundenschnelle aufgewuchtet. Die Augen des soeben noch bewusstlos scheinenden Mannes waren so weit aufgerissen, dass sie den Mühlsteinen im Keller Konkurrenz machen konnten. Die Hand mit dem Siegelring schnellte nach vorne, packte zielsicher Alberts Hals und drückte zu. Alberts Augen weiteten sich und traten hervor. Ehe er sich’s versah, verlor er die Besinnung und sackte zusammen wie ein nasser Jutesack. „Mich häutet ihr nicht! Semper victrix!“, rief der Angreifer, bevor auch er mit verdrehten Augen in sich zusammenfiel. Albert hustete und kam langsam wieder zu sich. „Ist er tot, Vater?“ Arthur beugte sich vorsichtig, um nicht auch zum Opfer zu werden, über das Gesicht des Mannes und schüttelte den Kopf.
„Ich denke, er wird jetzt erst einmal schlafen! Los, wir ziehen ihm mein Schlafgewand an und dann sollen Berthold und Kerbel ihn in die Gästekammer bringen.“ Dieses Zimmer hatte den Vorteil, dass die steinerne Rückseite der Küchenfeuerstelle sich in ihr befand, wodurch diese Stube gerade im Winter eine angenehme Grundtemperatur hielt.
Die beiden Knechte packten den teilnahmslosen Patienten an seinen Armen und Beinen und trugen ihn ohne Mühe ins Haus. Gerade hatten sie ihn auf die Pritsche abgelegt und Emma hatte ein Schafsfell und Decken über ihn gebreitet, als draußen im Hof Pferdegetrappel zu hören war. Schnell zog sie die Tür der Kammer zu und schickte die kräftigen Knechte auf den Hof. Sie selbst blieb, wie sie es mit ihrem Mann vereinbart hatte, mit den Kindern und ihrer Schwägerin Marga im Haus. Schließlich wusste man nie, wer draußen auftauchte und es wäre töricht gewesen, wenn die Frauen des Hauses einfach auf den Hof eilten.
Arthur, der soeben den Stall aufgeräumt und das Pferd des Fremden abgerieben und gefüttert hatte, schloss ebenfalls sicherheitshalber die Tür hinter sich. Er wusste nicht, warum er so geheimnisvoll tat, aber seine innere Stimme riet ihm dazu.
„Seid gegrüßt, Müller Arthur! Der Herr sei mit dir und den deinen!“
„Der Herr sei auch mit Euch, Hochwürden!“ Arthur wusste, dass dies nicht die richtige Anrede war, aber immerhin hatte sich Ignazius, der Verwalter des Klosters Sankt Severus, noch nie über diese Bezeichnung beschwert. Ein- bis zweimal in der Woche kam er hinaus zur Mühle geritten, begleitet von einem von zwei mächtigen rabenschwarzen Ochsen gezogenen Wagen, auf dem stets zig prallgefüllte Säcke mit Getreide lagen. Mal Gerste, mal Hafer oder – wie heute – auch einmal Weizen.
* * *