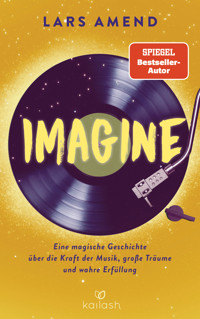16,99 €
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur Balance eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Abschied und Neuanfang – wie wir aus Krisen Kraft schöpfen können Nachdem Bestsellerautor Lars Amend in seinen Zwanzigern das Leben eines Rockstars führte, voller Ruhm und mit den ganz Großen der Musikszene, fand er Ruhe und Erfüllung im Familienleben. Doch diese neue Geborgenheit wird jäh erschüttert, als Lars vor einer seiner härtesten Prüfungen steht: der Krankheit und dem Tod seiner Mutter. Durch diese persönlichste aller Erfahrungen reflektiert er, was im Leben tatsächlich Bedeutung hat und teilt seine Einsichten in einem Buch, das nicht nur berührt, sondern auch inspiriert. Der größte Erfolg im Leben ist, bei sich selbst anzukommen Lars' Erkenntnis: Das Leben – mit all seinen Licht- und Schattenseiten– bietet immer die Gelegenheit, in allem einen Sinn zu sehen und in uns selbst ein Zuhause zu finden. Coming Home ist das bisher persönlichste Buch des Autors und zugleich eine Einladung, das Leben trotz seiner Unwägbarkeiten anzunehmen und die eigene Bestimmung zu finden. Lars zeigt, dass es völlig in Ordnung ist, zu straucheln, zu zweifeln und zu hoffen. Denn es sind gerade diese Momente, die uns letztendlich zu uns selbst führen und uns erkennen lassen, wo unser wahres Zuhause liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lars Amend
Coming Home
Finde deine Bestimmung und erkenne, was im Leben wirklich zählt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Abschied und Neuanfang – wie wir aus Krisen Kraft schöpfen können
Nachdem Bestsellerautor Lars Amend in seinen Zwanzigern das Leben eines Rockstars führte, voller Ruhm und mit den ganz Großen der Musikszene, fand er Ruhe und Erfüllung im Familienleben. Doch diese neue Geborgenheit wird jäh erschüttert, als Lars vor einer seiner härtesten Prüfungen steht: der Krankheit und dem Tod seiner Mutter. Durch diese persönlichste aller Erfahrungen reflektiert er, was im Leben tatsächlich Bedeutung hat und teilt seine Einsichten in einem Buch, das nicht nur berührt, sondern auch inspiriert.
Der größte Erfolg im Leben ist, bei sich selbst anzukommen
Lars’ Erkenntnis: Das Leben – mit all seinen Licht- und Schattenseiten – bietet immer die Gelegenheit, in allem einen Sinn zu sehen und in uns selbst ein Zuhause zu finden. Coming Home ist das bisher persönlichste Buch des Autors und zugleich eine Einladung, das Leben trotz seiner Unwägbarkeiten anzunehmen und die eigene Bestimmung zu finden. Lars zeigt, dass es völlig in Ordnung ist, zu straucheln, zu zweifeln und zu hoffen. Denn es sind gerade diese Momente, die uns letztendlich zu uns selbst führen und uns erkennen lassen, wo unser wahres Zuhause liegt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Vorwort
1. Die alte Frau und das Herz
2. Der Regenwurm
3. Wie war’s im Paradies?
4. Die Meisterin der Verdrängung
5. Der Moment des Loslassens
6. Der letzte Atemzug
7. Die Stunden danach
8. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber …
9. Würdest du dein Leben darauf verwetten?
10. Jeder Mensch bringt eine Geschichte mit
11 Und was, wenn du gar nicht kaputt bist?
12. Ein neuer Tag
13. Deine Bestimmung
14. Stille
15. Die Insel der Götter
16. Der eigene Weg
17. Was ist dein Skateboard?
18. Orientierung
1. Folge der Freude, nicht dem Geld
2. Suche Liebe, nicht Verliebtheit
3. Mache Dankbarkeit zu deinem Lebensmotto
4. Sei ehrlich zu dir
5. Strebe finanzielle Unabhängigkeit an
6. Bleib am Ball
7. Hör niemals auf zu träumen
8. Glaube an dich (du weißt nie, wer morgen anruft)
9. Achte auf dein Wachstum
10. Folge deinem inneren Kompass
19. Besteht die Möglichkeit?
20. Was mache ich jetzt aus meinem Leben?
21. Tutto Passa – alles vergeht
Sechs Monate später … 22. Eine Botschaft aus der Zukunft
Danksagung
Zehn Fragen, die dein Leben verändern können
»Für meine Tochter.«
»Der größte Erfolg im Leben ist, gern nach Hause zu kommen.«
Lars Amend
Vorwort
Ich hatte nicht die Absicht, noch ein Buch zu schreiben. Nicht jetzt. Nicht so schnell. Ich wollte erst noch ein bisschen von diesem Leben inhalieren, mehr lieben, mehr lernen, mehr geben, mehr empfangen, ein bisschen mehr scheitern, mehr verstehen. Ich wollte durch die Augen eines kleinen Kindes meine erwachsene Welt wieder neu entdecken und ein bisschen mehr von dieser ganz besonderen Magie in mein Leben ziehen.
Aber dann ist etwas passiert, was genau diese Welt ins Wanken gebracht hat. Davon erzähle ich dir auf den kommenden Seiten. In der Hoffnung, dass meine Worte dein Herz berühren und dort eine Spur von Erkenntnis, Liebe und Leichtigkeit hinterlassen. In der Hoffnung, dass sie dir in schwierigen Zeiten Trost, Ruhe und Kraft schenken und vielleicht sogar ein bisschen von diesem Seelenfrieden bringen, nach dem so viele von uns so sehnsüchtig suchen. In der Hoffnung, dass du dich am Ende an deine wahre Bestimmung erinnerst und erkennst, wer du tatsächlich bist, welches göttliche Potenzial in dir steckt und was wirklich im Leben zählt. Auch wenn du es nicht weißt, aber du sitzt mir in diesem Augenblick gegenüber und hörst mir zu. Während ich diese Worte schreibe, spreche ich zu dir. Ich brauche dich für dieses Buch, denn ohne dich geht es nicht. Ich erzähle dir hier meine Geschichte, teile meine tiefsten und wahrhaftigsten Gedanken. Danke, dass du mir durch diese Zeit hilfst, und danke für dein Vertrauen, dass auch ich dir helfen darf. Denn die Luft, die ich ausatme, ist die Luft, die du einatmest. Dieses Buch ist für uns.
In tiefer Verbundenheit,
Dein Lars
1.Die alte Frau und das Herz
»All das erschien nie wirklich real, nie zum Greifen nah.
Wie in einem Traum, nur dass es keiner war.«
Lars Amend
»Lass mich dir eine Geschichte erzählen, okay?«
Der kleine Junge nickte.
»Es ist die Geschichte von einem alten Herzen mit vielen Narben.«
Der kleine Junge sah mich verwirrt an und fragte: »Ist es eine schöne oder eine traurige Geschichte?«
»Beides, sie ist traurig und schön«, antwortete ich.
»Okay, dann darfst du sie erzählen«, sagte der kleine Junge. »Nur traurig wäre mir zu traurig gewesen.«
Ich lächelte kurz und begann zu erzählen.
»Die Geschichte vom alten Herzen mit den vielen Narben spielte sich vor vielen Jahren in einem malerischen Fischerdorf ab. Auf der einen Seite war das Meer, auf der anderen Seite die Berge. Die Götter nannten diesen Ort »Paradies auf Erden«. Genau dort, mitten im Paradies stand nun ein junger Mann auf dem Marktplatz und gab lautstark damit an, das schönste Herz weit und breit zu besitzen. Es dauerte nicht lange, bis sich eine riesige Menschenmenge um ihn versammelt hatte. Die Menschen aus dem Dorf waren neugierig geworden und wollten natürlich das Herz des jungen Mannes bewundern. Sie applaudierten ihm sogar, denn sein Herz war tatsächlich makellos, ohne auch nur einen einzigen Kratzer oder Riss. Dieses Herz war schlicht perfekt.«
»Darf ich dich was fragen?«, unterbrach mich der kleine Junge.
»Natürlich«, sagte ich.
»Wie konnten die Menschen sein Herz sehen?«, fragte er neugierig. »So etwas geht doch gar nicht. Kannst du denn mein Herz sehen?«
»Stell es dir einfach vor«, lächelte ich sanft. »Wie in einem Märchen, wie bei Cinderella oder bei Sterntaler.«
Der kleine Junge nickte und hörte wieder zu.
»Also, der junge Mann mit dem perfekten Herzen war groß und schön, hatte kräftiges kastanienbraunes Haar und lehnte lässig an einem Brunnen, der mitten auf dem Marktplatz stand. In den ersten Reihen der Menschentraube drängten sich die hübschen Mädchen des Dorfes, um ihn anzuhimmeln. Er trug weiße Turnschuhe, eine blaue Hose und hatte sein weißes Hemd weit aufgeknöpft, sodass alle sein schönes Herz bewundern konnten, das golden im Abendlicht leuchtete.
Doch dann ertönte aus der letzten Reihe plötzlich eine Stimme: ›Dein Herz ist nicht ansatzweise so schön wie meines!‹
Eine alte Frau hatte sich den Weg durch die Menge gebahnt, und alle fragten sich: Wie kann das Herz dieser alten Frau schöner sein als das des hübschen starken Jungen? Nun, die alte Frau ließ ihren langen Mantel zu Boden fallen und präsentierte voller Stolz ihr altes Herz. Es schlug noch immer kräftig, was jeder deutlich sehen konnte, aber es war übersät mit Narben. An einigen Stellen waren sogar Stücke herausgenommen und provisorisch ersetzt worden, aber irgendwie passte nichts richtig zusammen. Und so sah das alte Herz gar nicht mehr wie ein Herz aus, sondern viel mehr wie ein klumpiges Durcheinander.
Der junge Mann betrachtete das zusammengeflickte Herz und begann laut zu lachen.
›Bei allem Respekt, alte Frau, du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Du traust dich, dein verschrumpeltes Herz mit meinem Traumherzen zu vergleichen? Meins ist perfekt, und deines ist voller vernarbter Risse.‹
Die Menschen aus dem Dorf traten dichter an die alte Frau heran, begutachteten ihr Herz und stimmten dem Jungen einhellig zu. Ihr Herz war wirklich nicht besonders schön anzusehen.
›Ja‹, begann die alte Frau und zeigte mit dem Finger auf den Jungen. ›Dein Herz sieht makellos aus, wie aus dem Lehrbuch, und trotzdem würde ich niemals mit dir tauschen wollen.‹ Der Junge sah sie überrascht an. Die Alte lächelte weise und klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. ›Weißt du, mein Junge, jede Narbe auf meinem Herzen steht für einen Menschen, dem ich im Laufe meines Lebens meine Liebe geschenkt habe. Immer mal wieder brach ich ein Stück aus meinem Herzen für jemand anderen heraus, und oft schenkten mir die Menschen auch ein Stück ihres Herzens. Natürlich waren die Stücke nie gleich groß, weswegen überall diese Kanten herausragen.‹ Die alte Frau zeigte auf die vielen Unebenheiten ihres Herzens.
Das ganze Dorf starrte sie schweigend und staunend an, und ihr Herz wurde plötzlich, von Wort zu Wort, das die alte Frau sagte, immer interessanter und auch schöner.
›Manchmal‹, erzählte sie weiter, ›habe ich auch ein Stück meines Herzens weggegeben, ohne dass ich etwas zurückbekam. Deshalb die vielen Furchen. Liebe zu geben, bedeutet immer, ein Risiko einzugehen. Und obwohl all diese Krater und Narben furchtbar schmerzen, so erinnern sie mich jeden Tag an die Liebe, die ich noch immer für diese Menschen verspüre, und vielleicht, ja, ganz vielleicht, kommen sie eines Tages zu mir zurück und füllen die leeren Stellen in meinem Herzen doch noch mit ihrer Liebe aus.‹
Sie legte ihren Arm um die Schulter des Jungen und sagte: ›Verstehst du jetzt, was echte Schönheit bedeutet?‹
Der junge Mann war so gerührt, dass ihm Tränen über seine Wangen liefen. Ohne darüber nachzudenken, griff er in sein wunderschönes Herz, brach ein Stück heraus und überreichte es der alten Frau. Die nahm es dankend an, suchte eine geeignete Stelle dafür in ihrer Brust, brach ebenfalls ein Stück aus ihrem Herzen heraus und verschloss damit die frische Wunde im Herzen des Jungen, das nun nicht mehr perfekt, aber schöner war denn je. Und zum ersten Mal in seinem Leben spürte der junge Mann die Liebe eines anderen Menschen durch sein Herz strömen.«
2.Der Regenwurm
»Der Preis allen Wachstums ist Schmerz. Das ist die schlechte Nachricht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Der Schmerz vergeht, und das Wachstum bleibt.«
Lars Amend
Ich öffnete meine Augen. Im Zimmer war es dunkel, aber es fiel schon graues Morgenlicht durch das Fenster. Die Tür zum Balkon stand offen. Kalt war es nicht, obwohl das Jahr gerade erst begonnen hatte. Die Stadt, die uns zu Füßen lag, erwachte allmählich. Motorengeräusche, Sirenen, Blaulicht. Ohne mich zu bewegen, blieb ich noch für einen Moment so liegen und dachte über meinen Traum mit der alten Frau und dem jungen Mann nach, den ich vor langer Zeit schon einmal geträumt hatte, aber immer noch nicht verstand. War ich dieser Junge? War die Frau meine Mutter?
Die Geschichte ergab keinen Sinn, jedenfalls nicht, wenn ich versuchte, sie auf mich zu beziehen. Vielleicht wollte ich den Traum auch gar nicht verstehen. Oder vielleicht wollte ich, konnte aber nicht. Vielleicht hätte ich sogar gekonnt, aber die Wahrheit wäre noch zu schmerzhaft gewesen. Vielleicht war mein Gedankenspeicher auch einfach nur randvoll. Und vielleicht war ich zu erschöpft für all diese Gedanken. Eine Menge Vielleichts so früh am Morgen.
Mein Körper verlangte nach einem Kaffee, aber ich wusste schon, dass die Suche danach an diesem Ort erfolglos bleiben würde. Das Café im Erdgeschoss öffnete erst in ein paar Stunden, und alle anderen Optionen, die ich in den vergangenen Tagen und Wochen schon ausprobiert hatte, waren keine. Selbst für einen Koffein-Junkie wie mich.
Ich wollte aufstehen, spürte mich aber nicht. Regungslos lag ich da, wie ein Hundert-Kilo-Sack, bei dem jegliche Anstrengung ins Leere läuft. Die vergangenen Monate hatten mich komplett ausgelaugt. Eine Zeit wie auf Drogen, wie in Zeitlupe und auf Speed zugleich. Wie in einem Film, der von Szene zu Szene das Genre wechselt. Doch im Gegensatz zur Hauptfigur, die irgendwann voller Tatendrang vom dreckigen und schmerzbehafteten Boden aufsteht, um die Welt oder zumindest sich selbst zu retten, lag ich weiter einfach da. Ich war noch nicht bereit für diesen Kampf. All das erschien nie wirklich real, nie zum Greifen nah. Wie in einem Traum, nur dass es keiner war.
Es stimmt, was sie sagen. Wenn deine Mutter stirbt, wird nie wieder etwas so sein wie zuvor. Dein altes Leben ist vorbei. Dein Herz wird gebrochen, und der Riss wird bleiben. Ganz egal, wie sehr du dich auch bemühst, ihn mit Klebstoff aus Gold zu füllen. Der Riss in deinem Herzen wird nicht mehr verschwinden.
Es gibt Erfahrungen im Leben, die uns unmittelbar in der Tiefe unseres Wesens treffen und uns mit kaum auszuhaltenden Schmerzen, auf die wir nicht vorbereitet waren, in zwei Hälften zerreißen. Wir alle wissen, dass es diese Erfahrungen gibt. Wir alle wissen, was eines Tages auf uns zukommt. Wir hören diese Geschichten in den Nachrichten, lesen über sie in den sozialen Netzwerken und sehen sie bei Freunden. Künstler schreiben Songs darüber, drehen Kinofilme, die Buchhandlungen überall auf der Welt sind voll davon. Es kann jeden von uns jederzeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Lebens treffen. Einfach so, ohne Grund und ohne Vorwarnung. Und obwohl wir das wissen, tun wir so, als hätte das Heute keine Bedeutung und der Morgen sei garantiert. »Warum ist das Glück so schwer zu fassen?«, wurde ich einmal gefragt, und ich antwortete: »Weil wir das Glück stets in der Zukunft suchen und nie in diesem Moment.«
Nie in diesem Moment. Nie in diesem Moment. Nie in diesem Moment.
War ich denn glücklich in diesem Moment? Genau hier, in diesem kargen Zimmer auf der fünften Etage? Nein, war ich nicht. Ich war alles andere als glücklich. Ich hätte nicht einmal beschreiben können, wie ich mich in all dem Gedankenchaos fühlte, aber das Wort Glück wäre ganz sicher nicht vorgekommen. Ich lag da, voller Verzweiflung, und suchte in einer ungewissen Zukunft nach Antworten auf so viele Fragen.
Die Menschheit (mich eingeschlossen) scheint bei all dem rasanten technologischen Fortschritt, auf den sie sich so unglaublich viel einbildet (mich ausgeschlossen), trotzdem kaum etwas über die wahre Essenz des Lebens gelernt zu haben. Dass nämlich genau dieses Leben schon mit deinem nächsten Wimpernschlag vorbei sein kann. Gott hat uns ein Bewusstsein gegeben. Wir wissen, dass wir existieren und dass wir, aus der Perspektive des Universums, schon sehr bald sterben werden, die Hülle des menschlichen Körpers verlassen und uns zurück in unsere Ausgangsform transformieren werden. Von Sternenstaub zu Sternenstaub. Mit diesem intellektuellen Damoklesschwert zu leben, ist mit dem bisschen Verstand, das wir haben, kaum zu ertragen, weswegen uns Gott praktischerweise alle möglichen Arten von Verdrängungsmechanismen mit in die Wundertüte des Lebens gepackt hat.
»Wenn jemand jederzeit in der Mitte auseinandergehen kann, ist nichts ganz sicher«, schrieb die finnische Autorin Tove Jansson in ihrem so unglaublich schönen Roman »Das Sommerbuch«, erschienen im Jahr 1972, sechs Jahre vor meiner Geburt, in dem sie den Tod ihrer Mutter verarbeitete.1 Wahre Worte. Nichts im Leben ist einfach, wenn man jeden Moment zerbrechen kann. Die Geschichte handelt von drei Menschen auf einer winzigen Insel im Finnischen Meerbusen: von Sophia, ihrem Vater und ihrer Großmutter. Es ist ein Buch vor allem über eine Freundschaft zwischen einer sehr alten Frau und einem kleinen Mädchen. Die beiden streifen auf ihrer Insel umher, plaudern, lachen, weinen, streiten, stellen Fragen, erleben hier und da kleine Abenteuer und verbringen Zeit miteinander.
Wenn ich an dieses Buch denke, denke ich automatisch an die Abenteuer vom großen Panda und dem kleinen Drachen, die ebenfalls gemeinsam durchs Leben gehen, und natürlich an ihre berühmten Dialoge.
»Was ist wichtiger«, fragt Großer Panda einmal, während die beiden Freunde durch die Gegend stromern, »der Weg oder das Ziel?«
Und Kleiner Drache sagt: »Die Gefährten.«2
Vielleicht hatte ich das Buch deswegen meiner Mutter vor einer ganzen Weile geschenkt. Damals, als sie noch nicht krank war. Als Anregung, als Inspiration, als heimlichen Wink mit dem Zaunpfahl. Ob sie es gelesen hat, weiß ich nicht. Sie hatte es in unseren Gesprächen nie mehr erwähnt, und ich hatte auch nie mehr danach gefragt. Mein Fehler. Ganz klar. Ich hätte es einfach ansprechen sollen. Ohnehin gab es so viele Fragen, die ich ihr gern noch gestellt hätte. Nichts Kompliziertes, nichts, was an irgendwelchen Schubladen in ihrem Kopf gerüttelt hätte, die seit Jahrzehnten verschlossen waren. Einfach nur Fragen direkt aus meinem Herzen, auf die ich gerne ungefiltert und direkt aus ihrem Herzen eine ehrliche Antwort bekommen hätte:
Was ist deine schönste Erinnerung an uns?
Wie war das erste Jahr der Mutterschaft für dich?
Gibt es etwas in unserer Familiengeschichte, das du geheim gehalten hast?
Was ist das Schönste, das ich je für dich getan habe?
Was wünschst du dir am meisten für deine Kinder und dein Enkelkind?
Was war das Beste und das Schlimmste am Älterwerden?
Was ist eine Sache, an die ich mich immer erinnern soll, wenn du nicht mehr da bist?
Was würdest du anders machen, wenn du dein Leben noch mal leben könntest?
Sei ganz ehrlich: Hast du dein Leben richtig gelebt?
Hast du auf deinem Lebensweg herausgefunden, wer du bist?
Hast du dich in diesem Leben geliebt gefühlt?
Was weißt du heute, was du gerne schon mit neunzehn gewusst hättest?
Welche Erfahrung hättest du in diesem Leben gerne noch gemacht?
Was wird dir am meisten fehlen?
Wie ist das so, zu wissen, dass man bald sterben wird?
Die Fragen, die sich in meinen Gedanken stapelten, nahmen kein Ende. Wie gerne hätte ich mit meiner Mutter über dieses Buch geredet, über das kleine Mädchen Sophia, das nach dem Tod ihrer Mutter mit ihrer alten Großmutter auf dieser kleinen Insel in Finnland lebt und in aller Ausführlichkeit darüber nachdenkt, wie es wohl ist, ein Regenwurm zu sein, von dem im Allgemeinen angenommen wird, dass er zwei neue Leben beginnt, sobald er von einem Spaten in zwei Hälften geteilt wird. Wie gerne hätte ich nur noch einmal mit meiner Mutter in dem kleinen Innenhof ihres Häuschens in den Weinbergen zwischen all ihren Pflanzen und Blumentöpfen gesessen, die sie so sehr geliebt hat, um ihr zu sagen: »Mama, stell dir mal kurz vor, du bist ein Wurm!«
Ich lächelte bei dem Gedanken, denn mir schoss sofort das Bild ihres Gesichtsausdruckes vor mein geistiges Auge. Sie hätte wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt und ihre Augen verdreht, lustige Geräusche gemacht und etwas gesagt wie: »Ein Wurm? Urgh, nein danke.«
»Aber Mama, überleg doch mal«, hätte ich erwidert, »was für eine Zauberkraft in dem Regenwurm steckt. Wenn der Tod bei ihm anklopft, kann er sich einfach verdoppeln und ein völlig neues Leben beginnen. Charles Darwin war nicht ohne Grund ein Fan dieser – wie er sie nannte – ›bescheidensten und unterschätztesten aller Kreaturen‹. Er betrachtete sie mit größter Bewunderung und feierte sie als ›die wahren Bildhauer der Biosphäre‹. Sie bearbeiten unsere Erde, lockern sie auf, befruchten sie. Der Regenwurm zieht seine Bahnen, und überall, wo er vorbeikommt, entsteht hinter ihm wieder neues Leben. Unerschütterlich und dem Tod trotzend, ist der Regenwurm die lebende Metapher für Regeneration, vielleicht sogar für Unsterblichkeit und die Verwandlung von Trauma in neues Leben. Jetzt stell dir also vor, du bist ein Regenwurm und ein Spaten trennt dich von all deinen Krankheiten, all den Geschwüren, all deinem Kummer und Schmerz, all dem Ballast und Müll, der sich im Laufe eines Lebens angesammelt hat, und du könntest als neugeborener Superwurm ganz neu anfangen und die Geschichte vom Rest deines Lebens ganz neu schreiben?«
Meine Mutter hätte mir bei solchen Worten natürlich sofort den Vogel gezeigt. Sie wäre aufgestanden und nach ein paar Minuten mit ihrem Tablet wieder rausgekommen, um mir analytisch korrekt zu erklären, dass zwischen meiner kindlichen Träumerei und der tatsächlichen Wissenschaft dann doch eine recht große Lücke klafft. Sie hätte mir erklärt, dass bei den meisten Regenwürmern, von denen es übrigens mehr als 1800 unterschiedliche Arten gibt, sodass man ohnehin nicht von »dem Regenwurm« sprechen könne, der Kopf vom Schwanz getrennt sei. Würde man den Regenwurm also in der Mitte durchschneiden, kann bei einigen Arten, aber bei Weitem nicht bei allen, aus der Kopfhälfte ein neuer Schwanz nachwachsen, wodurch sie weiterleben, aber die Schwanzhälfte würde auf jeden Fall absterben.
»Ist doch genau, was ich sage«, hätte ich lächelnd geantwortet. »Der Regenwurm hätte alles Schlechte in seinen Schwanz runtergedrückt, hätte sich mit dem Tod von ihm getrennt, und mit der guten Hälfte ein neues Leben begonnen.«
Nach einiger Recherche hätte meine Mutter dann trocken und ohne den Blick von ihrem Tablet abzuwenden, geantwortet: »Na gut, wenn es schon ein Wurm sein muss, dann wäre ich lieber ein Plattwurm. Das ist ein winziges wirbelloses Tier, das zum Stamm der Plathelminthes gehört und sich kolossal von den Regenwürmern unterscheidet. Wenn du also schon in Metaphern sprichst, dann bitte wissenschaftlich korrekt, denn nur der Plattwurm kann seinen gesamten Körper aus dem kleinsten abgeschnittenen Teilstück nachwachsen lassen.«
»Okay, Mama. Dann nehmen wir eben den Plattwurm. Stell dir also vor, du wärst ein Plattwurm …«
Spätestens an diesem Punkt wäre die Unterhaltung endgültig beendet gewesen. Meine Mutter hätte ihre Blumen gegossen, und ich wäre noch ein bisschen in der Sonne sitzen geblieben und hätte über dieses Bild des gespaltenen Wurms nachgedacht, das ja in Wahrheit nur ein Gedankenexperiment ist, wie wir Menschen lernen können, mit den einschneidendsten Erfahrungen unseres Lebens umzugehen. So wie die kleine Sophia es im »Sommerbuch« von Tove Jansson macht. Indem sie sich fragt, wie es für den Wurm wohl sein mag, in zwei Hälften geschnitten zu werden, und ob der Wurm während des Schnitts Schmerzen fühlt, entdeckt sie ganz nebenbei eine der elementaren Wahrheiten des Lebens: Der Preis allen Wachstums ist Schmerz. Das ist die schlechte Nachricht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Der Schmerz vergeht, und das Wachstum bleibt.
3.Wie war’s im Paradies?
»Das Leben muss nicht perfekt sein, es muss echt sein.«
Lars Amend
Es klopfte an der Tür.
»Guten Morgen. Möchten Sie Frühstück und einen Kaffee?«
Ich sprang von meinem Feldbett auf und nickte. Die Nonne lächelte und betrat fast geräuschlos das Zimmer. Es kümmerte sie nicht, dass ich nur in Boxershorts und T-Shirt vor ihr stand.
»Ich nehme mir nur den Kaffee vom Tablett, falls das okay ist«, sagte ich leise und bevor sie das Tablett auf den Tisch stellen konnte. »Das Frühstück können Sie bitte wieder mitnehmen. Danke, das ist sehr lieb von Ihnen.«
»Gerne«, nickte die Nonne. »Und wenn Sie noch mehr Kaffee möchten, sagen Sie einfach Bescheid. Ich habe gerade für die ganze Station ein paar Kannen gekocht.«
»So machen wir es«, lächelte ich.
Die Nonne stellte das Tablett dann doch kurz ab, drehte sich zu meiner Mutter und sprach ein stilles Gebet. Dann ging sie wieder.
»Danke«, rief ich schnell noch in ihre Richtung. »Und haben Sie einen schönen Tag.«
Dann war die Tür auch schon wieder zu.
Ich traute mich kaum, den Kaffee anzurühren, denn ich wusste ja bereits, wie er schmeckte. Trotzdem verrührte ich unmotiviert die beiden eckigen Zuckerwürfel und hoffte auf ein kleines Wunder. Ich nippte an dem Kaffee, der wirklich kaum den Namen verdient hatte, und fragte mich zum tausendsten Mal, warum in Krankenhäusern alles so scheußlich schmeckte. Dafür musste es doch einen Grund geben. Wollte man denn nicht, dass die Menschen schnell wieder gesund werden? Oder wie hier auf der Palliativstation, dass die Patienten, die noch essen und trinken können, am Ende ihres Lebens wenigstens noch einen winzigen Funken Lebensqualität bekommen?
Als meine Mutter noch bei Bewusstsein war, musste ich ihr immer bis ins kleinste Detail beschreiben, was ich an dem Tag alles gegessen hatte, was wir zu Hause in der letzten Zeit gekocht hatten, welche Zutaten wir verwendet hatten, und von jeder Mahlzeit, jedem Smoothie und jedem Cappuccino ein Foto schicken. Und wenn wir in einem Restaurant waren, mussten wir immer die Speisekarte abfotografieren und ihr schicken, damit sie sich in ihrer Vorstellung etwas aussuchen konnte, was sie für sich bestellt hätte. Ihr Körper konnte festes Essen nicht mehr verdauen, aber ihre Erinnerung daran funktionierte noch ausgezeichnet.
»Göttlich«, war ihr Lieblingswort, wenn es darum ging, etwas zu beschreiben, was sie lecker fand. »Hmm, köstlich. Zum Reinlegen. Einfach göttlich.«
Am Anfang ihres Aufenthaltes glaubte meine Mutter noch, das Krankenhaus irgendwann wieder verlassen zu können, aber als diese Hoffnung platzte, ging es nur noch darum, überhaupt noch einmal etwas anderes zu sehen als die kargen Wände ihres Krankenhauszimmers. Ihr großes Ziel war es bis zum Schluss, für ein letztes Mal in einem Restaurant einzukehren. Es sollte bei einem Wunsch bleiben.
In der Vorweihnachtszeit waren wir nach einem langen Besuchstag im Krankenhaus so hungrig, dass wir im gegenüberliegenden Restaurant die halbe Speisekarte bestellten. Schwäbische Maultaschensuppe, Knödel in einer Kräuterrahmsauce mit frischen Pfifferlingen, Zwiebelrostbraten mit Kartoffelstampf, gebratene Maultaschen, schwäbischer Kartoffelsalat, Käsespätzle, Apfelstrudel mit Vanilleeis – das volle Programm. Mein Bruder, meine Partnerin, meine Tochter und ich gönnten uns ein gewaltiges Festmahl, machten natürlich von jedem Teller ein Foto für meine Mutter, und ich weiß noch, wie ich dachte: »Mama liegt nur ein paar Hundert Meter von hier entfernt und würde alles dafür geben, hier mit uns am Tisch zu sitzen. Sie ist so nah, und doch ist das alles hier unerreichbar für sie. Und wir? Genießen wir dieses Essen denn wirklich? Nehmen wir den Genuss voll wahr? Sind wir ganz da? Sind wir bei all dem Leid, dem Kummer und der Sorge gleichzeitig auch voller Dankbarkeit? Erfassen wir wirklich die Bedeutung dieses Essens in seiner vollen Gänze, wofür es steht, was es symbolisiert? Oder denken wir selbst in dieser für uns alle außergewöhnlichen Situation schon wieder an die lange Rückfahrt nach Hause, daran, ob es auf der Autobahn einen Stau gibt, an die Verpflichtungen des Alltags, die schon auf uns warten, an die nächsten Projekte, die unbeantworteten E-Mails, die Bahnfahrt zurück nach Berlin, an das ewige Morgen?«
Gedankenverloren nippte ich an dem Kaffee und spuckte den Inhalt sofort in die Tasse zurück. Was hatte ich erwartet? Wunder waren an diesem Ort rar gesät. Ich nahm mein Handy vom Stromkabel und bemerkte, dass unsere Playlist die ganze Nacht lautlos durchgelaufen war. Bob Dylan, Cat Power, Lizz Wright, Moby, Norah Jones, Coldplay, Keith Jarrett, Mark Knopfler, Johnny Cash, Van Morrison. »Brown Eyed Girl« war ihr absoluter Lieblingssong. Meine Mutter hatte einen fantastischen Musikgeschmack. Auf unseren langen Autofahrten nach Südfrankreich, wo wir bis zu meinem Abitur einige Surfurlaube verbracht haben, hörten wir Mark Knopfler rauf und runter. Ein Album nach dem anderen, stundenlang. Mountainbikes, Surfbretter, das Meer, die Sonne, der Wind, französischer Vanillejoghurt, mein Skateboard, grenzenlose Freiheit. So viele schöne Erinnerungen. Ich hatte ja nie einen Alltag mit meiner Mutter. Es gab immer nur einzelne Augenblicke, Urlaube, die Wochenenden, Familienfeste, kurze Schnappschüsse, Highlights, Momentaufnahmen. Am Ende blieb uns zu wenig Zeit. Wobei, wenn ich ehrlich darüber nachdenke, dann müsste ich eher sagen: Zeit gab es schon, meine Mutter hat sie nur an anderen Orten verbracht. Auf den meisten Fotos meines Lebens fehlt sie. Die Wahrheit tut weh, weswegen wir Menschen uns Luftschlösser bauen und in einer Illusion leben, um nicht mit der Realität konfrontiert zu werden. Aber so stark man auch die Augen vor der Wahrheit verschließt, sie geht trotzdem nicht weg. Sie kommt ans Licht, ob man will oder nicht.
Ich stand auf, wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und setzte mich zu meiner Mutter ans Bett. Sie trug ein weißes T-Shirt, auf dem vorne das Wort »Dankbar« stand. Ich hatte es ihr vor einer Weile aus meinem eigenen Onlineshop mitgebracht. Eine der Krankenschwestern hatte mir verraten, dass meine Mutter unbedingt in diesem T-Shirt sterben wollte. Darauf habe sie mehrfach sehr deutlich hingewiesen. Es war ihr wichtig. Das war ihre Art zu sagen: »Mein Sohn, ich liebe dich.« Auch wenn sie es mir nie persönlich ins Gesicht sagen konnte. Ihre Botschaft kam an. Meine Mutter war so stolz auf mich. Das wusste ich, weil sie allen, die es hören und vor allem nicht hören wollten, von mir und meinem Bruder erzählte. Streng genommen erzählte sie nicht von uns, sondern von unseren beruflichen Erfolgen. Dieser Erfolg, den man vorzeigen konnte, mit dem man bei seinen Arbeitskollegen liebevoll angeben konnte, war ihr unglaublich wichtig. Das war ihre Welt. Dort blühte sie auf. Ihre Arbeit war tatsächlich, ohne zu übertreiben, ihr Lebenselixier. Hier im Krankenhaus wussten alle Ärzte, Ärztinnen, Pfleger und Krankenschwestern, wer wir waren. Sogar das Reinigungspersonal. Und zwar nur deswegen, weil meine Mutter es ihnen bei jeder Visite auf die Nase band. Christoph, der berühmte Journalist, und Lars, der berühmte Autor. Sie zeigte Fotos von uns auf ihrem Tablet, reichte es herum, und alle mussten zuhören. Bevor ich das erste Mal ins Krankenhaus kam, schickte mir meine Mutter vorab eine Liste mit meinen Büchern, die ich signieren und mitbringen sollte, damit sie sie auf der Station verteilen konnte. Wenn sie jemanden mochte, bekam er ein Buch oder einen Kalender geschenkt. Und kam ihr jemand aus dem Krankenhausteam blöd, dann ging er eben leer aus und wurde keines Blickes gewürdigt. So war sie. Das war ihr Belohnungssystem.
Ich nahm ihre Hand, die trotz der vielen blauen Flecken ganz zart war, streichelte sie und gab ihr einen Kuss. Sie atmete ruhig, mechanisch. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Kopf leicht zur Seite gelehnt. Sie war sediert, bekam hoch dosiertes Morphin. Ihre Leber produzierte schon keine Gallenflüssigkeit mehr, und auch andere lebenswichtige Organe hatten ihre Funktion bereits eingestellt oder waren kurz davor. Mir war klar, dass sie nicht mehr aufwachen würde. Verabschiedet hatten wir uns schon am Tag zuvor. Ohne große Worte, es war mehr ein letzter tiefer Blick in die Augen. Von Seele zu Seele, von Mutter zu Kind. Ab diesem Moment ging es nur noch darum, für sie da zu sein, ihre Hand zu halten und ihr am Ende ihres Lebens die Sicherheit zu geben, dass sie nicht allein ist. Mein Onkel, meine Tante und ich hatten uns in den letzten Tagen abgewechselt. Wir hielten an ihrem Bett Wache. In dieser Zeit wurde mir so richtig bewusst, wie wichtig die Familie ist und welch bedeutsame Rolle sie in einem langen Leben spielt. Zumindest für mich. Wenn nichts mehr zu gewinnen ist, wenn das Spiel längst entschieden ist, dann ist es oft eben doch die Familie, die mit dir auf dem Platz steht und dir bis zur letzten Sekunde die Daumen drückt.
Ich lehnte mich gegen die Stuhllehne und ließ unsere Playlist wieder laufen. Wir hörten zusammen »Hurt« von Johnny Cash. Die berühmte Coverversion, geschrieben von Trent Reznor, dem Frontmann der Rockband Nine Inch Nails. Trent veröffentlichte den Song im Jahr 1994 als junger Mann, gerade mal achtundzwanzig Jahre alt. Johnny Cash nahm seine Coverversion im Jahr 2002 auf, im Alter von einundsiebzig Jahren, ein Jahr vor seinem Tod. Was hätten wir hier in diesem Zimmer darum gegeben, noch ein Jahr zu haben, noch einen Monat, noch eine Woche. Meine Mutter war in diesem Moment, als Johnny Cash zu uns sang, genauso alt wie er, als er den Song in seinem Wohnzimmer aufnahm.
»What have I become?
My sweetest friend
Everyone I know goes away
In the end«3
Ich schloss die Augen und hörte genau zu. Dieser Text, in dem so viel Schmerz steckt, so viel Leid, so viel Hoffnungslosigkeit und der das Leben meiner Mutter so treffend beschreibt. Meine Mutter hatte kein leichtes Leben, sie musste permanent kämpfen, sich durchsetzen, sich behaupten in einer Welt, die nicht auf sie gewartet hatte. Sie befand sich ihr Leben lang im Überlebensmodus. Johnny Cash beginnt seinen Song mit den Worten »I hurt myself today«, eine der grandiosesten Opening-Lines aller Zeiten. Meine Mutter hat sich ihr Leben lang wehgetan, nicht im Außen, aber tief in ihrem Inneren. Wahrscheinlich hat sie es nicht einmal gemerkt. Sie hat funktioniert. Mehr war in diesem Leben für sie einfach nicht drin.
So viele neue Fragen schossen mir durch den Kopf, so viele alte Tränen tropften auf den Boden. So viel Trauer und so viel Liebe, die ihren Weg nicht zurückfanden.
»Mama, warum warst du weg, als ich dich am meisten brauchte? Wie kann man denn sein krankes Kind einfach so allein lassen? Ich war doch erst zwei. Ich weiß, Mama, du hast das nicht gegen mich gemacht, aber dennoch bist du gegangen und hast mich im Stich gelassen. Warum?«
Fragen, auf die ich so gerne Antworten bekommen hätte. Antworten, die so viel Ballast von meinen Schultern genommen hätten. Antworten, die meinem Herzen so gutgetan hätten. Ich kannte die Antworten ja. Natürlich kannte ich sie. Aber ich hätte sie aus ihrem Mund hören müssen. Das hätte den Unterschied ausgemacht.
Johnny Cash kam zum Ende seines Liedes und sang die letzten Worte für uns:
»If I could start again
A million miles away
I would keep myself
I would find a way«
»Wenn ich neu anfangen könnte, eine Million Meilen entfernt, würde ich so bleiben, wie ich bin. Ich würde einen Weg finden.« Gutes Ende, Neuanfang, auf der anderen Seite. Vielleicht ja im Paradies? Gibt es das überhaupt? Aber was soll für eine Mutter im Paradies schöner sein, als hier auf Erden mit ihrem Kind zu sein? Johnny Cash wurde kurz vor seinem Tod gefragt, was für ihn das Paradies sei, und er antwortete: »Heute Morgen mit ihr einen Kaffee zu trinken.«
Ich konnte so nachfühlen, was Johnny Cash damit meinte, obwohl er in dem Moment sicher nicht an seine Mutter dachte. Hier saß ich nun, mitten im »heute Morgen«, mit meiner Mutter, einem ungenießbaren Kaffee auf dem Tisch, auf der Suche nach dem Paradies. Und wieder kam mir eine Geschichte in den Sinn, eigentlich war es mehr eine Frage, die ich einmal aufgeschnappt hatte und die mich seitdem nicht mehr losließ:
Ein Mensch stirbt nach einem anstrengenden Leben voller Plackerei und Kampf und klettert voller Hoffnung und Vorfreude auf eine bessere Zukunft die Himmelstreppe empor. Oben angelangt, schaut sich der Mensch um und trifft irgendwann auf Gott, die ihn freudig begrüßt und ihm nur eine Frage stellt: »Erzähl doch mal, wie war’s da unten im Paradies?«
Es ist ziemlich schwer, das Paradies zu erkennen, wenn man mittendrin ist und der Kopf im Sand steckt. Vielleicht ist es sogar unmöglich. Im Herzen des Sturms ist es vollkommen windstill. Wenn in dir drinnen, in deinem Herzen, kein Frieden herrscht, kann dein Außen noch so schön sein, du wirst diese Schönheit nicht in ihrer Gänze sehen. Vielleicht führen wir deswegen so viele Kriege – gegen andere Länder, andere Kulturen, andere Menschen, andere Ideen und Vorstellungen, gegen uns selbst. Weil wir das Paradies in uns nicht finden. Deswegen die verzweifelte Suche danach an anderen Orten. Doch ich habe Hoffnung, denn vielleicht ist das wahre Paradies ja gar nicht das verlorene, das vergessene, das vergangene, sondern jenes, das noch auf uns wartet. Irgendwo tief in uns.
Das Leben muss nicht perfekt sein, es muss echt sein. Dein Leben muss für andere auch nicht gut aussehen, es muss sich für dich gut anfühlen. Nur darum geht es. Nicht perfekt, sondern von Herzen. Wie dieser Song von Johnny Cash. Die finale Version von »Hurt«, die weltberühmt wurde, war anfangs nur ein Demotape. Johnny Cash hatte sie in seinem Wohnzimmer eingesungen, sitzend in seinem Lieblingsstuhl, nicht in der Annahme, dass sie am Ende veröffentlicht werden würde. Er sang, weil es in diesem Augenblick aus ihm heraus musste. Sein Herz war geöffnet, und all der Schmerz eines gelebten Lebens floss in diesem Moment durch ihn hindurch. Ein magischer Moment, eingefangen auf Tape. Anfangs realisierten sein Produzent Rick Rubin und er überhaupt nicht, was gerade geschehen war, denn sie gingen mit dem Demoband, das lediglich als Referenz diente, immer wieder ins Studio, um eine klanglich bessere Version aufzunehmen. Doch irgendwann begriffen sie, dass den perfekten Studiomixen etwas Entscheidendes fehlte: die Seele. Also veröffentlichten sie die Demoversion genau so, wie sie war, eingesungen in einem Take, roh und unperfekt, und genau deswegen resoniert sie noch immer mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Die Energie des Schmerzes, der Hoffnung und der Erlösung, die Johnny Cash in dem Moment fühlte, wurde auf die Aufnahme übertragen und für immer in diesem Lied gespeichert. Was für ein Geschenk des Universums und welch starkes Symbol! Das Leben will nicht, dass du alles richtig machst. Das Leben gibt dir die einmalige Möglichkeit, dich so auszudrücken, wie du bist – mit all deinen Fehlern, Makeln, Schrammen und Rissen im Herzen, in all deiner wahren Schönheit.
4.Die Meisterin der Verdrängung
»Ich muss nicht mit dir übereinstimmen, um dich zu lieben.«
Lars Amend
Es heißt, die Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Das Leben meiner Mutter war gepflastert mit Katastrophen. Sie konnte arbeiten, aber nicht leben. Sie konnte Probleme lösen, aber nicht ihre eigenen. Sie war eine Meisterin der Verdrängung. Schon immer. Anstatt ihre eigene Kindheit aufzuarbeiten, das Gespräch zu suchen, in Therapie zu gehen, eine Beziehung zu ihren Gefühlen aufzubauen und ihr Privatleben aufzuräumen, hat sie lieber noch einen Termin mehr angenommen. Noch mehr gearbeitet. Noch mehr verdrängt. Alles, was nicht im Ansatz mit ihrer Arbeit in Verbindung stand, war für sie ein Störfaktor. Auch ihre Krankheit, auch der nahende Tod. Es passte ihr nicht. Anstatt sich rechtzeitig mit allem Wesentlichen auseinanderzusetzen, den weltlichen wie den seelischen Angelegenheiten, griff sie auf ihre drei Lieblingsstrategien zurück, die sie ein Leben lang begleiteten: Ignorieren, Verdrängen, Arbeiten. Selbst als sie auf die Palliativstation verlegt wurde, sagte sie voller Überzeugung, dass sie nur deswegen dort sei, weil auf den normalen Stationen kein freies Bett mehr für sie übrig sei. Sie wollte die Wahrheit nicht hören. Lieber erzählte sie von neuen beruflichen Projekten, die sie im nächsten Jahr angehen würde.
»Mama, du wirst sterben«, sagte ich zu ihr. »Was redest du denn da? Was denn für Projekte? Das ist doch jetzt völlig unwichtig.«
Für mich war das unwichtig, nicht für meine Mutter. Für sie war genau das – ein zukünftiges Projekt zu planen und schon jetzt nach Lösungen zu suchen – ihr ganzer Lebensinhalt.
Selbst auf der Palliativstation, mitten in der Chemotherapie, lagen ihr Handy, ihr Tablet und ihr Terminkalender stets griffbereit. Eines Mittags, als ich wieder zu Besuch kam, eine dreistündige Autofahrt hinter mir hatte und ihr Krankenzimmer betrat, sagte sie nach wenigen Minuten: »Ich habe gleich eine Videokonferenz, die geht ungefähr eine Stunde. Du kannst ja solange unten im Café einen Espresso trinken gehen.«
Es war ihr in dem Moment tatsächlich wichtiger, an einer Videokonferenz teilzunehmen, als die Dinge zu regeln, die man regeln muss, und die Dinge zu sagen, die man sagen muss, wenn man weiß, dass einem kaum noch Zeit bleibt. Meine Mutter hat ihren Tod bis zum Schluss nicht wahrhaben wollen, und dementsprechend hat sie auch ihrer Familie, vor allem meinem Bruder und mir, nie die volle Wahrheit über all ihre Erkrankungen erzählt. Alles blieb stets vage, immer mit einem Hoffnungsschimmer am Horizont, auch wenn es den selbst mit der größtmöglichen Fantasie zu keinem Zeitpunkt jemals gab. Als die erste Chemotherapie keinerlei Wirkung zeigte, meine Mutter aber auf eine Fortsetzung der Therapie pochte und der behandelnde Arzt sogar eine weitere Operation an einem Nebenkriegsschauplatz vorschlug, schickte ich den medizinischen Zwischenbericht an meinen Freund Prof. Dr. med. Sven Gottschling, der bis heute Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Schmerztherapie des Uniklinikums des Saarlandes ist, und bat ihn um eine ehrliche und schonungslose Einschätzung der Sachlage. Ich hatte mit Sven zusammen drei Bücher geschrieben, unter anderem den acht Jahre zuvor erschienenen Spiegel-Bestseller »Leben bis zuletzt. Was wir für ein gutes Sterben tun können«, weswegen ich seiner Weisheit und Expertise zu 100 Prozent vertraute.
Unmittelbar nach der Durchsicht der Befunde rief er mich an. Anhand seiner Stimmlage wusste ich sofort Bescheid. Sven begann seine Analyse mit den Worten: »Lars, es tut mir leid, dir das in dieser Deutlichkeit sagen zu müssen, aber hier ist nichts mehr zu gewinnen, und der Krebs wird sich auch von einer weiteren Chemotherapie nicht mehr beeindrucken lassen.« Sven sprach Klartext. Er erklärte mir in Ruhe und in einer Sprache, die ich verstand, was im Körper meiner Mutter vor sich ging, und sagte zum Schluss: »Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, denn es kann mit diesem Krankheitsverlauf im Prinzip jederzeit zu Komplikationen kommen, die dann zum Tod führen. Der Moment, um alles Wichtige zu regeln, war für deine Mutter eigentlich schon vorgestern. Wenn sie noch etwas zu klären hat, was ihren Nachlass angeht, ihr Erbe, ihr Vermächtnis, dann sollte sie das sofort tun. Sie wird keine Monate mehr haben, auch keine Wochen. Besprecht doch mal in der Familie, ob ihr anstatt einer weiteren Runde Chemotherapie mit all den schmerzhaften Nebenwirkungen nicht lieber noch gemeinsam eine letzte Reise unternehmen wollt. Vielleicht gibt es ja einen Ort, den sie noch einmal sehen möchte.« Sven bot sogar an, persönlich mit meiner Mutter zu telefonieren oder einen Videocall mit ihr zu machen, um ihr seine Expertensicht zu schildern. Meine Mutter war ja ein Fan von ihm. Sie hatte Sven vor Jahren auf einer gemeinsamen Buchveranstaltung persönlich kennengelernt. Doch als ich ihr unser Buch ins Krankenhaus mitbrachte mit dem Hinweis, dass sie es sich doch einmal durchlesen könne, winkte sie nur ab und sagte, dass sie das nicht brauche. Auch an Svens Analyse, seinem Vorschlag mit der letzten Reise und dem Telefonangebot hatte sie keinerlei Interesse. Sie bestand auf eine weitere Chemotherapie. Punkt. Aus. Basta.
Es brach mir das Herz, sie so zu sehen. Mal wieder. Sie klammerte sich an Strohhalme, die sie selbst erfunden hatte, und nichts durfte an dieser Fantasiewelt rütteln. Ich stand hilflos neben ihr und musste akzeptieren, dass es ihr Leben war, nicht meins. Und natürlich durfte sie frei über ihr Leben entscheiden. Auch wenn es für mich als Sohn schwer zu ertragen war, so dermaßen ohnmächtig zu sein, weil so vieles zwischen uns noch unausgesprochen war.
Meine Mutter blockte jedes Gesprächsangebot ab. Sie wollte weder ihren Nachlass sauber regeln noch mit einem Notar sprechen oder uns Kinder in irgendeiner Form an ihrer Gedankenwelt teilhaben lassen. Die private Lebenssituation meiner Mutter war kompliziert, weswegen ein klärendes Gespräch über all ihre familiären, gesundheitlichen und finanziellen Baustellen eigentlich schon vor Jahren dringend notwendig gewesen wäre. Aber sie wollte einfach nicht. Wie ein kleines Kind steckte sie ihren Kopf in den Sand und war beleidigt, wenn wir Kinder den Versuch unternahmen, ihren Kopf wieder auszubuddeln, um das Gespräch fortzusetzen. Wie konnte sie nur so egoistisch sein? Verdammt, wir waren doch nicht irgendwer! Wir waren ihre Kinder. Ich war ihr jüngster Sohn.
»Mama, willst du mir noch irgendwas sagen? Willst du mir noch etwas anvertrauen? Hast du noch einen Wunsch, den ich dir erfüllen könnte? Irgendwas, Mama? Gibt es nicht noch irgendwas zu sagen? Mama, du stirbst! Und wir wissen gar nichts. Du erzählst ja nichts. Ist es wirklich das, was du willst, mich mit tausend Fragezeichen zurücklassen? Mama, ich bin dein Sohn. Rede doch mit mir. Bitte, Mama.«
Nichts.
Alles, was sie sagte und ständig wiederholte, war: »Ist schon gut. Alles ist gut.«
»Mama, nichts ist gut. Gar nichts ist gut. Aber lassen wir das für heute. Ruh dich aus. Wir sehen uns morgen. Ich liebe dich.«
Am nächsten Tag kam ich mit einem Brief zurück, den ich in der Nacht geschrieben hatte. Ich gab ihn ihr, kurz bevor ich wieder nach Hause fuhr, zusammen mit einem Kuss und einer langen Umarmung. Ich hatte ein rotes Herz auf den Umschlag gemalt und »Für Mama« draufgeschrieben. Der Brief war ein Ausdruck meiner Verzweiflung. Ich hatte ihn nicht nur mit Tinte, sondern mit ebenso vielen Tränen verfasst. Ein Wunder, dass man am Ende überhaupt noch etwas lesen konnte, so nass, wie er war. Aber Tränen trocknen schnell. Ein Kind sollte so einen Brief nicht schreiben müssen, dachte ich mir mit jedem Wort, das durch meine Finger floss. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt schon sechsundvierzig Jahre alt war, so war ich dennoch das Kind einer Mutter. Man bleibt immer, was man ist. Mutter, Vater, Kind, Sohn, Tochter. Ein Leben lang verbunden.